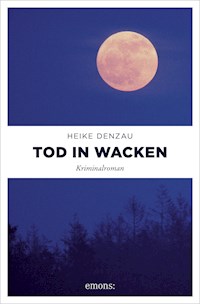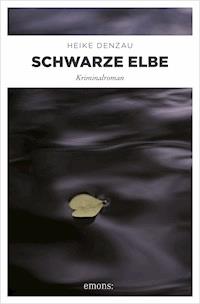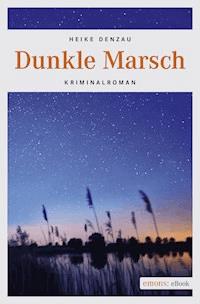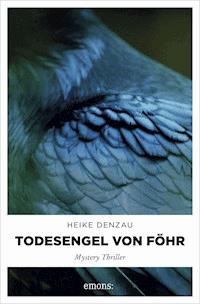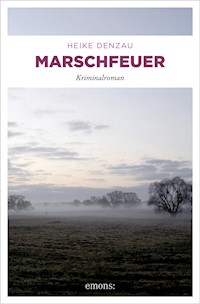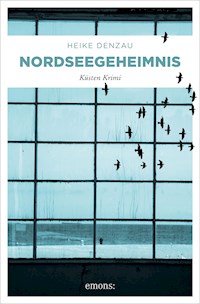Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Lyn Harms
- Sprache: Deutsch
Lyn Harms ermittelt in Wacken – Teil 2. Ein Überfall auf einen Itzehoer Juwelier endet blutig. Die Spur führt Ermittlerin Lyn Harms zum gerade stattfindenden Heavy-Metal-Festival in Wacken. Dort feiern 75.000 Fans eine riesige Party und haben das Dorf fest im Griff. Niemand ahnt, dass die Täter weitere Verbrechen planen. Als sich die Schlinge um die Bande immer enger zuzieht, eskaliert die Situation. Und es bleibt nicht bei einem Toten …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 479
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Heike Denzau, Jahrgang 1963, ist verheiratet, hat zwei Töchter und lebt in dem kleinen Störort Wewelsfleth in Schleswig-Holstein. Ihr Kriminalroman »Die Tote am Deich« war für den Friedrich-Glauser-Preis 2012 in der Sparte »Debüt« nominiert.
www.heike-denzau.de
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2018 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: klafrog/photocase.de
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Hilla Czinczoll
eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-360-8
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Weiche, Wotan! Weiche!Flieh des Ringes Fluch!Rettungslos dunklem Verderbenweiht dich sein Gewinn.
Erda in »Rheingold« von Richard Wagner
Prolog
Ihr Herz hämmerte in der Brust. So heftig, dass es gleich aufhören würde zu schlagen. Weil es gegen ihre Angst nicht mehr anpumpen konnte.
Und wäre es nicht wirklich Erlösung, zu sterben? Endlich nicht mehr diese grauenhafte Angst zu spüren? Ruhe, Frieden zu haben?
Doch die Angst ließ nicht einmal eine Antwort darauf zu. Arme und Beine zusammengepfercht in dem dunklen Schrank, waren ihre Sinne nur darauf ausgerichtet zu horchen, ob er kam.
»… acht … neun …«
Als sie seine Stimme durch das Holz des Schrankes hörte, schüttelte es sie. Er stand vor der Zimmertür, die sie nicht geschlossen hatte, weil ihr die Zeit gefehlt hatte.
»Wo steckst du, meine Schöne? Wo hast du dich verkrochen?«
Seine Stimme klang ruhig und lockend, hatte alles Laute, aber nicht das Hässliche verloren. Siegessicher klang sie. Und das gruselte sie mehr, als wenn er geschrien hätte. Um das Wimmern, das in ihrer Kehle zum Sprung bereit hockte, zurückzudrängen, presste sie beide Hände vor den zitternden Mund. Ein Fehler, denn ihre Finger klebten von Blut. Dass es nicht ihr eigenes war, verstärkte die Übelkeit, die der süßliche, eisenartige Geruch auslöste. Krampfhaft versuchte sie, das Würgen zurückzuhalten.
Und dann stockte ihr der Atem. Weil er direkt vor dem Schrank stand. Das dünne Holz filterte seine Stimme kaum. »Du steckst doch wohl nicht hier drin? So einfallslos bist du doch nicht?« Etwas schabte über das Holz. Und sie wusste, dass es die Waffe war, die er darübergleiten ließ. Dann herrschte Ruhe. Aber nur für einen winzigen Moment.
»Zehn … Ich komme.«
Das Knarzen der Schranktür, als er sie langsam aufzog, war lauter als alles, was sie je gehört hatte.
Eine Woche vorher …
EINS
»Aufs Festival?« Matthias Blomberg sah seine Frau irritiert an, während er den Finger in die Bolognese auf dem Herd tunkte und ableckte. »Wieso bist du jetzt doch im Team? Ich dachte, es wäre vollzählig?«
Annika Blomberg griff den Topf mit den Nudeln und leerte ihn in ein Sieb in der Spüle. »Die Mutter von Dr. Hermer ist gestern gestorben, also fällt er aus. Es wurde Ersatz für ihn gesucht, und da habe ich mich gemeldet. Wenn es für dich okay ist. Sonst würde ein anderer Kollege einspringen.«
»Klar ist das okay. Ich bin für die Kinder da. Und ich freu mich für dich. Du wirst so viele verrückte Typen kennenlernen wie nie zuvor.«
»Ich bin gespannt.« Annika lächelte ihren Mann an.
Seit einem halben Jahr wohnten sie in Wacken im Haus von Matthias’ verstorbener Tante, das sie gekauft hatten, um den Kindern das Aufwachsen in ländlicher Ruhe zu ermöglichen. Außerdem war eigener Wohnraum in guter Lage in Hamburg nahezu unerschwinglich gewesen, obwohl sie beide Gutverdiener waren.
Sie stellte das Sieb auf einen Unterteller und brachte beides zum Küchentisch. »Holst du Ida? Ich schnappe mir Schumi.« Sie beugte sich zu Emil hinunter, der vor sich hin brabbelnd in einer Lauflernhilfe mit flinken Beinchen von einem Ende der Küche zum anderen rollte.
Annika zog ihn heraus, schmatzte zwei Küsschen auf die rosigen Wangen und setzte ihn in den Hochstuhl, was er ohne zu schreien mit sich geschehen ließ. Hochstuhl bedeutete Essen. Und das liebte Emil.
Ida hing auf Matthias’ Rücken und hatte die Arme um den Hals ihres Vaters geschlungen, als sie die Küche betraten. »Lecker Nudeln«, sagte sie, als Matthias sie auf ihrem Kinderstuhl abstellte. Sie lehnte sich über den Tisch, um eine der Spiralen aus der Schüssel zu stibitzen.
»Vorsicht, heiß!«, rief Annika, aber es war schon zu spät.
»Aua!« Im Nullkommanichts zog Ida die Finger wieder aus der Schüssel und steckte sie in den Mund. »Doofe Nudeln.«
Annika lachte. »Die Nudeln können nichts dafür, Mäuschen.«
»Ich brauch ein Pflaster.« Anklagend hielt Ida ihr die Hand hin.
Annika band Emil ein Lätzchen um. »Du brauchst kein Pflaster«, sagte sie ungerührt.
Matthias lachte und pustete auf Idas Hand. »So ist das als Kind einer Ärztin. Da wird man nicht ernst genommen.«
»Stimmt doch gar nicht. Ich nehme alles ernst. Nur keine Lappalien.«
»Mal schauen, was Mama zu erzählen hat, wenn sie vom Festival zurück ist.« Matthias grinste. »Bei den schwarzen Männern wird es schon nicht langweilig werden.«
»Schwarze Männer?« Idas Hand mit dem vollen Löffel verharrte vor dem beschmierten Mund. Mit großen Augen sah sie ihren Vater an. »Sind die böse, die schwarzen Männer?«
»Quatsch!« Annikas verärgerter Blick traf Matthias, bevor sie sich mit einem Lächeln Ida zuwandte. »Da ist niemand böse. Hier in unserem Dorf kommen bald ganz viele Menschen zusammen, die Musik hören wollen. Und weil es so viele Menschen sind –«
»Wie viele?«, unterbrach Ida sie, »mehr als hundert?«
»Oh ja, es sind viele tausend Menschen. Mehr als siebzigtausend«, sagte Annika, wohl wissend, dass Ida die Zahlengrößen nicht einordnen konnte. »Und das sind Männer und Frauen, die am liebsten schwarze Sachen anziehen. Hosen, T-Shirts, Hoodies, alles ist schwarz. Allerdings«, Annika lachte auf und sah Matthias an, »gibt es wohl auch Ausnahmen. Corinna erzählte, dass sie im letzten Jahr Männer in Ballettröckchen und geblümten Morgenmänteln gesehen hat. Ich freu mich richtig drauf, das alles einmal live zu erleben.«
Ida hatte aufmerksam zugehört. »Haha«, lachte sie, »Männer ziehen doch nur Hosen an.«
»Eigentlich ja«, gab Annika ihr recht. »Auf jeden Fall sind das alles liebe Menschen. Die tun mir nichts, Maus. Ganz im Gegenteil. Die feiern da eine große Party, und alle haben gute Laune. Und Mami muss da nur hin, weil manchmal jemand ein Pflaster oder einen Verband braucht. Oder jemand verbrennt sich in der Sonne, weil er sich nicht eincremt.« Und bestimmt würde es zuhauf Kreislaufprobleme geben. Hitze, gepaart mit zu viel Alkohol, war eine brisante Mischung.
»Bei unserem norddeutschen Sommer wirst du keine Sonnenbrände behandeln müssen«, sagte Matthias. »Laut Wetterbericht wird es durch die Schwüle Gewitter geben. Das heißt: Das Festivalgelände wird wohl wieder zur Schlammwüste werden.«
»Danke, dass du dabei so schadenfroh grinst. Ich sollte wohl meine Gummistiefel aus dem Keller holen.«
Ida schaufelte einen Löffel frisch geriebenen Parmesan auf ihre Nudeln. »Warum brauchen da welche einen Verband?«
Annika seufzte. Jetzt ging die Warum-Fragerei los. »Weil sie sich stoßen oder hinfallen.«
»Warum fallen die hin?«
»Weil da ganz viele Zelte zum Schlafen aufgebaut sind, und da stolpern die Menschen manchmal über die Leinen.«
»Warum stolpern die über die Leinen?«
Matthias lachte auf. »Weil sie dicht sind wie Uhus.«
Annika warf ihm einen bösen Blick zu, obwohl Ida diesen Satz nicht zuordnen konnte.
»Die stolpern über die Leinen, weil sie …«, Annika überlegte kurz, »… weil sie die manchmal nicht sehen.«
»Warum sehen die Leute die Leinen ni–«
»Weiß ich nicht«, brach Annika das Endlos-Verhör ihrer Tochter ab. »Und jetzt iss bitte deine Nudeln, Ida, sonst sind sie gleich kalt.«
Aufmerksam hörte Annika während des Essens zu, was Ida aus dem Kindergarten und ihr Mann aus der Firma zu berichten hatten. Das gemeinsame Abendessen mit den Kindern war ihr und Matthias heilig. Sie arbeitete noch nicht wieder in Vollzeit, seit Emil vor dreizehn Monaten auf die Welt gekommen war, aber ihr Schichtdienst im Krankenhaus machte es an manchen Tagen schwierig, zusammen zu essen.
»Lass uns noch mal auf das Festival zurückkommen«, sagte Annika zu Matthias, nachdem alle satt waren. »Ich habe mich dort für die Nachtschichten einplanen lassen. Dann kann ich an den Nachmittagen für die Kinder da sein. Das heißt aber, dass du Ida dann morgens in den Kindergarten und Emil zur Tagesmutter bringen musst. Du müsstest dann eine Bahn später nehmen.«
Da Matthias in Hamburg in Hauptbahnhofsnähe arbeitete, war die Bahnfahrt die angenehmere Alternative zum Auto.
»Kein Problem. Welche Tage sind es genau?«
»Ich werde ab Mittwoch dort sein. Bis einschließlich Sonntag.«
Matthias nickte. Nach kurzer Überlegung sagte er zu Ida: »Was hältst du davon, wenn ich mir den Freitag freinehme und wir am Wochenende zu Oma und Opa nach Mölln fahren? Da Mama arbeiten muss, können wir uns ein bisschen von Oma verwöhnen lassen. Und Oma und Opa freuen sich, euch mal wiederzusehen.« Er sah Annika an. »Wir würden dann Donnerstagmittag losfahren, und Sonntagnachmittag sind wir alle wieder hier.«
»Oh ja! Zu Omi und Opi!« Ida ließ den Löffel fallen und klatschte in die Hände. »Omi, Opi, Omi, Opi!«
»Aber willst du denn nicht selbst auf das Gelände?«, fragte Annika überrascht. »Schließlich ist es auch für dich das erste Festival, an dem du selbst Wackener bist.«
Matthias war durch die Verbindung zu seiner Tante einige Male Gast in Wacken gewesen, lange bevor sie sich kennengelernt hatten.
»Mir reicht der Mittwoch. Da hab ich dann genug gesehen. Und gehört.«
»Dann ist es doch eine tolle Idee, zu Oma und Opa zu fahren. Ich rufe euch nachmittags an. Vom Festnetz aus. Mein Handy spinnt nämlich total. Der Akku ist Schrott.«
»Soll ich dir ein neues mitbringen?«
Annika schüttelte den Kopf. »Das ist lieb, aber ich hol mir in Itzehoe eins. Wenn das Ding nicht funktioniert, merkt man erst, wie sehr man davon abhängig ist. Eigentlich erschreckend.«
»Auf jeden Fall wirst du hier deine Ruhe haben, wenn wir nicht da sind«, sagte Matthias. »Genieß es.«
Annika nickte. »Bis zum frühen Nachmittag werde ich wohl schlafen, je nachdem, wann ich aus dem Sani-Zelt wegkomme. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die Nachtschicht nicht so anstrengend ist wie Tagesdienst.«
Ida hatte aufmerksam zugehört. Anscheinend ließen ihr Matthias’ Worte noch keine Ruhe, denn sie fragte: »Und die schwarzen Männer tun dir wirklich nichts, Mama?«
Annika schenkte ihr ein herzliches Lächeln. »Nein, Maus, wirklich nicht.« Sie legte die rechte Hand auf ihr Herz. »Oberdickes Ehrenwort. Sonntag fahren die alle nach Hause, und ich bin dann wieder hier. Bei euch. Gesund und munter.«
***
Ulf Baumann war dabei, die Maschinenpistole zu reinigen. Sonnenstrahlen fielen durch die Spalten der Holzlatten der alten Scheune, und er konnte sehen, wie die harten Bässe den Staub aus den Ritzen des Holzes trieben.
»Meine Fresse!« Er warf seinen Söhnen einen finsteren Blick zu. »Geht das auch ’n bisschen leiser?«
Doch Jannek ließ sich beim Spielen der Luftgitarre nicht stören. Nicht einmal die stickige Hitze in der Scheune schreckte ihn ab. Im Gegenteil, sein Kopf ruckte im Rhythmus der Bässe noch wilder vor und zurück, sodass das dunkelblonde, zu einem kurzen Pferdeschwanz gebundene Haar hin und her wedelte.
Auch Roman antwortete nicht. Mit verstellt tiefer Stimme begleitete er die dunklen Stimmen, die aus dem Lautsprecher dröhnten, aber direkt aus der Hölle zu stammen schienen: »Twilight of … the thunder god! Twilight of … the thunder god!«
Das Mitsingen hielt ihn nicht davon ab, den Pinsel in den Farbeimer zu tunken und das O in einem Schriftzug auf der linken Seite des Wohnwagens weiter schwarz auszumalen. »Die Band ist richtig geil«, grölte er seinem Bruder zu. »Wie heißen die?«
Jannek riss zur Bestätigung beide Hände mit Teufelsgruß in die Höhe. »Amon Amarth. Hab ich grad gegoogelt. Mal ich auch noch auf den Wohnwagen drauf.«
»Jetzt dreht die Kiste leiser!«, verschaffte Ulf Baumann sich über die Bässe hinweg erneut Gehör.
Diesmal reagierte Jannek. Er ging zu dem rostigen Werkzeugkasten, auf dem er sein Smartphone und den Bluetooth-Lautsprecher abgestellt hatte, und korrigierte die Lautstärke nach unten. Zeitgleich öffnete sich das Tor des Holzschuppens. Ein Hauch angenehmerer Luft trat mit dem Mann in Motorradklamotten ein. Durch die laute Musik hindurch hatten sie das Motorrad nicht kommen hören.
Jannek wischte sich mit dem Unterarm den Schweiß von der Stirn, trat mit einem »Hi, Devil« zu ihm und hob die Hand.
Der Neuankömmling klatschte ihn ab. »Grüß dich, Alter.«
»Alles klar, Devil?«, begrüßte auch Ulf Baumann seinen Kumpel, während er die Maschinenpistole wieder aufnahm und nach dem Lappen griff, den er leicht mit Waffenöl getränkt hatte. Liebevoll rieb er damit über den schwarzen Lauf.
Devil hängte seine Jacke an einen rostigen Nagel an der Schuppenwand. Dann nahm er die Tasche der Maschinenpistole von den zu einem Sitz umfunktionierten, übereinandergestapelten Bierkisten, warf sie achtlos auf den Boden und setzte sich. Ein kleiner Campingtisch trennte ihn von Ulf, der auf einem Klappstuhl saß.
»Wie oft willst du die MP noch reinigen? Das hast du doch gestern schon gemacht. Oder hast du heute etwa wieder geballert?« Seine Stimme hatte einen aggressiven Unterton.
»Hältst du mich für dämlich?«, gab Ulf scharf zurück. Er hasste es, wenn Devil seine Intelligenz in Frage stellte. Natürlich übte er nicht mehr, als es sein musste. Und wenn, dann nur in Waldstücken, die fernab jedes Spazierwegs lagen. Und natürlich benutzte er den Schalldämpfer. »Beruhigt mich einfach, wenn ich mein Baby polier.«
»Nervös?« Devil musterte ihn.
»Nicht mehr als beim letzten Mal. Aber das gehört doch dazu. Wenn wir uns einbilden, uns könnte kein Fehler unterlaufen, passiert nämlich genau das.«
Devil nickte nur und stand auf. Er trat zu Roman an den Wohnwagen und schlug ihm auf die Schulter. »An dir ist wohl ein da Vinci oder wie der Vogel hieß, verloren gegangen, was? Sieht verdammt cool aus. Wie ’ne echte Fankutsche.«
»Ey!« Roman verzog ärgerlich die Lippen, weil ihm durch den Schlag der Pinsel verrutscht war. »Scheiße, jetzt sieht das aus wie ’n Q«, motzte er und griff nach dem mit Farbe besprenkelten Lappen auf dem Boden. Vorsichtig wischte er um den unteren Teil des großen O herum.
»Ist doch latte«, sagte Devil grinsend. »Oder bist du jetzt etwa zum Wacken-Fan mutiert?«
»Wieso nicht?« Romans Stimme klang aufmüpfig. »Ist doch geil, wenn man das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden kann. Außerdem sind die auf Wacken alle voll gut drauf. Hab Kumpels, die da hingehen.«
»Reg dich ab, Kleiner. Ist ja in Ordnung, wenn du auf die Mucke stehst, aber du wirst dich da nicht mit deinen Kumpels treffen. Das ist dir hoffentlich klar?«
Roman warf den Lappen auf den Boden. »Mach hier nicht den Klugscheißer, Devil. Nur weil ich das erste Mal dabei bin, bin ich nicht der Vollhonk.«
Devil lachte. »Dann ist ja gut.« Er ging um den Wohnwagen herum, der hinter einem alten Opel Vectra stand. Den Opel hatten sie vor vier Jahren gestohlen, umgespritzt und mit ebenfalls gestohlenen Nummernschildern versehen. Sie hatten ihn nur für die beiden Überfälle benutzt, ansonsten hielten sie ihn in einer Garage in Hamburg, in der Nähe von Devils Wohnung, versteckt. Vorgestern hatten sie ihn hierhergefahren.
»Was ist mit den Reifen? Wechselt ihr die noch?« Devil trat gegen den linken Reifen des Wohnwagens und sah Ulf an.
»Nee, Mann, die gehen noch. Das Profil ist okay. Hab ich mit ’ner Münze gecheckt.«
»Ich mein auch nicht das Profil, sondern das Material.« Er ging in die Knie und strich über den Reifen. »Das wird langsam porös. Kommt vom ewigen Stehen.« Er kam wieder hoch. »Ich hab keinen Bock drauf, dass uns die Bullen wegen der Kackreifen anhalten.«
»Dann darfst du gern neue Reifen bezahlen. Ich hab erst wieder nach dem Coup Kohle.«
Devil nickte. »Werden schon noch halten, wenn du’s sagst.« Er setzte sich wieder auf die Bierkisten. Einen Augenblick später spreizte er die Beine, griff sich eine der Astra-Flaschen und öffnete sie am Rand des kleinen Campingtisches, auf dem das Waffenöl seinen Geruch verbreitete, was aber kaum auffiel, weil die Farbeimer einen noch intensiveren Geruch verströmten.
»Musst du jetzt saufen?« Ulf Baumann stand auf. Er war fertig mit dem Polieren der Waffe. »Was wir jetzt nicht gebrauchen können, ist, dass die Bullen dich anhalten und deinen Lappen einkassieren. Wir können uns nicht erlauben, aufzufallen.«
»Reg dich ab.« Unbeeindruckt nahm Devil einen tiefen Schluck. »Ich trink schon nicht mehr als eins. Schmeckt sowieso nicht. Ist piwarm. Nehmt beim nächsten Mal ’ne Kühltasche mit hierher.« Mit angewidertem Gesichtsausdruck hielt er die Flasche kopfüber und sah zu, wie das Bier glucksend herausschäumte und eine Lache bildete, bevor es langsam im Bodendreck der Scheune versickerte.
Jannek grinste. »Hättste mal vorher gefragt.« Er ging zu Ulfs altem BMW, der neben dem Opel stand, öffnete die Hintertür und zog eine Kühlbox zu sich heran. Er nahm eine der gekühlten Flaschen heraus und warf sie Devil zu. »Prost, Alter.«
Ulf wartete, bis Devil die Flasche abstellte, die er in einem Zug halb geleert hatte. »Gib mal das Schweinchen rüber.« Er deutete auf die in Tarnfarben gehaltene MP-Tasche, die Devil achtlos auf den Boden geworfen hatte.
Devil reichte sie ihm. »Ich hab unsern Fluchtwagen übrigens schon vergangene Nacht klargemacht. In Eidelstedt. Ein unauffälliger silberfarbener Toyota. Steht mit neuem Kennzeichen abfahrbereit in der Garage.«
Ulfs Kopf schoss hoch. »Was soll das? Wir hatten abgemacht, dass du den Wagen erst einen Tag vorher klaust.«
»Ist doch alles klargegangen. Jetzt steht er sicher in der Garage. Das Risiko, dass die Bullerei ihn vor dem Überfall findet, liegt also bei null. Mit dem falschen Kennzeichen raffen die Uniformkasper das sowieso nicht.« Er lachte schäbig. »Zwei Kanister muss ich allerdings noch mal nachtanken. Bei der blöden Toyotakiste war nämlich der Tank fast leer, und ich hab mit den Kanistern nachgefüllt.«
Ulf nickte. »Dann mach das. Aber such dir ’ne Tanke in Hamburg, nicht hier in Itzehoe. Kleinstädter merken sich so ’ne Visage wie deine eher.«
Devils heiseres Lachen ließ die Jungs aufblicken, die jetzt beide ins Bemalen des Busses vertieft waren. »Ihr habt ja Spaß!«, sagte Jannek. »Lasst uns teilhaben.«
»War nix Erwähnenswertes.« Devil stand auf und ging zum Tor. »Also, bleibt fruchtig, Kumpels. In drei Tagen sind wir wieder mal stinkreich, dann gönnen wir uns aufm Kiez ’n paar Edelnutten.« Er grinste Roman an. »Dir geb ich eine aus, Kleiner. Eine mit besonders feuchter Muschi.«
Ulf Baumann sah, dass sich die Ohren seines Sohnes rot färbten, während er Devil den Mittelfinger zeigte. Mit Weibern hatte Roman im Gegensatz zu seinem sechs Jahre älteren Bruder Jannek noch nicht viel Erfahrung. Aber er war auch gerade erst neunzehn geworden. Vielleicht hatte Devil recht. Der Junior brauchte mal eine, die ihn auf den Geschmack brachte.
Doch immer schön der Reihe nach. Erst kam die Arbeit, dann das Vergnügen. Ulf setzte sich wieder und griff nach dem Itzehoer Stadtplan.
***
»Habt ihr jetzt langsam mal alles?«, rief Lyn die Treppe hinauf und sah auf ihre Armbanduhr. »Wir müssen los. Sonst fährt der Zug ohne euch ab, und ihr könnt sehen, wie ihr zu eurem Vater kommt.«
Sophie kam in Shorts und Top die Treppe herunter. Sie trug einen schwarzen Rucksack, der schon bessere Tage gesehen hatte. »Ich bin fertig. Lotte stopft noch ein paar Strings in ihre Handtasche. Ihr Koffer ist so voll, dass alles rausquellen würde, wenn sie ihn noch mal öffnet. Ich musste mich draufsetzen, damit er zugeht.«
Von draußen erklang durch die offene Haustür ein dunkles Lachen. Hendrik war dem Tumult im Haus entflohen und saß auf der Bank unter dem Küchenfenster. Er hatte die »Norddeutsche Rundschau« mit rausgenommen, ein Rascheln verriet das Umblättern, aber anscheinend hörte er durch die geöffnete Tür zu, was gesprochen wurde.
Sophie stellte den Rucksack vorsichtig auf der voll bepackten Reisetasche ab, die neben der Küchentür stand. Lyn wunderte sich über diese Umsicht. Normalerweise pfefferte Sophie Taschen und Rucksäcke durch die Gegend.
»Eure Fresstüten stehen auf dem Küchentisch«, sagte Lyn zu ihrer Jüngsten, die mit einem freudigen Laut in die Küche stürmte. Wenn die Mädchen in den Ferien zu ihrem Vater nach Franken fuhren, war es Usus, dass sie für die Zugfahrt reichlich Verpflegung mitbekamen: belegte Brötchen, ein wenig Obst, viel Naschkram und Getränke in Dosen. Dosen waren ansonsten verpönt, aber zur Zugfahrt gehörten sie wie der Tomatensaft zum Fliegen.
Sophie wühlte in dem Proviantbeutel aus Leinen herum, auf dem ihr Name mit Textil-Marker geschrieben stand. »Cool! Danke, Mama.« Anscheinend war sie auf die Riesenpackung Smarties gestoßen. Es klang, als schüttete sie sich gerade eine Ladung der bunten Schokoteile auf die Hand.
Lyn lächelte. »Das ist für die Zugfahrt gedacht.« Nach oben grölte sie: »Lotte, jetzt sieh zu! Wir müssen los.«
»Ja-ha.« Die achtzehnjährige Charlotte tauchte am Treppenabsatz auf. Sie trug ein kurzes, luftiges Sommerkleid mit Spaghettiträgern. Ihre Handtasche hing um die Schulter. Mit beiden Händen wuchtete sie einen mit Städtenamen bedruckten Hartschalenkoffer die Treppe hinunter.
»Brauchst du Hilfe?«, fragte Lyn und strich sich eine Strähne ihres halblangen braunen Haars hinters Ohr.
»Eher einen zweiten Koffer.«
»Was schleppst du denn nur alles mit? Euer Vater hat eine Waschmaschine, die ihr benutzen könnt.« Sie hörte Charlottes Antwort nicht, weil ein Maunzen zu ihr drang. »Mieze?«
Lyns Augenbrauen zogen sich zusammen, als ein weiteres klägliches Miauen verriet, woher die Geräusche kamen. Mit zwei Schritten war Lyn an der Küchentür. »Sophie Hollwinkel, kannst du mir verraten, warum dein Rucksack miaut?«
»Oh Mann, Garfield!«, stieß Sophie genervt aus, während sie die Smarties wieder im Leinenbeutel verstaute, und quetschte sich an Lyn vorbei. Sie öffnete den Rucksack. »Du dumme Katze. Jetzt musst du hierbleiben.« Sie sah zu Lyn. »Oder?«
»Nix, oder. Natürlich bleibt Mieze hier.«
Die Katze sprang heraus und strich Charlotte um die Beine, die ihren Koffer mit einem Ächzen abgestellt hatte. »Armes Krummbeinchen«, murmelte sie und hob die Katze hoch. Sie bedachte die vier Jahre jüngere Schwester mit einem giftigen Blick. »Spinnst du? Du kannst Krummbein doch bei der Hitze nicht in deinen Rucksack zwängen. Wolltest du sie ernsthaft mitnehmen? Du weißt doch ganz genau, dass Miriam eine Katzenhaarallergie hat.«
»Genau«, gab Lyn ihrer Ältesten recht, obwohl es ihr ziemlich egal war, ob Miriam Hollwinkel, die neue Frau ihres Ex-Mannes, sich in den Orbit nieste.
»Aber wenn sie hierbleibt, ist sie vielleicht tot, wenn wir wiederkommen«, sagte Sophie mit anklagendem Blick zu Lyn.
Von draußen war wieder Hendriks Lachen zu hören, was Sophie veranlasste, einen weiteren bösen Blick Richtung Haustür zu werfen.
»Was kann ich dafür, wenn die Katze sich im Kirchturm einschließen lässt?«, wehrte Lyn sich, trotz Anflug eines schlechten Gewissens.
In den Herbstferien des vergangenen Jahres war Mieze zwei Tage vor der Rückkehr der Mädchen verschwunden. Der Friedhofsangestellte, der Rasenmäher und Werkzeuge im unteren Teil des Kirchturms verwahrte, hatte sie dort gefunden. Ausgerechnet, als sie mit den Mädchen vom Bahnhof gekommen war. Sophie hatte nicht glauben wollen, dass Mieze nur zwei Tage verschwunden gewesen war. »Sie ist voll abgemagert!«, hatte sie gerufen. »Dann soll sie Mäuse fressen, wenn ihr das Dosenfutter nicht reicht«, hatte Lyn geantwortet, und das hatte Sophies Laune seinerzeit nicht gebessert.
Hendrik kam rein. Er sah Sophie an. »Ich werde mich um Garfield kümmern, versprochen.«
Lyn freute sich, als Sophie nickte und sogar ein mehr als freundliches »Danke, Hendrik« folgte. Die anfängliche Abneigung ihrer Jüngsten gegen Hendrik schwand zwar zusehends, aber von herzlicher Zuneigung war sie noch ein ganzes Stück entfernt.
Hendrik ließ sich glücklicherweise durch ihr oft patziges Verhalten nicht aus der Ruhe bringen. Er baggerte mit vielen Kleinigkeiten um ihre Zuneigung und arbeitete sich so langsam, aber sicher zu ihrem Herzen durch. Gab es Streit ums Fernsehprogramm, schlug er sich auf ihre Seite. Die Katze, die von jedem Familienmitglied anders genannt wurde, nannte er Garfield, genau wie Sophie. Und wenn Hendrik kochte, was er liebend gern tat, gab es viel öfter Sophies Lieblingsessen als das von Charlotte oder Lyn. Charlotte nahm es gelassen. Sie freute sich für Lyn und Hendrik, dass Sophie langsam auftaute.
Hendrik tippte mit dem Finger auf seine Armbanduhr. »Ladys, ich drängle euch ja nur ungern, aber wenn sich keine weiteren Haustiere oder sonstige Schmuggelware im Gepäck befinden, könnten wir vielleicht starten? Schließlich müssen wir auch noch Markus abholen.«
Er griff sich Charlottes Koffer und Sophies Reisetasche und trug sie über das kurze Stück Friedhofsweg zu seinem Volvo, der neben dem Grundstück des Alfred-Döblin-Hauses stand. Die Mädchen folgten ihm mit dem restlichen Gepäck und dem Proviant.
Als Lyn die Haustür abschloss, lächelte sie. Seit wenigen Wochen waren Hendrik und sie die Besitzer dieses kleinen Hauses, das direkt am Wewelsflether Friedhof lag und das sie vorher mit den Mädchen zur Miete bewohnt hatte. Sie liebte den Blick aus dem Küchenfenster auf die fünfhundert Jahre alte Kirche und den Glockenturm. Auch die Gräber störten sie nicht. Im Gegenteil, vom Frühjahr bis in den Herbst mit blühenden Blumen geschmückt und im Winter schneebedeckt, waren sie Sinnbild des Friedens.
»Ich bin gespannt, wie Papa Markus findet. Hoffentlich mögen sie sich«, sagte Charlotte, als sie am Wagen waren und Hendrik das Gepäck so verstaute, dass auch noch der Koffer von Charlottes Freund Markus Lindmeir hineinpassen würde. Sie klang unsicher.
»Dein Vater wird ihm Löcher in den Bauch fragen«, orakelte Lyn. Bernd Hollwinkel war nicht nur berufsbedingt neugierig – er war wie Lyn und Hendrik bei der Kriminalpolizei.
Als Charlotte erschrocken die Augen aufriss, beruhigte Lyn sie umgehend: »Keine Panik, Lottchen. Ich habe noch mal mit eurem Vater telefoniert. Er wird keine Fragen zu Markus’ Vater stellen.«
Paul Lindmeir saß im Gefängnis, verurteilt zu lebenslanger Haft wegen heimtückischen Mordes. Ein bizarrer Fall, den Lyn und ihre Kollegen von der Mordkommission der Itzehoer Kriminalpolizei vor einigen Jahren aufgeklärt hatten.
»Na hoffentlich«, murmelte Charlotte.
Markus selbst hatte keinen Kontakt zu seinem Vater. Charlotte hatte Lyn erzählt, dass Paul Lindmeir wöchentlich Briefe aus dem Gefängnis schrieb, Markus sie allerdings ungeöffnet zerriss und in den Müll warf. Er sprach auch mit Charlotte niemals über seinen Vater. Lyn hielt das für falsch, aber sie wagte keinen Widerspruch. Es würde sich schon finden, wenn es an der Zeit war.
Lyn stellte das Winken ein, als der ICE aus dem Hamburger Hauptbahnhof heraus war. Sie verschränkte ihre Finger mit Hendriks, als sie sich zum Gehen wandten. »Puh! Ist ja immer ein Aufstand, bis sie weg sind.«
Hendrik hielt zwei Dosen Katzenfutter in der anderen Hand. Sophie war erst auf dem Bahnsteig eingefallen, dass sie Garfields Reiseproviant, der noch im Rucksack steckte, mangels Katze nicht brauchen würde, und hatte die Dosen Hendrik in die Hand gedrückt.
»Schenk sie dem Obdachlosen, der draußen mit seinem Hund sitzt«, sagte Lyn, während sie sich in der Wandelhalle ihren Weg durch die an- und abreisende Menschenmenge bahnten. Sie löste ihre Finger. »Geh schon mal vor. Ich muss noch mal aufs Klo.«
»Das ist Katzen-, kein Hundefutter«, sagte Hendrik.
»Ist doch wurscht.«
»Wenn’s Wurscht wäre, würde der Hund sich freuen.« Hendrik grinste und ging.
Als Lyn wenig später nach draußen kam, sah sie die Katzenfutterdosen neben dem Rucksack des Obdachlosen liegen. Er knüllte ein Stück Papier zusammen, während er kaute.
»Ich hab ihm eine Cola und einen Burger ausgegeben«, sagte Hendrik, als sie bei ihm ankam. Es war Samstag, und die Leute strömten in Massen Richtung Mönckebergstraße. »Das Katzenfutter für seinen Hund hat er auch nicht abgelehnt.«
»Sag ich doch.«
Hendrik griff nach ihrer Hand. »Und?«
Lyn blickte ihn verständnislos an. »Was, und?«
»Na«, er druckste herum, »du weißt schon … Hast du sie bekommen?«
Lyn brauchte eine Sekunde, bis sie begriff, was er meinte. Ärger flammte stichflammenartig auf. »Jetzt reicht’s, Hendrik Wolff! Wenn du mich jetzt nach jedem Toilettengang fragst, ob ich meine Regel gekriegt hab, dreh ich durch.« Schon zu Hause hatte er sie damit genervt, dabei war ihre Regel frühestens morgen fällig, und das hatte sie ihm auch gesagt.
»Lyn«, er griff nach ihrer Hand, als sie weiterstapfte, »ich bin nur so aufgeregt.« Er blieb einfach stehen, ohne sie loszulassen. »Wir können doch auf jeden Fall schon mal einen Schwangerschaftstest kaufen.«
»Ich bin zweiundvierzig.« Lyn bemühte sich, ihren Ton zu dämpfen. »Da kommt die Regel nicht mehr pünktlich alle achtundzwanzig Tage. Ich mache erst einen Test, wenn ich fünf Tage drüber bin. Die Fruchtbarkeit ist nun mal nicht mehr wie bei einer Zwanzig- oder Dreißigjährigen.«
Das hatten sie schon im letzten Monat ausgiebig diskutiert, als Hendrik enttäuscht reagiert hatte, als ihre Regel einsetzte, nachdem sie drei Tage über den Termin gewesen war.
»Und jetzt komm bitte weiter.« Sie entzog ihm ihre Hand. »Ich habe keine Lust, das in einer Menschenmenge mitten in Hamburg erneut auszupalavern.«
ZWEI
»Lasst es uns noch mal durchgehen.« Ulf Baumann rückte die zusammengeklebten DIN-A4-Seiten mit den aufgezeichneten Straßen und Gebäuden noch einmal in die Mitte des Esstisches. Große und kleine Post-its, mit Bemerkungen versehen, waren daraufgeklebt.
Sie saßen in seiner Wohnung in Hamburg-Altona. Seine Frau hatte sich verzogen, als Devil eingetroffen war. Steffi konnte Devil genauso wenig leiden wie Devil sie. Außerdem war es gut, wenn sie so wenig wie möglich wusste. Details zu dem Coup machten sie nur nervös. Und sie hatte schon genug Schiss wegen der Jungs.
Dass nach Jannek jetzt auch noch Roman an einem Überfall teilnahm, hatte sie Ulf äußerst übel genommen. Seit zwei Wochen zickte sie rum, wenn er Sex wollte. Klar, er hätte aushäusig ficken können, aber wozu war er verheiratet? Dosensuppen konnte er sich auch allein aufmachen. Und viel mehr hatte Steffi ihm in letzter Zeit nicht kredenzt. Madame hatte keinen Bock mehr auf Kochen, seit Roman zum Essen kaum mal zu Hause war. Dabei hatte sie genug Zeit. Der Kassiererinnenjob im Supermarkt lief nur auf Vierhundertfünfzig-Euro-Basis, und die paar Stunden, in denen sie mit Haareschneiden schwarz noch was dazuverdiente, waren auch nicht der Rede wert.
»Wir haben das jetzt oft genug durchgekaut«, holte Devil ihn in die Realität zurück. »Jeder weiß, was er zu tun hat. Außerdem muss ich gleich los. Mein Dienst beginnt.« Er tippte auf seine Armbanduhr, eine uralte Rolex, die er vor Jahren einem Dealer abgekauft hatte.
Ulf musterte seinen Kumpel. Devil arbeitete als Türsteher auf dem Hamburger Kiez. Sie hatten sich vor über zwanzig Jahren im Knast kennengelernt und, seit auch Devil wieder draußen war, ein paar kleine Dinger zusammen gedreht. Und zwei dicke Dinger, die richtig Kohle gebracht hatten. Jetzt war das Geld fast verbraucht, und sie mussten für Nachschub sorgen, wenn sie so gut weiterleben wollten wie bisher. Mit Hartz IV und dem Schwarzgeld, das er auf dem Bau verdiente, war das bei Weitem nicht möglich.
Jannek klopfte Devil auf die Schulter. »Zisch ruhig ab, Alter. Ich finde auch, dass wir genug gelabert haben. Es wird laufen wie bei den letzten beiden Malen.«
Roman sah seinen Vater an. »Also, ich würd’s gern noch mal durchsprechen. Kann doch nicht schaden.« Er befeuchtete die trockenen Lippen mit der Zunge und beugte sich vor, um den Plan besser studieren zu können.
Die anderen beiden verdrehten genervt die Augen, aber Ulf Baumann scherte sich nicht darum. »Also, es läuft folgendermaßen ab: Devil holt den Toyota aus der Garage und kommt mit Jannek um neun hierher und sackt uns ein. Gegen Viertel nach zehn werden wir spätestens auf dem Itzehoer Parkplatz in der Breitenburger Straße sein.« Er fuhr mit dem Finger über das Papier, auf dem Itzehoer Straßen, Parkplätze und Gebäude gezeichnet waren. Zweimal waren sie vor Ort gewesen, um die Örtlichkeiten abzuchecken – paarweise, um nicht aufzufallen.
»Ihr beide«, er blickte Devil und seinen Jüngsten an, »verlasst den Wagen zuerst. Zwei Minuten vor uns, das reicht dicke, wenn ihr normal geht.« Es war wichtig, dass sie nicht durch schnelles Gehen oder gar Rennen auffielen.
»Du und ich, Jannek, wir beide warten diese zwei Minuten, bevor wir den Wagen verlassen. Wichtig ist, dass ihr dran denkt«, er nickte Devil zu, »dass der Polenschlüssel unter der Matte liegt. Falls ihr vor uns zurück seid.«
Ulf ignorierte Devils »Blablabla« und sah Roman an, der aufmerksam zuhörte. Er war dankbar, dass Jannek wenigstens schwieg. Er hatte anscheinend kapiert, dass es für seinen Bruder wichtig war, alles perfekt geplant zu wissen.
»Wir werden ziemlich zeitgleich bei den beiden Juweliergeschäften eintreffen«, fuhr Ulf fort. »Dann haben wir fünf Minuten. Keine Minute länger. Wir müssen davon ausgehen, dass der Alarmknopf sofort gedrückt wird. Und wir müssen noch den Rückweg einplanen. Wir rennen nicht, sondern wir gehen.« Jetzt blickte er in die Runde. »Ist das klar? Gehen. Nicht auffallen.«
»Mann, Alter, ja!« Devil steckte sich eine Gauloises an und paffte den Dampf genervt aus, nachdem er einen tiefen Zug genommen hatte.
Ulf ließ sich nicht beirren. »Der Ablauf ist bei beiden Aktionen gleich: Im Schmuckstübchen Stöther halte ich die Angestellten und eventuelle Kunden mit der MP in Schach, bei Juwelier Kromme macht das Devil. Ihr«, er sah seine Söhne an, »rafft jeweils an Schmuck und Uhren zusammen, was euch in die Finger fällt. Und vergesst nicht, die Kasse zu leeren.«
Es würde zwar nicht viel Geld darin sein, weil das Tagesgeschäft um diese Uhrzeit erst begann, aber dafür wäre im Zentrum der Kleinstadt Itzehoe auch noch nicht viel Publikum unterwegs. Und das war wichtiger als die Knete. Geld würden sie durch den Verkauf des Schmucks genug erzielen.
»Die Auslagen der Schaufenster nehmt ihr euch zuletzt vor.« Das war wichtig, denn diese Aktion konnte von Passanten beobachtet werden.
»Die Schaufensterauslage werden Roman und ich wahrscheinlich nicht schaffen«, sagte Devil. »Je nachdem, wie lange das Aufschließen dauert.«
»Ja, ja, ist klar.« Ulf sah seinen Sohn an. »Raff einfach zusammen, was dir in die Hände fällt. Und dann ist Abmarsch. Wir gehen zügig zum Parkplatz zurück. Je nachdem, wer von uns zuerst wieder beim Auto ist, schmeißt schon mal die Kiste an, fährt aber nicht los, sondern wartet auf das andere Paar. Wir verlassen Itzehoe auf demselben Weg, auf dem wir gekommen sind. Mit der kleinen Änderung, dass wir in Dägeling die Fahrzeuge wechseln.«
»Hast du das jetzt gerafft, Baumännchen?«, fuhr Devil Roman an und stand auf. »Ich muss nämlich los.«
»Klar hab ich das!«, ranzte Roman zurück. »Ich werd schon alles richtig machen. Hauptsache, du passt auf, dass die Angestellten ruhig bleiben.«
»Keine Sorge, Kleiner. Schwarze Masken und ’ne MP im Anschlag haben noch jeden in Schockzustand versetzt. Du wirst deine Glock nicht benutzen müssen.« Devil drückte die Kippe im Aschenbecher aus und sah Jannek an. »Ich fahr jetzt. Soll ich dich mitnehmen?«
»Nee, ich will noch in die Muckibude, bevor Cassy kommt.« Jannek deutete auf die Sporttasche, die er neben der Wohnzimmertür abgestellt hatte. »Ich nehm die U-Bahn.«
Devil musterte ihn. »Cassy. Die hängt neuerdings oft bei dir ab, oder?«
»Ja und? Wir wollen zusammenziehen. Was dagegen?«
Devil schürzte die Lippen. »Ist mir latte. Hauptsache, du erzählst der nix. Ich will keine weitere Mitwisserin. Steffi reicht schon.«
Jannek tippte sich an die Stirn. »Hältst du mich für blöd, oder was? Wenn Cassy wüsste, was wir planen, würde die gleich abhauen. Eher schneid ich mir die Zunge ab, als ihr was zu erzählen.«
»Dann ist ja gut.« Devil tippte sich an einen imaginären Hut. »Bis Mittwoch, Leute.«
»Wart mal.« Ulf Baumann stand vom Sofa auf. »Vielleicht sollten wir die Gruppierung doch tauschen? Vielleicht sollte Roman lieber mit mir und Jannek mit dir –«
»Alter, jetzt ist genug«, fiel Devil ihm ins Wort. »Wir machen das jetzt so, wie wir das besprochen haben. Ich pass schon auf deinen Kleinen auf.«
»Ja, Mensch!« Verärgert sah Roman seinen Vater an. »Das haben wir doch längst geklärt. Ich geh mit Devil.«
Ulf gab nach. Devil hatte es so gewollt, weil er befürchtete, dass Ulf nervös sein könnte, wenn er mit Roman arbeitete. Und Nervosität konnten sie nicht gebrauchen.
»Ich verschwinde auch«, sagte Jannek und stand auf. »Wir sehen uns Mittwoch.« Er verabschiedete sich von seinem Vater und seinem Bruder durch Abklatschen. »Und sag Mutsch, dass sie Rouladen machen soll, wenn wir Sonntag hier antanzen. Dann wird gefeiert.«
Devil grinste. »Rouladen. Lecker. Aber ich lass mir meine lieber nicht von Steffi servieren. Womöglich ist da Gift drin.«
Jannek lachte. »Mutsch findet dich zwar scheiße, Devil, aber vergiften würde sie dich nicht. Ist die Einzige in der Familie, die nicht kriminell ist und auch nicht wird.«
»Hauptsache, sie hält die Fresse.« Devil zog seine abgewetzte Lederjacke an.
»Sie lebt ja schließlich nicht schlecht davon.« Ulf deutete ins Wohnzimmer, das mit allen elektronischen Raffinessen, teuren Ledermöbeln und einem Haufen für Ulf völlig überflüssiger Kitschdeko ausgestattet war.
Devil blickte in die Runde. »Ich bin richtig geil drauf, endlich mal wieder ein Ding zu drehen.« Er sah Roman an. »Das gibt dir voll den Kick, sag ich dir. Das Adrenalin flasht dich völlig, wenn du auf der Flucht vor den Bullen bist. Und es ist zu geil, wenn du ihnen dann entgegenfährst und die nix raffen.«
Sein heiseres Lachen hing in der Luft, als die Tür hinter ihm zufiel.
***
Lyn saß vor dem PC in ihrem Büro der Mordkommission Itzehoe und tippte einen Ermittlungsbericht. Fleißarbeit, die sie wenig schätzte, die aber einen Großteil ihrer Arbeit ausmachte. Und wenn es im Büro so stickig war wie heute, fiel es doppelt schwer.
Vielleicht mache ich das bald nur noch, dachte sie, als ihr in den Sinn kam, dass sie schwanger sein könnte. Sobald eine Schwangerschaft bestätigt war, durfte sie keinen Außendienst mehr machen. Kein angenehmer Gedanke, immer nur im Büro hocken zu müssen, aber unter keinen Umständen würde sie es wagen, eine erneute Schwangerschaft zu gefährden. Sie hatte schon einmal Hendriks und ihr Kind durch eine Schießerei im Dienst verloren.
Heute war Dienstag, und ihre Regel hatte noch nicht eingesetzt. Hendrik stand völlig unter Strom. Sie selbst versuchte, ruhig zu bleiben. Und dennoch konnte sie die innere Angespanntheit nicht leugnen. Ihre Hand glitt über den Unterleib. Wuchs es da schon? Ein winziges Ganzes, zusammengefügt aus zwei Hälften, aus Hendrik und ihr?
»Wackeeen!«
Lyn zuckte zusammen. Hauptkommissar Thilo Steenbuck stand in der offenen Bürotür und streckte ihr die Hand mit Teufelsgruß entgegen.
Sie zeigte ihm einen Vogel. »Schrei hier nicht so rum, Kollege. Spar dir das für Wacken auf und nerv uns Normalos nicht ständig damit. Und du brauchst auch nicht jedes Mal diesen … diesen Schaschlikspieß zu machen, wenn du an meinem Büro vorbeikommst.«
Thilo gab ein kurzes Wimmern von sich. »Schaschlikspieß? Sie sagt ›Schaschlikspieß‹!« Seine Stimme wurde streng. »Kollegin, das heißt Pommesgabel!« Er ballte die Hand erneut zur Faust, den kleinen Finger und den Zeigefinger dabei ausstreckend. Dann grölte er noch einmal »Wackeeen!« über den Flur und verschwand. Sein Murmeln war allerdings noch zu hören. »Schaschlikspieß. Die Frau ist wirklich irre.«
Lyn grinste in sich rein. Schon seit letzter Woche war Thilo aufgedreht wie ein Grundschüler, der das erste Mal auf Klassenfahrt geht. Er war durch und durch Heavy-Metal-Fan und ständiger Gast auf dem Festival. In den letzten zwanzig Jahren hatte er Wacken nur einmal sausen lassen müssen, vor knapp sieben Jahren, als sein Sohn sechs Wochen zu früh geboren wurde. Und das hielt er dem Kleinen an seinem Geburtstag Jahr für Jahr wieder vor, wie Lyn von seiner Frau Tessa wusste.
Sich sammelnd, begann sie weiterzutippen. Allerdings kam sie nicht weit, denn Hauptkommissar Wilfried Knebel, Leiter der Itzehoer Mordkommission, klopfte an den Türrahmen.
»Hallo, Chef.«
»Lyn, der Arzt einer Frau …«, er sah auf die Notiz, die er in Händen hielt, während er an ihren Schreibtisch trat, »… Karrenberger, wohnhaft in der Lotsensiedlung, hat bei der Einsatzleitstelle angerufen. Es besteht der Verdacht eines Tötungsdelikts. Die Tote ist zweiundachtzig Jahre alt, war schwer an Demenz erkrankt und wohl seit Jahren ans Bett gefesselt. Der Arzt wurde gerufen mit der Angabe, sie sei friedlich eingeschlafen. Aber nach Vermutung des Arztes wurde anscheinend nachgeholfen. Der Doc ist vor Ort. Hier ist die Adresse.« Er legte ihr den Zettel auf den Schreibtisch. »Schnapp dir einen Kollegen und schau mal, was Sache ist. Wenn ich dir die Spurensicherung hinterherschicken soll, melde dich.«
Lyn stand auf. Alles war besser als die stupide Schreibtischarbeit.
Hendrik, der nicht nur ihr Mann, sondern auch ihr Kollege war, saß nicht an seinem Schreibtisch, als sie in sein Büro eintrat. Auch die kleine Küche war menschenleer. Also würde sie einen der anderen Kollegen fragen müssen.
Da Hauptkommissarin Karin Schäfer heute Überstunden abfeierte, entschied sie sich für Thilo. Aber auch sein Büro war verwaist. Ein Büro, das sich von allen anderen Büros dieses Kommissariats unterschied, weil es von Festival-Merchandise-Produkten überquoll. Als Papierkorb diente Thilo ein schwarzer Zwölf-Liter-Plastikeimer. An den Wänden hingen Blechschilder und eine Wanduhr neben einem Poster mit Luftbildaufnahme des Festivalgeländes. Wilfried hatte das gestattet. Die Schädelskulptur hatte Thilo allerdings wieder von der Wand abhängen müssen. Genau wie das Handtuch mit dem Aufdruck »Duschen ist kein Heavy Metal«.
Lyn schmunzelte. Thilos Familie hatte auf jeden Fall keine Probleme damit, ein Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk für ihn zu finden.
Sie trat an den Schreibtisch, auf dem die Farbe Schwarz vorherrschte und das Festival-Logo auf allen möglichen Dingen zu sehen war: Papiertaschentücher, eine Blechbox, ein Tischkalender und eine Schneekugel mit einer Miniatur des Wacken-Turms. Lyn griff nach der Gummibadeente. Sie war schwarz und gehörnt, trug eine blaue Kutte und streckte dem Betrachter ihre dunkle Flügelhand mit Teufelsgruß entgegen.
»Die ist neu«, sagte Thilo, der hereinkam. Er nahm ihr die Ente aus der Hand. »Witzig, nicht? Und guck mal«, er hielt sie ihr direkt vor die Nase, »die macht mit ihrem Flügel auch den Schaschlikspieß.«
»Blödmann.« Lyn schlug Thilo die Fliegenklatsche mit dem Bullenschädel auf den Oberschenkel. »Allerdings bin ich nicht wegen deiner Wacken-Macke hier.« Sie legte die Fliegenklatsche zurück und wurde ernst. »Es gibt anscheinend ein Tötungsdelikt in der Lotsensiedlung, Pünstorfer Straße. Jetzt suche ich einen besonders netten Kollegen, der mich begleitet, und da ist meine Wahl auf dich gefallen.«
Thilo verzog die Lippen. »Ehrlich, Lyn, immer gern, aber heute … Du weißt doch, dass ich übermorgen nach Wacken geh. Vielleicht könntest du dir ja einen Kollegen suchen, der den Fall auch in den nächsten Tagen mit dir bearbeiten kann?«
»Spar dir deinen Hundeblick. Ich hab schon verstanden. Du hast mal wieder Muffe, dass Wilfried dir den Urlaub streichen könnte.«
»Du weise, du wunderbare, du Lieblingskollegin.«
»Na dann. Mal schauen, wer sich erbarmt.« An der Tür drehte sie sich noch einmal um. »Ich wünsch dir auf jeden Fall jede Menge Spaß auf Wacken. Grüß die Metallköppe von mir.«
Während sie über den Flur ging, wanderten ihre Gedanken zu einem Fall zurück, der sie vor einigen Jahren auf das Festival geführt hatte. Andreas Stobling, Judith Schwedtke … Die Namen streiften durch die Erinnerung. Verbunden mit Erschütterung. Doch trotz des grässlichen Falls hatte sie sich seinerzeit bei der Ermittlungsarbeit auf dem Festivalgelände dem besonderen Flair der Veranstaltung nicht entziehen können.
An Jochen Bertholds Tür ging sie vorbei, weil er kein umgänglicher Kollege war. Also blieb nur noch Thomas Martens, der Neuzugang im K1.
Thomas war erst vor Kurzem intern vom K2 zur Mordkommission gewechselt. Lyn hatte das mit mulmigem Gefühl zur Kenntnis genommen, denn zu Thomas hatte sie ein anderes Verhältnis als zu den übrigen Kollegen. Es ging jedenfalls über Kollegialität hinaus, das gestand sie sich ein. Freundschaftlich, das traf es wohl am ehesten. Und das sagte sie auch Hendrik immer wieder, der überhaupt nicht begeistert gewesen war, als der Chef ihnen Thomas als neuen Kollegen präsentiert hatte.
Hendrik war eifersüchtig auf Thomas. Dazu bestand zwar aus Lyns Sicht kein Grund, aber es reichten schon die Blicke, die Thomas Lyn zuwarf, um Hendrik immer wieder aufs Neue zu reizen. Dennoch steuerte sie Thomas’ Büro an. Hendrik musste sich daran gewöhnen, dass Thomas ein Kollege wie alle anderen war.
Thomas befand sich im Gespräch mit Kommissariatssekretärin Birgit, als Lyn eintrat.
»Ich kann so nicht arbeiten«, sagte Birgit gerade zu ihm. Sie ignorierte Lyn und verschränkte die Arme vor dem üppigen Busen, den das wallende türkisfarbene Leinenkleid ein wenig kaschierte. Ins Auge fielen die Schweißflecke, die sich unter den Armen großflächig gebildet hatten. »Ich bin ja mehr mit Vor- und Zurückspulen beschäftigt als mit Schreiben.«
Thomas wiederum ignorierte Birgit, als er Lyn sah. »Hallo, Frau Hauptkommissarin«, begrüßte er sie mit strahlendem Lächeln und deutete auf den Stuhl vor seinem Schreibtisch. »Setz dich. Wir sind hier gleich fertig.«
Lyn blieb stehen. Frau Hauptkommissarin, das klang noch so ungewohnt. Sie hatte ihre Beförderung mit den Kollegen ordentlich gefeiert. Sophie und Charlotte hatten lieber shoppen gehen wollen. Schließlich gab es endlich die höhere Besoldungsgruppe.
»Ich bin fix und fertig«, lamentierte Birgit weiter und strich sich ein wenig zu theatralisch über die glänzende Stirn. Seit sie ihre Kosmetik selbst anmischte, hatte sie ständig einen öligen Film im Gesicht. Aber Lyn würde sich eher die Zunge abbeißen, als ihr zu raten, ein wenig Puder zu benutzen, denn Birgit war in etwa so kritikfähig wie Donald Trump.
»Wie soll ich einen Text tippen, wenn ihr immer so nuschelt«, scherte sie Lyn gleich mit über einen Kamm. Mit einem giftigen Blick für beide nahm sie das Diktiergerät von Thomas’ Schreibtisch auf und rauschte hinaus. Sie hinterließ dabei einen starken Lavendelduft. Anscheinend hatte sie die Angst vor unangenehmem Schweißgeruch mit der dreifachen Parfümdosis bekämpft. Erfolgreich.
»Sie riecht wie ein altertümliches Wannenbad«, sagte Thomas, kam um den Schreibtisch herum und blieb vor Lyn stehen, die sich nicht gesetzt hatte. Er reckte seinen Kopf vor und verharrte kurz vor ihrem Hals. »Du duftest dagegen wie eine Frühlingswiese. Veilchen?«
Lyn widerstand dem Impuls, einen Schritt zurückzutreten. »Ich hau dir ein Veilchen, wenn du weiterhin solche Sachen sagst.«
Thomas lachte herzhaft auf und hockte sich auf die Schreibtischkante. »Was kann ich denn für dich tun?«
»Mich begleiten.«
Er stand wieder auf. »Wo immer du hinwillst.«
Lyn klärte ihn auf, während sie über den Flur zum Sekretariat gingen, um den Schlüssel für den Dienstwagen zu holen. Auf dem Flur mussten sie anschließend auf den Fahrstuhl warten. Als sich die Tür öffnete, trat Hendrik heraus.
Sein Blick verfinsterte sich. »Wo wollt ihr denn hin?«
Lyn setzte ihn kurz in Kenntnis.
»Na«, sagte er nur, ignorierte Thomas und war schon im Gehen, als er es sich anders überlegte und stehen blieb.
Ehe Lyn wusste, wie ihr geschah, legte er seine Lippen auf ihre und küsste sie. Gar nicht mal so kurz.
»Bis später, Liebling.« Ohne Thomas anzusehen, verschwand Hendrik durch die Tür zum K1.
Lyn ärgerte sich. Hendrik wusste genau, dass es ihr nicht gefiel, wenn er während der Arbeitszeit im Beisein anderer so zärtlich wurde. Und eigentlich tat er es auch nicht. Eigentlich.
»Grins nicht so blöd«, sagte sie zu Thomas, als sie im Fahrstuhl vom zehnten Stock ins Erdgeschoss fuhren.
Diese Ansage hielt ihn jedoch nicht davon ab. »Er ist so eifersüchtig. Irgendwie gefällt mir das.«
Lyn atmete tief aus. »Manchmal kommt ihr mir vor wie zwei Kindergartenbengel, die sich im Sandkasten um die Schaufel kloppen. Und ich bin die Kindergärtnerin und darf mir das Geplärre anhören.«
»Falsch. Du bist die Schaufel.«
»Stimmt. Hendriks Schaufel.«
Thomas lachte wieder. »Du hast ja recht. Ich sollte Hendrik nicht ärgern. Schließlich bin ich der wesentlich Ältere und damit der Vernünftigere.«
Lyn spürte Hitze in sich aufsteigen. War es Absicht, dass Thomas auf Hendriks Alter anspielte? Thomas war vierundvierzig, Hendrik dreiunddreißig und damit neun Jahre jünger als sie, und das war ein Stachel in ihrer Brust, der manches Mal pikte, auch wenn Hendrik ihr nie einen Grund gab, an seiner tiefen Liebe zu ihr zu zweifeln.
Die Fahrt vom Polizeihochhaus in der Großen Paaschburg zur Pünstorfer Straße dauerte nicht lange. Als Lyn und Thomas vor dem Häuschen aus den fünfziger Jahren standen, drückte Thomas den Klingelknopf unter dem schäbigen cremefarbenen Schildchen, auf dem der Name Karrenberger kaum noch zu entziffern war. Der junge Mann, der ihnen öffnete, stellte sich als Dr. Porz vor.
Jedes Haus hat seinen eigenen Geruch, dachte Lyn, als sie eintraten. Dieses verströmte etwas, das ihr öfters bei Senioren entgegenschlug. Abgestandene Luft, fehlende Reinlichkeit … Hier kam ein Hauch Eukalyptus dazu. Vielleicht Bronchialtee?
Ein ausgetretener Läufer lag auf der Treppe, die in den ersten Stock hinaufführte.
Oben bot sich ihnen ein Bild des Jammers. Ein bitterlich weinender alter Mann saß auf einem Stuhl im Flur vor einer geschlossenen Tür, vornübergebeugt, die Unterarme auf die mageren Beine gelegt. Lyn blickte auf die von weißen Haarfusseln gesäumte Halbglatze, deren Pigmentierungen darauf schließen ließen, dass der Mann seit Jahrzehnten haarlos war. Er trug ein langärmeliges Hemd, das bis zu den Ellenbogen aufgekrempelt war. Auffällig waren die Verbände um beide Handgelenke.
Eine Frau um die fünfzig stand hinter ihm und weinte ebenfalls. »Es tut mir so leid«, sagte sie unter Tränen, ohne Lyns und Thomas’ Gruß zu erwidern. »Ich weiß jetzt, dass ich das nicht hätte tun dürfen. Aber Onkel Karrenberger hat mir so leidgetan. Ich wollte doch nur, dass er nicht … dass er …« Sie brach ab, laut aufweinend, und schlug die Hände vor das Gesicht.
Lyn blickte den Arzt an. »Können Sie uns aufklären?«
»Ich habe die Tür zum Schlafzimmer lieber abgeschlossen, als sie klingelten«, fiel der Arzt ihr ins Wort. »Weil Herr Karrenberger immer zu seiner Frau reinwill. Aber ich hatte Angst, dass er Spuren verwischen könnte. Er hat zugegeben, seine Frau mit dem Kissen erstickt zu haben.«
»Ich wollte uns doch nur erlösen«, schluchzte der alte Mann, nachdem Lyn ihn über seine Rechte aufgeklärt hatte. Seine Stimme klang schwach und heiser. »Nur erlösen. Sie hätte das so gewollt. Das weiß ich. Jawohl, jawohl … das hätte sie. Und sie hätte das Gleiche für mich getan. Hoff ich. Ja, das hoff ich.«
Lyn und Thomas wechselten einen kurzen Blick.
»Den Schlüssel bitte«, sagte Thomas zu dem Arzt, während Lyn neben dem alten Mann in die Knie ging. Als Thomas das Schlafzimmer betrat und die Tür hinter sich schloss, griff sie nach der Hand des alten Mannes.
»Herr Karrenberger, vielleicht ist es gut, wenn der Doktor Ihnen ein leichtes Beruhigungsmittel gibt. Was meinen Sie?«
Seine mageren Schultern hoben und senkten sich unschlüssig unter dem karierten Hemd, das viel zu weit war und auf der Brust Kleckerflecken hatte, die aussahen, als befänden sie sich dort schon länger.
Lyn sah den Arzt an. »Würden Sie das bitte machen?«
Dr. Porz schürzte die Lippen. »Ja, natürlich, aber ich muss vorher überprüfen, ob er Medikamente einnimmt. Und welche.«
»Dann tun Sie das bitte.« Lyn tätschelte noch einmal die Hand des alten Mannes, bevor sie wieder aufstand und sich an die Frau hinter ihm wandte. »Und wer sind Sie?«
Die Frau wischte sich den Schnodder unter der Nase mit dem Handrücken weg. »Die Nachbarin.«
»Wie ist Ihr Name?«
»Hubbert, Silja Hubbert.«
Lyn zog ein Päckchen Papiertaschentücher aus ihrer Tasche, reichte ihr eines und klärte sie über ihre Rechte und Pflichten als Zeugin auf.
Silja Hubbert hörte mit großen Augen zu und schnäuzte sich noch einmal lautstark in das Taschentuch.
»Dann erzählen Sie mal, Frau Hubbert«, forderte Lyn sie auf. »Sie sagten eben, Sie hätten das nicht tun dürfen. Was hätten Sie nicht tun dürfen?«
Bevor Silja Hubbert antworten konnte, hob Herr Karrenberger seinen Kopf und sah Lyn an. »Silja kann da gar nix für. Das ist ja alles meine Schuld. Das … das ist ja nun alles so ein Schiet. Das hatt ich ja anders gedacht. Das sollte ja nicht so sein, dass ich nun übrig bleib … Nicht dass Silja nun auch noch Ärger kriegt.«
Silja Hubbert stopfte das Taschentuch in die Tasche ihrer Jeansshorts und holte tief Luft. »Ich bin vor anderthalb Stunden hier rüber, weil ich in Sorge war. Weil die Jalousien im Schlafzimmer noch unten waren. Und die zieht Onkel Karrenberger immer hoch, auch im Hochsommer.«
»Sie sind die Nichte?«, hakte Lyn nach.
Silja Hubbert schüttelte den Kopf. »Nein, nein, ich bin nur die Nachbarin, aber ich nenne ihn seit meiner Kindheit Onkel. Ich lebe mit meiner Familie nebenan, im Haus meiner verstorbenen Eltern.«
»Okay, erzählen Sie bitte weiter.«
»Ich hab einen Schlüssel für das Haus hier. Weil die Kinder der Karrenbergers nicht in Itzehoe wohnen. Ich guck nicht jeden Tag rüber, aber zwei-, dreimal die Woche bestimmt. Heute Morgen nur wegen der Jalousien. Weil Onkel Karrenberger nicht unten war, bin ich hoch, ins Schlafzimmer.« Sie nickte Richtung Tür. »Und da … da lagen sie beide in ihrem Bett.« Sie begann wieder zu weinen. »Tante Karrenberger war tot, und … Onkel Karrenberger lag auf der anderen Bettseite und … hat geblutet.«
»Ich wollt auch gehen«, schaltete sich der alte Herr in das Gespräch ein. »Ich wollte doch mit Mutter gehen. Aber ich hab das wohl nicht richtig gemacht.«
»Was haben Sie nicht richtig gemacht?«, hakte Lyn nach, obwohl sie die Antwort ahnte. Die Verbände um die Handgelenke verrieten, was er versucht hatte.
Der Arzt nahm dem alten Mann die Antwort ab, als er wieder zu ihnen trat. »Herr Karrenberger hat seine Frau erstickt und danach versucht, sich selbst das Leben zu nehmen. Er wollte sich mit einem Messer die Pulsadern aufschneiden. Allerdings hat er den Fehler begangen, die Adern nicht längs, sondern quer aufzuschneiden. Und anhand der Wunden an den Handgelenken würde ich sagen, es war außerdem ein stumpfes Messer. Er hat so oft angesetzt …«
Lyn musste schlucken. Die Luft hier oben war mehr als schlecht und dann noch die Vorstellung, was passiert war.
»Jedenfalls bin ich hierhergerufen worden«, fuhr der junge Arzt fort, »weil es hieß, Frau Karrenberger sei heute Morgen eingeschlafen. Sie«, er deutete auf Silja Hubbert, »hat angerufen und das behauptet.«
Die Nachbarin weinte. »Ich wollte doch nur nicht, dass Onkel Karrenberger ins Gefängnis muss.«
Dr. Porz schüttelte den Kopf. »Es war so eindeutig.« Er sah Lyn an. »Frau Karrenberger hat Einblutungen in den Augen, die auf Ersticken hinweisen. Und als ich dann die Handgelenke von Herrn Karrenberger sah … Die Nachbarin hatte sie verbunden. Sie haben versucht, sie unter einer Wolljacke zu verstecken, aber ich habe es gesehen und eins und eins zusammengezählt. Sie haben es dann beide sofort zugegeben.« Er nickte Lyn gewichtig zu. »Erweiterter Suizid. Mit dem Fehler, dass der Suizid fehlgeschlagen ist und nur das wehrlose Opfer den Tod fand.«
Lyn war erschüttert. Und auch verärgert über die Aussage des Arztes. »Einen Fehler würde ich es nicht gerade nennen, wenn ein Suizid fehlschlägt. Sie warten bitte alle hier draußen«, sagte sie und öffnete die Tür zum Schlafzimmer.
Am liebsten hätte sie gleich wieder kehrtgemacht, doch das ging natürlich nicht. Fehlende Frischluft und die seit Tagen anhaltende Hitze – auch nachts kühlte es sich kaum ab – hatten den Raum aufgeheizt. Doch es war nicht nur die abgestandene Luft, die Lyn zusetzte. Es roch nach Tod. Sie atmete flacher. Sie würde sich nie an diesen mit nichts zu vergleichenden Geruch gewöhnen.
Sie informierte Thomas über das, was sie erfahren hatte. Dankbar registrierte sie, dass er das Fenster öffnete, durch das die Morgensonne, so unbeeindruckt vom Geschehen, hereinstrahlte.
Frau Karrenberger lag auf der rechten Seite des Ehebetts. Die Augen waren geschlossen, der Mund stand ein wenig offen in dem starren Gesicht, dessen Haut sich wächsern auf die Knochen gelegt hatte. Der Tod war offensichtlich nicht erst vor Kurzem eingetreten.
Nichts deutete darauf hin, dass ihr jemand ein Kissen auf das Gesicht gedrückt hatte. Auch ihre Hände lagen unverkrampft auf der rosa geblümten Bettdecke. Lyn legte kurz die Finger auf die rechte Hand der Frau. Die Haut war kalt, und diese Kühle wollte so gar nicht zu der Temperatur im Raum passen. Noch ein Indiz, dass sie schon länger tot war als eine Stunde oder zwei.
Lyn sah sich um. Das Bett auf der linken Seite war gemacht. Allerdings fehlte das Kopfkissen. Auf dem Nachttisch der Frau stand eine dicke rote Kerze ohne Unterteller. Sie brannte nicht mehr, aber es hatte sich eine große, zum größten Teil erhärtete Wachslache gebildet. Die Nachbarin oder vielleicht auch Herr Karrenberger selbst hatte das Licht wohl für seine tote Frau entzündet.
Neben einem Wasserglas lag ein Medikamentendosierer mit Wochentageinteilung. In jedem der Fächer lagen vier Tabletten, nur nicht im ersten. Im Fach für den gestrigen Montag befand sich noch eine Tablette. Lyn deutete darauf und sagte zu Thomas: »Wahrscheinlich nimmt sie die abends. Was bestätigen würde, dass sie schon seit gestern tot ist.«
»Das sieht man ihr auch an. Dieses wächserne Gesicht … Ich habe Wilfried verständigt. Die Spurensicherung ist bereits auf dem Weg.«
Lyn stellte sich ans Fenster und atmete dort ein paarmal tief durch.
»Alles klar bei dir?« Thomas musterte sie. »Sonst warte doch draußen bei dem Ehemann.«
»Geht schon.«
Es klopfte an der Tür, und der Arzt trat ein. »Ich habe beiden einen Tranquilizer gegeben.« Dann deutete er auf die Tote. »Ich bin stutzig geworden, weil Frau Hubbert sagte, Frau Karrenberger sei heute Morgen eingeschlafen. Aber sie ist eindeutig schon länger tot. Und da ist auch noch eine Tablette, die sie abends hätte nehmen müssen. Das habe ich in den Unterlagen von Dr. Hermanns recherchieren lassen. Das ist ihr Hausarzt. Na, und die Einblutungen waren auch nicht zu übersehen.«
»Ach, Sie sind gar nicht der Hausarzt?«, fragte Lyn.
Er schüttelte den Kopf. »Dr. Hermanns ist krank. Ich bin seine Vertretung. Wahrscheinlich hat Frau Hubbert gedacht, Dr. Hermanns könnten sie ihren Bären aufbinden. Aber mir kann man nichts vormachen. Und das fehlende Kopfkissen auf seiner Seite – ich hatte so eine Ahnung. Der alte Mann hat es sofort zugegeben, als ich ihn darauf ansprach. Das Kissen liegt im Bad. Na, und als ich dann noch die Verbände unter der Wolljacke rauslugen sah … Ich habe ihm dann vernünftige Verbände gemacht, während wir auf Sie warteten.«
Lyn musterte den Arzt. Er war aufgeregt. Für ihren Geschmack allerdings zu positiv aufgeregt. Er wirkte tatsächlich glücklich darüber, die Entdeckung gemacht zu haben.
Als sich die Tür öffnete und Herr Karrenberger eintrat, ging Lyn auf ihn zu. »Herr Karrenberger, ich kann Sie hier nicht wieder reinlassen.« Die Worte, dass das Schlafzimmer ein Tatort sei, schluckte sie herunter. »Bitte setzen Sie sich wieder auf den Stuhl.«
»Aber ich will doch nur zu meiner Frau«, fiel ihr der alte Mann heiser ins Wort. »Ich hab sie noch nie allein gelassen.«
»Es tut mir leid«, sagte sie, nahm den Arm des alten Mannes und führte ihn hinaus.
Als er wieder auf dem Stuhl Platz genommen hatte, ging sie vor ihm in die Knie. »Warum haben Sie das getan?«, fragte sie leise.