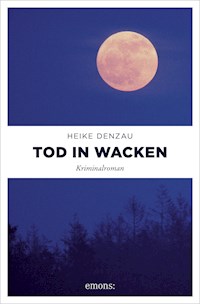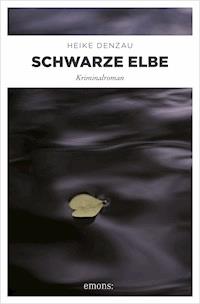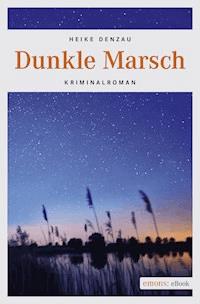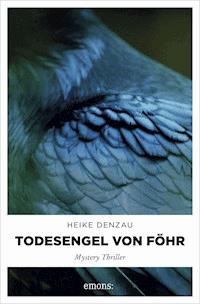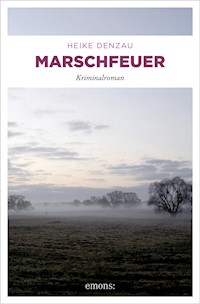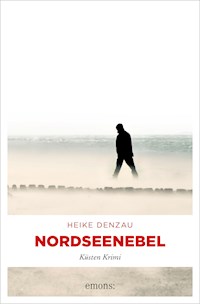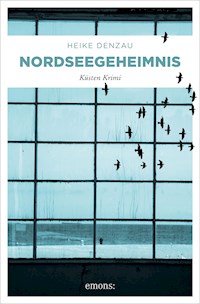6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein charmanter Roman über die Suche nach dem Sinn des Lebens und dem Glück mit einer großen Portion Herz und einer Prise Ernst. Das Leben der 28-jährigen Isa steckt in einer Sackgasse: Seit 20 Jahren hat sie ihren Vater nicht gesehen, den sie schmerzlich vermisst; vom Mann fürs Leben ist weit und breit nichts zu entdecken; und nun muss sie auch noch ihr Medizinstudium unterbrechen, um ihrer Mutter in der Familienpension zu helfen. Als wäre das nicht genug, taucht in der Landarztpraxis, die Isa zu übernehmen hofft, handfeste Konkurrenz auf: Dr. Aaron Berner, der Neffe des alten Arztes. Trotz heftiger Gegenwehr bringt der charmante Aaron Isa ganz durcheinander. Denn da ist auch noch ein geheimnisvoller Pensionsgast, zu dem sich Isa unerklärlich hingezogen fühlt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 528
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Heike Denzau
Ein Landarzt zum Verlieben
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Das Leben der 28-jährigen Isa steckt in einer Sackgasse: Seit 20 Jahren hat sie ihren Vater nicht gesehen, den sie schmerzlich vermisst; vom Mann fürs Leben ist weit und breit nichts zu entdecken; und nun muss sie auch noch ihr Medizinstudium unterbrechen, um ihrer Mutter in der Familienpension zu helfen. Als wäre das nicht genug, taucht in der Landarztpraxis, die Isa zu übernehmen hofft, handfeste Konkurrenz auf: Dr. Richard Berner, der Neffe des alten Arztes. Trotz heftiger Gegenwehr bringt der charmante Aaron Isa ganz durcheinander. Denn da ist auch noch ein geheimnisvoller Pensionsgast, zu dem sich Isa unerklärlich hingezogen fühlt …
Inhaltsübersicht
Widmung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
Epilog
Ein Leben ohne liebste Freundinnen wäre wie Stracciatellaeis ohne Schokostückchen.
Für meine Mucknocks Urte, Tina, Bärbel und Anja
1
So, Maja, jetzt geht’s wieder ab in den Keller.«
Mein Biene-Maja-Wecker verzieht keine Miene, was er tun würde, wenn er könnte. Vorsichtig stecke ich ihn hinter die Postkartenbox in die Plastikwanne, denn ich möchte nicht, dass er auf dem Weg nach unten auch noch seinen linken Fühler verliert – schließlich geht schon der Verlust des rechten auf mich. Wecker sollten überhaupt aus wurfsicherem Material hergestellt werden.
Ein Blick in die Schublade verrät, dass der Nachttisch jetzt komplett leer ist. Okay, die Staubflusen zählen nicht. Ein letzter Rundumblick. Jetzt müsste ich alles haben – fast. Der Lattenrost knarzt ungnädig, als ich mich auf das Bett fallen lasse und nach dem hölzernen Zigarrenkästchen greife, das ungeöffnet auf dem Kopfkissen liegt. Wenn ich mein Zimmer nicht gerade räumen muss, halte ich das Kästchen im Kleiderschrank unter dem Pulloverstapel versteckt.
Ich nehme es und löse die zerfranste Schleife mit dem Teddybären-Aufdruck. Sie durch eine neue Schleife zu ersetzen, bringe ich nicht über mich, denn sie ist ein Stückchen Kindheit. Als ich den Deckel hebe, schaut Papa mich an. Ich versuche den Stich zu ignorieren, den der Anblick seines schmalen Gesichts mir versetzt, aber es will nicht ganz gelingen – wie immer. Darum schaue ich auch so selten in das Kästchen. Weil es wehtut. Auch noch nach fast zwanzig Jahren schmerzt mich der Anblick seines fröhlichen Lachens. Zeit heilt längst nicht alle Wunden, jedenfalls niemals so ganz. Allerdings kann ich jetzt als Achtundzwanzigjährige gut damit leben. Als Kind war es viel schwerer.
Auf dem zerknitterten Foto kräuselt sich neben Papas Kopf eine grüngelbe Luftschlange von der Wohnzimmerlampe. Er lacht aus voller Seele, und seine Augen lachen mit. Ich habe dieses Foto geschossen. An einem Silvesterabend, in einem anderen Leben. Seine Augen, die blau wie die Adria im Sommer sind, habe ich geerbt. Das braune Haar nicht. Meines ist honigblond wie das meiner Mutter. Wie von selbst gleitet mein Finger über die Wangen meines Vaters. »Mein kleiner Spatz«, murmle ich. So hat er mich immer genannt. Manchmal, wenn ich die Augen schließe und es mir gelingt, mich von allem um mich herum zu lösen, kann ich seine Stimme noch in mir abrufen. Aber oft gelingt es eben nicht mehr, und das lässt mich dann in Panik geraten. Und ich hasse diese Panik. Soll seine Stimme doch in mir verschwinden! Auf Nimmerwiedersehen, so wie er.
Abrupt nehme ich die Hand von der Fotografie. Ich war acht Jahre alt, da hatte es sich ausgespatzt. Weg war er, von einem Tag auf den anderen. Angeschrien haben Mama und er sich, bevor er ging, so fürchterlich, dass ich in mein Zimmer geflüchtet bin und mich unter die Bettdecke verkrochen habe. Ich weiß nur noch, dass ich laut geweint habe vor Angst und vielleicht auch, weil ich sie übertönen wollte. Irgendwann knallte eine Tür, dann war Ruhe bis auf Mamas und mein Weinen.
Ich klappe den Deckel der Zigarrenkiste zu und starre vor mich hin. Dieses Haus hat noch viele Tränen von meiner Mutter und mir geschluckt. Dass es nicht ersoffen ist …
Ich komme nicht dazu, mich weiter in diese Gedanken zu verlieren, denn ich höre Mamas Schritte auf der Treppe. Schnell stopfe ich Kiste und Schleife zwischen die Bücher in die Plastikwanne.
Ich versuche, nicht auf ihre Frisur zu starren, als sie mein Zimmer betritt. Sie sieht aus, als trüge sie eine Kurzhaarperücke, die die Nacht in der Mikrowelle verbracht hat. Auf Höchststufe. Jedes einzelne Haar ihres dichten blonden Schopfs ist kraus und zauselig. Und das Schlimme daran – ich bin dafür verantwortlich. Als ich ihr heute Morgen das Haar gewaschen und geföhnt habe, ist mir wieder einmal klar geworden, dass Friseure richtig tolle Handwerker sind oder vielmehr Künstler. Mir ist es nicht gegeben, mit nur zwei Händen eine wenigstens einigermaßen akzeptable Frisur zu föhnen. In ein paar Hunderttausend Jahren wird uns evolutionsbedingt bestimmt eine dritte Hand gewachsen sein, um den Föhn zu halten, während die anderen beiden Hände damit beschäftigt sind, die einzelnen Strähnen auf die Rundbürste zu bekommen. Leider ist das für mich zu spät. Und vor allem für Mamas Styling.
Sie blickt sich um. »Isa-Schatz, ist jetzt alles Persönliche raus aus dem Zimmer? Hast du das Bett frisch bezogen?«
»Ja, Mama.«
Ihre bandagierte Rechte streicht über die hellblau-weiß gestreifte Bettdecke. Ihr linker Arm hängt in einer Schlinge. Mama ist vor drei Monaten beim Reinigen der Dachrinne von der Trittleiter gefallen. Die Operationen an den Armen liegen schon einige Wochen zurück, aber sie kann den linken Arm immer noch nicht richtig bewegen. Nächste Woche nimmt sie endlich die längst fällige Reha wahr.
»Und du hast gesaugt und Staub gewischt?« Meine Mutter lugt von einer Ecke des Zimmers in die andere und scannt dabei jeden Winkel. Wie eine Krankenschwester auf der Suche nach einem entflohenen Tuberkelbazillus.
Ich schlage meine Handkante gegen die Stirn. »Jawohl, Schwester Silke. Die Quarantänestation der Uniklinik ist ein Seuchenpfuhl gegen diesen Raum.«
Sie zeigt mir ein falsches Lächeln. »Warum schenkst du dir deine albernen Bemerkungen nicht endlich, Isa?«
Sie nennt es albern, ich nenne es Humor. Aber das sage ich ihr nicht, weil ich weiß, dass ihre Antwort wieder mit dem Satz enden würde: »Das steckt von deinem Vater in dir.«
Das wenige, das sie von meinem Vater in mir erkennt, ist immer abartig. Jedenfalls strahlt ihr Gesicht das aus, wenn sie sich zu dieser Äußerung hinreißen lässt.
Statt zu antworten, gehe ich zum Fenster und schaue hinaus. Die Elbe strömt an diesem Maitag hellgrau vor dem mit Schafen und Lämmern bevölkerten Deich entlang. Sie fließt eher träge, was zu unserem beschaulichen schleswig-holsteinischen Örtchen passt. In Elmfleth herrscht nie Hektik. Wie auch. Dreihundertvierundsechzig Seelen, verteilt auf jede Menge landwirtschaftliche Fläche und ein Dörfchen mit Kirche und baufälligem Gemeindehaus, das gleichzeitig Kultur-, Sport- und Einkaufszentrum ist, können gar keinen Stress verursachen.
Hier, vom zweiten Stock unserer Pension aus, hat man einen wundervollen Blick auf den Fluss. Die Frühjahrssonne lässt das Wasser wie verzaubert schimmern. Allerdings lassen die Sonnenstrahlen auch erkennen, dass Fensterputzen nicht zu meinen herausragenden Fähigkeiten gehört. Um die Aufmerksamkeit meiner Mutter nicht auf die Schlieren zu lenken, greife ich nach Bob, der in einem antiken geblümten Porzellannachttopf sein Dasein auf der Fensterbank fristet, und setze ihn zuoberst auf die übervolle Plastikwanne.
»Lass doch den Farn stehen, Isa.« Mamas Blick fällt auf die vertrockneten Blättchen am Boden, die Bob bei unserem Rückzug verloren hat. Wäre sie nicht so lädiert, hätte sie sich längst gebückt und sie aufgesammelt. »Warum schleppst du ihn immer mit in dein Sommerzimmer?«
»Weil er persönlich ist.« Mit einem letzten wehmütigen Blick auf das wunderschöne Elbpanorama verlasse ich mit der schweren Wanne mein Zimmer. »Sommerzimmer!«, murmle ich dabei. Wenn ein Zimmer das Attribut Sommer nicht verdient, dann das Zimmer, in das ich Bob jetzt bringe.
»Was hast du gesagt, Isa?« Die Stimme meiner Mutter klingt leicht gereizt, während sie gebückt mit der bandagierten Hand versucht die Bettdecke zu glätten.
»Nichts, Mama.« Sie müsste doch langsam mal wissen, dass ich Gemurmeltes nicht laut wiederhole. Ich murmle oft. An der Treppe bleibe ich stehen, weil der schwarze Kater meiner Oma mitten auf der vorletzten Stufe liegt. Mit der Wanne in den Händen kann ich unmöglich über ihn rübersteigen. »Luzifer, verschwinde.« Ich stupse ihn mit dem Fuß an, weil er sich nicht rührt. »Luzifer!«
Aus meinem Zimmer erklingt Mamas Lachen. »Vielleicht solltest du ihn mit seinem richtigen Namen anreden, dann macht er Platz. Eventuell.« Sie lacht wieder.
Ich mag Tiere, wirklich, aber den Kater meiner Oma kann ich nicht ausstehen. Nicht, weil er fett und faul ist und schnarcht wie ein Grizzly, sondern weil er etwas Heimtückisches im Blick hat. Darum nenne ich ihn auch nicht Karlchen – das klingt viel zu niedlich –, sondern nach dem fiesen Kater aus dem Disney-Cinderella-Film.
»Isa?«
Ich drehe mich am Treppenabsatz noch einmal zu Mama um. »Ja?«
»Hast du zufällig heute Abend noch eine Verabredung?«
Wie ich es hasse, wenn sie diese Frage stellt. Sie will damit nicht nur in meinem Liebesleben herumbohren, sondern, falls ich diese Frage mit einem Nein beantworte, und das werde ich, eine Forderung hinterherschicken.
»Nein.«
Ich habe seit fast anderthalb Jahren kein Date mehr gehabt. Eine so große Zeitspanne lag noch nie zwischen meinen Beziehungen. Seit dem Desaster meiner letzten Beziehung – darüber möchte ich jetzt nicht nachdenken – bin ich solo.
»Wie schön«, sagt meine Mutter und meint damit definitiv nicht nur die Tatsache, dass ich verabredungslos bin. Nein, sie meint damit, dass sie mir dann ja beruhigt einen Auftrag erteilen kann. »Frau Weller hat Omas Lieblingskuchen gebacken. Es wäre wunderbar, wenn du ihr nachher noch ein Stück davon vorbeibringen könntest.«
»Heute?« Ich stelle die Wanne ab, weil sie mir zu schwer wird, und sehe auf die Armbanduhr. »Ich muss doch gleich rüber in die Praxis. Und nach der Arbeit wollte ich das Sommerzimmer in Ruhe herrichten. Ich bringe ihr den Kuchen morgen.« Dass ich heute Abend eigentlich gar nicht einräumen, sondern mit Jette telefonieren will, ist schließlich nicht von Belang, wenn ich damit den Besuch bei meiner Oma hinauszögern kann.
»Morgen sind die Streusel nicht mehr kross, Isa, und dann meckert Oma wieder. Mach doch in der Praxis früher Schluss.«
In meinem Oberbauch krampft es. »Früher Schluss machen, Mama? Das ist mein Job! Es war schon ein Zugeständnis von Onkel Hollerbeck, dass ich momentan nur nachmittags zu arbeiten brauche, damit ich dich hier am Vormittag unterstützen kann. Und außerdem meckert Oma ständig, ob mit oder ohne krosse Streusel.«
»Ach, na gut.« Mama seufzt. »Dann krieg ich das auch noch irgendwie hin. Ich hab ja noch immer alles hinbekommen. Auch ohne Mann. Ich habe ein Kind allein großgezogen, ein Studium finanziert …«
O Mann, wie kann ein Gesicht nur so leidend aussehen? »Wo steht der Kuchen? Ich fahre nach der Arbeit zu ihr.«
»Ach, danke, mein Schatz.« Sie haucht mir einen Kuss auf die Wange. »Die Allegra mit dem Kuchen steht auf dem Küchentisch.«
Allegra. Seit meiner Kindheit bin ich vertraut mit den bunten Plastikschüsseln mit den fantasievollen Namen. Meine Mutter hortet sie zu Hunderten in den Tiefen ihrer Küchenschränke. Bei uns heißt es nicht: Füll den Quark bitte in eine Schüssel. Bei uns heißt es: Füll den Quark bitte in die Clarissa. Der Puderzucker befindet sich in der Süßen Müllerin und die Butterkekse im Naschkätzchen. Und ich kenne alle Namen, weil ich mit ihnen groß geworden bin. Wenn man schon keine Geschwister hat, ist man dankbar, wenn man wenigstens zu seiner Frühstücksdose ein familiäres Verhältnis hat.
»Isa, du siehst heute wieder besonders hübsch aus. Schürzen sieht man ja heutzutage gar nicht mehr.«
»Danke, Herr Gercke.« Ich streiche mit der Rechten über meinen neuesten Flohmarktfund – eine weiße Krankenschwesterschürze aus der Kriegszeit – und strahle den alten Herrn an, während ich die Tür vom Wartezimmer aufhalte, damit er mit seinen Krücken hindurchgehen kann. Würde ich die Tür nicht aufhalten, würde sie von allein zufallen, weil das alte Haus mit der Landarztpraxis, in der ich seit einigen Monaten arbeite, schiefer ist als Pisas Glockenturm. Ein Gemisch aus Alkohol- und Nikotindunst zieht an meiner Nase vorbei, als Herr Gercke an mir vorbeihumpelt. Ich laufe schnell voraus, um die Tür zum Arztzimmer für ihn zu öffnen. »Herr Gercke ist der Nächste, Onkel Hollerbeck.«
Dr. Herbert Hollerbeck ist der Allgemeinmediziner in unserem Dorf. Ein typischer Landarzt der Sorte, die es eigentlich gar nicht mehr gibt. Auch mit dreiundsiebzig Jahren denkt er nicht ans Aufhören. Er braucht seine Patienten wie die Luft zum Atmen. Er ist unser Nachbar, und ich kenne ihn seit Kindertagen, und so hat er darauf bestanden, dass ich ihn weiterhin duze. Allerdings würde ich mich nie trauen, ihn beim Vornamen zu nennen. Also ist es bei Onkel Hollerbeck geblieben.
Er sitzt in seinem gestärkten weißen Kittel hinter einem mit wunderschönen Schnitzereien verzierten Schreibtisch aus dunkler Eiche und sieht uns über seine Brille an, die von modisch so weit weg ist, dass sie schon wieder kultig ist. »Moin, Hans-Otto«, begrüßt er Herrn Gercke und steht auf. »Was macht das Bein?« Er deutet auf die Liege mit dem vanillegelben Frotteebezug und der Gummimatte.
Herr Gercke humpelt zur Liege und setzt sich. »Will nicht heilen.«
Natürlich nicht. Wer mit einem offenen Bein qualmt wie ein Schlot und trinkt wie ein Verdurstender – statt Wasser allerdings Alkohol –, hat wenig Chancen auf Heilung. Aber das sage ich natürlich nicht, sondern nehme Herrn Gercke die Krücken ab und stelle sie an die Wand.
»Isa«, sagt Onkel Hollerbeck, »ruf mal unseren Lehrling rein. Die Lütte kann dir zuschauen, wenn du den Verband wechselst.«
Na, da wird Poppy, Auszubildende im ersten Lehrjahr, sich freuen. Sie liebt alle Arten von Körperflüssigkeiten, die von Wunden abgesondert werden. Schnellen Schrittes verlasse ich das Zimmer, um sie zu holen. Da sie nicht zu sehen ist, frage ich Frau Lutter, die an der Anmeldung sitzt: »Wo steckt Poppy?«
Sie sieht von der Karteikarte, die sie bearbeitet, nicht auf. »Im Spaceshuttle.«
Schmunzelnd wende ich mich in Richtung des Raums, in dem unter anderem das EKG- und das Ultraschallgerät stehen. Seit vor zwei Monaten das alte Ultraschallgerät gegen ein hochmodernes ersetzt wurde, wird der Raum von ihr nur noch Spaceshuttle genannt. Frau Lutter ist dreiundsechzig Jahre alt, einen Meter fünfundfünfzig klein und unverheiratet. Obwohl … Eigentlich ist sie ja doch verheiratet – mit der Praxis. Nun, auf jeden Fall hat sie es so gar nicht mit Technik, und darum ist für sie alles, was über eine mechanische Schreibmaschine hinausgeht, ein Wunder der Technik. Mein Vorschlag, einen PC anzuschaffen, weil der eine enorme Arbeitserleichterung mit sich bringen würde, ist von ihr verächtlich abgeschmettert worden. »Moderner Firlefanz! Nachher räumen uns die Banditen die Konten leer. Kennt man doch aus dem Fernsehen.«
Mein Einwand, dass wir ja kein Onlinebanking machen müssen, wurde im Keim erstickt. Ich sehe sie noch vor mir, wie sie mit verkniffenem Gesicht dasaß, mit verschränkten Armen vor dem üppigen Busen über den beiden Speckfalten, die der viel zu enge weiße Kittel nicht verbirgt. »Wenn ein Computer kommt, komme ich nicht mehr.« Onkel Hollerbeck hat klein beigegeben. Ohne Frau Lutter, hat er gesagt, wäre die Praxis wie ein Bienenstock ohne Königin. Seitdem ist sie einen Meter sechsundfünfzig groß und lässt gerne mal die Queen raushängen.
Als ich die Tür zum Spaceshuttle öffne, stockt mir für einen Moment der Atem.
»Poppy!«, stoße ich aus, trete ein und schließe schnell die Tür hinter mir.
Oberkörperfrei steht sie neben dem EKG-Gerät, voll verkabelt mit den Elektroden. Ohne eine Spur Verlegenheit strahlt sie mich an und sagt: »Isa, kannst du dir das mal angucken, das EKG? Sieht man da einen Unterschied zu sonst?«
Ich bin noch ein paar Sekunden sprachlos, dann mit vier Schritten bei ihr. »Spinnst du jetzt völlig? Was treibst du denn hier?«
»Ich wollte nur schnell mal sehen, ob man das an den Kurven erkennt, wenn man verliebt ist. Fett verliebt.« Sie strahlt mich weiter an.
Ich ziehe schon die Klebeelektroden von ihrer Haut. »Poppy, du bist … unmöglich«, sage ich in die Ploppgeräusche. »Freu dich, dass ich reingekommen bin und nicht Frau Lutter. Dann hättest du jetzt einen Einlauf gekriegt, der sich gewaschen hätte.«
»He, du solltest doch erst gucken«, schimpft sie und haut mir auf die Finger, während ich die Elektroden abziehe.
Ich halte inne. »Das Kardiogramm wäre völlig unbrauchbar, Madame. Du hast die Extremitätenelektroden mit den Brustelektroden verwechselt.«
»Echt? Ach, darum hatte ich auch zwei Kabel übrig.«
»Außerdem misst man im Liegen oder Sitzen und nicht im Stehen«, erkläre ich ihr, was sie eigentlich schon wissen müsste, und entstöpsle sie weiter. »Und glaub mir, es ist nicht zu erkennen, ob du verliebt bist oder nicht. Und selbst wenn, hättest du ja eine Aufzeichnung im Nichtverliebt-Zustand haben müssen, um es vergleichen zu können, oder?«
Sie überlegt. »Irgendwie hast du, glaub ich, recht.«
»Nicht nur irgendwie. Und jetzt zieh dich schleunigst an. Dr. Hollerbeck möchte dich dabeihaben, wenn Herr Gercke einen neuen Verband bekommt.«
»Herr Gercke ist da? Der mit dem offenen Bein?« Sie freut sich wie erwartet. »Cool.« Sie greift nach dem BH auf der Liege und schlüpft hinein.
Kopfschüttelnd sehe ich zu, wie sie sich weiter anzieht. Sie ist ein molliges Mädchen, aber nicht schwabblig, sondern fest im Fleisch. Als der liebe Gott die Sommersprossen in die Luft gepustet hat, um sie auf den Gesichtern zu verteilen, muss er bei Poppy einen Niesanfall gehabt haben. Dicht an dicht tummeln sich die kleinen Sprossen auf ihrer Nase und großflächig darum herum. Mit ihrem karottenroten Lockenschopf macht sie ihrem Namen alle Ehre. Poppy – der englische Name für Mohnblume. Der Name ist das Einzige, was ihre Mutter ihr mitgegeben hat, bevor sie sich den goldenen Schuss setzte. Sie ist nur vierundzwanzig Jahre alt geworden. Poppy ist bei ihren Großeltern aufgewachsen. Leider ist auch ihre Oma vor drei Jahren gestorben.
Ich lächle Poppy an, als sie in den weißen Kittel schlüpft. Sie hat es nicht leicht. Ihr Opa ist sehr streng mit ihr, vermutlich, weil er befürchtet, sie könnte so enden wie ihre Mutter. Dabei ist Poppy ein absolut liebenswürdiges Mädchen. Und genau diese Liebenswürdigkeit ist wohl der Grund, warum Onkel Hollerbeck ihr die Ausbildung zur Medizinischen Fachangestellten ermöglicht. Und weil Poppys Opa Harald Lehmann sein Skatbruder ist. Aufgrund ihrer Zeugnisse – ich habe sie in der Personalakte gesehen – hätte er sie wohl kaum eingestellt. Sie hat die Gemeinschaftsschule mit einem Dreier- und Viererzeugnis der Hauptschulstufe verlassen und hat es in der Berufsschule sehr schwer.
»Du fragst gar nicht, in wen ich so verliebt bin«, sagt sie, als wir den Raum verlassen. Frau Lutter blickt wieder nicht von ihrer Arbeit auf.
»Das weiß ich doch«, entgegne ich und ziehe sie am Arm mit, weil sie schon wieder stehen bleibt. »In Kevin.«
»Mit dem ist Schluss. Ich bin jetzt mit Speedy zusammen.«
»Ich hoffe, das ist nicht sein Vorname.« Ich habe in der letzten Woche einen Artikel gelesen, in dem die unglaublichsten Vornamen aufgelistet waren, die Eltern ihren bemitleidenswerten Sprösslingen verpasst hatten – Winnetou, Pumuckl, Waterloo, Billibald … Da wäre Speedy sogar noch die angenehme Alternative.
Sie kichert. »Nee, Speedy heißt Lukas. Warum den alle Speedy nennen, weiß ich gar nicht.«
Tja, wenn der Name Programm ist, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ist er drogensüchtig oder ein richtig schneller Läufer. »Ist er sportlich?«
Sie nickt eifrig, was mich beruhigt. »Der macht voll viel Bodybuilding und so. Der hat voll die Muskeln. Da steh ich drauf. Du auch?«
Nein, ich stehe mehr auf Hirn, aber für Grundsatzdiskussionen ist keine Zeit. Trotzdem klopfe ich noch nicht gleich, als wir vor der Tür des Arztzimmers stehen bleiben. »Du warst also mit Kevin zusammen und davor mit diesem Jo-Jo oder was weiß ich, wie der hieß?«
Poppy nickt. »Ja, und jetzt mit Speedy. Der ist total süß. Diesmal ist es vielleicht für immer. Bestimmt.«
»Poppy«, ich sehe ihr in die Augen und spreche leise, damit Frau Lutter nicht aufmerksam wird, »auch wenn es mich nichts angeht, aber du bist gerade erst sechzehn geworden. Ich hoffe sehr, dass du nicht gleich mit jedem der Jungen …« Hier breche ich ab. Das, was ich sagen will, braucht einen anderen Ort und eine andere Zeit.
»Ja?« Sie schaut mich arglos an, anscheinend nicht die Spur ahnend, was ich sagen wollte.
»Lass uns in den nächsten Tagen mal ein Eis essen gehen, ja? Ich lade dich ein.«
»Klar, cool.« Sie strahlt mich an. »Aber nun rein da.« Sie deutet auf die Tür des Arztzimmers. »Ich will doch bei Herr Gercke zugucken.«
»Bei Herrn Gercke«, verbessere ich sie.
»Aha.«
Ich klopfe an, und wir treten ein.
Poppys Begrüßung ist fröhlich. »Hallo, Herrn Gercke!«
O Mann.
Onkel Hollerbeck winkt Poppy heran. Zu mir sagt er: »Ich habe mächtigen Kaffeedurst, Isa. Setz doch mal einen auf. Aber einen vernünftigen, nicht so ein Labberzeug, das Frau Lutter mir immer vorsetzt.« Er sieht Herrn Gercke an. »Kaffee muss auch nach Kaffee schmecken, nicht wahr?«
Der nickt. »Noch besser schmeckt er, wenn da ein Schuss Weinbrand mit drin ist.«
Ich höre Onkel Hollerbecks Antwort im Rausgehen. »So kann dein Bein nicht heilen, Hans-Otto. Nicht so viel Alkohol, das weißt du doch.«
Die Erwiderung bekomme ich nicht mehr mit, aber ich weiß, dass bei Herrn Gercke Hopfen und Malz verloren ist beziehungsweise leider auf der Tagesordnung steht.
Die Kaffeemaschine hat ihren Platz auf einem kleinen Tisch hinter der Anmeldung. Frau Lutter sieht auf, als ich Wasser in den verkalkten Behälter fülle. »Vier Löffel auf acht Tassen Wasser«, sagt sie zu mir. »Nicht mehr. Du weißt ja, Isa, das Herz vom Chef …«
Ich nicke und zähle langsam und laut, damit sie mich hört. »Eins … zwei … drei … vier.« Dass ich bei jeder Zahl zwei Löffel Kaffee in den Filter gegeben habe, kriegt sie nicht mit, weil ich mit dem Rücken zu ihr stehe. Außerdem verrät das Kratzen eines Stiftes auf Papier, dass sie wieder über den Karteikarten brütet. Da sie selbst Teetrinkerin ist, wird sie auch nicht herausfinden, dass ich dem Doktor mal einen ordentlichen Kaffee gebraut habe. Ein leichter Herzanfall vor fünf Jahren hängt ihm immer noch nach – aber einzig aus ihrer Sicht.
Während der Kaffee durchläuft, nehme ich die Karteikarte, die Frau Lutter auf den Tresen gelegt hat. Die kleine Anna mit der Bronchitis ist die Nächste. Ich gehe ins Wartezimmer, in dem die zwölf Holzstühle mit den roten und blauen Sitzkissen zur Hälfte besetzt sind. Eigentlich standen hier vierzehn Stühle, aber als ich meinen Job begann, wurde einer der Stühle meiner und steht jetzt hinter dem Empfangstresen. Da Frau Lutter keine dreizehn Stühle im Wartezimmer haben wollte, wurde kurzerhand noch einer entfernt. Er fristet sein Dasein nun an der Wand im Arztzimmer.
Anna und ihre Mutter sitzen neben dem grün-weiß lackierten Holzfenster mit den Sprossen, aus dem man unser Haus sehen kann. Nicht, dass es etwas Lohnenswertes zu sehen gäbe, nein, weiß Gott nicht. Unser Haus ist nicht hübsch, sondern zweckmäßig. Ein mächtiger weiß verputzter Kasten mit holzverkleideten großen Gauben im Dach. Die grauen Dachpfannen sind an der Seite zum Garten hin dick vermoost. Ich mag das Moos, weil es die Sterilität aufhebt, die Haus und Garten wie der böse Geist von Meister Proper umweht. Mama hasst das Moos. Wenn es nicht so teuer wäre, hätte sie das Dach längst fachmännisch reinigen lassen. Als seinerzeit der Anruf meiner Oma kam, dass Mama mit beidseitigen Armverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden war, war ich davon ausgegangen, dass sie vom Dach stürzte, auf der Jagd nach unschuldigen flauschigen Moosnestern.
Weil die Luft im Wartezimmer verbraucht ist, trete ich ans Fenster, öffne einen Flügel nach außen und fixiere ihn, indem ich den langen, dünnen Halter einhake. Neben frischer Luft dringt das Gegackere der beiden Hühner, die Onkel Hollerbeck im Garten hält, herein. Frieda und Hilde gackern selten, eigentlich nur, wenn sie gefüttert oder von Luzifer gescheucht werden. Da Frieda gerade hektisch angeflattert kommt und so viel an Höhe gewinnt, dass sie fast an das offene Fenster knallt, steht fest, dass Luzifer sein Unwesen treibt.
Die kleine Anna, die sich neben mir auf ihrem Stuhl auf die Knie gehockt hat und rausguckt, lacht. »Ein witziges Huhn. Kann es noch mehr Kunststücke?«
»Es kann Eier legen.«
»Das ist ja kein Kunststück. Das kann doch jedes Huhn.«
»Aber dieses legt Spiegeleier.«
»Echt?« Sie sieht mich mit großen Augen an.
Ihre Mutter lacht, und ich zwinkere Anna zu. »Ich hab nur einen Witz gemacht.«
Weil auch die übrigen Patienten lachen, läuft Anna rot an. »Du bist gar nicht witzig«, stößt sie beleidigt aus. Mama würde ihr wohl zustimmen.
Ich bitte die Kleine und ihre Mutter ins Spaceshuttle. Dort kann Onkel Hollerbeck Anna schon mal abhorchen, während Herr Gercke gleich von mir im Arztzimmer verbunden wird. Weil der Kaffee noch nicht ganz durchgelaufen ist – die Maschine röchelt, als hätte ihr letztes Stündlein geschlagen –, schaue ich schnell noch auf mein Smartphone, das neben den Kaffeebechern auf dem Regal liegt.
Zwei WhatsApp-Nachrichten sind da. Eine ist von Theo, eigentlich Theodora, aber sie geht jedem verbal an die Gurgel, der sie so nennt. Theo studiert auch Medizin und will wissen, ob ich heute »Bock auf Feiern hab«. Ich war einige Male mit ihr und anderen Kommilitonen in Hamburg auf dem Kiez und der Schanze unterwegs. War schon lustig, aber als Studienspäteinsteiger merke ich doch den Altersunterschied. »Bock ja, aber keine Zeit«, winde ich mich elegant heraus und sende ein Küsschen-Emoticon hinterher.
Die zweite Nachricht ist von Jette. Sie schreibt, dass sie heute Abend leider keine Zeit für ein Telefonat hat, aber dafür morgen Abend sooooo gern vorbeikommen möchte. Ich schreibe ihr zurück, dass ich mich auf sie freue. Kaum ist die Nachricht versandt, da kommt schon ihre »Freu-mich-auch-riesig«-Antwort mit einem Herz-Emoticon.
»Küsschen«, schreibe ich zurück. Jette ist meine allerliebste, allerbeste, allerwunderbarste Freundin. Seit Kindertagen sind wir einander eng verbunden. Es gibt nichts, was wir nicht voneinander wüssten. Es gibt keine Geheimnisse zwischen uns.
Lieber Herr Hofer,
natürlich beantworte ich Ihre Briefe gern! Sie müssen sich nicht jedes Mal dafür entschuldigen. Allerdings kann ich mittlerweile mit Ihren Briefen den Hamburger Michel tapezieren, genauso wie Sie mit meinen. Also finden Sie nicht, dass es langsam mal an der Zeit ist, auf Isa persönlich zuzugehen? Und kommen Sie mir jetzt nicht wieder mit der Aussage: Sie hat nie auf meine Briefe geantwortet.
Ich finde, es reicht. Gehen Sie zu ihr! Besuchen Sie Isa zu Hause. Ihre Exfrau wird Sie schon nicht mit dem neuen Küchenmesser abstechen, das Isa ihr zum Geburtstag geschenkt hat. Ein Messer für 180 €uro! Ich würde ja niemals ein Messer kaufen, das so viel kostet wie meine Secondhand-Designer-Gladiatorensandalen.
Mein Papa sieht das natürlich anders. In seinem Restaurant hantiert er auch mit diesen teuren Dingern rum. Falls Sie einmal Appetit auf ein oberleckeres Saltimbocca alla Romana haben, Sie wissen ja, Papa kocht fantastisch. Aber ich schweife ab. Sie wollen schließlich nichts über mich, sondern Neuigkeiten über Isa erfahren. Das ist übrigens auch ein Grund, warum Sie endlich selbst mit ihr reden müssen! Auf meiner persönlichen Schlechtes-Gewissen-Skala von 1 bis 10 habe ich mittlerweile die 9,5 erreicht. Ich verschweige meiner allerliebsten Freundin, dass ich seit Jahren mit ihrem Vater korrespondiere!
Wie würden Sie das finden, wenn Ihr Freund Martin das machen würde? Mein Gott, ich weiß sooo viel über Sie und Isa gar nichts.
Nun gut, ein letztes Mal (!) aus Isas Leben:
Was soll ich sagen, Herr Hofer – sie ist immer noch Single. Nach dieser elenden Peer-Magnussen-Episode ist sie immer noch nicht bereit, sich auf eine neue Beziehung einzulassen. Wenn wir feiern gehen, schmettert sie alle Annäherungsversuche der Männer ab, obwohl sie selbst immer nach älteren Männern Ausschau hält. Sie kennen ja meine Meinung dazu, Herr Hofer. Ich sage es trotzdem noch einmal: Vater-Komplex! Isa hat solche Sehnsucht nach väterlicher Wärme und Geborgenheit.
Und wenn Sie nicht auf Ihre Exfrau treffen wollen, bietet sich ab nächster Woche die beste Gelegenheit, denn sie geht für drei Wochen zur Reha. Also fassen Sie sich endlich ein Herz, Herr Hofer!
Ich habe Ihnen wieder ein Foto von Isa dazugelegt. Da ich sie natürlich heimlich mit dem Handy aufgenommen habe, ist es nicht wirklich toll, aber besser als nichts. Sie sehen Isa bei ihrer Lieblingsbeschäftigung: Sie durchwühlt gerade einen Flohmarktstand nach neuen Fummeln. Hatte ich Ihnen geschrieben, dass Isa sich im Winter im Secondhandladen wieder einen von diesen Herrenmänteln gekauft hat? Lang und viel zu weit. Hässlich, wenn Sie mich fragen. Aber sie liebt den Mantel. Weil …? Ja, kriegen Sie ruhig ein schlechtes Gewissen, Herr Hofer!
Also, packen Sie’s an! Für Isa. Und für Sie selbst.
Herzliche Grüße von Ihrer Jette Graziano
PS: Wie gefällt Ihnen mein neues Briefpapier?
Der Kaffee ist fast durchgelaufen. Sein aromatischer Duft wabert verführerisch an meiner Nase vorbei, während die Maschine den letzten Wasserstoß in den Filter hustet. Ich schaue zu, wie der Rest Kaffee in die Kanne plätschert. Herr Gercke ist fort, frisch verbunden von mir, vollgetextet von Poppy, die als Dorfkind jeden Dorfbewohner kennt – genau wie ich. Und ich liebe es. Mich graust es nicht, dass die Menschen um mich herum so viel von mir wissen und ich von ihnen. Jette dagegen hat Elmfleth fluchtartig verlassen, als sich die erste Gelegenheit bot. Sie lebt seit ihrem neunzehnten Lebensjahr im nahen Hamburg. Während ihrer Ausbildung zur Erzieherin wohnte sie dort in einer WG, dann zwei Jahre mit einem Freund zusammen. Und seit zwei Jahren ist sie wieder allein in einer kleinen, aber feinen Wohnung im Schanzenviertel, größtenteils gesponsert von ihrem Vater.
Wir sind zwei achtundzwanzigjährige Singlefrauen, die das Singleleben hassen. Wir sehnen uns beide nach unserem Traumprinzen, aber vor lauter Fröschen gelingt es uns nicht, den mit der Krone zu erwischen. Dass wir beide nach bestimmten Typen von Mann suchen, erleichtert die Sache nicht gerade. Jette hält nur nach schwarzhaarigen Männern mit dunklen, feurigen Augen Ausschau. Mir ist es egal, welche Haarfarbe mein Traumprinz hat. Ich habe auch nichts gegen Grau. Im Gegenteil, es zeugt von Reife. Ich suche also eher nach einem Traumkönig als nach einem -prinzen.
»Isa«, holt Frau Lutter mich aus meinen Gedanken, »du kannst Merle Meyer aufrufen. Sie ist die Nächste.« Ihr Würstchenfinger tippt im Zehntelsekundentakt auf die Patientenkarteikarte auf dem Tresen.
»Vorher bringe ich dem Doktor seinen Kaffee.« Ich nehme den Becher mit dem »Bester-Chef-der-Welt«-Spruch vom Regal und schenke ihn so voll, dass gerade noch Platz für drei Stückchen Zucker ist. Ich höre noch Onkel Hollerbecks Antwort, als ich ihn an meinem ersten Arbeitstag fragte, wie er seinen Kaffee trinkt. »Wie ein Negerbaby, schwarz und süß.« Auf meinen entsetzten Blick hin hat er herzlich gelacht und gesagt: »Keine Angst, ich bin kein Rassist, Isa, sondern nur ein alter Trottel, der sich schwer umstellen kann. Das mit dem Kaffee und dem Baby sag ich schon seit mehr als fünfzig Jahren.«
Wie hätte ich ihm böse sein sollen? Meiner Oma habe ich die »Negerküsse«, die sie liebt, auch noch nicht austreiben können. Wenn ich sie verbessere, sagt sie jedes Mal: »Du kannst dir deine Schaumküsse an den Hut stecken, Fräulein.«
Ich balanciere den Kaffeebecher vorsichtig über den Flur zum Arztzimmer, in das Onkel Hollerbeck zurückgekehrt ist, nachdem er die kleine Anna abgehorcht und sie anschließend mit einem Kirschlolli versorgt hat, die in einem Glas auf dem Tresen stehen. Ich vermute, die Hollerbecksche Praxis ist die einzige in Deutschland, in der Kinder noch mit klebrig zuckersüßen Naschis belohnt werden.
»Ah!«, kommt es freudig von ihm, als ich eintrete. Er schnuppert über dem Becher, den ich vor ihm abstelle. »Das duftet nach einem vernünftigen Kaffee, mein Deern. Ich danke dir.«
»Gerne. Möchtest du ihn erst in Ruhe austrinken, oder kann ich Merle Meyer schon hereinbitten?«
»Die Tochter vom Bürgermeister?«
Ich nicke. Die siebzehnjährige Merle ist das jüngste der drei Kinder von Großbauer Bernd Meyer. Er hat den größten Milchviehbetrieb im Kreis und ist ständig schlecht gelaunt. Trotz seiner Übellaunigkeit hat er es geschafft, unser Bürgermeister zu werden. Welche Gründe die anderen Elmflether hatten, ihn zu wählen, weiß ich nicht. Ich habe es getan, weil ich seinen Aktivismus in der örtlichen Politik mag. Trotz seiner erheblichen Selbstüberschätzung hat er sich von Anfang an für die Flüchtlinge in unserem Dorf starkgemacht.
Onkel Hollerbeck schlürft den ersten heißen Schluck und sagt wohlig: »Aah, das tut gut. Dann lass das Mädel mal reinkommen. Sie will bestimmt ein Attest, weil eine Klausur ansteht. Ich kenn doch meine Pappenheimer.« Er lacht, nimmt ein Blankoformular aus der Schreibtischschublade und unterzeichnet es. »Hier, Isa, schreib das Übliche rein, du weißt schon.«
Allerdings weiß ich das. Ich bewundere Onkel Hollerbeck für die Fachkompetenz, die er hat, für sein Wissen und seine Weisheit, die über die Jahrzehnte gewachsen sind. Es ist mein hehres Ziel, einmal als praktische Ärztin genauso gut zu sein wie er. Aber ich werde garantiert nicht jeden Hinz und Kunz krankschreiben, nur weil er krankgeschrieben werden möchte. Gut, eventuell würde ich bei Allessandro, der im Sommer mit dem Eiswagen durch unser Dorf kommt, eine Ausnahme machen. Der hat Augen! Ich habe versucht Jette mit ihm zu verbandeln, indem ich sie jedes Mal, wenn sie zu Besuch war, zu seinem Wagen schickte. Aber obwohl er schwarzhaarig und feueräugig ist, hat es bei ihr nicht gefunkt. Was umso bedauerlicher ist, weil ich mein Eis somit weiterhin bezahlen muss.
Merle Meyer sehe ich allerdings nicht unbedingt als Schulschwänzerin. Sie erinnert mich an Poppy, naiv und grundfreundlich. Sie macht eine Ausbildung zur Hauswirtschafterin, ist sehr aktiv im Jugendgemeindeleben und betreut mit einigen erwachsenen Helfern die acht Flüchtlinge, die vor zwei Jahren in unser Dorf gezogen sind. Das weiß ich so genau, weil die Medien unseren Ort als Vorzeigedorf für Integration hoch gelobt haben. Sogar ein Fernsehsender hat seinerzeit den Weg in unsere dörfliche Beschaulichkeit gefunden.
Als ich Merle aufrufe, scheint Onkel Hollerbeck in Sachen Pappenheimer allerdings recht zu bekommen, denn sie beginnt zu husten. Ein Husten, der so echt ist wie die Brüste von Pamela Anderson. Es scheint also wirklich um eine Krankmeldung zu gehen. Sie hustet noch einmal, als wir an Frau Lutter vorbeigehen, und dann noch einmal, als wir Poppy begegnen, die Gerätschaften für den Sterilisator in Händen hält. Das erwartete Husten, als sie das Arztzimmer betritt, bleibt zu meiner Überraschung aus. Dabei ist es doch der Doktor, der überzeugt werden muss.
»Bleib hier, Isa, schließlich willst du Ärztin werden«, fordert Onkel Hollerbeck mich auf, als ich die Tür von außen schließen will. Und an Merle gewandt: »Du hast doch nichts dagegen, dass wir Isa eine Diagnose stellen lassen, bevor ich tätig werde?«
»Äh, ich …« Merles Wangen werden krebsrot, während sich ihr rechter Zeigefinger um eine Strähne der viel zu langen dunkelblonden Spaghettihaare wickelt. »Also, ich …«
Das hört sich für mich nicht nach Zustimmung an, aber der Doktor scheint dieses Feingefühl nicht zu besitzen. Er deutet auf den Stuhl an der Wand – Nummer dreizehn mit blauem Kissen –, den ich mir holen soll. Onkel Hollerbeck hat mich schon diverse Male diagnostizieren lassen, und die Elmflether hatten nichts dagegen. Schließlich weiß hier jeder, dass ich Medizin studiere – eigentlich.
Dann sagt er zu Merle: »Nun setz dich schon hin, Merle, und sag, was dir fehlt.«
Sein Befehlston, der mir hier absolut fehl am Platz erscheint, zeigt Wirkung bei ihr. Sie hockt sich auf die vorderste Stuhlkante, während ich mir den Stuhl zum Schreibtisch ziehe. Ihr Blick ruht einen Moment lang auf dem an einem Ständer hängenden Skelett, das seit ewigen Zeiten in der Ecke von Fenster und Bücherregal steht. Ich fand es schon in Kindertagen faszinierend, und es hat mir nie Angst gemacht, obwohl es nicht aus Plastik, sondern ein echtes Skelett ist. Seine Knochen sind vergilbt und haben feine Ritzen und Löcher. Poppy liebt Hook. So haben wir es getauft, weil ihm die linke Hand fehlt.
Die fehlende Hand ist vielleicht auch Merle aufgefallen, denn sie sieht auf ihre Hände. Doch es scheint mehr eine Verlegenheitsgeste zu sein. »Ich … also …«
Ihr Gestammele sagt mir, dass sie nicht wegen eines Hustens hier sitzt.
»Ich … äh … habe … habe Husten.« Sie sieht auf und blickt vom Doktor zu mir und wieder auf ihre Hände.
»Hm«, macht Onkel Hollerbeck. Er schiebt das Stethoskop, das neben der ledernen Schreibtischunterlage liegt, zu mir. »Dann horch sie mal ab, Isa.« Er lehnt sich in das weiche Leder des Stuhls zurück und schlürft seinen Kaffee.
Gesagt, getan. Ich horche Merles Brust und Rücken ab und lasse sie dabei husten. »Tja, zu hören ist nichts. Die Lungen sind frei.« Weil sie wieder tomatenrote Wangen bekommt, möchte ich sie erlösen und hinausgehen. Sie will eindeutig nicht sagen, warum sie hier ist, solange ich dabei bin. Und das ist ihr gutes Recht. »Ich geh dann mal …« Ich schaffe es nicht, den Satz zu beenden, weil Onkel Hollerbeck Merle seine Diagnose wie einen Squashball entgegenschmettert.
»Du bist schwanger.«
Merles Antwort sagt alles. Sie bricht in Tränen aus.
Er stellt den halb vollen Kaffeebecher ab, während ich neben Merles Stuhl in die Knie gehe. »Merle, auch ich unterliege der Schweigepflicht. Hab keine Angst, über meine Lippen kommt kein Ton. Ich gehe jetzt raus«, sage ich im Aufstehen Onkel Hollerbeck.
Er nickt. Im Hinausgehen höre ich, wie er Merle großväterlich fragt: »Hast Angst vor deinem Vater, was, dem alten Brüllaffen?«
Frau Lutter vergibt gerade telefonisch einen Termin, Poppy winkt mir freudig aus dem Mini-Labor zu. Eine Urinprobe steht vor ihr. Ich greife mir die nächste Patientenkarte vom Tresen, ohne den Namen darauf wahrzunehmen.
Merle, gerade mal siebzehn Jahre alt, ist also schwanger. Warum sie wohl hier ist? Die jungen Mädchen aus unserem Ort gehen alle zu Frauenärzten in Hamburg, nicht zu Onkel Hollerbeck, wenn es um Verhütung und Schwangerschaften geht.
Ich komme nicht dazu, mir weitere Gedanken zu machen, denn aus dem Arztzimmer erklingt ein Schrei. Sekunden später wird die Tür aufgerissen, und Merle stürzt heraus, blass, nach drinnen deutend. »Der Doktor … ist tot.«
Poppy kommt aus dem Labor gestürmt, Frau Lutter fällt das Telefon aus der Hand. Ich stehe da wie erstarrt, mein Blick ist durch die offene Tür des Arztzimmers direkt auf den mächtigen Schreibtisch gerichtet. Onkel Hollerbecks Oberkörper liegt auf der Schreibtischunterlage.
»Er hat seinen Kaffee ausgetrunken«, schluchzt Merle neben mir, »und dann ist er blass geworden und einfach vornübergekippt.«
Der Doktor ist tot. Ihre Worte wabern durch mein Hirn, gräulich, verschwimmend. Wie in Trance gehe ich auf den Schreibtisch zu. Onkel Hollerbecks Halbglatze leuchtet mir, von Sonnenlicht beschienen, entgegen. Der leere Becher liegt umgekippt neben seinem Kopf. Ein winziges braunes Rinnsal ist herausgelaufen.
Onkel Hollerbeck ist tot. Ich habe ihn umgebracht. Mit Kaffee.
2
Frau Lutter und ich weinen beide, als der Rettungswagen mit Sirenengeheul davonfährt, gefolgt vom Notarzt. Ihr laufen die Tränen vor Schreck, mir vor Erleichterung. Onkel Hollerbeck lebt!
Nach der ersten Schreckstarre habe ich funktioniert. Ich bin zu ihm an den Schreibtisch gestürzt, habe seinen Puls gefühlt und den tiefsten Erleichterungsseufzer meines Lebens ausgestoßen. Dann habe ich Frau Lutter instruiert, den Notarzt zu rufen. Zu diesem Zeitpunkt kam der Doktor wieder zu sich, was einen weiteren Seufzer nach sich zog. Auch das EKG, das ich mit seiner Genehmigung machen durfte, war unauffällig. Däumchen drehend hat er dann auf der Liege auf den Rettungswagen gewartet.
Frau Lutter ist wie Henne Frieda um ihn herumgeflattert, während Poppy im Wartezimmer die Patienten informiert hat. Als der Notarzt kam, hat Onkel Hollerbeck sich nicht geweigert, mit ins Krankenhaus zu fahren. Ein Zeichen, dass er sich nicht so gut fühlte, wie er uns weiszumachen versuchte.
Ich lege Frau Lutter einen Arm um die Schultern, als der Rettungswagen hinter der Kurve verschwindet. »Kommen Sie, Frau Lutter, den Doktor haut so schnell nichts um. Der ist schneller wieder hier, als wir gucken können.« Das soll nicht nur sie, sondern vor allem mich trösten. Die Sirene noch im Ohr, führe ich sie in die Praxis und setze sie auf ihren Stuhl hinter dem Tresen. Poppy – dieses unglaubliche Mädchen hat von uns allen die größte Ruhe bewahrt – hat ihr schon einen Tee gekocht. Dankbar nimmt Frau Lutter ihn von ihr entgegen.
»Möchtest du einen Kaffee, Isa?«, fragt Poppy mich.
Schuldbewusst blicke ich zur Kaffeemaschine, die ihrerseits unschuldig dasteht mit dem Rest des dunkelbraunen Gifts. »Danke, Poppy, ich mach das schon selbst«, sage ich und schenke den Kaffee in einen Becher. Mit einem Blick zu Frau Lutter, die hinter mir mit sich selbst redend ihren Tee schlürft, nehme ich den verräterischen Kaffeefilter und entsorge ihn in den Mülleimer, und zwar unter den bereits darin befindlichen Müll. Ich muss verhindern, dass Frau Lutter die Kaffeemenge im Filter bemerkt.
»Im Wartezimmer sitzen noch Frau Kratke und Herr Pomering«, erklärt Poppy, die vor dem Tresen steht. »Ich habe sie nicht nach Hause geschickt, weil die beiden ja nicht zum Doktor reinmüssen.«
»Sehr gut mitgedacht«, lobe ich Poppy. Frau Kratke ist da, um sich die fällige Tetanusspritze abzuholen, Herr Pomering bekommt ein Langzeit-EKG-Gerät. Dazu brauchen wir den Doktor nicht.
»Und Herr Scheel wollte auch nicht gehen.« Poppy sieht mich an. »Er sagt, er braucht ein Rezept.«
»Wir können ihm keines ausstellen, weil der Doktor es unterschreiben muss«, entgegne ich. »Vertretung ist in diesem Fall Frau Dr. Müller-Sierk.«
»Papperlapapp«, kommt es energisch von Frau Lutter. Sie scheint sich berappelt zu haben. Sich auf ihrem Stuhl gerade aufrichtend, atmet sie einmal tief durch. Dann öffnet sie die obere Schreibtischschublade und nimmt ein Rezeptformular heraus, ein Blankoformular, aber bereits vom Doktor unterschrieben. Noch etwas, das es bei mir niemals geben würde.
»Poppy«, sie deutet auf das Schränkchen, in dessen Schubladen sich die Patientenkarten befinden, »such mal die von Rudi Scheel raus.«
»Aber«, wage ich Widerspruch, »wir können nicht einfach …«
»Der braucht seine Beruhigungstabletten«, fährt Frau Lutter mir über den Mund. »Die kriegt er seit Jahren vom Doktor. Und jetzt kriegt er sie von mir.« Sie reißt Poppy die aufklappbare Patientenkarte, die sie ihr reicht, aus der Hand, öffnet sie und studiert den letzten Eintrag. »Sag ich doch«, murmelt sie, »die Zeit ist da für ein neues Rezept.« Sie schreibt den Namen des Medikaments auf das Formular und reicht es Poppy. »Gib es ihm.«
Gleich darauf verlässt Herr Scheel das Wartezimmer mit einem Winken und den Worten: »Danke! Und für den Doktor gute Besserung.«
»Beim nächsten Mal nicht die Versichertenkarte vergessen, Herr Scheel«, ruft Frau Lutter ihm hinterher. »Neues Quartal!«
»Mach ich.« Er winkt noch einmal, dann ist er weg. Rudolf Scheel ist einundfünfzig Jahre alt und Lehrer an einer Gemeinschaftsschule. »Der wird nicht in Altersrente gehen«, hat Onkel Hollerbeck vor Kurzem prophezeit. »Ein Wrack. Ohne die Tabletten würde der keinen Tag in der Schule überstehen.«
Mein Einwand, ihm eine Therapie statt Tabletten zu verordnen oder zumindest zusätzlich, hat Onkel Hollerbeck abgewehrt. »Hat der alles schon hinter sich. Labern hilft da nicht mehr, Isa. Dem Mann sind schon zu viele Synapsen durchgekokelt. Ohne ein bisschen was Beruhigendes übersteht der keinen Tag.« Auf meinen skeptischen Blick hin hat er hinzugefügt: »Rudi Scheel sagt, die Gören terrorisieren ihn. Er nennt die Schule Taliban-Camp.«
Da habe ich aufgegeben. Vielleicht ist es wirklich besser, wenn Herr Scheel in Frührente geht, für ihn und für die Terrorzelle, die er unterrichtet.
Frau Lutter reißt mich aus meinen Gedanken, als sie Poppy weitere Anweisungen erteilt. »Herrn Pomering kannst du ins Spaceshuttle führen. Isa kann ihm das EKG-Gerät anlegen.« Sie schenkt mir ein süßliches Lächeln.
In mir beginnt es zu brodeln. Sie lässt immer gern durchblicken, dass sie hier das Sagen hat. Dass ich ausgebildete Krankenschwester bin und einmal Ärztin sein werde – in grauer Zukunft –, zählt nicht. Hier bin ich nur die Aushilfe.
»Es wartet noch jemand.« Poppy guckt unsicher von mir zu Frau Lutter. »Merle Meyer möchte noch mit Isa sprechen, bevor sie geht.«
»So?« Frau Lutter klingt pikiert. »Na, dann …« Sie sieht Poppy an. »Dann muss Merle warten. Erst wird Isa Frau Kratke impfen.«
Jetzt reicht’s! »Nein«, sage ich laut, »ich werde zuerst mit Merle reden. Ich werde mit ihr in den Ultraschallraum gehen. Im Arztzimmer fühlt sie sich heute bestimmt nicht mehr wohl. Aber Herr Pomering kann dort schon Platz nehmen, Poppy.«
»Spielst du dich jetzt hier als Chefin auf?« Frau Lutter atmet so heftig, dass die Knöpfe ihres engen weißen Kittels kurz davor sind, abzuspringen.
Ich lächle. »Nein, aber ich kann mitdenken und eigenständig arbeiten, Frau Lutter, genauso wie Sie.« Ich drehe mich um und gehe gemeinsam mit Poppy zum Wartezimmer. Sie ruft Herrn Pomering auf, ich schenke Merle ein herzliches Lächeln und sage: »Komm bitte mit mir, Merle.«
Als ich die Tür des Ultraschallraums hinter uns schließe und Merle anblicke, füllen sich ihre Augen mit Tränen. »Isa, du … du sagst bestimmt nichts, oder? Wenn Papa das rauskriegt, dass ich … dass ich schwanger bin, dann …« Sie lässt offen, was dann passiert.
Ich führe sie zur Liege. Wir setzen uns nebeneinander, und ich lege meinen Arm um sie. »Merle, du musst keine Angst haben. Ich sage nichts. Das darf ich gar nicht. Alles, was du hier erzählst, bleibt auch hier. Bist du denn ganz sicher, dass du schwanger bist? Hast du einen Test gemacht?«
Sie schnieft und nickt.
»Du solltest dir zur Bestätigung auf jeden Fall einen Termin bei deiner Frauenärztin geben lassen. Du warst doch bestimmt schon mal bei einer Frauenärztin?«
Merle schüttelt den Kopf. »Brauchte ich ja noch nie. Ich … ich nehm ja nicht die Pille.«
Ich muss mich zusammenreißen, um diese Äußerung nicht sarkastisch zu kommentieren. »Warum hast du dir denn nicht die Pille verschreiben lassen, wenn du mit einem Jungen intim wirst?«
»Ich wusste an dem Abend ja selbst nicht, dass wir … also, dass wir das tun. Es … ist einfach passiert. Jedenfalls einmal ohne Kondom.« Ihr Gesicht wird rot. »Danach haben wir immer ein Kondom benutzt.«
»Aber ein Kondom reicht doch nicht aus, Merle«, sage ich und versuche meine Stimme nicht vorwurfsvoll klingen zu lassen. »Ein Kondom ist niemals so sicher wie die Pille.« Ich seufze. »Aber darüber brauchen wir uns jetzt nicht mehr zu unterhalten.« Ich nehme ihre Hand. »Was genau hast du dir von deinem Besuch hier erhofft? Hat der Doktor dir noch einen Rat gegeben, bevor er … ohnmächtig wurde?«
»Nein.« Jetzt kullern die Tränen. »Ich … ich weiß ja selbst nicht, warum ich hierhergekommen bin. Ich … ich dachte vielleicht, dass Dr. Hollerbeck …« Sie bricht ab und weint.
Ich nehme ihre kalte Hand in meine und streichle sie. »Bist du vielleicht wegen eines Schwangerschaftsabbruchs hier, Merle?«
»Nein!« Sie wischt sich über die feuchten Wangen und sieht mich mit ihren großen blauen Augen an. »Nein, das will ich nicht! Ich … ich hab extra so lange gewartet.« Der letzte Satz klingt trotzig.
»So lange gewartet?«, hake ich nach.
Sie nickt. »So lange, dass es für eine Abtreibung zu spät ist. Jetzt kann mein Vater mich nicht mehr zwingen, das Baby … wegzumachen. Ich bin schon im fünften Monat.«
Mein Blick wandert zu ihrem Bauch. Sie trägt Strumpfhosen und ein Langarmshirt unter einem kurzen geblümten Jumpsuit, der nicht so locker über den Bauch fällt, wie er sollte. Lange wird sie die Schwangerschaft nicht mehr verbergen können. Mich interessiert aber eher das, was sie gesagt hat. Sie hat Angst, dass ihr Vater sie zwingt, das Baby abzutreiben?
»Vielleicht wolltest du ja, dass Dr. Hollerbeck mit deinen Eltern spricht?«, taste ich mich vor.
Als sie nickt und weinerlich die Unterlippe schürzt, sieht sie aus wie eine Zwölfjährige.
»Zwingen kann dich dein Vater sowieso nicht«, sage ich. »Aber du und deine Eltern, ihr solltet euch beraten lassen und dann gemeinsam überlegen, wie es mit deiner Ausbildung weitergehen soll.«
Merle läuft eine Gänsehaut über die Arme. Wie es weitergehen wird, scheint für sie von zweitrangigem Interesse zu sein. Sie hat einfach nur eine Scheißangst vor ihrem Vater.
»Wer ist denn der Vater des Babys? Ist es ein Junge aus dem Dorf? Weiß er es schon?«
Jetzt kullern die Tränen wieder, als sie nickt. »Er heißt Jamal.«
Das klingt nicht wirklich norddeutsch.
»Papa wird ihn umbringen«, schluchzt Merle. »Und mich auch.«
»Ist Jamal einer der Asylanten?«, frage ich vorsichtig.
Merle nickt wieder. Sie ist kaum zu verstehen, als sie antwortet: »Er kommt aus Eritrea. Er ist einer von den Flüchtlingen, die vor zwei Jahren hierhergekommen sind. Sein Asylantrag ist durch, und er will hierbleiben, in Elmfleth, bei mir. Hast du ein Taschentuch für mich?«
Ich stehe auf und reiße zwei Stücke von der Küchenrolle ab, mit der wir das Ultraschallgel entfernen, und reiche sie ihr. Sie schnäuzt sich kräftig, während ich mir vorstelle, wie Bernd Meyer auf die Nachricht reagieren wird, dass er von seiner siebzehnjährigen Tochter ein Enkelkind bekommt. Ein cappuccino- bis mokkabraunes.
»Papa schlägt mich tot.«
»Quatsch«, sage ich voller Inbrunst. »Dein Vater wird nicht begeistert sein, dass du mit siebzehn und mitten in der Ausbildung schwanger bist, aber es wird für ihn keinen Unterschied machen, ob sein Enkelkind weiß- oder dunkelhäutig ist. Er macht sich für unsere Flüchtlinge doch immer stark.« Ich streichle ihre heiße Wange.
Merle lacht auf. Es ist ein verzweifeltes Lachen. »Du kennst meinen Vater nicht wirklich.«
Jetzt wird mir doch ein bisschen mulmig. Bernd Meyer ist schon im Normalzustand kein umgänglicher Typ. Vielleicht hat Merle recht, und er wird ausrasten? Ich atme tief aus. Ich kann Merle mit ihren Sorgen nicht allein lassen.
»Möchtest du, dass ich dabei bin, wenn du es deinen Eltern sagst? Dann kann ich ihnen auch gleich erklären, wo ihr euch Unterstützung und Beratung holen könnt. Deine Mutter kann dich ja vielleicht zur Frauenärztin begleiten. Was meinst du?«
Ihr »Ja!« kommt wie aus der Pistole geschossen. Vermutlich hofft sie, dass ihr Vater nicht die Schrotflinte holt, wenn jemand Fremdes dabei ist. Ich hoffe das auch.
Der Gedanke an das bevorstehende Gespräch mit Bernd Meyer kommt wieder, als ich meiner Oma im Seniorenheim Sünnschien, das wenige Kilometer von unserer Pension entfernt liegt, gegenübersitze, denn auch sie hat die schlechte Laune gepachtet. Sie residiert in einem Sessel mit gestrickten Deckchen auf den Armlehnen, die in keiner Weise abgeschabt sind, eben weil wohl seit ewigen Zeiten die Schoner darauf liegen. Ich hocke auf einem der beiden Nussbaumstühle am kleinen Tisch.
»Füttert ihr Karlchen auch ordentlich?« Wenn sie von ihrem Kater spricht, wird ihre Stimme ein wenig milder. »Du weißt ja, Luisa, am liebsten mag er Wildhäppchen in Soße.«
»Ja, natürlich. Er ist so fett wie eh und je. Mama hat ihm sogar von dem Streuselkuchen gegeben.« Ich deute auf ihren Teller.
Sie grunzt und teilt mit der Gabel ein Stückchen vom Kuchen ab. Ein paar Krümel fallen auf ihren in Pastellfarben gestreiften Pullover, den sie zu einer kakigrünen Cordhose trägt. Nicht einmal das zarte Rosa und Mint des Pullis lassen ihr herbes Gesicht weicher erscheinen. Ihr glatter grauer Kurzhaarschnitt mit dem rasierten Nacken tut ein Übriges, um sie fast männlich erscheinen zu lassen. »Die Streusel sind hart«, murrt sie und kaut von links nach rechts und zurück, als hätte sie den Mund voll mit Betonkrümeln. »Ich lass den Kuchen bis morgen stehen, dann ist er wohl genießbar.«
»Mach das, Oma«, sage ich abwesend, weil mein Blick auf das Kreuzworträtsel auf dem Tisch gefallen ist. Ich sehe schwarz für den End-Lösungsbegriff. Oma hat unter Mittelmeerstaat statt Malta Miami eingetragen, und unter südamerikanische Schlange hat sie die korrekt belegten ersten beiden As und das O zu Amazonas aufgefüllt.
»Luisa!« Sie spuckt ein paar Streuselkörnchen aus, während sie schimpft: »Wie oft muss ich dir noch sagen, dass du mich nicht Oma nennen sollst? Die Wände haben hier Ohren. Und wenn dieses impertinente Pflegepersonal mitkriegt, dass du mich Oma nennst, verlieren sie auch noch den letzten Funken Respekt. Ich möchte von dir Großmutter genannt werden.«
»Großmutter … warum hast du so große Ohren?« Ich kann mir diesen Satz leider nicht verkneifen, obwohl ich weiß, dass ich es bedauern werde.
Ich habe recht.
Meine Oma macht ein weinerliches Gesicht. »Wie soll mich hier jemand ernst nehmen, wenn nicht einmal meine einzige Enkelin, mein eigen Fleisch und Blut, mich respektvoll behandelt?«
Ihr Gesicht bleibt weinerlich. Eine Träne habe ich bei ihr allerdings noch nie gesehen, stelle ich gerade fest. »Ach, Om… Großmutter! Alle behandeln dich hier mit Respekt. Niemand duzt dich oder würde es wagen, dich Oma zu nennen.« Natürlich weiß ich, dass es Heime gibt, in denen das Pflegepersonal mit den Bewohnern nicht würdevoll umgeht, aber hier habe ich eine solche Behandlung noch nie erlebt.
Meine Oma grunzt. Das macht sie, wenn sie ihr Gegenüber einer Antwort nicht für würdig hält.
»Du mich auch«, murmle ich.
»Luisa, du musst deutlich sprechen. Ich habe dich nicht verstanden. Eine schlimme Angewohnheit ist das. Und du musst dich gerade halten. Das hast du von deinem Großvater geerbt. Das Bucklige färbt auch auf das Verhalten ab. Großvater Günter hatte am Ende auch dieses Kriechende. Schrecklich.«
Verschlucken sich alte Leute nicht manchmal an harten Kuchen? Und ersticken dann? Ich überlege, ob, und wenn ja, wann ich Hilfe holen würde.
»Ich glaube, ich sehe schon einen Buckel bei dir, Luisa.«
Ich denke, ich würde warten, bis sie zumindest blau angelaufen ist.
»Großmutter«, meine Stimme klingt deprimiert, »Opa Günni war doch gar nicht mein leiblicher Opa. Er war dein zweiter Mann. Also kann ich auch nichts von ihm geerbt haben.«
Opa Günni, den ich sehr geliebt habe, hatte tatsächlich einen Buckel. Und alte Fotos beweisen, dass er ihn definitiv vor der Heirat mit meiner Oma noch nicht hatte. Dass er vor achtzehn Jahren entschieden hat, sich mit einem Herzinfarkt still und heimlich von dieser Welt und insbesondere von seiner Frau zu verabschieden, ist für mich im Nachhinein nachvollziehbar.
Meine Oma grunzt erneut, bevor sie das angebissene Kuchenstück in die Allegra zurücklegt.
»Wie sieht es denn mit einem Mann aus, Luisa? Bist du etwa immer noch allein?«
Im Gegensatz zu Mama findet Oma es grässlich, dass ich solo bin. Bei jedem Besuch muss ich mir anhören, dass sie in meinem Alter längst verheiratet und meine Mutter auf der Welt war.
»Ich war in deinem Alter längst …«
»Ja, Oma, ich weiß«, falle ich ihr ins Wort.
»Wenn sich doch noch mal einer erbarmt, ist es hoffentlich jemand, der dich ein bisschen an die Kandare nimmt. Du brauchst eine starke Hand. Für dein fortgeschrittenes Alter bist du einfach noch viel zu kindisch.«
Ich befürchte einen weiteren ellenlangen Vortrag, wie ich zu einem Mann komme, aber das Schicksal meint es gut mit mir. Es schickt eine kleine weißhaarige Dame ins Zimmer meiner Oma. Sie hat nicht geklopft, ist einfach hereingekommen, ohne die Tür wieder zu schließen. Sie sagt keinen Ton, sondern sieht uns kurz an und geht dann an das Fenster, um hinauszuschauen. Ich kenne sie nicht, aber ich bin ihr sehr dankbar für ihr Auftauchen, denn meiner Oma ist die nächste Bemerkung im Hals stecken geblieben. Empört streckt sie ihren Zeigefinger in Richtung alte Dame aus und ruft: »Also! Das … das ist ja … Sie verschwinden jetzt auf der Stelle aus meinem Zimmer! Hören Sie?« Im gleichen Moment greift sie nach der Klingel auf dem Beistelltisch neben ihrem Sessel und drückt darauf herum, als würde sie im Morsealphabet SOS funken.
Ich stehe auf und gehe zu der kleinen Dame mit den weißen Löckchen – so stelle ich mir eine Oma vor – ans Fenster. »Kann ich Ihnen helfen?«
Sie sieht mich an, dann wieder aus dem Fenster. »Beate kommt gleich. Ich schaue, ob sie gleich da ist.«
Wir blicken beide aus dem Fenster. Aber niemand, der ausschaut wie eine Beate, ist zu sehen. Nur zwei alte Männer und ein Pfleger laufen vor dem Haus herum.
Meine Oma zetert noch, als eine Pflegerin hereinkommt und mich freundlich anlächelt. »Entschuldigen Sie«, sagt sie zu mir und nimmt den Arm der alten Dame. »Kommen Sie, Frau Magens, ich bringe Sie in Ihr Zimmer zurück. Sie sollen doch nicht immer weglaufen. Schauen Sie, die Frau Waltersheim ist schon ganz böse, weil Sie sie und ihren Besuch hier stören.«
Omas »Allerdings!« und mein »Das macht doch nichts« erklingen zur gleichen Zeit.
»Wer war das?«, frage ich meine Oma, als sich die Tür hinter der Pflegerin und der alten Dame schließt.
»Die alte Magens. Die ist …«, Oma macht kreisende Bewegungen mit dem Finger neben ihrer Stirn, »ballaballa. Das war jetzt schon das zweite Mal, dass sie einfach in mein Zimmer platzt. Mit ihren widerlichen flinken Beinchen rennt sie tagein, tagaus über den Flur und in fremde Zimmer und redet Unsinn und hält Ausschau nach ihrer Tochter, die lange tot ist. Eine Verschwendung ist das – kann laufen wie ein Wiesel, aber das Oberstübchen müsste dringend renoviert werden.«
Ich streichle über die Beine meiner Oma. Das linke Bein ist nach einem Schlaganfall lahm. Natürlich beneidet sie die alte Frau Magens, weil die ihre Beine noch gebrauchen kann, aber … »Glaubst du nicht, dass die alte Dame gern mit dir tauschen würde, Großmutter? Immerhin ist dein Gehirn voll funktionstüchtig … Das Kreuzworträtsel vergessen wir mal.« Den letzten Satz habe ich natürlich gemurmelt.
»Pah! Keine Privatsphäre hat man in diesem Kasten. Ich hoffe, deine Mutter ist bald wieder so weit hergestellt, dass ich nach Hause kann. Ich werde es ihr sowieso nie verzeihen, dass sie mich hier reingesteckt hat.«
Ich seufze. Wie kann sie nur so verbohrt sein? Mama hat Oma, als die vor drei Jahren den Schlaganfall erlitt, zu uns geholt. Sie umsorgt sie mehr als fürsorglich. Aber als Mama von der Leiter fiel, gab es keine andere Möglichkeit, als Oma in die Kurzzeitpflege zu geben. »Es ist doch nicht für immer«, sage ich. »Wenn Mama von der Reha zurück ist, holen wir dich nach Hause.«
Als Oma grunzt, beschließe ich, dass es an der Zeit ist zu gehen. Grunzen und Murmeln sind einfach keine gute Grundlage für Konversation. Ich lege Oma das Kreuzworträtsel auf den Schoß und küsse sie zum Abschied auf die schlaffe Wange.
3
Auch wenn sich Nachrichten, insbesondere schlechte, tornadomäßig in unserem Ort verbreiten, ist die Tatsache, dass Onkel Hollerbeck im Krankenhaus ist, nicht zu jedermann durchgedrungen. Etliche Patienten treffen über den Vormittag verteilt ein, und Frau Lutter wird nicht müde, jedem Einzelnen die gestrigen Geschehnisse zu erzählen. Dabei dichtet sie von Stunde zu Stunde einiges dazu, wohl um der Tristesse beim Sichselbstzuhören zu entkommen. Poppy und ich wechseln uns mit Augenverdrehen ab und erledigen ansonsten unsere Arbeit. Wir nehmen Urinproben entgegen, messen Blutdruck, sortieren den Medikamentenschrank und erledigen den Schreibkram, zu dem Frau Lutter vor lauter Erzählen nicht kommt.
Als Heiner Holler die Praxis betritt, kommt mir der Gedanke, dass wir Elmflether für unsere geringe Einwohnerzahl einen doch hohen Anteil an schwarzhäutigen Dörflern haben. Heiner ist einer von ihnen. Er ist Anfang dreißig, stammt ursprünglich aus dem Kongo und hieß Tesfaye, als er als Einjähriger nach Elmfleth kam, als Adoptivsohn von Uwe und Katharine Holler, die am Dorfrand in einem Haus mit märchenhaftem Garten leben. Jette und ich waren als Kinder oft bei den Hollers, denn sie liebten es, den Dorfkindern ein offenes Haus zu bieten. Uwe Holler ist Künstler, und sie leben von seiner Arbeit als Maler und Bildhauer und von dem Geld, das Katharine mit ihrer Töpferwerkstatt verdient, die sie im Keller des Hauses betreibt. Sie sind tolle Leute, weltoffen, liebevoll und ein wenig exzentrisch. Sie würden es niemals zugeben, aber ich vermute, dass es ihnen einen mächtigen Stich versetzt hat, als Heiner sich für eine spießige Laufbahn als Finanzbeamter entschied. Er lebt mit seinem Freund Lennart im ausgebauten Obergeschoss des Hollerschen Hauses. Dass er schwul ist, hat die Hollers vermutlich mit seiner Beamtenlaufbahn versöhnt.
»Moin, Luisa«, begrüßt Heiner mich. Er will mich ärgern. Er weiß ganz genau, dass ich lieber Isa genannt werde.
Natürlich erwartet er eine Reaktion, die er auch bekommt. »Hallo, Black Beauty.«
Frau Lutters Augenbrauen ziehen sich zusammen, aber sie sagt nichts. Sie kennt unseren Humor mittlerweile, denn Heiner kommt vierteljährlich vorbei, um seine Rezepte abzuholen. Er ist seit seinem zehnten Lebensjahr Diabetiker. Außerdem ist es nicht gelogen, wenn ich Heiner Black Beauty nenne. Er ist ein schöner Mann, groß und schlank. Seine Augen sind nachtschwarz wie seine Haut und das Haar. Sein weißes Gebiss ist perfekt, und er kleidet sich immer nach der neuesten Männermode. Noch ein Gräuel für seinen Vater, der wallende Gewänder und Kittel bevorzugt. Mir gefällt Heiners Modetick. Ab und an tauschen wir Schals aus.
Heiner grinst mich an. »Alle Gäste rennen aus der brennenden Pension, nur nicht Isa Hofa, die schläft auf dem knisternden Sofa.«
Als Kinder und Jugendliche haben wir uns diese Reime zu Dutzenden um die Ohren gehauen. Heiner und ich machen es immer noch, wenn wir uns sehen.
Ich muss nicht lange nachdenken, denn wir legen uns immer schon einen Spruch parat für das nächste Zusammentreffen. »Alle Finanzbeamten sind unbestechlich, nur nicht Hein, der nimmt jeden Schein.«