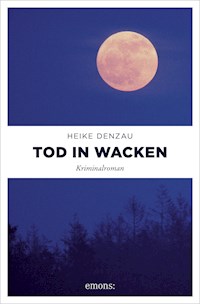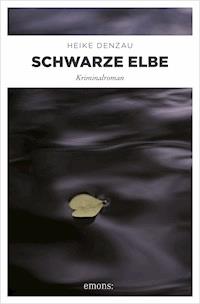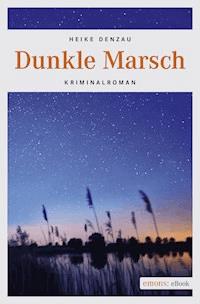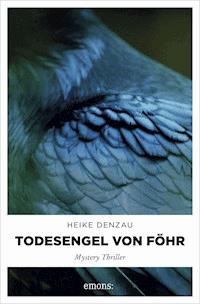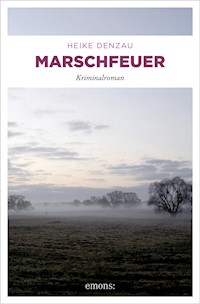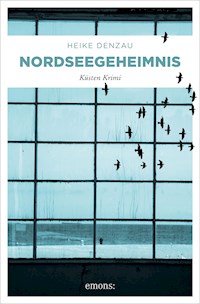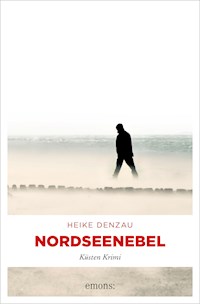
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Küsten Krimi
- Sprache: Deutsch
Raphael Freersen liebt Frauen, Boxen und das Nichtstun. Als sein vermögender Vater ihm den Geldhahn zudreht, ist er allerdings gezwungen, sich seinen Lebensunterhalt selbst zu verdienen. Er reist nach Föhr, um das Erbe seines verstorbenen Onkels anzutreten: eine Detektei. Raphael hatte eigentlich nicht vor, Ermittler zu spielen, doch beim Durchsehen der Akten stößt er auf den Fall der verschwundenen Dalika Gorden, der ihn nicht mehr loslässt. Lebt die schöne Einheimische noch? Oder wurde sie womöglich ermordet?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 452
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Heike Denzau, Jahrgang 1963, ist verheiratet, hat zwei Töchter und lebt in dem kleinen Störort Wewelsfleth in Schleswig-Holstein. Beim KrimiNordica Award 2015 erlangte sie den zweiten Platz in der Kategorie »Story«. Ihr Kriminalroman »Die Tote am Deich« war nominiert für den Friedrich-Glauser-Preis 2012 in der Sparte »Debüt«. Es folgten zahlreiche Kriminalromane. Heike Denzau veröffentlicht außerdem humorvolle Liebesromane.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind bis auf wenige Ausnahmen frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
Lust auf mehr? Laden Sie sich die »LChoice«-App runter, scannen Sie den QR-Code und bestellen Sie weitere Bücher direkt in Ihrer Buchhandlung.
© 2019 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: fotolia.com/helmutvogler
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Hilla Czinczoll
eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-465-0
Küsten Krimi
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Für Ralf
Vorüber die Flut.Noch braust es fern.Wild Wasser und obenStern an Stern.
Aus »Am Strande«von Rainer Maria Rilke
Prolog
»Oh Gott! Dali? … Dalika!« Er beugte sich zu der jungen Frau hinunter, aber noch bevor seine Hand ihren Körper berührte, zog er sie hastig wieder zurück.
Blut suchte sich den Weg durch ihr blauschwarzes Haar, wurde zu einem Rinnsal und sammelte sich auf dem Bongossi-Holz der Terrasse zu einer im Mondlicht funkelnden Pfütze.
Entsetzt richtete er sich auf und trat von ihr weg. »Dalika?«, stammelte er noch einmal.
Er bekam keine Antwort. Nur das leise Rauschen der Wellen war zu hören. Sanft plätscherten sie an den Nordseestrand. Monoton. Wie ein Totenlied.
EINS
Mit einem Stöhnen warf Raphael die Bettdecke von sich und öffnete die Augen. Okay, er war nicht zu Hause, so viel stand fest, denn an der Decke seines Schlafzimmers hing keine Bambus-Funzel. Langsam wandte er den brummenden Schädel und blickte in das Gesicht einer blonden Frau. Einer nackten schlafenden Frau, deren Mund leicht offen stand. Aus dem Mundwinkel verlief eine Spur angetrockneten Speichels Richtung Kinn, und unter den Lidern bildete verschmierte Wimperntusche einen gräulichen Rand. Kein schöner Anblick, aber Raphael war sich sicher, dass er nicht besser aussah. Stöhnend fuhr er sich durchs Haar, während er mit der pelzigen Zunge über seine Lippen glitt.
Elena … Elisa … Eli… Ihr Name wollte ihm nicht einfallen. Fest stand: Er hatte Blondie am vergangenen Abend im Klähblatt Pub am Flensburger Hafen aufgerissen, nachdem er bereits diverse Whiskys in sich reingeschüttet hatte. Sie war höchstens fünfundzwanzig und wahrscheinlich eine der Studentinnen, die Flensburg zu Hunderten bevölkerten.
Er ließ seinen Blick über ihre Brüste wandern. Nun, selbst in besoffenem Zustand konnte er sich auf seinen Geschmack verlassen. Ihre Figur war perfekt, und wahrscheinlich hatten sie sich bestens amüsiert. Erinnern konnte er sich nur dumpf daran. Er blickte noch einmal auf ihren Mund. War es wirklich nur Speichel, was da angetrocknet an ihrem Kinn haftete?
Als er sich umdrehte, um nach seiner Armbanduhr und dem Smartphone Ausschau zu halten, bewegte Eli-Irgendwer sich neben ihm. Er nahm sein Handy, das auf dem Boden lag, und drehte sich zu ihr um.
Himmelblaue Augen blickten ihn an. »Raphi.« Sie lächelte, und der trockene Speichel bekam Risse, während ihre Hand seinen nackten Brustkorb streichelte. »Wollen wir zusammen frühstücken? Ich koche Kaffee und –«
»Shit!«, fuhr er ihr über den Mund, auf die Zeitanzeige seines Smartphones starrend. Es war zwanzig vor elf! Und der Termin mit Notar Dr. Andresen im Haus seiner Eltern war um elf Uhr. »Fuck!« Er sprang aus dem Bett, fischte seine Klamotten im Zimmer zusammen und zog sich an, während die Stimme seiner Mutter durch seinen malträtierten Kopf hallte: Sei wenigstens dieses eine Mal pünktlich, Raphael. Mir zuliebe …
»Was ist denn los, Raphi?«, fragte Blondie.
Er sah sie an, während er in das weiße Hemd schlüpfte. »Ich hab einen Termin verpennt, und tu mir einen Gefallen: Nenn mich nicht Raphi.«
Ihre Mundwinkel kippten. »Heute Nacht hat’s dir nichts ausgemacht.«
»Pass auf, Eli…sa«, riet er drauflos. »Ich war stinkbesoffen. Jetzt bin ich nüchtern. Und niemand nennt mich Raphi, wenn mein Blutalkoholwert unter zwei Promille liegt.«
Ihre feinen blonden Augenbrauen zogen sich zusammen. »Ich heiße Rieke.«
Er hielt beim Zuknöpfen des Hemds kurz inne. Dann lächelte er strahlend, dass seine weißen Zähne blitzten, und zwinkerte. »Ja, klar, weiß ich doch. Wie komm ich denn auf Elina?«
»Du sagtest Elisa.«
Er lächelte einfach weiter.
»Rufst du mich an?«, fragte sie, während sie ein Glitzertop vom Boden aufsammelte, hineinschlüpfte und an ihm vorbei zu einer Kommode ging. Sie nahm einen String heraus und drehte sich wieder zu ihm um. Ihr Brazilian Cut verschwand unter dem winzigen Stück Stoff, als sie hineinschlüpfte.
Raphael löste den Blick von ihrem Intimbereich und sah ihr in die Augen. »Ja, klar.« Er griff sein Smartphone und wählte die Nummer seines favorisierten Taxiunternehmens. »Freersen«, meldete er sich. »Ich brauch schnellstens ein Taxi in die …« Er sah Rieke an, die ihre Telefonnummer auf einen Notizzettel kritzelte. »Wo sind wir hier?«
»Friesische Straße.«
Er nannte die Straße und die Hausnummer, die sie hinterwarf, und beendete das Gespräch mit einem »Danke«.
»Hier, meine Handynummer«, sagte sie und hielt ihm den Zettel hin, während er seine Armbanduhr umlegte, zum Flur eilte und seine Sneakers anzog. Er riss ihr den Zettel aus der Hand, sammelte seine Lederjacke vom Boden des Flurs auf und sah sie an. »Ja, dann … bis dann.«
Er übersah ihren gespitzten Mund und drückte seine Lippen kurz auf ihr verwuscheltes Haar.
Die hölzernen Treppenstufen knarzten, als er nach unten hastete. Das Taxi war noch nicht da. Er nutzte die Wartezeit und klemmte ihren Zettel hinter die Windschutzscheibe eines rostigen Fiestas.
»Du Arschloch!«
Raphael blickte die Hausfront hoch. Rieke stand auf einem kleinen Balkon und sah zu ihm runter. Er ging in Deckung, als sie mit beiden Händen in einen bepflanzten Blumenkasten griff und Sekunden später bunte Sommerblumen neben ihm auf dem Boden aufschlugen. Dankbar, dass das Taxi in diesem Moment um die Ecke bog und vor ihm hielt, zog Raphael die Autotür auf. Doch noch während er einstieg, landete eine Geranie samt Wurzeln und Erde direkt auf seiner Brust.
»Arschloch«, schrie sie noch mal und warf Erde nach ihm, weil keine Pflanzen mehr im Kasten waren.
Raphael schüttelte die Geranie und den größten Teil der Erde vor der offenen Autotür ab und zog sie hastig zu.
Der Fahrer musterte ihn, guckte dann zum Balkon hoch. »Na, zielen kann sie ja, was?«
»Allerdings«, sagte Raphael. »Schnell weg.«
»Wo wollen Sie denn hin?«
»In den Marienhölzungsweg, bitte.«
Als sie vor dem Grundstück seiner Eltern ankamen, gab Raphael wegen der Erde, die auf dem Sitz und im Fußraum des Taxis gelandet war, ein mehr als großzügiges Trinkgeld.
Ein Blick auf die Armbanduhr verriet, dass es zwei Minuten nach elf war. Auf eine Dusche würde er verzichten müssen, aber zumindest das verdreckte Hemd musste er noch wechseln, bevor er der versammelten Familie und dem Notar im Esszimmer unter die Augen treten konnte. Sein Vater würde wegen der Verspätung die buschigen grau melierten Augenbrauen zusammenziehen, sich aber erst darüber auslassen, nachdem der Notar gegangen war. Hans-Joachim Freersen, der Kaffeekönig von Flensburg, würde niemals vor einem Nichtfamilienmitglied die Beherrschung verlieren.
Der Kies knirschte unter seinen Füßen, als Raphael den Weg zu der prächtigen Stadtvilla im Laufschritt nahm. Die Augustsonne schien vom Himmel und hatte den Rasen links und rechts des Weges über die Wochen verdorren lassen. Obwohl seine Eltern es gern perfekt hatten, war ihr Öko-Bewusstsein diesmal stärker gewesen, und sie hatten auf das Sprengen verzichtet.
»Hallo, Onkel Raphael. Du kommst viel zu spät«, hallte es neben ihm aus dem Gartenbeet.
Er wandte den Kopf. Zwei blonde Schöpfe waren hinter einem Busch zu erkennen. Die Brut seiner Schwester.
»Ich hab euch schon tausendmal gesagt, dass wir im 21. Jahrhundert leben«, rief er den Jungen zu. »Also sagt gefälligst nicht Onkel Raphael. Das ist furchtbar.«
»Aber Papa und Mama haben gesagt, dass wir das sagen sollen«, rief der Kleinere der beiden zurück.
»Die sind ja auch so antiquiert wie die Standuhr in der Bibliothek«, murmelte Raphael, nahm die Eingangsstufen im Laufen und öffnete den rechten Flügel der Haustür. Als er eintrat, verstummten die Gespräche in der kleinen Halle.
Raphael starrte in die Gesichter seiner Familie und des Notars.
Wieso waren die noch nicht im Esszimmer?
»Sorry«, sagte er und setzte sein strahlendes Lächeln auf. »Ich weiß, dass ich ein wenig zu spät bin, aber ich bin in zwei Minuten bei euch.«
Der Kontrast seines Lächelns zu den ernsten Gesichtern musste kolossal sein. Seine Schwester Eva hielt die große Nase wie immer etwas zu hoch, während ihr Mann Olaf, der hinter ihr stand, den Mund spöttisch verzog. Die Lippen seiner Mutter zitterten, während sie fahrig eine Strähne ihrer perfekt sitzenden Frisur hinter das Ohr strich, an dem eine Perle dezent schimmerte. Neben ihr wippte der Notar auf seinen Füßen, die silbergefasste Brille den Nasenrücken hochschiebend.
Raphaels Blick verharrte einen Moment in dem seines Bruders Johannes, der einen grauen Anzug trug, ein weißes Hemd ohne Schlips und hervorragend aussah. Da sie eineiige Zwillinge waren, musste es umso mehr auffallen, wie schäbig er selbst daherkam.
Sein Bruder verzog die Lippen. Allerdings nicht hämisch, sondern wohl, um ihn vorzuwarnen. Dicke Luft … Raphael nickte ihm zu und suchte den Blick seines Vaters.
Hans-Joachim Freersen, das stand fest wie das Amen in der Kirche, war kurz vorm Platzen. Wegen drei Minuten Verspätung? Raphael musste sich zusammenreißen, um nichts Falsches zu sagen. Hoffentlich war die Verlesung des Testaments zügig abgehakt. Umso schneller konnte er hier wieder verschwinden und sein Leben in London leben.
»Es reicht, Raphael«, sagte Hans-Joachim Freersen. Er sprach leise, aber seine Stimme bebte. »Es reicht.«
»Meine Güte, diese paar Minuten, Vater«, begann Raphael. »Fangt doch einfach schon mal an. Ich bin ja gleich bei euch …«
»Fangt doch an?«
Raphael klappte der Mund auf. Hatte er seinen Vater jemals so schreien hören? Wenn ja, musste es ewig her sein.
»Wir haben angefangen!«, schrie Hans-Joachim Freersen. Speichel sprühte aus seinem Mund, während er zwei Schritte auf Raphael zutrat. »Pünktlich! Um zehn Uhr! Und alle waren da. Nur der große Zampano hatte es ja mal wieder nicht nötig!«
Zehn Uhr? Raphael sah zu seiner Mutter, die mit Tränen in den Augen ihrem Mann eine Hand auf den Arm legte. »Hajo, bitte.« Ihre Stimme wurde leiser. »Herr Dr. Andresen ist noch hier.«
»Dr. Andresen kann das ruhig hören«, schrie Hans-Joachim Freersen weiter. Sein Gesicht nahm eine ungesunde Rötung an, während er noch einen Schritt auf Raphael zutrat. »Er kann hören, wie ich dich vor die Tür setze! Er kann hören, dass du … dass du«, er suchte nach den richtigen Worten, »ein Versager bist! Ein Schnorrer! Ein … ein Niemand!« Er wurde nicht leiser. »Du bist die größte Enttäuschung meines Lebens!«
In die sekundenlange Stille ertönte das Schreien der Papageien aus dem Esszimmer – zwei der extravaganten Haustiere, die es im Hause Freersen gab.
»Vater.« Es war Johannes, der sich einschaltete. Er trat neben Hans-Joachim Freersen, legte eine Hand auf dessen Schulter und sagte mit ruhiger Stimme: »Lass es gut sein. Du solltest dich erst mal beruhigen. Und dann klären wir das. Raph hat bestimmt einen guten Grund«, sein Blick wanderte kurz über Raphaels knittriges, von Erde verdrecktes Hemd, »warum er nicht ganz pünktlich war.«
Hans-Joachim Freersen schüttelte Johannes’ Hand von der Schulter ab. »Vielleicht solltest du aufhören, diesen Nichtsnutz, auch wenn er dein Zwillingsbruder ist, immer und immer wieder in Schutz zu nehmen! Ich werde das jetzt jedenfalls nicht mehr durchgehen lassen.«
Er wandte sich wieder Raphael zu: »Wenigstens deiner Mutter zuliebe hättest du heute einmal pünktlich sein können. Ist es denn zu viel verlangt, einmal nicht an dich zu denken, sondern an sie? Doch statt den letzten Willen deines Onkels zu respektieren, treibst du dich in irgendwelchen Spelunken rum. Mit deinen ominösen Boxkumpanen und … mit Weibern.«
Sein Blick glitt abfällig an Raphael herunter. »Du siehst aus, als hättest du die Nacht in der Gosse verbracht. Aber«, seine Augen glänzten, »vielleicht ist das auch gut so, denn dann bist du schon mal daran gewöhnt. Ich werde dir den Geldhahn zudrehen. Sofort. Hier und heute. Sieh zu, wie du klarkommst. Wenn du zur Abwechslung mal arbeiten musst, um dein Geld zu verdienen, wird dein Leben ja vielleicht noch mal einen Sinn bekommen.«
»Hajo, bitte!« Frauke Freersen griff nach dem Arm ihres Mannes.
»Ich … werde mich dann verabschieden«, erklang die helle Stimme des Notars. »Sie, äh, können Ihren Sohn ja von seinem Erbe unterrichten.« Er hielt Hans-Joachim Freersen die Hand hin.
Der schüttelte sie mit hochrotem Kopf, nicht in der Lage, auch nur ein Wort herauszubringen.
»Vielen Dank, Herr Dr. Andresen«, verabschiedete Frauke Freersen den Notar und öffnete die schwere Eichentür mit dem Glaseinsatz für ihn. »Auf Wiedersehen.«
Raphael starrte seinen Vater an. »Jetzt mach mal halblang, Vater. Ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ich war von elf Uhr ausgegangen und –«
»Glaubst du, es geht hier nur um diesen verpassten Termin?«, schrie sein Vater. »Das ist doch nur einer von Hunderten. Nur ein Tropfen Dreck im Sumpf deines Schmarotzerlebens.« Er hustete, weil er sich an seinem Speichel verschluckte.
Raphael hätte seinem Schwager Olaf am liebsten die Gurgel umgedreht, als der von hinten an Hans-Joachim Freersen herantrat, ihm auf den Rücken klopfte und besorgt fragte: »Geht es, Schwiegervater?«
»Ich schmarotze nicht, sondern mache in London meine Arbeit in der Firma. Sam Wright kann dir bestätigen, dass ich –«
»Wright?«, fuhr Hans-Joachim Freersen ihm über den Mund. Er klang, als würde er jeden Moment wieder loshusten müssen, und doch waren seine Worte gut zu verstehen. »Samuel Wright kann sich glücklich schätzen, wenn ich ihm nicht kündige, und ich bin noch nicht sicher, ob ich das nicht doch noch tun werde. Du wirst keinen Fuß mehr in unsere Londoner Niederlassung setzen. Und weißt du, wie sich das auf unseren Umsatz auswirken wird? Gar nicht! Du wirst dort genauso wenig fehlen wie ein Fuchs in einem Hühnerstall.«
In Raphaels Brummschädel begann eine Alarmsirene, schrill zu läuten. Das hier war eindeutig anders als die üblichen Tiraden seines Vaters. Er schien es wirklich ernst zu meinen.
Bevor Raphael zu einer Verteidigungsrede ansetzen konnte, setzte Hans-Joachim Freersen seine Standpauke schon fort.
»Glaubst du denn wirklich, ich erfahre nicht, was ihr da in London treibt? Dass ihr, du und Wright, die Abende in den Nachtclubs verbringt und du erst gegen Mittag in der Firma auftauchst? Ich habe lange genug meine Augen davor verschlossen. Hab euch das durchgehen lassen, weil ich hoffte, dass du in London zur Besinnung kommst und zu einem wertvollen Mitglied des Familienunternehmens wirst.« Er hustete noch einmal. »Aber ich habe mich getäuscht.«
Er drehte sich zu Johannes um. »Sag ihm, was er bezüglich des Testaments wissen muss.« Dann wandte er sich noch einmal an Raphael. »Das Erbe deines Onkels wird alles sein, was du bekommst. Und wer weiß, vielleicht pustet dir der frische Nordseewind deinen verlebten Kopf mal so frei, dass du doch noch in akzeptable Gesellschaft zurückfindest. Bis es so weit ist, erwarte von mir keinen Cent mehr.«
Mit diesen Worten wandte er sich ab und ging die geschwungene Treppe hinauf. Frauke Freersen warf Raphael einen traurigen Blick zu, bevor sie ihrem Mann hinterhereilte.
Dass seine Mutter sich so gar nicht für ihn einsetzte, erschütterte Raphael. Es war absolut untypisch für sie.
»Das hast du dir selbst zuzuschreiben.«
Diese Worte aus dem Mund seines Schwagers ließen Raphael rotsehen. Er trat auf ihn zu, blickte von seinen eins dreiundneunzig auf den Kleineren herunter und packte ihn an der silbergrau gestreiften Krawatte. »Du Schleimbeutel solltest mal schön die Fresse halten. Wenn du meine Schwester damals nicht geschwängert hättest, würdest du viel kleinere Brötchen backen.«
»Raphael!« Eva Freersen-Hobel krallte ihre dezent lackierten Nägel in die Hand ihres Bruders. »Lass ihn sofort los. Sofort!«
»Pff!« Raphael löste die Finger aus dem Schlips seines Schwagers und trat zurück.
»Komm mit ins Esszimmer.« Es war Johannes, der ihn am Arm packte und von den anderen wegzog.
»Meine Güte«, sagte sein Bruder, als er die Tür des Zimmers hinter sich zugezogen hatte und Raphael ansah. »Das war hart. Nimm es Vater nicht übel. Er ist einfach –«
»Bitte!«, unterbrach Raphael ihn. »Wir wissen beide, dass er jedes Wort genau so meint, wie er es gesagt hat. Also spar dir deine Predigt für die Kanzel auf. Und jetzt sag mir, was Onkel Schorsch mir vererbt hat. Kann ich mir davon die Wohnung in London leisten?«
Johannes musterte sein Ebenbild ernst. »Definitiv nicht. Aber unter der Brücke schlafen musst du trotzdem nicht. Onkel Schorsch hat uns beiden sein Doppelhaus vererbt. Dir gehört die linke Hälfte, mir die rechte.«
»Hä?« Raphael starrte seinen Bruder an. »Du meinst hoffentlich nicht die alte Bruchbude auf Föhr?«
Johannes grinste. »Genau die.«
***
Raphael atmete tief ein und aus, als er den Boxclub betrat. Die abgestandene Luft, in der sich die Aromen von Schweiß und Staub und Undefinierbarem tummelten, tat gut. Er freute sich darauf, sich die Seele frei zu boxen. Hoffentlich war ein Sparringspartner da.
»Hi, Grumpy«, begrüßte er den Besitzer der Location, der dabei war, einem jungen Türken in die Boxhandschuhe zu helfen.
»Raph!« Gregor Denger verzog die dünnen Lippen zu einem herzhaften Lachen, sodass die Zahnlücke im Oberkiefer zur Geltung kam. »Bin hier gleich fertig. Hol dir solange bei Sunny einen Kaffee ab.« Er nickte zur Seite, wo sich ein kleiner Tresen befand.
Raphael ging zu der jungen Frau, die In-Ears trug und eine Melodie summend an der Kaffeemaschine hantierte. Er tippte ihr über den Tresen auf die Schulter.
Sie zuckte zusammen und schnellte herum. »Raph!«, stieß sie freudig aus und zog sich die Stöpsel aus den Ohren.
»Hallo, Sonnenschein.«
Sie umrundete den Tresen. »Es ist ewig her.«
»Drei Monate sind doch keine Ewigkeit«, sagte er lächelnd, nahm ihren Kopf in beide Hände und küsste sie. Als er ihre Zunge an seinen Lippen spürte, löste er seinen Mund schnell.
Sunny verzog schmollend die Lippen. »Irgendwann wirst du mich richtig küssen, oder?«
»Natürlich. Sobald ich den Wunsch verspüre, sterben zu wollen.«
»Die richtige Antwort, Kumpel«, lachte neben ihm Gregor Denger auf. »Und du, mein Schatz«, wandte er sich an Sunny, »provozier ihn nicht immer.« Er setzte sich auf einen der klapprigen Holzbarhocker. »Du weißt doch, dass ich Raphael nicht am Leben lassen kann, wenn er dir seine Zunge in den Hals steckt.« Grinsend zeigte er noch einmal seine Zahnlücke. »Ich weiß schließlich, wo die schon überall war.«
Raphael lachte, während Gregors Tochter die Augen verdrehte und wieder hinter dem Tresen verschwand, um die Kaffeemaschine weiter zu befüllen.
Raphaels Blick wanderte zu dem Türken, der sich warm machte, dann weiter zum Ring. Die beiden boxenden Männer erkannte Raphael trotz des Kopfschutzes, den sie trugen. Es waren zwei der Rocker, die einen Großteil der Klientel in Grumpys kleinem privatem Boxclub ausmachten. Dann fiel sein Blick auf einen durchtrainierten blonden Riesen, der sich an einem Sandsack abrackerte. »Wer ist der Zwei-Meter-Mann, Grumpy?«
Gregor griente. »Das ist Morten, ’n Däne. Den geb ich dir als Trainingspartner, sollte sich deine Zunge doch mal aus Versehen im Mund meiner Tochter verirren.«
»Lass mal gut sein. Ich bin nicht mehr so gut in Form, seit ich nicht mehr regelmäßig trainiere. Was ist mit dem Türken? Ist der was für mich?«
Grumpy nickte. »Mehmet ist immer für ’nen kleinen Fight zu haben. Willst du noch einen Kaffee trinken oder dich gleich warm machen?«
Raphael griff nach seiner Sporttasche. »Ich werd erst mal die Maisbirne platt hauen. Wenn mir irgendwas diesen Scheißtag noch versüßen kann, dann ein paar Runden, in denen ich mich richtig auspowern kann.«
»Ärger?«
Raphael nickte. »Mein Alter ist der Meinung, dass ich mein Schwarzes-Schaf-Image überstrapaziert habe.«
»Und das bedeutet?«
»Dass er mich mal kreuzweise kann. Ich hab meine Sachen gepackt, bin hierhergefahren und werde anschließend nach Föhr rüberschippern.«
»Hä?« Grumpy steckte sich einen der Kirschlollis in den Mund, die auf dem Tresen standen. »Was willst du auf der Insel?«
»Überlegen, wie ich meinem Vater zeigen kann, dass ich auf sein Geld nicht angewiesen bin.«
Grumpy brach in schallendes Gelächter aus. Sunny stimmte mit ein.
»Äh …« Raphael starrte von der jungen Frau zu ihrem Vater.
Grumpy wischte sich eine Träne aus dem Augenwinkel. »Du willst ohne das Geld deines Alten klarkommen? Never!«
ZWEI
Raphael stand an der Reling der »Uthlande« und sah zu den Warften der Hallig Langeneß, die sich wie riesige Maulwurfshügel dunkel gegen den noch hellen Himmel abhoben. Die Fähre hatte pünktlich um zwanzig Uhr abgelegt. Er hatte schon die vorherige Fähre nehmen wollen, allerdings hätte er dann seinen Wagen in Dagebüll stehen lassen müssen, weil die Fähre ausgebucht gewesen war. So hatte er wohl oder übel warten müssen und auch nur das Glück gehabt, dass zwei Reservierungen nicht in Anspruch genommen worden waren.
Er zog ein Päckchen Zigaretten aus der Jackentasche, steckte sich eine an und inhalierte tief. Johannes und er hatten als Kinder oft eine Ferienwoche beim Onkel verbracht. Er erinnerte sich an heiße Sommer, Baden im Meer, Bauen von Sandburgen, Inselerkundungen auf dem Rad und dicke Schwarzbrotstullen mit Griebenschmalz.
Es war ewig lange her, dass er zuletzt auf Föhr gewesen war. Zwölf Jahre etwa. Er war so um die zwanzig gewesen. Ansonsten hatte er seinen Onkel Georg »Schorsch« Rickers nur bei Familienfeiern, die in Flensburg stattfanden, gesehen. Er hatte ihn gemocht. Vielleicht, weil sie sich ähnelten? Auch Schorsch hatte auf Etikette und dergleichen gepfiffen. Sein Geld hatte er mit allem Möglichen verdient, Hauptsache, es hatte nicht zu viel Arbeit gekostet. Es war nie viel übrig gewesen, das meiste war für Schnaps und Zigaretten draufgegangen. Und für Essen. Schorschs Plauze hatte einen beachtlichen Umfang besessen.
Letztendlich war sein Herzinfarkt für alle nicht überraschend gekommen. Immerhin achtundsechzig Jahre hatte der Onkel geschafft, bevor es ihn dahingerafft hatte.
Raphael zuckte zusammen, als sich etwas in seinen Rücken bohrte und eine weibliche Stimme sagte: »Rauchen verboten! Können Sie nicht lesen?«
Er drehte sich um und sah in das empörte Gesicht einer Endsiebzigerin in blauer Windjacke, die mit einer Gehhilfe vor seiner Zigarette herumfuchtelte.
»Wenn du mir noch einmal deine Krücke in den Rücken bohrst, Oma, schmeiß ich dich über Bord.« Er nahm einen weiteren genüsslichen Zug.
Sie schnappte nach Luft. »Unverschämtheit!« Vor sich hin schimpfend drehte sie bei und steuerte eine der Sitzbänke auf der gegenüberliegenden Seite an. Die übrigen Fahrgäste hatten von dem Intermezzo nichts mitbekommen. Die meisten hielten den Blick auf das Meer gerichtet, einige lasen, andere hielten die Augen geschlossen. Ein paar Kinder tobten durch die Bänke. Allen gemein war wohl, dass sie sich auf die Insel freuten.
Im Gegensatz zu ihm. Raphael war dankbar, dass er sich am Nachmittag noch im Boxring abreagiert hatte, sonst wäre die Oma vielleicht schon am Schwimmen. Der Familienkrieg am Morgen, die Wut auf seinen Vater und die Umstände, die ihn auf die Fähre gebracht hatten, wühlten in ihm. Insbesondere, weil er den Vorwürfen nichts entgegenzusetzen hatte. Der Kaffeekönig hatte recht. Er hatte in London nicht viel zum Nutzen der Firma getan.
Er nahm noch einen Zug und warf die Kippe in die Wellen. Eine Möwe flog schreiend an der Reling vorbei und ließ sich auf den Aufbauten nieder.
Er würde es seinem Vater zeigen. Er würde schon irgendwie klarkommen. Auf jeden Fall würde er nicht zu Kreuze kriechen, das stand fest. Diesen Triumph gönnte er seinem Vater nicht. Es konnte doch nicht so schlimm sein, mit weniger Geld auszukommen. Das mussten andere Leute schließlich auch. Und im Notfall konnte er Johannes anpumpen.
Vierzig Minuten später fuhr er mit seinem weißen Mercedes-Benz 300 SE von der Fähre. Der Oldtimer zog immer Blicke auf sich, und Raphael genoss es. Er liebte den Wagen.
Keine fünf Minuten später parkte er das Cabriolet in der Mühlenstraße gegenüber dem Haus seines Onkels – direkt hinter Schorschs silberfarbenem Renault Clio, der nun ebenfalls ihm gehörte. Mit einem verächtlichen Blick auf das rostige Auto stieg er aus und blieb vor der wild wuchernden Buchsbaumhecke stehen, steckte sich eine Zigarette an und ließ seinen Blick über das rot geklinkerte Fünfziger-Jahre-Haus wandern. Einzelne weiß gestrichene Holzbuchstaben über der Haustür ergaben das Wort »Friesen lück«. Raphael musste nicht überlegen, was es bedeutete, denn in seiner Erinnerung war das kleine G noch vorhanden. »Friesenglück«, murmelte er vor sich hin. Zu der Lücke passte das »Friesen lück« jedenfalls perfekt.
Efeu bedeckte die Hauswände größtenteils, und das war zweifellos von Vorteil, denn das Mauerwerk, das hervorblitzte, sah mehr als verwittert aus. Die hölzernen Fenster waren weißgrün gestrichen, doch die Farbe blätterte bereits ab. Ein neuer Anstrich war dringend nötig. Die Vorgärten der beiden Haushälften waren durch eine Buchsbaumhecke getrennt, die gepflegt aussah, genau wie die Hecke vor Johannes’ Hälfte zur Straße hin. Seine Hecke dagegen spross in alle Richtungen. Der Apfelbaum auf seiner Grundstückshälfte musste uralt sein, denn er erinnerte sich dunkel, dass er als Kind darauf herumgeklettert war. Der Baum hing voll mit grünen Äpfeln.
Toll! Er war jetzt also Besitzer einer verrottenden halben Spießerbude mit Spießervorgarten in einer Spießerstraße.
Hinter den Fenstern beider Haushälften war es dunkel. Johannes hatte ihm erzählt, dass er seine Haushälfte ab morgen bereits an Feriengäste vermietete – wie der Onkel es getan hatte. Jo hatte also schon gewusst, dass Onkel Schorsch ihnen die Hütte vererbt hatte.
Missmutig öffnete Raphael die schmiedeeiserne Gartenpforte zu seiner Haushälfte und ging den Weg über teilweise gebrochene Waschbetonplatten hinauf. Ein Zweig des Apfelbaums streifte sein Haar, und Raphael dachte daran, dass sein Onkel so klein wie breit gewesen war. Er hatte unter dem Zweig problemlos hindurchgehen können.
Er fummelte den Haustürschlüssel aus der Jackentasche. Ein Mini-Seehund aus Fell baumelte am Schlüsselanhänger. Seine Mutter hatte geweint, als sie ihm den Schlüssel ausgehändigt hatte. »Schorsch mochte Tiere«, hatte sie geschluchzt.
»Ja, am liebsten in der Pfanne gebraten.« Die Antwort war raus gewesen, bevor er es hatte verhindern können. Doch statt in noch größere Tränenbäche auszubrechen, hatte sie aufgelacht. »Ja, allerdings. Essen war seine Leidenschaft. Wie hat er Vegetarier noch genannt? Ach ja: körnerpickende Spaßbremsen.«
»Warst schon ein sympathischer Typ, Schorsch«, sagte Raphael in die Stille des Hauses, nachdem er eingetreten war und die Tür hinter sich geschlossen hatte. Er lauschte in die Leere hinein. Sollte der Geist seines Onkels hier noch verweilen, dann ohne Rasselkette. Die vollkommene Ruhe war irritierend. London schien Galaxien entfernt.
»Eventuell hättest du öfter lüften sollen«, murmelte Raphael und zog die Haustür wieder auf. Dann ging er durch die Räume des Erdgeschosses und öffnete sämtliche Fenster. Das heisere Kläffen eines Hundes drang herein.
Die Küche erinnerte ihn an seine WG-Zeit in der Studentenbude. Es gab ein Sammelsurium an Schränken, eine mit Kalkflecken verhunzte Spüle und einen Herd, der aussah, als hätten bereits die Neandertaler ihre Mammutkeulen darauf gebraten. Die alte Kaffeemaschine erntete ebenfalls einen verächtlichen Blick. Das Bad entpuppte sich als Alptraum in Dunkelgrün. Die Dusche befand sich in der Wanne.
Im Wohnzimmer gab es die übliche In-diesem-Haus-gab-es-nie-eine-Frau-Ausstattung: durchgesessene Couch, ein einziges Kissen darauf, Sessel, Couchtisch mit Kacheln, Nussbaumschrank, Stehlampe mit Fransenschirm, eingestaubtes Bücherregal und – Raphael strich ehrfurchtsvoll darüber – einen Röhrenfernseher.
Ein weiteres Zimmer hatte wohl als Arbeitszimmer gedient. Ungewöhnlicherweise standen zwei Schreibtische in dem kleinen Raum. Einer davon, Marke Ikea, war aufgeräumt. Ein Laptop stand darauf. Der andere Schreibtisch war aus dunkler Eiche und mit Schnitzereien versehen. Und vollgemüllt.
Raphael griff sich einen der Pappordner, die zu einem schiefen Turm gestapelt waren. »Fall Möhring«, stand dort in der krakeligen Handschrift des Onkels geschrieben. Raphael öffnete ihn und blätterte durch den Inhalt. Der Ordner enthielt eine Art Fragebogen und verschiedene Fotos von einem Mann und einer Frau, die die beiden in eindeutiger Situation zeigten. Raphael stieß ein »Holla!« aus. Der Typ auf dem Foto nagelte gerade eine Brünette auf einer Ledercouch. Anscheinend waren die Fotografien durch ein Fenster geschossen worden.
Raphael legte den Ordner zur Seite und nahm den nächsten. »Fall Bonzo«. Auch hier gab es Fotos. Allerdings von einem Hund. Einem ziemlich toten Hund. Aus allen Winkeln war der Hundekadaver geknipst worden.
Raphael hob weitere Ordner an und las die Namen darauf. »Was zum Teufel …?« War sein Onkel in den letzten Lebensjahren zum Rechtsanwalt mutiert?
Er zog die Schreibtischschubladen auf. In zweien fand er etwas, das ihm ein Grinsen ins Gesicht trieb. Das Erste waren Visitenkarten in einem kleinen Pappkarton. »Friesendetektei Georg Rickers«, stand darauf, mit Angabe der Adresse, Telefonnummer und einer E-Mail-Adresse des Onkels.
Unfassbar. Onkel Schorsch hatte sich als Detektiv verdingt!
Das noch breitere Lächeln galt der Flasche Whisky in der untersten Schublade. Ein Laphroaig. »Guter Stoff, Schorsch«, murmelte Raphael, drehte sich mit dem Schreibtischstuhl und fand im Regal hinter sich, was er suchte. Ein zwar beschlagenes, aber sauberes Glas. Er öffnete die Flasche, schenkte zwei Daumen breit von der bernsteinfarbenen Flüssigkeit ein und atmete die stark torfigen Aromen tief ein, bevor er das Glas hob und in die einsetzende Dämmerung prostete. »Auf dich, Onkel! Slàinte!«
***
Als Raphael aufwachte, schien die Morgensonne ins Zimmer. Viel zu grell für seinen Geschmack. Gut, die diversen Single Malts am Vorabend taten das ihre dazu, dass er sich benommen fühlte. Er stützte sich mit den Unterarmen auf der Matratze auf und sah sich im Schlafzimmer um. Er konnte sich kaum erinnern, die Treppe hochgegangen zu sein. Auf jeden Fall hatte er gut geschlafen. Die Matratze war super. Die Frage war: Wer hatte das Bett bezogen? Denn der frische Duft verriet, dass er nicht im Mief seines Onkels geschlafen hatte – wofür er mehr als dankbar war. Schorsch war zwar nicht hier im Bett verstorben, sondern auf dem Golfplatz, doch die saubere Bettwäsche wusste Raphael trotzdem zu schätzen.
Das Schlafzimmer war klein, wegen der beiden Fenster aber sehr hell, was wiederum den Gelbstich der Tapeten hervorhob. Onkel Schorsch hatte anscheinend auch im Schlafzimmer geraucht. Das hölzerne Einzelbett stand in der Ecke neben dem Fenster, vor dem Fenster war der Nachttisch platziert, der aus dem gleichen dunklen Holz wie der wuchtige Kleiderschrank war. Auf einem ausgedienten Küchenstuhl lagen Kataloge, und in der anderen Ecke stapelten sich alte Elektrogeräte wie Videorekorder und CD-Player.
Raphael grinste in sich rein, während er seinen Blick durch das Zimmer schweifen ließ. Kein Wunder, dass der Onkel lebenslang Single gewesen war. Dieser Raum war nicht dazu angetan, eine Frau auch nur in den Hauch einer erotischen Stimmung zu versetzen.
Raphael entsann sich dunkel, dass eines der Lieblingswörter seines Onkels »Weiber!« gewesen war. Er hatte es immer mit einem Pfund Verachtung gewürzt.
Und dann hörte Raphael Stimmen. »Weiber?«, stieß er aus und stand auf, um aus dem Fenster zu sehen, aber im Garten und vor dem Haus waren keine Frauen zu sehen. Als ein helles Lachen erklang, stand fest: Es kam von unten.
Mit zusammengezogenen Augenbrauen schlüpfte Raphael in seine Jeans. Was war hier los? Hatte Schorsch vielleicht eine Putzfrau gehabt, die einen Schlüssel besaß? Das würde die frische Bettwäsche erklären. Aber falls das da unten die Putzfrau war, sprach sie entweder mit sich selbst oder war Bauchrednerin. Jetzt kam noch eine dritte Stimme dazu, eine sehr tiefe. Und die konnte er einordnen. Denn seine klang genauso.
Johannes.
Raphael zog einen Pulli aus der Reisetasche, die er anscheinend im Suff noch nach oben geschleppt hatte, schlüpfte rein und ging barfuß die Treppe runter. Es roch nach Kaffee, und das war gut. Egal, wer ihn gekocht hatte.
Die Stimmen kamen aus dem Arbeitszimmer. Als Raphael im Türrahmen stehen blieb, verstummten sie.
Raphaels Blick fiel auf Johannes, der einen Becher in der Hand hielt und am Bücherregal lehnte. Hinter dem unaufgeräumten Schreibtisch saß eine Frau, die so friesisch aussah, wie man nur aussehen konnte. Sie trug das weizenblonde, leicht gewellte Haar kurz und hatte den Oberkörper einer Hammerwerferin.
Und die Stimme eines Generals, wie ihr »Wow!« verriet.
Sie starrte von ihm zu Johannes. »Der sieht ja wirklich genauso aus wie du.«
Lachend setzte Johannes den Kaffeebecher auf dem aufgeräumten Schreibtisch ab. »So ist das bei eineiigen Zwillingen. Moin, Bruderherz.«
»Hi, Jo.« Raphael sah ihn dabei nicht an, weil er den Blick nicht von der Blonden abwenden konnte, die aufgestanden war und auf ihn zukam. Er konnte sich nicht erinnern, jemals eine Frau getroffen zu haben, die ihm direkt in die Augen blicken konnte. Alles an ihr war überdimensional. In ihren Mund, der ihn angrinste, passte mit Sicherheit eine Banane quer rein.
»Tachchen, Raphael«, begrüßte sie ihn wie einen alten Kumpel und schlug ihm auf den Oberarm. »Freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin Imme. Imme Hölderling. Eine deiner beiden Assistentinnen.«
Raphael starrte sie an und schüttelte die Hand, die sie ihm hinhielt, sprachlos. Er konnte nicht einordnen, was sie da gerade gesagt hatte.
Sein Blick wanderte zu der zweiten Frau, die an dem ordentlichen Schreibtisch saß und Blickkontakt mit Johannes hielt. Ein perfektes Profil – die langen dunklen Wimpern, die kleine Nase, die hübsch geschwungenen Lippen –, wäre da nicht das Kopftuch gewesen.
Raphael gruselte sich vor zwei Arten von Menschen: Kinder und Frauen mit Kopftüchern.
Vor Kindern, weil sie eben Kinder waren. Nervten. Und Frauen mit Kopftüchern – unabhängig davon, ob sie das Tuch aus religiösen Gründen trugen oder nicht – verkörperten das Gegenteil der Frauen, die er schätzte. Er liebte moderne, unabhängige Frauen. Frauen, die wussten, was sie wollten. Die nicht vor Männern kuschten, sondern sie herausforderten und reizten, ohne aufdringlich zu sein.
Er war noch in den Anblick ihres Profils vertieft, als sie ihm ihr Gesicht ganz zuwandte. Und Raphael konnte ein leichtes Zucken nicht verhindern. Sie hatte es bemerkt, denn ihr Blick aus den dunklen Augen verhärtete sich.
Raphael schluckte, während er versuchte, nicht auf ihre linke Wange zu starren, die stark vernarbt war, von der Schläfe abwärts über die halbe Wange bis hinunter zum Kinn. Eindeutig waren Hauttransplantationen vorgenommen worden.
»Das ist Ava Rahmani«, erklang Immes Stimme. »Deine zweite Assistentin. Sie arbeitet nachmittags, ich morgens.« Sie hockte sich auf die Schreibtischkante und strahlte in die Runde.
Raphael wandte den Blick von den Frauen ab und sah seinen Bruder an. »Ich würde dich gern mal sprechen. Allein. Draußen.«
Im Rausgehen hörte er Johannes zu den Frauen sagen: »Keine Panik. Er wird ein guter Chef sein. Er weiß es nur noch nicht.«
Raphael lehnte barfuß an seinem Cabrio und rauchte, als Johannes aus dem Haus trat und mit einem Lächeln auf ihn zukam.
Raphael lächelte nicht.
»Kannst du mir mal sagen«, fuhr er Johannes an, »was Brienne von Tarth und bin Ladens Schwester in meinem Haus zu suchen haben? Wie sind die überhaupt reingekommen? Haben die etwa einen Schlüssel? Oder hast du die angeschleppt? Und was, verdammt, soll das Gequatsche, sie seien meine Assistentinnen? Wobei sollten die mir assistieren?«
»Ganz schön viele Fragen auf einmal«, sagte Johannes. »Aber die sind schnell beantwortet. Heute habe ich die beiden reingelassen, aber Ava und Imme haben tatsächlich einen Schlüssel. Sie haben für Onkel Schorsch gearbeitet. Jeweils auf Vierhundertfünfzig-Euro-Basis haben sie ihn in seiner Detektei unterstützt und –«
»Ja«, fuhr Raphael ihm über den Mund, »das hab ich gestern Abend schon entdeckt, dass unser lieber Onkel Visitenkarten im Schreibtisch hat, auf denen irgendein Detektiv-Quatsch steht. Du willst mir doch nicht sagen, dass er das wirklich gemacht hat?«
Johannes nickte. »Damit hat er sein Geld verdient. Seit drei Jahren.«
»Und wieso weiß ich das nicht?«
»Weil du nie hier warst. Und vor allem, weil Mama nicht wollte, dass es publik wird. Sie fand es wohl zu schräg? Zu peinlich? Zu …«
»… lachhaft?«
»Wie auch immer. Unser Onkel hatte jedenfalls auf seine letzten Jahre seine Bestimmung gefunden. Er ist darin aufgegangen. Laut Ava und Imme hatte er eine enorme Erfolgsquote zu verzeichnen. Er war in ganz Schleswig-Holstein unterwegs. Und ich glaube«, Johannes atmete tief durch, »dass du ebenfalls ein guter Detektiv wärst. Denn du hast Biss und Leidenschaft und … du bist kein Zahlenmensch, Raph, kein Kaufmann. Du wirst im Familienbetrieb niemals glücklich werden, egal in welchem Bereich.«
Raphael warf die Kippe auf die Straße, seinen Bruder nicht aus den Augen lassend. »Du glaubst wirklich, was du da sagst, oder? Ich … ein Detektiv!« Er lachte schäbig auf. »Raphael Poirot, der Welt größter –«
»Vielleicht solltest du die Latte nicht so hoch hängen«, unterbrach Johannes ihn. »Ich sehe dich eher im Wilsberg-Bereich.«
»Wer ist das?«
»Okay.« Johannes schüttelte den Kopf. »Es ist vielleicht auch besser, wenn du dich nicht an TV-Detektiven orientierst. Dann verzapfst du bei der Lösung der Fälle noch mehr Unsinn, als du es ohnehin tun wirst.«
»Ich werde überhaupt keine Fälle lösen.« Raphael stieß sich vom Auto ab. »Und jetzt gehen wir beide zurück ins Haus. Ich werde mir in der Küche einen Kaffee einschenken, und du schickst die Weiber nach Hause. Schorsch ist tot und der Job der beiden damit hinfällig.«
Er ging zurück ins Haus, ohne auch nur einen Blick nach links in das Arbeitszimmer zu werfen. Er bediente sich an der Kaffeemaschine und sah, dass Johannes mit einem Seufzer das Arbeitszimmer betrat. Da er die Tür nicht schloss, ging Raphael mit dem Becher in der Hand auf den Flur und lauschte.
Johannes stammelte: »Lief ganz gut. Ich, äh …«
»Wie lautet das sechste Gebot?«, unterbrach die blonde Riesin Johannes.
»Du sollst nicht ehebrechen.«
Raphael grinste in sich rein, als sie sagte: »Ach so, nee, ich mein das mit dem Lügen.«
»Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten, das achte Gebot.«
»Okay, und warum redest du dann falsch Zeugnis? Er will nicht, oder?«
Von Johannes kam keine Antwort. Vielleicht hatte er auch nur genickt.
»Ich hätte sowieso nicht mit ihm arbeiten wollen«, stieß Ava Rahmani aus. Das Stuhlrücken verriet, dass sie aufgestanden war. »Er ist unsympathisch. Arrogant. Wie könnt ihr Zwillinge sein?«
Zicke, dachte Raphael, während Johannes auflachte und sagte: »Wenn ich für diese Frage jedes Mal einen Euro in ein Sparschein gesteckt hätte, hätte ich van Goghs ›Mandelblüte‹ nicht als Kunstdruck, sondern im Original in meinem Wohnzimmer hängen.«
Raphael hörte ein Schlüsselbund klimpern. Anscheinend löste sie einen Schlüssel daraus. »Danke für alles, Johannes. Ich werde schon etwas Passendes finden.«
Imme schloss sich ihr an. Wie es sich anhörte, klopfte sie ihm den Rücken wie ein Steak. »Mach dir keinen Kopf, Herr Pastor. Uns Friesen haut so schnell nichts um. Auch kein verlorener Job. Und wer weiß, vielleicht ändert er seine Meinung noch.«
»Das Gebet dafür geht heute noch raus«, hörte Raphael seinen Bruder antworten, als er seinen Lauschposten verließ.
DREI
Auf dem Weg vom Anleger zurück zur Mühlenstraße schlenderte Raphael den Sandwall entlang. Er hatte Johannes zum Hafen begleitet, der zu Fuß herübergekommen war und nun auf der »Nordfriesland« zurück zum Festland schipperte.
Sie hatten den Nachmittag zusammen am Meer verbracht, waren schwimmen gegangen, hatten sich die Sonne auf den Bauch brennen lassen und im Aquamarin Currywurst mit Pommes gegessen. Richtig genießen können hatte Raphael den Strandtag trotz des genialen Wetters nicht, obwohl Johannes den Detektei-Schwachsinn mit keinem Wort mehr erwähnt hatte. Da sein Bruder ihm allerdings auch keine anderen Optionen gepredigt hatte, war die Wahrscheinlichkeit groß, dass das Thema für Johannes noch nicht vom Tisch war.
Nicht mit mir, Bruder, dachte Raphael, während er eine Rothaarige ins Visier nahm, die vor der Confiserie Föhr an einem der Stehtische auf einem Hocker saß und an einem Aperol Spritz sog. Obwohl sie in männlicher Begleitung war, nahm sie seinen Blick auf und lächelte ihm zu, während sie das Glas absetzte. Raphael ging weiter. Wie konnte Johannes nur all den Versuchungen widerstehen? Sie waren nun mal scheißattraktive Kerle, die Frauen flogen auf ihr Äußeres. Also konnte man das reichhaltige Angebot doch auch nutzen.
Als er von der Feldstraße in die Mühlenstraße abbog und auf das Haus seines Onkels zuging – er konnte es noch nicht als seines betrachten –, kam ihm eine Frau entgegen. Sein Blick scannte sie automatisch. Sie war eine Exotin, vermutlich Thailänderin, passte aber nicht in sein Beuteschema, denn sie war zu alt. Vielleicht Ende vierzig, Anfang fünfzig. Also löste er den Blickkontakt, öffnete die Gartenpforte und ging zum Haus hinauf.
Als er den Schlüssel ins Schloss steckte, erklang hinter ihm eine dunkle Stimme. »Sie hier neuer Detektiv? Oder Haus gekauft und gibt nix neuer Detektiv?«
Verwundert drehte er sich um. Die Exotin stand an der geschlossenen Pforte und starrte zu ihm herüber.
»Wie bitte?« Er ging zurück.
»Gute Tag. Ich frage, ob Sie Detektiv.« Sie sprach mit schwerem Akzent. »Ich weiß, Herr Rickers tot. Hab ich aber Hoffen, dass neuer Detektiv kommt und kann Hilfe geben zu mir. Sie neuer Detektiv?« Ihre dunklen Augen hingen an seinem Gesicht.
»Ich bin kein Detektiv. Mit dem Tod meines Onkels gibt es auch die Detektei nicht mehr.«
»Oh.« Die Mandelaugen füllten sich mit Tränen. »Ich gewünscht, dass neuer Detektiv kommt. Onkel von Sie hat Hoffen gemacht bei mir. Hat gesagt, hat vielleicht Spur. Aber dann gestorben.« Die Tränen lösten sich und bildeten feuchte Rinnsale auf der bemerkenswert glatten Haut der Frau.
»Eine Spur?«, wiederholte Raphael. »Was für eine Spur?«
Sie schluckte und wischte sich mit dem Handrücken über die Wangen. »Mein Tochter ist verschwunden. Seit ein Jahr. Hier auf Föhr. Von Tag auf andere Tag sie weg. Ehemann sagt, Dalika ertrunken in Meer, aber ich nix glauben. Ich glaube, er sie gemordet.« Das Dunkle ihrer Augen schien noch schwärzer zu werden. Auch ihre Stimme verhärtete sich. »Ich weiß, dass er sie totgemacht.«
Wovon redete die Frau da? Er trat einen Schritt von der Pforte zurück. »Warum gehen Sie nicht zur Polizei? Die ist dafür zuständig, wenn Sie, äh, ein Problem haben.«
»Nix Polizei Hilfe.« Sie wedelte abwehrend mit der Hand. »Polizei untersucht alles und findet nix. Dalika weg. Ohne Spur.«
»Tja, äh, Frau …«
»Sagen bitte Khun Som. Ist Name von mir.«
»Das tut mir wirklich leid, Frau Khun … Som«, sagte Raphael. »Aber ich muss jetzt mal rein.« Er deutete zum Haus. »Für Sie dann alles Gute.« Er wandte sich ab.
Sie ging glücklicherweise auch weiter. Doch sein Unbehagen verstärkte sich, denn sie weinte herzerweichend, während sie langsam die Mühlenstraße entlangschritt.
Im Haus steuerte Raphael direkt die Küche an, nahm das letzte Bier aus dem Kühlschrank, das wohl noch sein Onkel hineingestellt hatte, öffnete es mit einem Messer, als er in der Schublade keinen Öffner fand, und trank es im Stehen.
Verrückt. Sein Onkel hatte dieser Frau also gesagt, dass er eine Spur hatte? Was konnte Schorsch schon herausgefunden haben, das der Polizei entgangen war? Wenn die Tochter dieser Frau tatsächlich spurlos verschwunden war, wären die Bullen doch wohl eher auf eine Spur gestoßen als sein versoffener Onkel.
Die Gedanken an die Frau begleiteten ihn, während er mit dem Wagen zum Sky-Supermarkt fuhr, während er an der Kasse in einer Schlange Touristen stand, und auch noch, als er zwei Sandwiches im Wohnzimmer aß und auf den Fernseher starrte. Noch kauend ging er schließlich ins Arbeitszimmer und stellte den Laptop auf dem aufgeräumten Schreibtisch an.
»Fuck, welches Passwort benutzt ihr?« Er probierte ein paar naheliegende Möglichkeiten, ohne Erfolg. Schließlich griff er sich den Packen Ordner vom Schreibtisch und ging damit ins Wohnzimmer. Stück für Stück arbeitete er sich hindurch, aber in keinem der Ordner stieß er auf Unterlagen, die zu dem Fall der verschwundenen Frau passten.
Er ging zurück ins Arbeitszimmer und durchwühlte beide Schreibtische. In einer der Schubladen fand er noch einen Ordner, aber der enthielt die Unterlagen über Imme Hölderling und Ava Rahmani. Genervt hockte er sich wieder vor den Fernseher und zappte sich durch die Programme. Netflix und Sky gab es in Schorschs Bude nicht.
Als er die Beine lang auf dem Sofa ausstreckte, dauerte es nicht lange, und er nickte weg. Immer wieder öffnete er die Augen, doch sie fielen sofort wieder zu. Die Nordseeluft und das ausgiebige Schwimmen und Sonnenbaden forderten ihren Tribut. Er konnte sich nicht erinnern, wann er das letzte Mal vor dreiundzwanzig Uhr schlafen gegangen war.
Im Schlafzimmer des Onkels zog er sich schließlich aus und warf sich aufs Bett. An Schlaf war allerdings nicht zu denken, denn der alte Wecker auf dem Nachttisch tickte so laut, dass Raphael genervt das Licht wieder anmachte und die Schublade aufzog, um den Wecker darin verschwinden zu lassen. Er stutzte.
Sein Herz begann einen Tick schneller zu klopfen, als er den abgegriffenen blauen Ordner herauszog und auf der Pappe las: »Fall Dalika Gorden«. Wobei der Nachname bei der krakeligen Schrift seines Onkels auch Gonden, Gordan oder wie auch immer lauten konnte. »Dalika« konnte er nur entziffern, weil die Asiatin ihm den Namen ihrer Tochter genannt hatte.
Die Müdigkeit war wie weggeblasen. Er setzte sich im Bett auf und öffnete den Ordner. Ins Auge fiel sofort ein Foto, das mit einer Büroklammer an den vom Onkel entworfenen Fragebogen geheftet war. Langes schwarzes Haar umrahmte ein herzförmiges Gesicht. Dunkle Mandelaugen blickten ihn an. Dalikas Lächeln war hinreißend. Um ihren zarten Hals hing eine Kette mit einem Stern, der mit vielen kleinen Zirkonias besetzt war – dass es Diamanten waren, war wohl kaum anzunehmen.
»Hoffentlich lebst du noch«, murmelte Raphael. »Du bist viel zu schön, um tot zu sein.« Er blätterte sich durch die linierten und karierten Seiten, die sein Onkel wohl aus Collegeblöcken herausgerissen hatte. Viel gab es allerdings nicht zu lesen. Schorsch schien wenig davon gehalten zu haben, Erkenntnisse schriftlich festzuhalten. Wenn es denn überhaupt Erkenntnisse gegeben hatte.
Raphael hielt ein Blatt Papier, auf dem der Onkel einzelne Wörter, Buchstaben und Zahlen notiert hatte, näher an das trübe Licht der Nachttischlampe. »Elende Sauklaue.« Was stand da? »Flesch … Flasch … Flasche?« Nein, Flasche konnte es nicht heißen. Denn es fehlte hinten das e. Aber was sollte Flesch oder Flasch bedeuten? Schorsch hatte drei Ausrufezeichen dahintergesetzt.
Raphael konzentrierte sich auf die weiteren Wörter. Eines konnte Hinsch heißen – oder Hirsch? Ein weiteres vielleicht Erhardt oder Enhadt. Oder Erholt? Auf einem kleinen Zettel, der von einem Zettelblock abgerissen war, stand ein weiteres einzelnes Wort. Basid. Auch hinter dieses Wort hatte Schorsch drei Ausrufezeichen gesetzt.
Basid? Was sollte das heißen? Vielleicht war es thailändisch. Raphael googelte ein Übersetzungsprogramm, aber als er »Basid« eingab, blieb die Übersetzung ein »Basid«.
»Leck mich, Schorsch«, murmelte Raphael genervt. Er ging mit dem Smartphone nach unten ins Arbeitszimmer und zog den Ordner aus der Schreibtischschublade, in dem sich die Unterlagen zu Imme Hölderling und Ava Rahmani befanden.
Er nahm das Blatt mit Immes Daten zur Hand und wählte die darauf angegebene Festnetznummer.
»Raphael Freersen hier«, meldete er sich, als Imme das Gespräch annahm. »Ich vermute mal, dass du mit der Sauklaue meines Onkels vertraut bist? … Wie? Ja, ich weiß, dass es gleich Mitternacht ist … Geschlafen? Ja, sorry, das kann ich ja nicht ahnen. Welcher normale Mensch geht denn vor zwölf ins Bett? … Nein, ich bin schon noch ganz dicht. Und wenn du deinen Job hier weitermachen willst, dann sei morgen früh um Punkt neun hier … Ja-ha, du kriegst Geld dafür.«
Er starrte auf sein Handy. Sie hatte mit einem »Juchhu, Johannes’ Gebete sind erhört worden« aufgelegt.
»Gar nichts ist erhört worden.« Raphael gähnte und stieg wieder die Treppe hinauf. Er warf den Ordner auf den Boden und ging zu Bett. Mandelförmige Augen begleiteten ihn in einen tiefen Schlaf.
***
»Flesch oder Flasch … oder vielleicht Flasche?« Imme Hölderling hielt das Blatt, das Raphael ihr gereicht hatte, gegen das Licht der Morgensonne, die in das Bürofenster schien. »Aber da ist ja kein e, oder?«
»Ja, danke, so weit war ich auch. Ich denke, du kennst die Schrift meines Onkels?«
»Ruhig, Brauner«, sagte Imme, ohne ihn anzusehen. »Ich habe gesagt, dass ich sie kenne, nicht, dass ich sie lesen kann. Schorsch hat nicht nur gekrakelt, sondern war auch noch starker Legastheniker.«
»Ach«, Raphael war überrascht, »das ist mir neu.«
»Du weißt nicht viel von deinem Onkel, was?«
So, wie Imme ihn musterte, fühlte er sich gleich schuldig. »Wir haben uns keine Liebesbriefe geschrieben. Woher soll ich also wissen, dass er Legastheniker war?«
»Von seiner Schwester vielleicht? Die ist doch deine Mutter.«
Raphael lachte auf. »Meine Mutter würde sich eher Bart Simpson auf die Brust tätowieren, als zuzugeben, dass in ihrer Familie etwas nicht perfekt ist.«
Er nahm ihr das Papier aus der Hand und legte es in den Ordner zurück, zusammen mit dem Zettel, auf dem das Wort »Basid« stand. Auch dieses Wort hatte Imme nicht zuordnen können.
»Er hat ja kaum was aufgeschrieben. Hat er euch vielleicht etwas gesagt zu dem Fall? Habt ihr mit ihm darüber gesprochen?«
Imme schürzte die Lippen. »Schorsch war uns gegenüber nie mitteilsam. Aber was willst du wissen? Ich kann dir etliches erzählen. Jedenfalls das, was hier jeder weiß. Dalika Gorden ist eine bildhübsche Thailänderin und seit fast einem Jahr spurlos verschwunden. Da ihre Flip-Flops und ihr Handtuch in den Dünen gefunden wurden, kann man davon ausgehen, dass sie ertrunken ist. Aber ihre Leiche wurde nie angespült. Ihr Mann ist Martin Gorden, Pächter des Restaurants ›Bullauge‹ in der Gmelinstraße.« Sie deutete auf die Akte. »Schorsch hat alle Zeitungsartikel über den Fall gesammelt. Daraus erfährst du schon mal ’ne Menge.«
»Einige hab ich beim Frühstück schon gelesen. Die Journalisten haben fleißig recherchiert.« Er lümmelte sich auf seinen Schreibtischstuhl und legte die langen Beine auf dem Schreibtisch ab. »Dalika war ’ne Nutte.«
»Ja, das war sie in ihrem Vorleben wohl«, sagte Imme ernst. »Gorden hat sie in Thailand bestimmt nicht auf einer Kunstauktion kennengelernt. Er hat sie aus ihrem Drecksleben in Bangkok rausgeholt. Auf jeden Fall hat er sie aber lieben gelernt. Und sie hat ihn auch geliebt. Vielleicht einfach nur aus Dankbarkeit, aber alle hier haben sehen und erleben können, dass sie ihn geliebt hat.« Ihre Augen blitzten. »Ich wäre jedenfalls dankbar, wenn ich keine geilen europäischen Böcke mehr bedienen müsste, um meine Familie ernähren zu können.«
»Guck mich nicht so an! Ich war noch nicht bei ’ner Nutte.« Er grinste. »Hab ich nicht nötig. Die Weiber fliegen auf mich.«
Ungläubig schüttelte Imme den Kopf. »Dass du ein Zwilling von Johannes bist, ist wirklich ein Mysterium … Aber zurück zum Thema. Martin Gorden hat Dalika vor einem Jahr als vermisst gemeldet, als er von einer Tour zurückkam, die er mit dem Kleinen auf dem Festland gemacht hatte.«
»Sie haben ein Kind?«
»Nath ist Dalikas Sohn. Er müsste jetzt sieben Jahre alt sein. Sie hat ihn als Zweijährigen mit in die Ehe gebracht. Martin Gorden hat ihn adoptiert, als sie geheiratet haben. Und er ist vernarrt in den Kleinen. Sie waren eine glückliche kleine Familie.«
»Dalikas Mutter ist fest davon überzeugt, dass ihre Tochter von Gorden umgebracht wurde.« Raphael hatte Imme von dem Gespräch berichtet.
»Ja«, Imme nickte, »der Verdacht, dass der Ehemann es war, liegt ja immer nahe, wenn eine Frau spurlos verschwindet. Da ist die Kripo wohl auch dran gewesen. Der hat etliche Verhöre über sich ergehen lassen müssen. In der Nacht ihres Verschwindens war er erwiesenermaßen nicht auf der Insel. Aber ihre Sachen hätte er schließlich am Morgen nach seiner Rückkehr am Strand deponieren können, um ein Ertrinken vorzutäuschen. Es gab auch Gerüchte über eine angebliche Geldnot bei den Gordens, aber das können einfach Gerüchte sein. Der Laden brummt schließlich. Im ›Bullauge‹ ist immer was los.« Sie stockte. »Ganz ehrlich, ich glaub nicht, dass er was damit zu tun hat. Martin Gorden ist völlig fertig, seit Dalika weg ist. Immer noch. Und er liebt den Jungen. Der würde nichts tun, was Nath schadet.«
»Hmm«, Raphael musterte Imme, »wo soll man da also ansetzen, um was rauszufinden? Wenn sogar die Polizei auf dem Schlauch steht …«
»Zuallererst musst du dich mal um dich selbst kümmern, bevor du überhaupt was rausfinden darfst.« Immes Blick war streng. »Du musst beim Ordnungsamt ein Gewerbe anmelden, wenn du detektivisch tätig sein willst. Das heißt, du musst ein polizeiliches Führungszeugnis anfordern, und du musst nachweisen, dass du durch die IHK über die Rechtsvorschriften informiert wurdest. Vorbestraft bist du hoffentlich nicht? Dann kannst du’s nämlich vergessen.«
»Gewerbe anmelden? Ruhig, Braune. So weit sind wir ja wohl noch nicht. Ich bin nur ein wenig neugierig geworden.«
Imme lächelte breit. »Die Grundvoraussetzung für diesen Job erfüllst du also.« Sie tippte mit dem Finger auf den Ordner. »Ava kann Schorschs Hieroglyphen besser deuten als ich. Ruf sie an und bitte sie, herzukommen.« Ihr Gesicht wurde ernst. »Ehrlich, ich würde hier gern wieder arbeiten. Aber Ava ist auf das Geld mehr angewiesen als ich. Wenn du dir also nur eine von uns leisten kannst, nimm bitte sie.«
»Schauen wir mal«, sagte Raphael. »Noch ist mein Konto gut gefüllt, aber es gibt keinen Nachschub. Es sei denn, ich arbeite dafür.«
»Dann finde raus, was mit Dalika passiert ist. Es gibt auch noch weitere Fälle abzuarbeiten. Schorsch hat damit sein Geld verdient. Dann kannst du das auch.«
Raphael sah in Immes hochgradig begeistertes Gesicht. »Warum eigentlich nicht? Besseres hab ich momentan sowieso nicht zu tun.« Er deutete auf das Telefon auf dem Schreibtisch. »Funktioniert das? Dann ruf deine Kollegin an und sag ihr, dass sie sich pronto hierherbewegen soll, wenn sie arbeiten will.«
»Das will ich hören!« Imme boxte ihm auf die Brust und griff zum Hörer. »Bis auf freitags waren wir jeden Tag hier. Ava arbeitet immer nachmittags von zwei bis fünf, ich vormittags von neun bis zwölf«, sagte sie, während sie eine Kurzwahltaste drückte und lauschte.
»Mir wurscht, wer von euch hier wann auftaucht. Hauptsache, es ist immer frischer Kaffee gekocht.«
»Da muss ich noch mal in meine Stellenbeschreibung gucken … Ah, Ava! Imme hier. Du glaubst nicht, wo ich gerade bin, darum sag ich’s dir. Ich sitz an unserem Schreibtisch im ›Friesenglück‹. Er hat Blut geleckt! Der Fall von Dalika Gorden hat ihn so weit angefixt, dass er weitermachen will. Kannst du vorbeikommen? … Nun komm schon, Ava-Maus. So schlimm ist der gar nicht. Den Macho erziehen wir uns hin.«
Raphael hörte sprachlos zu. Die Friesenriesin war einmalig. Einmalig unverschämt. Und damit irgendwie perfekt geeignet, seine Mitarbeiterin zu sein.
»Wir werden aus Schorschs Klaue nicht schlau … Okay, sag ich ihm.« Imme legte den Hörer auf und sah Raphael an. »Sie kann erst heute Nachmittag kommen. Um zwei Uhr ist sie hier. Und bitte …«, ihr Gesicht wurde ernst, »reiß dich ’n bisschen zusammen. Ava ist nicht wie ich. Mit mir kannst du einen derben Spaß machen«, grinsend schlug sie ihm auf den Oberarm, »aber Ava ist … sensibel. Erschreck sie nicht mit deinem Gehabe.«
»Kann es sein, dass du das Verhältnis Chef/Angestellte irgendwie nicht begriffen hast? Erzählst du mir gerade, was ich tun und lassen soll?«
Imme stand auf. »Ich koch dir erst mal einen Kaffee, Chef. Das tun weibliche Angestellte doch?« Pfeifend ging sie in die Küche.
»Weiblich?«, murmelte Raphael. »Schön wär’s.«
***
»Danke«, sagte Raphael und nahm im »Bullauge« von der Bedienung die Speisekarte entgegen. Da er im Fall Dalika irgendwo ansetzen musste, hatte er sich zu einem Mittagessen hierher aufgemacht. Vielleicht bekam er Martin Gorden zu Gesicht.