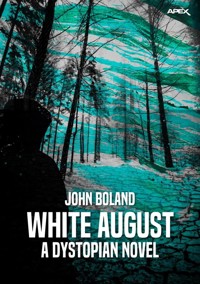5,99 €
Mehr erfahren.
Die Bedeutung des zugesandten Fotos war sonnenklar: Erpressung. Obwohl der Earl of Staves ein reicher Mann war, konnte er sich keinen Skandal leisten. Daher beauftragte er seinen Assistenten John Poynder, sich um die Angelegenheit zu kümmern. John, der sich zunächst dieser Aufgabe nicht gewachsen fühlte, war überrascht, als er bei seinen Ermittlungen feststellte, dass noch eine ganze Reihe weiterer prominenter Leute auf dieselbe Weise erpresst worden war - und dass es zur gleichen Zeit zu einigen geheimnisvollen Selbstmorden unter der jungen Generation der Londoner High Society gekommen war. Da wusste John Poynder, dass er rasch handeln musste, aber war es nicht bereits zu spät...?
Der Roman Der teuflische Spiegel des britischen Schriftstellers John Boland (* 5. Februar 1913; † 9. November 1976) erschien erstmals im Jahr 1960; die deutsche Erstveröffentlichung erfolgte 1981 (unter dem Titel Der Teufelsspiegel).
Der Verlag DER ROMANKIOSK veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Krimi-Klassikers in seiner Reihe DIE MITTERNACHTSKRIMIS.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
JOHN BOLAND
DER TEUFLISCHE SPIEGEL
Roman
Die Mitternachtskrimis, Band 13
Der Romankiosk
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
DER TEUFLISCHE SPIEGEL
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Das Buch
Die Bedeutung des zugesandten Fotos war sonnenklar: Erpressung. Obwohl der Earl of Staves ein reicher Mann war, konnte er sich keinen Skandal leisten. Daher beauftragte er seinen Assistenten John Poynder, sich um die Angelegenheit zu kümmern. John, der sich zunächst dieser Aufgabe nicht gewachsen fühlte, war überrascht, als er bei seinen Ermittlungen feststellte, dass noch eine ganze Reihe weiterer prominenter Leute auf dieselbe Weise erpresst worden war - und dass es zur gleichen Zeit zu einigen geheimnisvollen Selbstmorden unter der jungen Generation der Londoner High Society gekommen war. Da wusste John Poynder, dass er rasch handeln musste, aber war es nicht bereits zu spät...?
Der Roman Der teuflische Spiegel des britischen Schriftstellers John Boland (* 5. Februar 1913; † 9. November 1976) erschien erstmals im Jahr 1960; die deutsche Erstveröffentlichung erfolgte 1981 (unter dem Titel Der Teufelsspiegel).
Der Verlag DER ROMANKIOSK veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Krimi-Klassikers in seiner Reihe DIE MITTERNACHTSKRIMIS.
DER TEUFLISCHE SPIEGEL
Erstes Kapitel
Es handelte sich um ein Schwarzweißfoto, etwa zwanzig mal fünfzehn Zentimeter im Format, und alle Einzelheiten waren messerscharf zu erkennen. Obwohl das Gesicht des nackten Mädchens darauf durch eine läppische Grimasse verzerrt war, hatte der Earl of Staves keine Schwierigkeiten, es zu erkennen. Es war das Gesicht seiner achtzehnjährigen Tochter, Lady Roberta Levenside.
Hoch oben an seiner rechten Wange, unmittelbar unterhalb seines äußeren Augenwinkels, begann ein Nerv zu zucken, während er das Foto betrachtete, aber davon abgesehen, war seinem Gesicht nichts anzumerken. Lord Staves war eisern in der Familientradition aufgewachsen, keine anderen Gefühlsäußerungen außer allenfalls Belustigung zu äußern; bei allen anderen Gelegenheiten gab zumindest sein Gesicht keinen Aufschluss über das, was er dachte.
Er nahm den Umschlag und betrachtete ihn. Die Adresse war in schräger Handschrift geschrieben:
An den
Earl of Staves
Levenside Manor
Staves
Surrey
In der unteren rechten Ecke standen mit großen Buchstaben die Worte Privat und Vertraulich geschrieben, aber sonst lag nichts bei, keine irgendwie geartete Nachricht; und das einzige, was dem Brief zu entnehmen war, war die Tatsache, dass er am Tag zuvor in London aufgegeben worden war.
Staves war nicht der Mann, der überstürzt zu handeln pflegte. Bevor er sich über dieses - dieses Ding erregte, wollte er zuerst sein Frühstück beenden und sich dann Roberta vorknöpfen. Er legte das Foto, die Vorderseite nach unten, unter die noch immer zusammengefaltete Ausgabe von The Times und nickte anerkennend, als sein Diener Simpson den frischen Toast hereinbrachte. Eine Menge dünnen, heißen Toastes, mit Butter und Oxford-Marmelade bestrichen, war die einzige Zügellosigkeit, die er sich erlaubte.
Als er sein Frühstück beendet hatte, fehlten nur noch ein paar Minuten, bis sein Wagen vor der Tür stehen würde, um ihn in die Stadt zu bringen. Aber diese wenigen Minuten würden für das, was er zu tun hatte, genügen.
Das Foto in der Hand, stieg er die breite geschwungene Treppe hinauf und ging den Korridor entlang, der zu den Schlafzimmern im Westflügel führte. Seine eigenen Zimmer lagen im Ostflügel, und es war lange her, seit er in diesem Teil des Hauses gewesen war. Die meisten Räume wurden nicht mehr benutzt, denn er hatte nur selten Gäste.
Bevor er das Zimmer seiner Tochter betrat, blieb er kurz stehen, um noch einmal das Foto zu betrachten, und öffnete dann mit zusammengepressten Lippen die Tür.
Das Zimmer sah aus wie ein Schweinestall. Schuhe, Strümpfe, Unterwäsche, alles lag auf dem Teppich verstreut umher, und neben einem Stuhl lag zerknüllt ein Kleid. Lord Staves selbst war pedantisch und ordentlich, und das, was er sah, erfüllte ihn mit zornigem Abscheu. Er ging auf das Bett zu und starrte auf den unordentlichen Haarschopf auf dem Kopfkissen; das Mädchen hatte das Leintuch über das Gesicht gezogen, so dass nur das Haar sichtbar war.
»Roberta!«
Nichts rührte sieh, und er sagte noch einmal, diesmal lauter: »Roberta!«
Diesmal hörte sie ihn. Das Leintuch wurde herabgezogen, so dass ihr Gesicht zu sehen war, und ihre blassgrauen Augen blickten überrascht zu ihm auf. Es war das erstemal, dass er in ihrem Schlafzimmer erschienen war. Er hielt das Foto dicht vor ihr leicht dickliches Gesicht.
»Bist du das? Ich weiß, dass es dein Gesicht ist, aber ist es dein Körper?«
Roberta, erst halb wach, war verwirrt und ängstlich. Ihr Vater war der einzige Mensch, der ihr Furcht einjagte. Seit ihrer Geburt hatte er sich nie um sie gekümmert, und sie ging ihm, soweit es möglich war, aus dem Weg. Aber nun befand sich das glänzende Foto nur ein paar Zentimeter von ihrer Nase entfernt, und sie versuchte, es klar zu erkennen.
»Na?«
Sie konnte das Bild jetzt sehen und starrte es erschreckt und ungläubig an. Dann blickte sie in die eisblauen Augen empor, die sie betrachteten. »Ich - ich... Ich habe nie...«
»Bist du es, oder bist du es nicht?«
»Ich...« Ihre Zunge schien zu schwer, um ihr zu gehorchen, und ihr Herz begann zu pochen. Dann stieß sie einen kleinen Schrei aus, als ihr Vater das Leintuch packte und es über ihren Körper herabzog. Sie war nackt und unternahm wirkungslose Versuche, ihre Nacktheit mit den Händen zu verbergen. Die Erinnerung an Geschichten, die sie gelesen hatte und die ihr von Freundinnen erzählt worden waren - von Vätern, die ihre Töchter vergewaltigten -, blitzte in ihr auf.
Staves blickte, durch den Backfischspeck an ihren Brüsten, Hüften und an ihrer Taille leicht abgestoßen, auf den Körper seiner Tochter. Trotz ihrer Bemühungen, sich vor seinem Blick zu verbergen, konnte kein Zweifel bestehen, dass die Aufnahme sie zeigte. Er warf das Leintuch wieder über sie.
»Ich möchte heute Abend um neun Uhr deine Erklärung hören, Roberta. Du wirst in mein Arbeitszimmer kommen.«
Ohne ihr Gelegenheit zu einer Antwort zu geben, marschierte Lord Staves hinaus, sich mürrisch der Tatsache bewusst, dass sich der Tag schlecht anließ. Wie konnte sich das dumme kleine Luder nur in eine solche Situation hineinmanövriert haben! Er hatte Robertas Mutter in der Absicht geheiratet, das Levenside'sche Geschlecht aufzufrischen. Sie war eine große, schwerfällige Kuh von einer Frau gewesen, von einwandfreier Herkunft. Und doch war sie nach Robertas Geburt gesundheitlich zusammengebrochen und brachte den größten Teil des Jahres im Süden von Frankreich zu, eine Halb-Invalidin, unfähig, ein weiteres Kind zur Welt zu bringen. Und so, nach beinahe vierhundert Jahren Levenside- scher Tradition, gab es keinen Erben, der den Namen weitertragen würde.
Den Tag über war er in der Stadt zu beschäftigt, um über das Foto nachzubrüten, das er zusammengefaltet und in die innere Brusttasche seiner Jacke gesteckt hatte. Auf der Heimfahrt, als er nach der Arbeit im Rolls-Royce nach Hause zurückgebracht wurde, studierte er die Papiere, die er mitgenommen hatte. Sie befassten sich mit der geplanten Verschmelzung zweier kleiner Schiffsgesellschaften, an denen er beteiligt war; und das reichte aus, um ihn innerlich bis zum Abendessen zu beschäftigen.
Nach dem Essen ging er in die Bibliothek, aber die Zigarre, die er rauchte, schien völlig ohne Aroma zu sein, und er drückte sie ärgerlich aus, bevor er in das kleine Arbeitszimmer ging, um auf Roberta zu warten. Sie hatte nicht mit ihm zusammen zu Abend gegessen - das tat sie nie, selbst wenn sie zu Hause war, denn er zog einsame Mahlzeiten vor.
Roberta stand zumindest fünf Minuten lang vor der Tür, die zum Arbeitszimmer führte, bevor es neun Uhr schlug. Ihr Vater saß hinter seinem großen Schreibtisch, und Roberta spürte, wie ihr Herz hämmerte, während sie auf ihn zuging und versuchte, sich zu einem Lächeln zu zwingen.
»Nun?«
Sie starrte ihn einen Augenblick lang an und konzentrierte dann ihren Blick auf einen Fleck, der ein paar Zentimeter oberhalb seines Kopfes lag, und bemühte sich, ihre Stimme ruhig zu halten. »Vater, ich - ich kann es nicht erklären.« Ganz in ihrer Nähe stand ein Stuhl, und sie sank darauf. »Ich - ich weiß es einfach nicht, Vater.«
»Lüg mich nicht an.«
»Ich lüge nicht, ich schwöre es dir!«
Das Foto lag vor ihm auf dem Schreibtisch, und er tippte mit seinem rechten Zeigefinger darauf, während er sprach. »Das hier ist eine Aufnahme von dir; es handelt sich um keine Fotomontage, bei der jemand deinen Kopf auf einen anderen Körper gesetzt hat. - Du willst doch nicht etwa bestreiten, dass du das bist?«
Sie schüttelte den Kopf. »Nun, zumindest darin bist du ehrlich, Roberta. Wie wäre es, wenn du mir nun vollends die Wahrheit erzähltest?«
Zehn Minuten später weinte sie, und die Tränen liefen ihr die Wangen herab. Aber seltsamerweise waren ihr sonst keine Gefühle anzumerken. Ihr Mondgesicht war blass, aber gefasst, und nur die strömenden Tränen verrieten ihre Erregung. Er erinnerte sich, dass ihre Mutter ebenso war; und die Erinnerung verursachte in ihm eine Aufwallung von Zorn, gemischt mit dem Vergnügen, sie weinen zu sehen. Das Mädchen war völlig nach ihrer Mutter geraten; von ihm war nicht das Geringste in ihr.
Er setzte sich zurück, wartete darauf, dass die Tränen aufhören würden, und kaum war es soweit, als er wieder zum Angriff vorging. »Na gut, Roberta, ich schlage vor, wir hören mit diesem Unsinn auf. Bis jetzt ist ja nichts weiter passiert. Erzähle mir, wer die Aufnahme gemacht hat, und ich werde mich mit ihm auseinandersetzen.«
»Aber ich weiß es doch nicht!« Es war mehr ein Wimmern als eine Feststellung.
Wieder setzte er sich zurück, diesmal, um die Sache zu überdenken. Roberta hatte Angst vor ihm, das wusste er gut genug; deshalb war er auch überzeugt, dass sie ihm die Wahrheit sagen würde, wenn er sie unter Druck setzte. Konnte das Ding vielleicht doch eine Fälschung sein? War der Körper der eines anderen, mit Backfischspeck versehenen Mädchens? Aber nein, es war der Robertas, darüber konnte kein ernsthafter Zweifel bestehen.
Er begann, sich unsicher zu fühlen - ein seltenes Ereignis. Wenn mit dem Ganzen eine Geldforderung verbunden gewesen wäre, hätte er die Sache verstehen können. Seine erste Reaktion, als er das Foto gesehen hatte, war der Gedanke an Erpressung gewesen. Wahrscheinlich handelte es sich auch um einen Erpressungsversuch, aber offensichtlich wurde bei ihm dieselbe Taktik angewandt, die ihm selbst von seinen eigenen Geschäftspraktiken her so vertraut war: nämlich die Gegenseite durch einen gewissen Aufweichungsprozess unsicher und daher reif für eine Niederlage zu machen.
Aber müßige Spekulationen waren Zeitverschwendung. Er wollte etwas unternehmen können. Erneut starrte er auf das Bild. Robertas rundes Gesicht war zu einer albernen Grimasse verzogen, die Zunge war herausgestreckt, ihre Augen schielten. Die Füße waren weit gespreizt, der linke Arm war seitlich angehoben und der rechte im Ellbogen abgeknickt, so dass ihre Hand, die Innenfläche nach unten, unter dem Kinn lag und ihren Kopf zu stützen schien. Abgesehen von der Grimasse sah das Ganze so aus, als ob sie den schwerfälligen Versuch zu einem Ballettschritt unternommen hätte.
Er blickte auf und sah ihr brennendrotes Gesicht; offensichtlich setzte sie die sorgfältige Betrachtung, die er dem Foto hatte angedeihen lassen, in Verlegenheit.
»Gehört es zu deinen Gewohnheiten, nackt vor deinen Bekannten zu erscheinen?«
»Natürlich nicht!«
Ihre Stimme klang so entrüstet, dass er sich gezwungen fühlte, ihr zu glauben. »Hast du je so Modell gestanden?«
»Nein.«
»Ich möchte die Wahrheit wissen, Roberta, und ich werde sie auch erfahren. Nun hör genau auf das, was ich dir sagen werde.« Er machte eine Pause und fuhr dann fort: »Du hast dich nicht auf einer dieser Partys, zu denen du gehst, albern benommen?«
»Nein.« Wenn sie doch nur genügend Mut aufgebracht hätte, um hinauszugehen oder ihm auch nur ihren Protest ins Gesicht zu schreien, so hätte sich Roberta besser gefühlt. Aber ihr Verstand schien in Anwesenheit von Erwachsenen nie richtig zu funktionieren. In ihrer eigenen Clique wurde sie als eine Art Anführerin betrachtet. Die meisten Mädchen fügten sich ihr - mit Ausnahme derjenigen, deren Väter ebenso reich oder reicher waren als der ihre. Die nächste Frage brachte sie wieder in die unangenehme Gegenwart zurück.
»Hast du die Angewohnheit, Grimassen zu schneiden, die dich noch hässlicher machen?« Staves empfand eine Spur von Vergnügen, als er sah, wie sie bei seinen Worten zusammenzuckte. »Na?«
»Nein.« Sie begann, an dem zerknüllten Taschentuch, das sie in den Händen hielt, zu zupfen, um deren Zittern zu verbergen.
»Pflegst du ohne Kleider herumzutanzen?«
»Natürlich nicht.«
»Nie?«
In ihrer Antwort hatte eine Spur von Unsicherheit gelegen.
»Nun ja, manchmal in meinem Schlafzimmer - aber natürlich nur, wenn ich allein bin. Nie vor anderen Leuten.« Sie wäre vor Scham gestorben, wenn jemand sie in diesen Augenblicken gesehen hätte, wo sie sich der Vorstellung hingab, auf der Bühne von Covent Garden zu stehen und vor einem Publikum zu tanzen, das sie als die größte Tänzerin des Jahrhunderts feierte.
»Vor irgendwelchen deiner Freundinnen?«
»Nein.« Vor diesen zuallerletzt; sie wusste, dass sie sie. wegen ihrer Fülle auslachten; und sie hätte es niemals riskiert, sich noch vermehrter Lächerlichkeit auszusetzen.
»Gut. Du kannst gehen.« Es hatte keinen Sinn, das Interview fortzusetzen. Wenn sich das Ganze endgültig als Erpressungsversuch herausstellte, würde er wissen, wie er damit fertig wurde.
Roberta stand auf, zögerte aber zu gehen. »Was - was wirst du tun, Vater?« Sie musste es wissen. Noch mehr von all dieser Ungewissheit, die sie den ganzen Tag über gequält hatte, und sie hatte das Gefühl, ihr Kopf würde platzen.
»Ich werde es dir mitteilen, wenn ich mich entschieden habe.«
Damit musste sie sich zufriedengeben. Er sah ihr nach, wie sie aus dem Zimmer ging und ruhig die Tür hinter sich schloss, ohne dabei noch einmal einen Blick zu ihm zurückzuwerfen. Erneut starrte er auf das Foto, das nun einen Kniff in der Mitte aufwies, der durch das Zusammenfalten entstanden war.
Hatte Roberta ihm die Wahrheit erzählt, oder war sie eine verdammt gute Lügnerin? Er kannte sie nicht gut genug, um das beurteilen zu können. Sie war hässlich, dick und dumm - aber gewiss war sie nicht so dumm, vor einer Kamera herumzustolzieren. Plötzlich kam ihm ein grotesker Gedanke. Roberta war schließlich seine Tochter. Vielleicht hatte sie doch etwas von seinem Verstand geerbt? Angenommen, sie hatte absichtlich für diese Aufnahme Modell gestanden?
Es war kaum zu glauben, dass die Fotos ohne ihr Wissen auf genommen worden waren. Was für eine Alternative gab es also? Dass sie von einem aus dieser Nachtclubbande, mit der sie zu verkehren pflegte, dazu gebracht worden war, ein raffiniertes Erpressungsmanöver zu starten? Sollte er für das Negativ eine große Summe erhalten? Und wenn ja, würde dann das Geld geradewegs in die Taschen von Roberta und ihren Bekannten fließen?
Sie mochte ihn nicht, das wusste er. Wollte sie ihm mit Hilfe seines Bankkontos an den Kragen?
Aber bis jetzt gab es keinerlei Beweise für diese Theorie. Am besten wartete er darauf, was der Morgen bringen würde. Es schien wahrscheinlich, dass sich eine Geldforderung bei der Post befinden würde. Was auch geschehen mochte, er wollte die Angelegenheit regeln, ohne zur Polizei zu gehen. Er wollte keinen Skandal.
Am nächsten Morgen sah er die Post durch, aber sie enthielt keinen Brief und keine Forderung. Es war ein schöner Tag; die Sonne lag bereits warm auf den glatten Rasenflächen draußen und funkelte auf dem Wasser des kleinen Sees, der von dem in Elfenbein und Gold gehaltenen Frühstückszimmer aus zu sehen war. Staves nahm sich noch mehr Toast, Butter und Orangenmarmelade und war leidlich befriedigt.
Offensichtlich handelte es sich um einen Nervenkrieg. Die Erpresser wollten ihn noch eine Weile zappeln lassen, in der irrtümlichen Annahme, dass die Ungewissheit seine Entschlusskraft schwächen würde. Für eine Sekunde umspielte ein dünnes Lächeln seinen Mund. Wenn es so war, würden die Betreffenden einen Schock erleben.
Als er zum Rolls-Royce hinaustrat und dem Chauffeur, der ehrerbietig die Wagentür aufhielt, kurz zunickte, schob Lord Staves alle Gedanken an Roberta und das Foto beiseite. Jetzt galt es, Geschäfte zu erledigen, wirkliche Geschäfte.
Der Earl of Staves war Vorstandsmitglied vieler Gesellschaften in der Stadt, sein Aktienbesitz erstreckte sich auf Reedereien, Zementwerke, Glas- und Maschinenfabriken. Den Grundstock des gegenwärtigen Levenside'schen Reichtums hatte sein Vater, der vorige Earl of Levenside, während des Ersten Weltkriegs gelegt. Die Familie, von jeher wohlhabend, hatte sich während dieser Zeit zur Klasse der Millionäre aufgeschwungen.
Der verstorbene Earl hatte die Erbschaftssteuer umgangen, indem er rechtzeitig sein Vermögen seinem Sohn übertragen hatte; und der derzeitige Lord Staves hatte das Vermögen, das er sieben Jahre vor dem Tod seines Vaters übernommen hatte, mehr als verdoppelt; und es sah ganz so aus, als würde er es im Lauf weniger Jahre nochmals verdoppeln.
Sein Eintreffen in seinem Büro in der Leadenhall Street verlief unauffällig wie immer. Ein winziger privater Aufzug brachte ihn geradewegs in den obersten Stock hinauf; und als er die Lifttür öffnete, befand er sich in seinem eigenen Büro. Es war nicht sehr groß, aber luxuriös ausgestattet, mit Mahagonitäfelung und einem dazu passenden Schreibtisch, auf dem vier Telefonapparate standen. Eine Glastür führte auf einen mit vielen Blumenkästen geschmückten Balkon, von dem aus man eine schöne Aussicht auf die St.- Pauls-Kathedrale und, im Hintergrund, das Nelson-Denkmal hatte.
Genau auf der Mitte der Löschblattunterlage auf dem Schreibtisch lag ein Stapel Korrespondenz, und er las sie schnell durch, bevor er auf den Klingelknopf drückte, um sei- sen Privatsekretär, Gordon Wyldes, zu rufen.
Wyldes hatte für seinen Vater gearbeitet und war nun bereits seit fünfzehn Jahren beim derzeitigen Earl of Staves tätig. Er war beinahe sechzig, breitschultrig und größer als sein Arbeitgeber, jedoch so diskret, dass er es immer schaffte, anderen Männern, einschließlich Lord Staves, den Eindruck zu vermitteln, sie seien größer als er. Er war Witwer, eifriger Ruderer und liebte es ausgesprochen, die Ideen seines Chefs im Detail auszuarbeiten.
Es war eine gute Partnerschaft, denn Wyldes war sich immer der Tatsache bewusst, dass Lord Staves der bestmögliche Arbeitgeber für einen Mann war, der ein Talent anzubieten hatte. Lord Staves war klug genug, um zu realisieren, dass der beste Weg, Höchstleistungen aus einem Angestellten herauszuholen, darin bestand, ihn hoch zu bezahlen und ihn so oft zu loben, wie Anlass dazu bestand; und Wyldes hatte durch die Tips des Earl ein hübsches Vermögen erworben.
Lord Staves blickte auf den Block, auf dem die Verabredungen vermerkt waren. »John Poynder.« Er blickte auf. »Nun? Was soll ich ihm sagen?«
Der Sekretär lächelte. »Er ist ein guter Bursche. Jung, natürlich, aber er lernt dazu, und zwar gut. In fünf oder sechs Jahren...«
Staves nickte. Er wusste genau, was der andere dachte. John Poynder war als jüngster Assistent Wyldes’ eingestellt worden und zudem mit diesem entfernt verwandt. In fünf oder sechs Jahren würde sich Wyldes zur Ruhe setzen, und er hoffte wahrscheinlich, dass Poynder dann den freigewordenen Posten bekommen würde.
Lord Staves hatte den Werdegang des jungen Mannes jedes Vierteljahr überprüft; und nun war es an der Zeit, Poynder mitzuteilen, was die Zukunft für ihn parat hielt. Er war ein gutaussehender Junge, stammte aus einer guten Familie und war ein guter Arbeiter. Einmal oder zweimal hatte sich Staves gefragt, ob Poynder nicht einen passenden Schwiegersohn abgeben würde. Ganz sicher war er wesentlich besser als irgendein Junge aus der albernen Gesellschaft, die Roberta bevorzugte, aber die Idee war kaum mehr als eine träge Spekulation gewesen. Poynder hatte kein Geld, aber das spielte keine Rolle; was eine Rolle spielte, war, dass er intelligent war.
»Ich möchte ihn jetzt sprechen. Ich habe zehn Minuten Zeit.«
»Ich werde ihn hereinschicken.« Wyldes ging mit stiller Befriedigung hinaus. Wenn Seine Lordschaft gefunden hätte, dass mit dem jungen Mann etwas nicht stimmte, so wäre der Sekretär darüber informiert worden. Er ging geradewegs in das winzige Büro Poynder. »John, geh gleich ins Büro des Chefs.«
John Poynder blickte auf und erhob sich dann. Er war groß, fünfundzwanzig und hatte dichtes schwarzes Haar und graue Augen. Sein sonngebräuntes Gesicht war Reicht besorgt, während er »eine Krawatte zurechtrückte. »Ist es soweit?«
»Ja.«
John zwang sich zu einem Grinsen. »Na, es wird jedenfalls eine Erleichterung sein, endlich das Urteil zu hören.«
Wyldes nickte zustimmend. John war ein guter Bursche; er hatte nie versucht, aus ihm, Wyldes, herauszubekommen, was Lord Staves über seine, Johns, Aussichten, seinen Job zu behalten, dachte. »Viel Glück, mein Junge!«
»Danke.«
Trotz allem schwitzte John leicht, als er vor Staves’ Büro eintraf, und er blieb einen Augenblick stehen, um sich das Gesicht mit einem Taschentuch abzuwischen. Dann klopfte er und öffnete die Tür, wobei er das Gefühl hatte, als presse eine Hand seinen Magen zu Brei. »Sie wollen mich sprechen, Sir?«
Lord Staves wies mit dem Kopf zu einem Stuhl hinüber und wartete, bis sich der junge Mann gesetzt hatte. »Nun, John, wieviel Fehler haben Sie gemacht, während Sie hier bei mir gearbeitet haben?«
Das war die letzte Frage, die John erwartet hatte - und genau deshalb hatte Lord Staves sie gestellt. »Ich - das kann ich nicht sagen, Sir, nur dass es eine Menge waren.« Das war eine trübe Eröffnung eines Gesprächs, und er fühlte sich, was seine Zukunft anbetraf, um nichts sicherer.
Sein Chef starrte auf ein Blatt Papier, das er in der Hand hielt. »Sie haben neun Fehler gemacht.«
»So viele, Sir? Das tut mir leid.«
»Noch mehr, fürchte ich. Neun wesentliche Fehler.«
Das Sonnenlicht wurde, was John anbetraf, trüber. »Es tut mir leid, Sir. Ich habe mein Bestes getan.«
Lord Staves nickte. »Ich habe gehört, dass Sie, sobald Sie merkten, dass Ihnen ein Fehler unterlaufen war, dies mit meinem Sekretär besprochen haben. Nicht wahr?« Er nickte erneut, diesmal anerkennend. »Das ist gut. Jeder macht Fehler, John. Ich erwarte, dass die Leute in dieser Organisation gelegentlich Fehler machen. Dagegen ist kein Kraut gewachsen.
Aber was ich nicht erwarte und was ich auch nicht dulden würde, ist, wenn jemand einen Fehler macht und versucht, das zu verbergen. Solche Leute nützen mir nichts, mein Junge, und sich selbst auch nichts. Wenn nur Leute, die Fehler gemacht haben, genügend Grips hätten, ihren Irrtum sofort einzugestehen - nun, dann wäre die Erde ein wesentlich erfreulicherer Ort, und jeder wäre glücklicher.«
Für John kam die Sonne wieder heraus. Das, was Lord Staves sagte, klang nicht, als ob es sich um eine Entlassung handelte.
»Ein Mensch, der versucht, einen Fehler zu verdecken, ist dumm, John. Vergessen Sie das nicht, und wir werden gut miteinander auskommen.« Er lächelte. »Nun, was halten Sie davon, wenn ich Sie unter die Stammangestellten einreihe?«
Die Erleichterung war so enorm, dass Poynder seine Zustimmung am liebsten herausgeschrien hätte; aber er schaffte es, seine Stimme ruhig klingen zu lassen. »Ich - nichts, was mir lieber wäre, Sir.«
»Dann werde ich meinen Sekretär beauftragen, passende Vereinbarungen auszuarbeiten.« Einer der Telefonapparate begann zu klingeln, und er streckte die Hand aus, um den Hörer abzunehmen. »Ja?«
»Hier ist Simpson, Mylord.«
»Ja, was ist?« Nie zuvor hatte ihn sein Diener angerufen.
»Da ist - da ist etwas Schreckliches passiert, Mylord. Es - ist Lady Roberta. Sie ist tot.«
Zweites Kapitel
Simpson, mit bleichem Gesicht und zitternd, wartete unten an der Treppe, die zum Vordereingang des Schlosses hinaufführte, als Lord Staves’ Rolls-Royce vorfuhr. Etwas weiter vorn parkte ein Polizeiwagen, und ein Constable in Uniform stand oben auf der Treppe.
»Das - das ist schrecklich, Mylord.« Simpsons Stimme war kaum hörbar. Die Anwesenheit des Polizeibeamten schien ihn zu stören, denn er blickte immer wieder zu dem Mann empor.
Der Constable grüßte mitfühlend und ehrerbietig, als Lord Staves an ihm vorbeiging, während Simpson erklärte, was vorgefallen war. Die beiden Männer gingen durch das Haus in den Rosengarten und wandten sich dann nach links durch den Torbogen, der zu dem gepflasterten Hof vor den Ställen führte. Mehrere Männer standen in einer Gruppe zu Füßen des Uhrturms; und einer von ihnen, ein Chefinspektor in Uniform, kam herübergeeilt, als er den Earl kommen sah.
»Chefinspektor Miller, Mylord«, stellte er sich vor.
Staves nickte kurz und starrte dann zu dem Turm empor. Er war ein verrücktes Monstrum, vor beinahe dreihundert Jahren von einem exzentrischen Vorfahren erbaut. Der Turm bestand aus rotem Backstein, war viereckig und sieben- bis achtundzwanzig Meter hoch. Auf der Südseite war etwa sieben Meter unterhalb des flachen Turmdachs eine rautenförmige Uhr eingelassen.
Den Zugang zum Dach bildete eine Wendeltreppe, die in der Mitte des Turms hinaufführte; und Roberta hatte die Gewohnheit gehabt, das flache Dach zum Sonnenbaden oder als Refugium zu benutzen, wenn sie allein sein wollte. Eine etwa einen Meter hohe Mauer umgab das Dach, und an der Südseite fiel der Turm steil bis zum Hof ab.
Der Chefinspektor bildete auf die beiden Männer. Simpson, der Diener, zitterte und sah aus, als fiele er jeden Augenblick ohnmächtig um, aber dem Gesicht Seiner Lordschaft war nichts anzumerken. Zum ersten Mal begann sich der Polizeibeamte zu fragen, ob nicht doch etwas an der Theorie des Standesunterschiedes wäre: Lord Staves nahm das Ganze mit der Würde eines, wie man zu sagen pflegte, wirklichen Gentlemans auf.
»Nach allem, was ich gehört habe, Mylord, stieg die Verstorbene - äh, Lady Roberta - auf die Spitze des Turms.«
»Das hat sie oft getan.«
»Ganz recht, Mylord. Wurden ärztlicherseits bei ihr irgendwelche Neigungen zu Ohnmacht- oder Schwindelanfällen festgestellt?« Er zögerte und fuhr dann eilig fort: »Natürlich, Mylord, wenn Sie vorziehen, jetzt keine Fragen zu beantworten...?«
»Wenn sie gestellt werden müssen, werde ich sie jetzt beantworten.«
Aber es gab wenig oder nichts Nützliches, was er der Polizei mitteilen konnte. Roberta war allein auf den Turm hinaufgestiegen, ohne dass jemand der Hausangestellten es gemerkt hatte, aber darin lag nichts Ungewöhnliches, denn sie hatte es oft getan.
Der Earl wurde sich der mitleidigen Blicke der Männer bewusst, die noch immer um den Fuß des Turms versammelt waren. Als er näher trat, wichen sie beiseite, und er blieb stehen, als er ein paar unheimliche Spuren auf dem Pflaster erblickte. »Was, glauben Sie, ist passiert?«, fragte er.