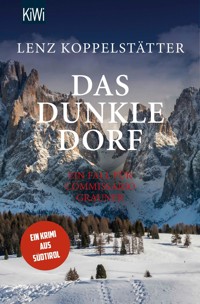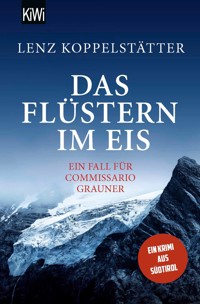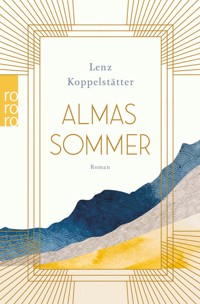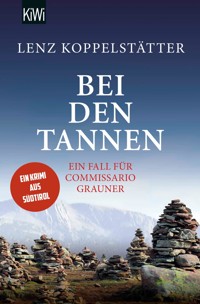Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: argon
- Kategorie: Krimi
- Serie: Commissario Grauner ermittelt
- Sprache: Deutsch
Alpenkulisse, italienisches Flair und ein raffinierter Fall – ein Muss für alle Südtirol-Fans Nachts auf dem Gletscher, da gehört der Mensch nicht hin. Da sind nur die Geister der Toten und der Sturm und der Schnee. Trotzdem entdeckt Skipisten-Toni im Dezember hoch oben ein seltsames Licht – und wenig später die Leiche eines Einsiedlers. Mit einer Pfeilspitze in der Schulter. Fast am selben Ort, an dem viele Jahre zuvor Ötzi, die weltberühmte Steinzeitmumie, gefunden wurde, die mittlerweile im Bozener Museum liegt. Ebenfalls von einer Pfeilspitze durchbohrt. Commissario Grauner, der an manchen Tagen lieber nur »Viechbauer« wäre, macht sich im tief verschneiten Schnalstal an die Ermittlungen. Unterstützt wird er von Saltapepe, seinem jungen Ispettore aus Neapel, der noch immer nicht versteht, was die Einheimischen an den Bergen finden. Zwischen Dorfintrigen, wortkargen Bewohnern, glühweinseligen Touristen, den kriminellen Machenschaften eines Skiliftunternehmers und kuriosen Ötzi-Spuren entwickelt sich ein hochspannender Fall, der weit in die Vergangenheit führt und die Ermittler vor immer neue Rätsel stellt.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lenz Koppelstätter
Der Tote am Gletscher
Ein Fall für Commissario Grauner
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Lenz Koppelstätter
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Lenz Koppelstätter
Lenz Koppelstätter, Jahrgang 1982, ist in Bozen geboren und in Südtirol aufgewachsen. Nach dem Studium der Politik in Bologna und der Sozialwissenschaften in Berlin absolvierte er in München die Deutsche Journalistenschule. Als freier Autor hat er u. a. für den Tagesspiegel und Zeit Online gearbeitet, als Textchef für zitty – außerdem als Kolumnist und Medienentwickler für verschiedene Verlage, Magazine und Zeitungen. »Der Tote am Gletscher« ist sein erster Roman.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Nachts auf dem Gletscher, da gehört der Mensch nicht hin. Da sind nur die Geister der Toten und der Sturm und der Schnee. Trotzdem entdeckt Skipisten-Toni im Dezember hoch oben ein seltsames Licht – und wenig später die Leiche eines Einsiedlers. Mit einer Pfeilspitze im Hals. Fast am gleichen Ort, an dem viele Jahre zuvor Ötzi, der weltberühmte Steinzeitmensch, gefunden wurde, der mittlerweile im Bozner Museum liegt. Commissario Grauner, der an manchen Tagen lieber nur »Viechbauer« wäre, macht sich im tief verschneiten Schnalstal an die Ermittlungen. Unterstützt wird er von Saltapepe, seinem jungen Ispettore aus Neapel, der noch immer nicht versteht, was die Einheimischen an den Bergen finden. Zwischen Dorfintrigen, wortkargen Bewohnern, glühweinseligen Touristen, den kriminellen Machenschaften eines Skiliftunternehmers und kuriosen Ötzi-Spuren entwickelt sich ein hochspannender Fall, der weit in die Vergangenheit führt und die Ermittler vor immer neue Rätsel stellt.
Hinweis für E-Reader-Leserinnen und Leser
Wenn Sie sich die Karte in Farbe und zoombar ansehen möchten, dann geben Sie bitte die folgende Internetadresse im Browser Ihres Computers oder Smartphones ein:
https://www.kiwi-verlag.de/magazin/extras/die-karten-zu-der-tote-am-gletscher
Hinweis für Leserinnen und Leser auf dem Smartphone/Tablet oder am Computer
Sie möchten sich die Karte zoombar anschauen? Dann tippen bzw. klicken Sie bitte auf die Abbildung. Es öffnet sich ein neues Fenster mit der entsprechenden Website-Ansicht.
Inhaltsverzeichnis
Hinweis
Prolog
21. Dezember
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
22. Dezember
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
23. Dezember
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
24. Dezember
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
Epilog
Danke
Leseprobe »Was der See birgt«
Die Handlung dieses Romans ist frei erfunden.
Auch alle Personen. Alle – außer Ötzi.
Den gibt es wirklich.
Prolog
Nachts auf dem Gletscher, da ist man nicht. Da hat man nicht zu sein, sagten die Leute in Schnals. Nachts auf dem Gletscher, das überlebst du nicht. Schon gar nicht im Winter, wenn es stürmt und schneit. Der Sturm ist es, der dich umbringt, sagten die Leute. Wenn der Sturm da ist, dann verlierst du die Orientierung, dann weißt du nicht mehr, wo vorne und wo hinten ist, wo Himmel und wo Erde sind, wo Gipfel und wo Tal, dann ist es aus – dann erfrierst.
Wenn kein Sturm tobte am Gletscher, dann spiegelte das eisige Weiß die Sterne wider, dann schimmerte und funkelte es.
Das Schimmern und das Funkeln, das sind die Eisgeister, erzählten seit jeher die Alten den Jungen, und die gaben es an ihre Kinder weiter. Das Schimmern und das Funkeln, das sind die Geister jener, die am Ferner, wie die Alten den Gletscher noch nannten, ihr Leben ließen, in den zurückliegenden Jahren, Jahrzehnten und Jahrhunderten. Die Geister jener, die vergangen und vergessen waren – aber immer noch nicht zur ewigen Ruhe gekommen.
Vielleicht die Geister der Schafhirten, die ihre Pamper, wie die Leute in den Tälern von Südtirol sagten, im Herbst über die Wasserscheide zu treiben versuchten – überrascht vom plötzlichen Wintereinbruch.
Vielleicht die Geister der Schmuggler, die Salz, Schnaps und Tabak von Österreich herüberbringen wollten, von der Guardia di Finanza aufgelauert, beim Versuch, über die Eiswand zu fliehen – Si fermi! Si fermi, o sparo! –, von hinten erschossen.
Wohl waren auch ein paar Geister der aufständischen Bauersleute von anno 1525 mit von der Partie, die während der Bauernkriege das ehemalige Kartäuserkloster plünderten; in ihrer Verzweiflung, so wurde erzählt, seien manche hoch auf den Gletscher geflüchtet, aus Furcht vor der Rache der allmächtigen Dreifaltigkeit, die sie dort oben nichtsdestotrotz in Form von Erfrierung ereilte.
Vielleicht war jüngst auch manch Geist eines unerfahrenen Tourengehers dazugekommen, der sorglos seine ersten Kurven schwang – und dann unter dem Getöse der unbarmherzigen Naturgewalt für immer verloren ging.
Der Geist der Gletschermumie vom Hauslabjoch, da zeigten Alt und Jung im Dorf unwidersprochene Einigkeit, war ganz sicher dabei. Hatte der doch über fünftausenddreihundert Winter da oben in aller Herrgottsruh unterm scheinbar ewigen Eis gelegen, bis das Eis – das so ewig, wie man dachte, doch nicht war – mehr und mehr zusammenschmolz; und bis ein wanderndes Ehepaar, vom Wege abgekommen, den Steinzeitmenschen entdeckte – den Ötzi, wie er später genannt wurde.
Die Gäste in Kurzras, dem letzten Ort des Schnalstals, wo die Straße endete und das Skigebiet begann, schwelgten bereits erschöpft vom anstrengenden Urlaubstag in ihren Träumen. Sie träumten von sonnig schönen Winterstunden, hier, inmitten der Südtiroler Alpengipfel, umzingelt von Dreitausendern, hier, am Fuße der Weißkugel, der Steinschlagspitze, der Grawand und des Bildstöckljochs.
Sie waren hergekommen, um kurz vor Weihnachten ein paar Tage Auszeit zu genießen. Weg von all dem Schmutz und Lärm der Großstädte! Hinein in die Idylle aus schwarzholzigen Bauernhäusern, weiß glitzernden Pisten, zwetschgenschnapsigen Après-Ski-Liebeleien, butterschmalzigen Knödelportionen, sonnenverbrannten Skibrillengesichtern, spabereichverschwitzten Abendstunden. Ein paar Tage Skifahren in der Alpenluft, ein paar Tage moderner Folklore. Ein paar Tage voller Sorglosigkeit – mit Ziehharmonikasound untermalt.
Alle schliefen, alle träumten. Nur der Skipisten-Toni wachte. Es war schon bald ein Uhr morgens, doch das machte ihm nichts. Er liebte das Wachbleiben. Einer muss wach bleiben, sagte Toni immer, wenn er in Rosas Bar am Budl stand. Einer muss wach bleiben und nachts auf die Geister aufpassen, damit sie oben am Gletscher verharren und nicht ins Tal kommen, sagte er immer, wenn er seinen Schwarzen mit Schuss, seinen Espresso mit Grappa, bestellte.
Toni war einer der stolzen Pistenarbeiter. Mit ihren Pistenraupen fuhren sie nachts den zu Hügeln aufgehäuften Schnee wieder platt, damit das Skivergnügen am nächsten Morgen von vorne beginnen konnte, damit sich keiner die Haxen brach. Jeder Pistenarbeiter hatte seinen Pistenabschnitt, und Toni war für den Part hinter der Grawand, ganz oben am Gletscher, verantwortlich.
Nachts, allein. Weit weg von der Talstation. Weit weg von den Leuten unten. So mochte er es.
Wach bleiben, wenn die Lifte und die Gondeln der Gletscherbahn stoppten, wenn die leeren Sessel im Wind schaukelten. Wach bleiben, wenn alle schlafen gingen. Wach bleiben, wenn es einsam und leise wurde, wenn nur noch der Wind heulte und pfiff. Wach bleiben, wenn die Geister kamen.
Normalerweise genoss Toni vom Steuer seiner Pistenraupe aus den Blick auf die Felskronen, die das Eis durchbrachen und den Himmelskörpern entgegenragten.
Doch diesmal war da nichts zu sehen. Ein Sturm war aufgezogen. Vom Süden her wölbten sich die mit schwerem Schnee beladenen Wolkenmassen über die Gipfel. Sie rauschten in Richtung Skigebiet und umhüllten es alsbald.
Toni hatte das Unwetter kommen sehen und seine Raupe vor einer der kleinen blechernen Lifthütten inmitten des Pistenkarussels abgestellt. Nun saß er in der Hütte, und weil der Sturm den Strom hatte ausfallen lassen, zündete er ein paar Kerzen an.
Die Thermoskanne mit Kräutertee stand auf dem Tisch. Das Schüttelbrot und die Kaminwurzen lagen noch im Rucksack, für später. Toni massierte sein Knie, das linke, das vermaledeite, das mehrfach kreuzbandoperierte, das seine Ambitionen, als gefeierter Weltcupfahrer sein Geld zu verdienen, vor Jahren zunichtegemacht hatte.
Kein Buch, kein Handy, keine Zeitung, keine Musik. Nur das Prasseln und das Rauschen und das Hämmern des Gletschersturms. So gefiel es dem Toni. Und halb war er schon eingenickt, da war ihm, als hätte er draußen ein Licht gesehen. Ein kurzes Flackern nur, aber ein Licht. Vielleicht waren es ja nur die Kerzen, die sich in der Scheibe spiegelten. Vielleicht war es nur das Leuchten eines Sterns, der es geschafft hatte, die dicken Wolkenmassen zu durchbrechen. Toni presste sein Gesicht an die Fensterscheibe und wartete.
Er hatte so einen Blick in den Augen, sagten die Leute in Kurzras. Er hatte diesen Blick, sagten die, die dabei gewesen waren, als der Skipisten-Toni um Hilfe schreiend durch die vereisten Straßen lief. Mitten im Sturm, in den frühen Morgenstunden, als nicht einmal mehr die Weihnachtsbeleuchtung brannte. Als er an die Türen schlug. Als sie zu ihm rausgingen, ihn zu beruhigen versuchten und ihn in die warme Stube eines der Hotels gleich neben der Piste brachten.
Er hatte diesen Blick in den Augen, sagten sie. Und auch die Kinder auf dem Schulhof erzählten es sich. Der Toni hatte diesen Blick in den Augen, den Blick, der einem bleibt, manchmal für immer. Den Blick, der jenen bleibt, die unvergesslich Grauenhaftes gesehen haben. Etwas, das sich einfrisst in deine Erinnerung und in deine Seele und in deinen Verstand.
21. Dezember
1
Es war wie immer nur dieser eine Moment. Grauner lag zwar schon eine Weile wach, aber seine Sinne waren noch von Träumen umhüllt. Dann ertönte das Piepsen seiner Armbanduhr, ein Fremdton, der den Schwebemoment ohne Vorwarnung auslöschte.
Grauner blinzelte und zählte bis drei. Dann schob er vorsichtig das Federbett beiseite, strich seiner Frau sanft übers Haar und lief barfuß am Zimmer von Sara, seiner vierzehnjährigen Tochter, vorbei ins Bad.
Den Rücken durchstrecken. Hose runter. Den Hintern auf die eisige Kloschüssel. Hände vors Gesicht.
Herrgott im Himmel, du verfluchter! Du vermaledeiter! Jesus, Maria und Josef! Heiliger Freinademetz! Heiliger Anton! Heilige Cäcilia! Heiliger Alpenflorian! Heilige Barbara! Heilige Notburga! Heiliger Hubert! Heiliger Michl! Heiliger Pimpam!
Grauner fluchte. Zuerst noch einigermaßen amtsdeutsch, dann wechselte er immer mehr in den Südtiroler Dialekt, um schließlich bei einer Mischung aus Dialekt und Italienisch zu landen. Weil sich’s so besser fluchte, weil es so noch böser klang.
Oschpralattn! Madonniga! Puttinziga! Sappralotti! Fockoletti! Zio Zoschtia! Zio Flittn! Zio Teggn! Porca Vacca! Porco Tschuda! Porca la Miseria! Miseronia! Puttanesca! Cavolonia! Cavoletti!
Grauner war kein böser Mensch. Außer morgens, wenn die Uhr piepste, da konnte er ganz schön grantig werden. Da konnte er alle bösen Menschen verstehen, denen er in seinem Leben schon begegnet war. Da konnte er verstehen, wo dieses Böse herkam, da verstand er, dass es tief im Inneren eines jeden schlummerte und dass es manchmal nicht mehr als so ein Piepsen brauchte, um es hervorzubringen.
Grauner griff nach dem Klopapier. Vor ein paar Jahren hatte er ein Abkommen mit dem lieben Gott geschlossen: Einmal am Tag durfte er sich über alles beklagen. Morgens wurde geflucht, dafür aber den ganzen Tag lang nicht mehr, und abends betete er ein Vaterunser. So waren sie quitt, der Commissario Johann Grauner vom Graunerhof, hoch über dem Eisacktal, und der liebe Gott, hoch oben im Himmel.
Frühmorgens Bauer sein, tagsüber Commissario, hast ja recht, lieber Gott, es hätt’ mich auch schlimmer treffen können, murmelte Grauner, ging zurück ins Schlafzimmer, zog sich was über und schlüpfte in die dicke Windjacke und in die grünen Plastikstiefel. Dann ging er rüber in den Stall.
Es hatte geregnet in der Nacht. Schneeregen. Weiter im Westen, im Vinschgau und in dessen Seitentälern, musste es wohl heftiger getobt haben. Grauner schaute auf die Uhr. Es war ein paar Minuten vor halb sechs.
Der alte Kassettenrekorder stand auf einem der dicken Holzbalken, die sich über den Köpfen der Kühe durch den Stall zogen. Als Student hatte Grauner darauf das Beste von damals gehört, doch das langweilte ihn mittlerweile, und das Beste von heute gefiel ihm nicht.
Irgendwann war seine Liebe zu Mahler entflammt, Gustav, dem Spätromantiker, bei einem Konzert unten in der Stadt, zu dem ihn seine Frau überreden konnte.
»Weil du mir sonst versauerst«, hatte die Graunerin gesagt und ihm die Konzertkarten in die Hand gedrückt. Erst wollte er nicht, schließlich war er doch mitgekommen. So wie immer.
Spätromantiker, das hatte auch in der Kurzbeschreibung gestanden, die im Libretto abgedruckt war. Ein Spätromantiker, sagte sich Grauner, das bin ich auch. Bei Disco Star, gleich um die Ecke der Questura in Bozen, kaufte er ein paar Kassetten, was nicht einfach war, da der Besitzer des Ladens schon seit Ende des letzten Jahrtausends kaum noch Kassetten führte und mehr dem Heavy Metal denn der Klassik zugetan war, doch es ließ sich organisieren. Und von da an pfiff Grauner tagein, tagaus Mahlers Sinfonien vor sich hin und war bald davon überzeugt, dass die Kühe beim Erklingen des Allegro risoluto aus der Siebten die bessere Milch gaben.
Wohl wissend, dass alle im Dorf darüber lachten, ließ er nicht ab von der musikalischen Beschallung während des Melkens. Im Gegenteil. Er drehte die Musik von Jahr zu Jahr lauter. Je lauter Mahler ertönte, desto weniger war in Grauners Kopf das Geraune der Leute zu hören. Und desto weniger kam die Vergangenheit zutage, deretwegen sie nach all den Jahren immer noch tuschelten.
Er drückte auf Play und streichelte Margarete über den dicken Bauch. Zwei Kälblein trug sie in sich. Vielleicht ein Weihnachtswurf, hatte der Viechdoktor gesagt. Drei Tage waren es noch bis zur Bescherung.
»Ruhig, Grete, ruhig«, flüsterte Grauner.
Die Wärme der prallen Kuhleiber, der Klang der Siebten. Viechbauer, das war es, was er immer hatte werden wollen. Den Hof bewirtschaften, gemeinsam mit Alba, die er liebte, seitdem er sie als Erstklässler zum ersten Mal gesehen hatte. Die ihn verstanden hatte, vom ersten Tag an. Die er verstand, auch ohne groß zu reden.
Doch Bauer sein, das reichte in den heutigen Zeiten nicht zum Leben, das hatte sein Vater schon richtig erkannt. Der Bub muss studieren, das hatte auch seine Mutter irgendwann einsehen müssen. Grauner war also nach Verona gegangen als junger Maturant, in die große, weit entfernte Universitätsstadt, jenseits des Tales, jenseits von Südtirol. Er hatte sich für die Juristerei entschieden. Seinen Vater und seine Mutter hatte er nicht mehr wiedergesehen.
Er schloss das Studium mit Auszeichnung ab, mit Centodieci e Lode – mit der Bestnote und einem Sternchen obendrauf. Seine Eltern wären stolz auf ihn gewesen, aber seine Eltern waren nicht mehr. Er wollte den Hof wieder auf Vordermann bringen, und da war dieser Wunsch, der schon seit Langem in ihm schlummerte, besonders seit dem Unfassbaren, das über seine Familie gekommen war.
Sein Wunsch war es, Commissario zu werden. So wie die Helden seiner Kindheit, die im Schwarz-Weiß-Fernseher, der in der Stube stand, den Schrecken der Welt ein wenig linderten. Als just zu dem Zeitpunkt seines Studienabschlusses bei der Polizei einige Stellen ausgeschrieben wurden, reichte er seine Bewerbung ein, gewann den Concorso und arbeitete sich recht schnell vom Ispettore zum Ispettore Capo und über einen erneuten Wettbewerb zum Commissario hoch. Nicht etwa durch Beziehungen – zu einem Staatsanwalt, zum Bischof, zu einem Parlamentarier, zu wem auch immer –, wie es in ganz Italien Alltag war. Nein, er schaffte es durch Ermittlungserfolge. Insbesondere draußen in den Dörfern, wo manch Polizist nur mit Ach und Krach der deutschen Sprache, geschweige denn dem Südtiroler Dialekt beizukommen vermochte, war Grauners Geschick gefragt.
Commissario sein, Verbrecher jagen. Das war ihm mittlerweile ebenso lieb wie Bauer sein. Fälle lösen. Auch den einen, sagte er sich. Dann würde das Geraune endlich verstummen, das hoffte er. Und die Bilder aus dem Kopf verschwinden, die ihm keine Ruhe ließen, das hoffte er noch viel mehr. Irgendwann würde dieser Fall, sein Fall, gelöst sein, das schwor er sich. Er schwor es sich jeden Morgen, wenn er sich im Spiegel sah.
Das Klingeln, es gehörte nicht zum Rondo-Finale der Siebten. Es kam von draußen. Es war das Klingeln des Haustelefons.
»Claudio ist am Apparat.« Die Stimme seiner Frau hallte über den Hof.
Ein Anruf von Ispettore Claudio Saltapepe. Grauner wusste, was das zu bedeuten hatte.
2
»Das waren nicht die Sterne. Das war das Licht einer Stirnlampe«, sagte der Skipisten-Toni, als sie ihm in der Stube die nassen Kleider vom Leib zerrten, ihn in warme Pamperwolldecken hüllten, ihm den Rücken warm rieben und ihm einen doppelten Schwarzen machten – mit einem doppelten Schuss darin.
Drei Männer von der Bergrettung, das halbe Dutzend Pistenarbeiter, der Direktor des Hotels, in das sie ihn gebracht hatten, und zwei Gäste, die durch Tonis Geschrei wach geworden waren, standen um ihn herum.
»Da war einer am Gletscher. Der irrte da umher, mitten im Sturm«, begann Toni zu erzählen. Er sprach stotternd und zähneklappernd. Seine Männer wickelten ihm einen Verband um die Wunde an seiner Stirn. »Das Licht ist über den Rand der Pisten hinausgewandert. In die Richtung der ausgesetzten Stellen, dahin, wo sich im vergangenen Sommer besonders viele Gletscherspalten gebildet haben. Wenn der da reingeht, habe ich mir gedacht, wenn der da in einen der Risse stürzt – dann ist der tot. Wenn er Glück hat, sofort. Wenn er Pech hat, dann bricht er sich alle Knochen und liegt da tagelang. Da kann der schreien, wie er will. Da hört den keiner.«
»Dann verendet der elendig«, sagte einer von der Bergrettung.
»Dann hilft auch kein Beten mehr«, seufzte der Hotelchef.
Toni erzählte weiter und die, die sich um ihn versammelt hatten, erzählten es später allen anderen. Dass er in dem Moment keine zwei Sekunden nachgedacht hatte. Dass ihm das Adrenalin ins Hirn geschossen und er sofort rausgelaufen war. Weil er dadrin ja nicht einfach so sitzen bleiben konnte, während einer da draußen womöglich ums Leben kam.
Toni fuhr also in Richtung des Lichtstrahls. Vollgas fuhr er. Immer wieder schlug die Pistenraupe gegen einen der Schneehügel, immer wieder riss es ihm die Hände vom Steuer. Irgendwann verlor er die Orientierung. Irgendwann umhüllten ihn Wolken und Wind, und es war ihm, als ob der Sturm ihn mitsamt seinem Gefährt im Kreis drehte. Er wusste nicht mehr, wo vorne und wo hinten war. Wo Himmel und wo Erde. Wo Gipfel und wo Tal.
Doch plötzlich sah er etwas im Scheinwerferlicht. Mitten im Tiefschnee, da war jemand. Toni machte den Motor aus und sprang vom Gefährt.
»Obacht, da sind Gletscherspalten!«, rief er.
Doch die Gestalt, die mit dem Rücken zu ihm stand, reagierte nicht. Noch zehn Meter war Toni von der vermummten Person entfernt, als er sah, wie sie etwas in den Schnee fallen ließ. Ein schwerer Rucksack, dachte Toni zuerst, aber viel Zeit zum Denken hatte er da schon nicht mehr, denn die Gestalt drehte sich in diesem Augenblick um und stapfte auf ihn zu. Sie trug eine Mütze, eine Skibrille und einen Schal ums Gesicht.
Toni versuchte noch, das Funkgerät aus der Seitentasche der Skihose zu holen. Er wollte noch den einen Handschuh ausziehen, um die kleinen Knöpfe bedienen zu können, doch da schlug der Vermummte ihm das Gerät aus der Hand.
Im nächsten Moment spürte Toni einen Schlag an der Schläfe, er spürte, wie ihm das warme Blut übers Gesicht lief und sah noch, wie die Gestalt auf seine Pistenraupe kletterte und die Lichter talabwärts verschwanden. Dann sank er zu Boden.
Toni hatte wohl für einige Sekunden das Bewusstsein verloren, und als er wieder zu sich kam, tobte der Sturm immer noch.
Blind suchte er den Schnee ab und ertastete etwas. Es war kein Rucksack. Er kroch näher ran und roch es. Toni kannte den Geruch. Jeder im Tal kannte ihn. So rochen die Ladeflächen der Jäger und Wilderer, wenn sie eine Gams geschossen hatten und sie mit ihrem Geländewagen zu Rosas Bar brachten, um dort eine Runde auszugeben.
Es roch nach totem Blut. Aber Gams war das keine. Denn das, wonach Toni da mit den Händen fasste, war kein Fell, das war kalte Haut.
Ihm kam die Galle hoch. Er würgte und spuckte und rieb sich Schnee ins Gesicht, um nicht ein zweites Mal das Bewusstsein zu verlieren. Er irrte umher und verlor das Zeitgefühl. Mehrmals fiel er hin, sein kaputtes Knie schmerzte, und er schrie gegen den Sturm an, er schrie den Schmerz in die kalte Nacht hinaus. Nur durch Glück und Zufall hatte er irgendwann wieder die Piste unter den Bergschuhen gehabt.
3
Rauf und runter. Und wieder rauf und wieder runter. Das waren die Wege, die ein Commissario zu machen hatte, auf diesem durch Berge, Täler und Schluchten zerstückelten Alpenfleck.
Rauf zu den Bergdörfern und Bergbauernhöfen, die sich wie Farbkleckse dahingeworfen an den steilen Hängen festzukrallen schienen. Runter zu den Dörfern und Städtchen in den Tälern, um die herum der fruchtbare Boden alles sprießen ließ, was es zum Leben brauchte. Wo nun im Winter Schnee lag, gediehen sonst saftige Äpfel, mancherorts Spargel, anderswo Erdbeeren, im südlichsten Zipfel sogar Zitronen, und wo Ebene und Berghang ineinander übergingen, da wuchsen der Vernatsch, der Lagrein, der Blauburgunder, der Weißburgunder, der Sauvignon und der Gewürztraminer.
Rauf und runter und wieder rauf, dem blauen Himmel entgegen, wo das Glück der Sonne einen anstrahlte, doch wo, wenn die Gipfel lange Schatten warfen und dunkle Wolken aufzogen, das Grauen noch wuchtiger zu Buche schlug. Wo es dreifach schön ist, ist der Schrecken dreifach schrecklich, das wussten die Leute in den Tälern von Südtirol, und Grauner wusste das auch. Es gab wieder einen Toten, einen Mord. Danach sah es aus.
Seit sechs Jahren war Grauner Commissario in Südtirol, einer Provinz, die durch eine Schlamperei der Weltpolitik nach dem großen Krieg Italien zugesprochen worden war. Während des Faschismus hatte Mussolini alles Deutsche im dazugewonnenen Gebiet tilgen wollen, um vorzutäuschen, dass dieses Alto Adige, diese Region, wo die Etsch entsprang, immer schon rein italienisch gewesen sei – doch es gelang ihm nicht.
Nach 1945 erkämpften sich die deutschsprachigen Südtiroler mit viel politischem Geschick eine weitreichende Autonomie – manch einer sagte, ein paar der in den 1960er-Jahren gesprengten Strommasten hätten ebenfalls dazu beigetragen. Und nachdem Tiroler und Italiener sich zu Anfang verachtet hatten, sich später mal neckten und mal beschnupperten, beeinflussten sie sich nunmehr im Guten wie im Schlechten.
Das Ländchen in den Bergen erblühte, der Obstbau und der Weinbau florierten und der Tourismus sowieso. Politisch ließ man sich von Rom alsbald nicht mehr viel dreinreden, was nicht hieß, dass man nicht weiter auf die Hauptstadt schimpfte. Was guttat. Denn gemeinsam jemanden zum Abwatschen zu haben, das schweißte zusammen und lenkte von der eigenen Kungelei ab.
Eine halbe Million Menschen lebte in Südtirol. Rund hunderttausend davon in der Landeshauptstadt Bozen, wo auch die Polizei ihren Sitz und Grauner sein Büro hatte. Der weitaus größere Teil der Bevölkerung aber wohnte in den über hundert Gemeinden und den paar Städtchen, die sich auf die einzelnen wie in einem Baumgeäst verzweigten Täler verteilten.
Eingeklemmt zwischen Österreich, der Schweiz und Italien, das hier ja erst so halb anfing, offerierte Südtirol dem Besucher beides: Tiroler Kultur und südländisches Flair, Ordnungssinn und Dolce Vita, Knödel und Pizza.
Die einen pflegten, so wie Grauner, einen für Neulinge unentschlüsselbaren deutschen Dialekt, der in jedem Tal und jedem Dorf anders klang. Die anderen parlierten so wie Ispettore Saltapepe in neapolitanischem oder in toskanischem, kalabrischem und sizilianischem Singsang. Und nicht selten sprachen alle gleichzeitig und durcheinander eine Mischung aus allem.
Grauner und Saltapepe hatten die Kurstadt Meran hinter sich gelassen, nun fuhren sie ein Stück den Vinschgau hinauf, der für seine starken Fallwinde und für seine Marillen bekannt war.
Grauner war sauer. Eine gute halbe Stunde hatte der Commissario mit seinem Fiat Panda nach Bozen gebraucht, eine Stunde hatte er für die Fahrt über die MeBo nach Meran und weiter ins hinterste Schnalstal hinein eingeplant. Sie hatten vereinbart, dass er Saltapepe um sieben abholen würde. Um kurz vor halb acht war der junge Ispettore endlich einsatzbereit gewesen, hatte aber unbedingt in der Bar dello Stadio noch einen Cappuccino trinken und ein Cornetto frühstücken wollen. Saltapepe wohnte gleich neben dem heruntergekommenen Fußballstadion, das der FC Südtirol für seine Heimspiele nutzte. Der Commissario interessierte sich nicht für Fußball. Er interessierte sich auch nicht besonders für die Kaffee-Manie seines jungen Kollegen. Alba fand Saltapepe nett. Zuvorkommend, freundlich, ein »fescher junger Mann«, wie sie sagte. Sie versuchte Grauner jedes Mal zu besänftigen, wenn er zu Hause über den Ispettore schimpfte, aber das regte ihn nur noch mehr auf.
Er konnte mit dem Neuen nicht viel anfangen. Er wusste noch nicht mal, warum der von Neapel hierherversetzt worden war – und es war ihm auch egal. Am Gemunkel darüber, was Saltapepe wohl angestellt haben mochte, beteiligte Grauner sich nicht. Er wusste nur: Der hier zuständige Staatsanwalt, Dr. Martino Belli, hatte einem neapolitanischen Kollegen einen Freundschaftsdienst erwiesen und Saltapepe vor einem Dreivierteljahr ins Grauner-Team gesteckt.
Das passte Grauner gar nicht, denn sein Team hatte bis dahin zumeist nur aus ihm selbst bestanden, was ihm mehr als recht gewesen war. Seine Abteilung war keine Mordkommission im eigentlichen Sinne. Eine Mordkommission gab es bei der Südtiroler Polizei nicht, dafür wurde zu wenig gemordet. Aber wenn es doch einmal ernst wurde, wenn Grauner Unterstützung brauchte, schnappte er sich meistens den erstbesten Streifenpolizisten, der ihm begegnete, oder er beauftragte Silvia Tappeiner, seine junge, sportliche und ehrgeizige Assistentin, heimlich mit Ermittlungstätigkeiten.
Das italienische Polizeisystem war kompliziert. Sehr kompliziert. Da gab es auf der einen Seite die Polizia di Stato, zu der Grauner und Saltapepe gehörten. Und anderseits die Carabinieri, von den Südtirolern »Karpf« genannt. Während die Polizia di Stato mit anderen Polizeieinheiten aus europäischen Nachbarländern zu vergleichen war, bildeten die Carabinieri eine sogenannte Streitkraft des Militärs. Demnach ging es dort auch strenger zu als unter Grauners und Saltapepes Kollegen. Während sie, wenn möglich, in Zivil hinterm Schreibtisch saßen oder ermittelten, trugen die Carabinieri ihre Uniformen, die sie immer erst zum Schneider bringen mussten, weil sie stets zu groß geliefert wurden.
In ihren Aufgaben jedoch unterschieden sich die beiden Einheiten kaum. Ein sinnbefreiter Anachronismus des wildwüchsigen Exekutivapparats, fand Grauner. Beide hatten die gleichen Kompetenzen, und beide waren gleichermaßen chronisch klamm. Da kam es auch schon mal vor, dass die Einsatzwagen im Hof vor sich hin rosteten, anstatt auf Streife genutzt zu werden, weil in den Kassen das Geld für Benzin fehlte.
Die Questura der Polizei und die Kaserne der Carabinieri lagen sich an der Drusus-Brücke zudem direkt gegenüber. Doch diese räumliche Nähe verstärkte die Kooperation keineswegs, im Gegenteil, man beäugte sich, neidete die Erfolgsquote des anderen, vermied es tunlichst, zusammenzuarbeiten, dem Konkurrenten in einem Fall zu Hilfe zu eilen, geschweige denn Akten zuzuspielen, die hilfreich wären. Und das, obwohl beide schlussendlich ein und derselben Staatsanwaltschaft unterstanden, die wiederum ihren Sitz am Gerichtsplatz im Westen der Stadt hatte.
Wer die Fälle zu lösen bekam, Polizei oder Carabinieri, entschied mehr oder weniger der Zufall – je nachdem, welche der beiden Einheiten zuerst zum Ort des Verbrechens gerufen wurde. In den Städten war es meist die Polizei und in den Dörfern die Carabinieri. Nur bei den ganz heiklen Fällen in den hintersten Dörfern der Provinz griff Staatsanwalt Belli ein und schickte stets Grauner. Und neuerdings auch Saltapepe.
Ein paar kleinere Fälle hatten die beiden in den vergangenen Monaten bereits zusammen gelöst. Mehr nebeneinanderher als gemeinsam. Einen Drogenumschlag auf der Einfahrt zur Brennerautobahn in Bozen-Süd, bei dem der Ispettore den entscheidenden Tipp von einem ehemaligen Kollegen aus Kampanien bekommen hatte.
Ein gegen einen Baum gefahrener Traktor auf der Seiser Alm; der vermeintliche Unfall stellte sich nach intensiverem Verhör als Racheakt eines benachbarten Bauern heraus, der die Bremskabel durchtrennt hatte.
Ein paar Familienzwiste und Nachbarschaftsstreitereien in Bozen und Umgebung.
Doch jetzt hatten sie es allem Anschein nach mit Mord zu tun. Das war ein anderes Kaliber. Der Commissario war sich nicht sicher, wie sich sein stark von der Tagesform abhängiger Ispettore – manchmal übereifrig und manchmal der Lethargie zugeneigt – dabei schlagen würde.
Warum sagte der denn nichts? Wenn man beleidigt war, dann sagte man doch was. Dann schwieg man doch nicht. Dann brüllte man herum.
Saltapepe verstand diesen Commissario nicht. Auch nicht diese Provinz, in die er da versetzt worden war. Und erst die Sprache! Zweimal in der Woche besuchte er einen Deutschkurs. Das Schriftdeutsch parlierte er mittlerweile passabel, auch dank seines Onkels, der in Deutschland bei Opel arbeitete und Saltapepe schon als Kind einiges beigebracht hatte.
Aber der Dialekt? Nein, darauf hatte ihn sein Onkel nicht vorbereitet. Das war ein hartes Stück Arbeit, und in den hintersten Tälern musste Saltapepe oft drei Mal nachfragen, bis er glaubte alles verstanden zu haben.
Dabei war die Sprache noch nicht alles. Dieser Fußball! Santo Cielo! Das war sogar noch schlimmer! Die Drittligaspiele des FC Südtirol waren nichts, was einen fußballverrückten Neapolitaner zu beeindrucken vermochte.
Außerdem war hier weit und breit kein Meer in Sicht. Nur Berge und Täler und Berge und Täler.
»Wozu sind diese Berge da?«, hatte der Ispettore Grauner schon an einem seiner ersten Arbeitstage gefragt.
»Die sind dazu da, um hochzugehen«, hatte der Commissario geantwortet.
»Wozu hochgehen?«
»Damit man runterschauen kann.«
»Da kann ich ja gleich unten bleiben.«
Saltapepe verstand es nicht. Er verstand vieles von dem nicht, was Grauner ihm sagte. Sie waren völlig verschieden, und doch hatten sie beide von klein auf das Gleiche gewollt. In Neapel gab es für Kinder zwei Traumberufe: Mafioso oder Mafiajäger. Vito Corleone oder Giovanni Falcone. Der Pate aus dem bekanntesten aller Mafiafilme oder der Staatsanwalt, der der Cosa Nostra so gefährlich geworden war, dass sie ein ganzes Autobahnstück sprengen musste, um ihn zu beseitigen.
Saltapepe hatte immer wie Falcone sein wollen. In Neapel. Im Herzen der Camorra, in der Schaltzentrale des organisierten Verbrechens. Nun saß er in Bozen, neben diesem Grauner, diesem Commissario, der nach Stall roch und mittags lieber eine Nudelsuppe mit Würstchen schlürfte, anstatt ein Tramezzino mit Prosciutto crudo zu essen. Zu allem Überfluss auch noch in diesem Land zwischen den Bergen, wo von der Mafia keine Spur war. Saltapepe fühlte sich unterfordert. Und er fühlte sich nicht ernst genommen. Er fühlte sich von Grauner behandelt wie ein Lausbub, der zur Strafe zu Hause mit dem Puppenhaus spielen musste, anstatt den großen Jungs auf dem Fußballplatz sein Können zu zeigen.
Der Ispettore sehnte sich zurück nach Neapel. Jeden einzelnen Tag dieses zu Ende gehenden Jahres sehnte er sich danach, seine Heimat wiederzusehen. Doch er wusste, dass das so schnell nicht passieren würde. Belli hatte ihm keinen Weihnachtsurlaub genehmigt. Jetzt, im Nachhinein, im Angesicht des Mordes, war Saltapepe sogar froh darüber. Vielleicht konnte er nun allen beweisen, was er draufhatte. Er hatte mehr drauf als die alle hier. Davon war er überzeugt. Er hatte in seiner jungen Karriere bereits einiges erlebt. Die würden hier schon noch sehen, wozu er fähig war.
Hinter Naturns führte ein Tunnel rechts ab. Am Ende des Tunnels begann eine neue Welt. Grauner schaltete in den dritten Gang zurück, dann in den zweiten. Die Kurven schlängelten sich um die Felsen. Zumindest hatte er den Ispettore dazu überreden können, mit dem Panda loszufahren und nicht mit dem alten Alfa Romeo 156, den die Südtiroler Polizei als Zivilfahrzeug nutzte und den Saltapepe, weil er wie so viele italienische Polizisten vernarrt in das Auto war, auch privat fuhr.
Grauner hielt nicht viel von dem Modell. Wenn es auf vereisten Straßen bergauf ging, war ihm sein Vierradantrieb lieber. Der tuckerte zwar bisweilen langsam wie ein Traktor vor sich hin – erreichte aber stets zuverlässig sein Ziel, während manch moderneres Gefährt längst am Straßenrand blinkte. Von Saltapepes eigenem Wagen ganz zu schweigen. Der Ispettore weigerte sich nämlich, Winterreifen zu montieren, da, wie er Grauner einmal erklärt hatte, Winter für ihn als Neapolitaner keiner nennenswerten Jahreszeitenkategorie entsprach.
Über ihren Köpfen wölbte sich das Gestein, unten, am Fuße der Schlucht, rauschte der Bach. Grauner hupte vor jeder Kurve, denn an vielen Stellen war die Straße kaum breit genug für zwei Fahrzeuge. Jahrhundertelang hatten Reisende, Pilger und Händler nur auf einem mühsamen Weg, der über die Berge führte, nach Schnals gelangen können. Zu steil, zu unzugänglich, zu Furcht einflößend war die drei Kilometer lange Kluft am Taleingang gewesen.
Schnals war im Laufe der Völkerwanderung zwischen dem fünften und dem neunten Jahrhundert nach Christus besiedelt worden. Der Name leitete sich aus dem Lateinischen Casinales ab, was so viel wie Sennhütte bedeutete. Das Schnals von damals war ein Bergbauerntal gewesen, wusste Grauner. Die Menschen hatten als Selbstversorger gelebt, in absoluter Eingeschlossenheit, von dreitausend Meter hohen Gipfeln umzingelt. Unter Karl dem Großen hatten Vögte und Grafen die Grundherrschaft unter sich aufgeteilt, allen voran die Montalbaner, die ihre Burg auf dem Katharinaberg errichteten, sich alsbald das gesamte Gebiet einverleibten und die Besitztümer im Jahr 1295 an Fürst Meinhard II. von Tirol abtraten.
Seit jeher mussten die Bauern Zins und Zehnert an die Montalbaner und später an das Kartäuserkloster abtreten, erst zu Anfang des 17. Jahrhunderts wurden sie Herren ihrer Höfe. 1782 wurde das Kloster aufgelöst, 1875 der erste fahrbare Weg durch die Schlucht errichtet. Er kostete neunundfünfzigtausend Gulden und bedeutete den Start einer neuen Zeitrechnung. Das Tal und der Rest der Welt wurden eins.
Grauner und Saltapepe fuhren vorbei an kleinen Dörfern. Sie passierten Katharinaberg, dessen Kirche auf einem Felsvorsprung thronte. Sie ließen Karthaus hinter sich, den Hauptort des Schnalstals mit dem ehemaligen Kartäuserkloster und die Wallfahrtskirche von Unser Frau, dem ältesten Wallfahrtsort Tirols.
Der Commissario lenkte den Panda die Kehren an der Stauseemauer von Vernagt hoch und am Stausee entlang, wo unter dem Eis die Ruinen einer Kirche und der acht Höfe lagen, die Mitte des 20. Jahrhunderts geflutet worden waren. Links und rechts klebten die Eismassen der Wasserfälle an den steilen Wänden. Die Bauernhäuser trugen meterhohen Schnee auf ihren Schindeldächern. In keinem anderen Alpental waren so viele alte Gehöfte erhalten geblieben. Lärchen, Tannen und Fichten säumten den Weg. Am Straßenrand standen Bildstöcke, in denen Kerzen brannten, und immer wieder hing ein holzgeschnitzter Jesus am Kreuz.
Sie erreichten das Dörfchen Kurzras gegen neun.
4
Grauner parkte den Panda an der Talstation der Gletscherbahn. Aus reiner Gewohnheit zog er die Handbremse, sie hielt schon seit einem Jahrzehnt nicht mehr. Am Rande des Parkplatzes entdeckte er einen großen Stein und legte ihn hinter den linken Hinterreifen.
Ein gigantischer Hotelkoloss mit dunkler Holzverkleidung flankierte das kleine Dorf vom Norden her. Der Koloss wirkte wie die Arche Noah, gestrandet hier am Fuße des Gletschers. Ein paar kleinere Hotels, ein Supermarkt und ein Souvenirladen bildeten den Ortskern. Davor stand ein bescheidenes Kirchlein mit hölzernem Türmchen.
Der Commissario schloss den Reißverschluss seiner Jacke. Saltapepe klopfte sich die Katzenhaare von der Hose; die Katzen von Grauners Hof und auch manche Katze der Nachbarhöfe hatten die Sitze des Pandas schon seit Langem zu ihrem Schlafgemach erkoren.
Einige Skiurlauber steckten in Grüppchen versammelt die Köpfe zusammen, auch einige Talbewohner standen vor der Talstation herum. Bislang wussten die beiden Ermittler nur, was ein aufgeregter Dorfbewohner beim Anruf in der Questura durchs Telefon gebrüllt und ein diensthabender Polizist ihnen weitervermittelt hatte. Und da der Dorfbewohner einen starken Dialekt sprach und der Polizist am anderen Ende der Leitung kaum Deutsch, gingen die Informationen über »Leiche im Skigebiet am Gletscher …«, »Skipisten-Toni halb tot runter ins Dorf gekommen …« und »Der Mörder hat ihn niedergeschlagen und ist mit seiner Pistenraupe abgehauen …« nicht hinaus.
Unterwegs hatte Grauner über sein Handy erste Anweisungen für die Arbeit vor Ort gegeben. Die bereits eingetroffenen Polizisten sollten erste Zeugenaussagen sammeln, den Fundort und die Pistenraupe sichern. Der Empfang war schlecht gewesen, der Commissario wusste nicht, welche seiner Anweisungen tatsächlich angekommen waren. Er sah sich wieder einmal darin bestärkt, dass dem aussterbenden Festnetztelefon nichts Paroli bieten konnte. Erstens, weil er beim Festnetztelefon zeit seines Lebens noch nie Probleme mit der Verbindung gehabt hatte. Und zweitens, weil das Handy so viele Funktionen und nutzlosen Schnickschnack beinhaltete, den er weder wollte noch brauchte.
Zwischen den Einsatzwagen, die auf dem Parkplatz standen, brachten zwei Polizisten Grauner und Saltapepe auf den aktuellen Stand. Noch in der Nacht waren einige Leute von der Bergwacht hochgefahren und hatten nach einigem Suchen die Leiche unter einer Schicht Neuschnee gefunden. Die beiden Polizisten erzählten, was Toni den Männern von den Geschehnissen im Sturm berichtet hatte. Toni selbst war bislang nicht ansprechbar gewesen – er hatte Beruhigungstropfen und Schlaftabletten intus, der Gemeindearzt behandelte seine Schürfwunden und untersuchte ihn nach möglichen Knochenbrüchen.
Grauner überlegte kurz, dann beschloss er, gemeinsam mit dem Ispettore zum Fundort hochzufahren, um sich dort ein erstes Bild von der Lage zu machen.
»Sie da, sind Sie die Verantwortlichen?« Wutentbrannt humpelte ein Mann mit braunem Vollbart, blauem Sarner und kuhfellgrauem Jägerhut auf sie zu. Der Mann, Grauner schätzte ihn auf Mitte siebzig, fuchtelte mit seinem Gehstock herum, als wäre dieser ein Degen. Über dem dicken Bartgestrüpp entdeckte der Commissario eine Narbe, die sich vom Auge bis zum rechten Ohr zog. »Meine Herrn, Bürgermeister Hinterhofer mein Name. Franz Hinterhofer. Seit neununddreißig Jahren im Amt. Nächstes Jahr feiere ich Jubiläum.«
Der Mann wartete offensichtlich auf eine angemessene Reaktion, aber den Gefallen tat Grauner ihm nicht. Der Commissario warf einen Blick in Richtung des Pandas, er traute dem Stein noch nicht. Saltapepe hauchte seine Sonnenbrillengläser an und wischte sie mit einem Taschentuch sauber.
Etliche Sekunden verstrichen, schließlich startete Hinterhofer einen zweiten Anlauf, die Narbe leuchtete weiß in seinem sich rötenden Gesicht, während er drauflospolterte: »Wir brauchen Sie hier nicht. Wir haben unseren eigenen Putz, den Meyer Siegfried, lassen Sie den mal machen. Dieser ganze Radau, den Sie hier veranstalten! Mit Sirenen und Blaulichtern sind Ihre Leute durchs Tal gebrettert. Die haben in Allerherrgottsfrüh sämtliche Touristen aus den Betten geholt. Das geht nicht! Leiche hin oder her. So einen Aufmarsch drei Tage vor Weihnachten, heilige Frau Muttergottes im Walde.«
Hinterhofer war vernatschrot angelaufen. Grauner setzte sein strenges Commissario-Gesicht auf. Er konnte Bürgermeister nicht leiden, die einen auf Staatspräsidenten machten.
»Grauner mein Name«, sagte er mit ruhiger Stimme, obwohl auch er nun innerlich kochte. »Hören Sie, wenn Sie nicht kooperieren, fordere ich noch mal so viele Wagen aus Bozen an. Und die machen hier mit ihren Sirenen und Blaulichtern ein buntes Weihnachtskonzert, wie Sie es Ihr ganzes Bürgermeisterleben lang noch nicht erlebt haben. Tag und Nacht und so lange, bis wir geklärt haben, warum diese Leiche da oben am Gletscher liegt und wie sie da hinkam.«
Grauner bluffte. Ihm war dieses ganze Sirenenbrimborium ja selbst zuwider, auch die dazugehörige Blaulichtshow, welche die Polizisten gern abzogen, um sich wichtigzumachen. Mit Sirene und Blaulicht war noch kein Fall der Welt gelöst worden – aber das musste dieser Hinterhofer ja nicht wissen.
»So, und nun bringt uns sofort einer zum Fundort. Kümmern Sie sich darum, sonst …« Grauner streckte einen Finger in die Höhe, ließ ihn kreisen und pfiff dazu.
Die Drohung wirkte. Hinterhofer stapfte schimpfend davon, seine Stimme krächzte, und keine zwei Minuten später meldete sich jemand von der Bergrettung, der Grauner und Saltapepe mit einem Motorschlitten auf den Gletscher brachte.
5
Der Tote lag rücklings im Schnee. Er trug eine abgewetzte Skijacke, eine geflickte Cordhose und alte Tourenskischuhe. Die Haut war glitschig und von einer dünnen Eisschicht überzogen. Aus seinem Hals ragte der abgebrochene Schaft eines Pfeils. Die Spitze war nicht zu sehen, sie steckte im Fleisch.
Grauner ging langsam um die Leiche herum und betrachtete sie von allen Seiten. So grausam es auch war, einen Toten vor sich liegen zu haben: Er mochte diese Momente, wenn ein Fall seinen Anfang nahm. Mitten in den Ermittlungen befiel ihn manchmal Panik. Da spürte er die Angst davor, sich aus dem Labyrinth der Verworrenheiten nicht befreien zu können. Es war die Urangst eines jeden Commissarios, vor lauter Spuren und Möglichkeiten die richtige Tür nicht zu erkennen, hinter der sich die Lösung verbarg.
Aber nicht am Anfang, wenn da nur diese Leiche lag. Jetzt, wo er noch nichts wusste von diesem Menschen, war der Commissario ganz ruhig; auch die Rückenschmerzen, die während eines Falles bis ins Unerträgliche zunahmen, waren noch nicht da.
Er musterte den Toten. Die von Eis überzogene Haut schien zart, die Falten wie geglättet, die Bartstoppeln fein, die Haare ruhten sanft auf der Stirn. Die burgunderblauen Lippen des Toten waren dünn, fast schien es, als würde er lächeln.
So komisch es auch klang, aber das Wort Unschuld war es, das Grauner in solchen Momenten in den Sinn kam. Unschuldig lag so ein Toter da, unschuldig wie ein neugeborenes Kind. Und erst durch die Ermittlungen, durch das Umgraben der Beziehungsgeflechte, durch die dunklen Seiten all der Menschen, die nach und nach in den Fällen auftauchten, verschwand die Unschuld – vom Grauen verdrängt.
Wieder und wieder wanderte Grauners Blick über den Toten und das Eis und den Schnee um ihn herum – die Leiche wirkte wie ein Fremdkörper in der idyllischen Kulisse. Der Himmel war wolkenlos. Die Sonne strahlte, und das Eis des schier endlos scheinenden Gipfelreigens glitzerte. Die Luft war kalt und rein, und jeder Atemzug weckte die Lebensgeister – bis auf die des toten Mannes, der mit einer Pfeilspitze im Hals im Schnee lag.
»Den zweiten Teil des Pfeils haben wir nicht gefunden.« Max Weiherer, der Chef der Spurensicherung, der Scientifica, wie man im Südtiroler Polizeijargon sagte, war von hinten an Grauner herangetreten und hielt den Männern die Hand entgegen, die in dicken Pamperwollfäustlingen steckte. Weiherer und seine Kollegen trugen weiße Ganzkörperschutzanzüge. Es sah alles ein bisschen nach Mondlandung aus.
»Wir haben außerdem ein Funkgerät sichergestellt. Es lag ein paar Meter neben der Leiche.«
»Und sonst?«, fragte Grauner.
»Sonst nichts.«
»Keine Skier, keine Skistöcke?«
»Nein.«
»Auch keinen Bogen, mit dem der Pfeil abgeschossen wurde?«
Weiherer schüttelte den Kopf. Grauner schaute grimmig. Es passte ihm nicht, dass er mit Saltapepe den Weg durch die Schlucht hatte nehmen müssen, während die Männer von der Scientifica mit dem Hubschrauber des Weißen Kreuzes ankutschiert worden waren. Weil deren DNA-Analysen so wichtig seien, wie Staatsanwalt Belli immer behauptete. Grauner nervte das. Was haben die denn gemacht in der Zwischenzeit hier oben?, fragte er sich. Was hat denn den Hubschraubertrip der Scientifica gerechtfertigt? Ein Funkgerät haben sie sichergestellt. Sonst nichts. Jesusmaria. Das hätte er auch noch selbst gefunden. Grauner versuchte, seinen Missmut zu unterdrücken und sich auf den Fall zu konzentrieren.
»Keine Skier. Keine Stöcke. Eigenartig«, sagte er.
»Ja, eigenartig. Es sieht alles danach aus, dass dieser Fundort nicht der Tatort ist«, antwortete Weiherer.
Grauner nickte. »Das würde auch mit den Aussagen dieses Skipisten-Tonis übereinstimmen.«
»Habt ihr den schon verhören können?«
»Nein, der schläft grad wie ein Murmeltier. Zu dem gehe ich später.«
Grauner blickte in die Runde. »Dass es sich um einen Unfall handelt, können wir wohl ausschließen«, sagte er.
»Ein Toter am Gletscher, wie beim Ötzi damals«, mischte sich der Mann von der Bergrettung ein, ein Zweimeterhüne, der sich als Manfred Berghammer vorgestellt und die beiden Ermittler an den Fundort gebracht hatte. »Der lag damals nicht weit von hier. Gleiche Meereshöhe in etwa. Über dreitausend Meter. In der Nähe der Similaunhütte. Nur ein paar Kilometer Luftlinie entfernt.« Der Mann zeigte zu Berggipfeln im Süden des Skigebietes.
»Wie der Ötzi …«, wiederholte Grauner mehr nachdenkend als bestätigend. Bei der berühmten Leiche aus der Jungsteinzeit, die im Südtiroler Archäologiemuseum in Bozen aufbewahrt wurde, hatte man, so erinnerte er sich, eine Pfeilspitze im Schulterblatt gefunden. Ötzi war damals wohl damit erschossen worden.
»Wie bei wem?«, fragte Saltapepe. »Ist der aus dem Dorf, ist der auch ermordet worden?« Der Ispettore nahm die Sonnenbrille ab und steckte sie sich ins vom Gel glänzende Haar.
Der Riese schaute ungläubig. »Was ist los mit Ihrem Kollegen da, kennt der wirklich unseren Ötzi nicht?«, fragte er.
»Nein, du Yeti«, antwortete Saltapepe und machte eine Handbewegung, wie nur Süditaliener sie zu machen vermochten. »Von dem habe ich noch nie gehört.«
»Aha, von Ötzi noch nie was gehört haben, aber vom Yeti erzählen«, gab Berghammer spöttisch zurück und wendete sich Grauner zu.
Der abschätzige Ton des Mannes gefiel dem Commissario nicht. Mehr noch als Stadtmenschen, die von Bergen keinen Schimmer hatten, nervten ihn Bergmenschen, die einen auf den Berg verirrten Stadtmenschen grundsätzlich zum Trottel degradierten. »Mein Kollege kommt nicht von hier. Der kommt aus dem Süden«, sagte Grauner und wollte das Späßchen damit beenden.
»Ah, Palermo«, sagte Berghammer.
»Napoli, du Idiot«, antwortete Saltapepe und rutschte mit seinen bereits durchnässten Prada-Sneakers noch ein Stückchen tiefer in den Schnee. »Bei uns in Neapel liegen die Leichen zumindest nicht auf dreitausend Meter hohen Bergen. Und löchrige Hosen haben sie auch nicht an. Höchstens von Kugeln durchlöchert. Die tragen auch keine alten Skijacken, sondern maßgeschneiderte Anzüge.«
»Beruhig dich wieder«, raunte Grauner. Er blickte auf das verkrustete Blut, das sich rund um die Wunde in das Eis und die Mantelfasern gefressen hatte.
»Das ist der Sattler Peppi«, sagte Berghammer jetzt.
Grauner stöhnte. Das hätte dieser Bergretter auch gleich sagen können, anstatt erstmal seinen Ispettore zu provozieren.
»Teuren Anzug hatte der sicher keinen in seinem Schrank«, fuhr Berghammer fort. »Schrank hatte der ja eigentlich auch keinen. Der ist vor Jahren in den Wald gegangen und hat in einer Höhle gelebt. Weiter unten im Tal. An einem der Wasserfälle am Stausee. Er hatte genug von allem.«