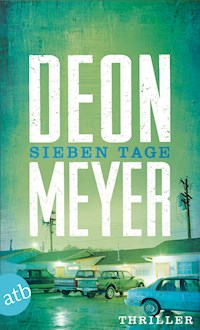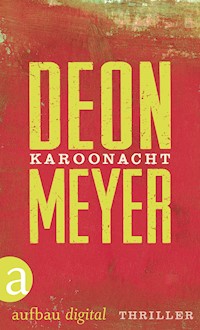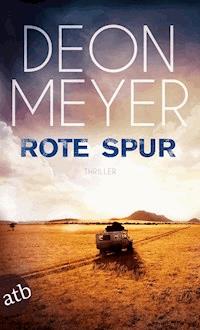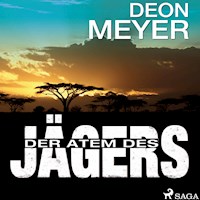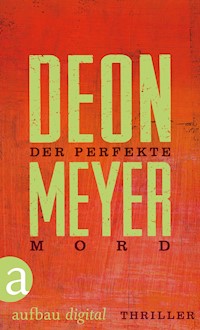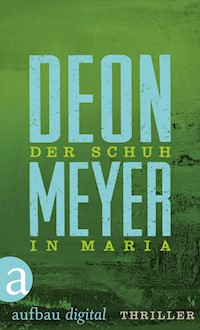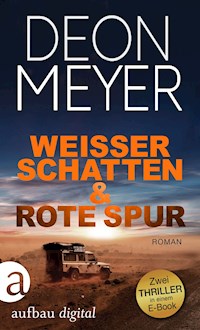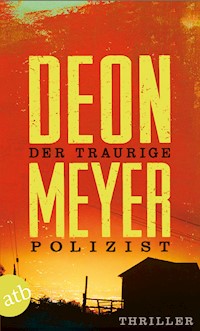
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Aufruhr in Kapstadt.
Seit dem Tod seiner Frau Lara ist Polizist Mat Joubert auf dem Weg nach unten. Er hat Übergewicht, er raucht zuviel, und neuerdings beschweren sich sogar die Kollegen über ihn. Als aus England ein neuer Chef nach Kapstadt kommt, erhält Joubert eine ernste Warnung: Entweder geht er zu einem Psychologen und lässt sich betreuen, oder er muss den Dienst quittieren. Während er noch zögert, was er tun soll, beginnt ein Serienmörder mit einer alten deutschen Pistole sein Unwesen zu treiben – und plötzlich steckt Joubert in seinem schwierigsten Fall. Für die Morde an mehreren weißen Männern gibt es scheinbar kein Motiv ...
"Deon Meyer versteht es, einen gierig Seite um Seite umblättern zu lassen.“ Frankfurter Rundschau, Sylvia Staude.
"Deon Meyer zeigt uns auf spannende Weise, wie Südafrika riecht, schmeckt und klingt. Unwiderstehlich, tragisch, komisch." Chicago Tribune.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 514
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Informationen zum Buch
Seit dem Tod seiner Frau Lara ist Polizist Mat Joubert auf dem Weg nach unten. Er hat Übergewicht, er raucht zuviel, und neuerdings beschweren sich sogar die Kollegen über ihn. Als aus England ein neuer Chef nach Kapstadt kommt, erhält Joubert eine ernste Warnung: Entweder geht er zu einem Psychologen und läßt sich betreuen, oder er muß den Dienst quittieren. Während er noch zögert, was er tun soll, beginnt ein Serienmörder mit einer alten deutschen Pistole sein Unwesen zu treiben – und plötzlich steckt Joubert in seinem schwierigsten Fall. Für die Morde an mehreren weißen Männern gibt es scheinbar kein Motiv.
Deon Meyer
Der traurige Polizist
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Ulrich Hoffmann
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Deon Meyer
Impressum
Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne …
1
In der Nachmittagsstille des letzten Tages des Jahres dachte Mat Joubert an den Tod. Seine Hände waren mechanisch damit beschäftigt, seine Dienstwaffe zu reinigen, die Z88. Er saß in seinem Wohnzimmer im Sessel und beugte sich vor, die Teile der Pistole lagen zusammen mit Lappen, Bürsten und einer Öldose auf dem Couchtisch. Die Zigarette im Aschenbecher ließ einen dünnen Rauchfaden aufsteigen. Über ihm flog eine Biene mit monotoner Regelmäßigkeit gegen die Fensterscheibe, ein irritierender Versuch, hinauszugelangen in den Sommernachmittag draußen, den ein leichter Südostwind abkühlte.
Joubert nahm das Geräusch nicht wahr. Sein Geist wanderte ziellos durch die Ereignisse der letzten Wochen, beschäftigte sich mit den verschiedenen Todesfällen, seinem täglich Brot. Eine Weiße, die auf dem Rücken in der Küche lag, den Bratenwender in der rechten Hand, das Omelett verkohlt auf dem Herd, das Blut nur ein weiterer Farbtupfer in dem hübschen Zimmer. Im Wohnzimmer der Junge, neunzehn, in Tränen aufgelöst, die R3 240 in der Tasche seiner Lederjacke; er sagte wieder und wieder den Namen seiner Mutter.
Der Mann in den Blumen, eine angenehmere Erinnerung. Ein würdevoller Tod. Er erinnerte sich an die Detectives und uniformierten Polizisten auf dem offenen Industriegelände zwischen den grauen Fabrikgebäuden. Sie bildeten einen Kreis, sie standen knietief in Wildblumen, die ihre gelben, weißen und orangefarbenen Köpfe reckten. In der Mitte dieses Kreises von Ermittlern lag die Leiche eines Mannes mittleren Alters, er war relativ klein. In einer Hand hielt er eine leere Flasche Fusel. Er lag mit dem Gesicht nach unten, preßte die Wange gegen den Boden.
Seine Augen waren geschlossen, und mit der anderen Hand umklammerte er ein paar Blumen, die mittlerweile verwelkt waren.
Mat Joubert erinnerte sich vor allem an die Hände.
Am Strand von Macassar. Drei Personen. Der Gestank von verbranntem Gummi und verkohltem Fleisch hing noch in der Luft; die Gesetzeshüter und Medienvertreter bildeten eine Barriere im Wind des Schreckens der schrecklichen Halskettenmorde.
Die Hände. Klauen. Sie reckten sich himmelwärts, als flehten sie auf ewig um Gnade.
Mat Joubert war des Lebens müde, aber so wollte er nicht sterben.
Mit Daumen und Zeigefinger schob er die fünfzehn 9-mm-Patronen, eine nach der anderen, in das Magazin. Die letzte glitzerte kurz in der Nachmittagssonne. Er hob die Patrone auf Augenhöhe, er balancierte sie zwischen Daumen und Zeigefinger, er starrte die schimmernde Spitze an.
Wie würde es sein? Wenn man sich den düsteren Mund der Z88 zärtlich gegen die Lippen preßte, wenn man dann den Abzug drückte, sorgsam, langsam, respektvoll. Würde man das Eindringen des spitzen Projektils noch schmerzhaft spüren? Würden einem Gedanken durch die unbeschädigten Bereiche des Hirns fluten? Empfand man Feigheit, bevor die Nacht einen umhüllte? Oder geschah alles so schnell, daß es der Klang des Schusses nicht einmal von der Pistole bis zum Ohr und weiter zum Hirn schaffte?
Das fragte er sich. War es für Lara so gewesen?
War ihr Licht einfach erloschen, ohne daß sie etwas von der Hand auf dem Schalter mitbekommen hatte? Oder hatte sie es gewußt und in jenem kürzesten Augenblick zwischen Leben und Tod alles gesehen? Hatte sie Reue empfunden oder ein letztes Mal höhnisch gelacht?
Darüber wollte er nicht nachdenken.
Das neue Jahr würde am nächsten Tag beginnen. Dort draußen gab es Menschen mit Plänen, Träumen, Vorsätzen und Begeisterung und Hoffnung für das neue Jahr. Und er saß hier.
Morgen würde bei der Arbeit alles anders sein. Ein neuer Mann, eine politische Entscheidung. Die anderen redeten von nichts anderem mehr. Joubert war es gleichgültig. Er wollte es nicht mehr länger wissen. Nichts vom Leben, nichts vom Tod. Es war nur noch etwas, das es zu überleben galt, das man zur Kenntnis nahm, das einem die Lebenslust austrieb und den gnadenlosen Sensenmann näher heranlockte.
Er schob das Magazin mit der ausgestreckten linken Hand in den Griff hinein und steckte die Waffe mit Schwung in ihre Lederhülle. Das Öl und die Lappen verschwanden in der alten Schuhschachtel. Er zog an seiner Zigarette, stieß den Rauch in Richtung Fenster aus. Dann sah er die Biene, er hörte ihre Erschöpfung, die das Surren der Flügel verlangsamte.
Joubert stand auf, zog den Vorhang beiseite und öffnete das Fenster. Die Biene spürte die warme Brise von draußen, versuchte aber immer noch, durch die geschlossene Seite des Fensters hinauszugelangen. Joubert wandte sich um, er griff nach einem öligen Lappen und zog ihn vorsichtig am Fenster vorbei. Das Insekt schien einen Augenblick vor der Öffnung zur Freiheit stillzustehen, dann flog es hinaus. Joubert schloß das Fenster und richtete den Vorhang.
Auch er konnte entkommen, dachte er. Wenn er nur wollte.
2
Kurz nach sieben Uhr am Silvesterabend überquerte Mat Joubert die Straße in seinem Vorort Monte Vista und ging zu Jerry Stoffberg von Stoffberg & Mordt, Beerdigungsunternehmer in Bellville. »Wir sind im selben Geschäft, Mat«, sagte Jerry oft und gern. »Bloß in unterschiedlichen Zweigstellen.«
Die Tür wurde geöffnet. Stoffberg sah Joubert ins Haus kommen. Sie begrüßten einander und stellten sich die üblichen Fragen.
»Das Geschäft läuft gut, Mat. Die beste Zeit des Jahres. Es scheint fast, als würden viele nur noch versuchen, die Feiertage zu erleben«, sagte er, während er das Bier, das Joubert mitgebracht hatte, in den Kühlschrank stellte. Der Bestatter trug eine Schürze, die verkündete, er sei DER SCHLIMMSTE KOCH DER WELT.
Joubert nickte nur, denn er hatte das alles schon einmal gehört, und öffnete das erste Castle des Abends.
In der Küche war es warm und gemütlich, sie war voll Freude und Gelächter. Frauenstimmen erfüllten den Raum. Kinder und Männer bahnten sich ihren Weg vorbei an den tratschenden Frauen, die das Essen vorbereiteten. Mat Joubert begab sich nach draußen.
Seine Aufmerksamkeit richtete sich nach innen, er hatte seine Fühler eingezogen wie ein Insekt. Ihn berührten die Wärme und Häuslichkeit nicht mehr.
Draußen huschten die Kinder wie Schatten durch Lichtflecken und Dunkelheit, die Gruppen bildeten sich nach Alter, vereint wurden sie aber durch ihre offensichtliche Sorglosigkeit.
Auf der stoep, der Veranda, saßen Teenager in dem unglücklichen Niemandsland zwischen Kindheit und Erwachsensein. Sie fielen Joubert auf, weil gerade ihre aufgesetzte Lässigkeit sie verriet. Sie hatten irgendeinen Mist gebaut. Er schaute zu ihnen hin, bis ihm klar wurde, was sie zu verbergen versuchten: Die Gläser auf dem Tisch waren mit verbotenem Inhalt gefüllt. Vor zwei, drei Jahren hätte er darüber gelächelt, er hätte an seine eigene stürmische Jugend zurückgedacht, aber nun zog er einfach nur seine Fühler wieder ein.
Er stellte sich zu den Männern, die einen Kreis um das Feuer bildeten. Die Eintrittskarte zu dieser Gruppe war ein Glas in der Hand. Alle starrten das Lamm an, das sich nackt und würdelos an Stoffbergs Spieß drehte.
»Herrgott, Mat, du bist ja wirklich riesig«, sagte Wessels, der Fotojournalist, als Joubert neben ihn trat.
»Wußtest du nicht, daß er die Geheimwaffe der Mordkommission ist?« fragte Myburgh, der Leiter der Verkehrspolizei von Bellville quer über das Feuer. Sein buschiger Schnauzer wippte bei den Worten auf und ab.
Jouberts Gesichtsmuskulatur spannte sich an, er zeigte seine Zähne in einem mechanischen Lächeln.
»Ja, er ist ihre menschliche Straßensperre«, sagte Storridge, ein Geschäftsmann. Sie lachten alle respektvoll.
Sprüche und Scherze flogen über das brutzelnde Lamm hin und her, sie waren sich alle Jouberts Verlust von vor zwei Jahren bewußt – es waren freundliche, fruchtlose Versuche, seine Laune zu heben.
Dann ebbte das Gespräch ab. Stoffberg drehte den Spieß und injizierte dem bräunenden Fleisch eine Sauce, wie ein Arzt einem Patienten. Sport, quasi-erotische Witze, die üblichen Jobprobleme. Joubert schüttelte eine Winston aus dem Päckchen in seiner Hemdtasche. Er hielt es in die Runde. Ein Feuerzeug flammte auf.
Die Mitglieder des Kreises um das Feuer kamen und gingen. Stoffberg drehte den Spieß und überprüfte das Fleisch. Joubert akzeptierte ein weiteres Bier und holte sich später selbst noch eines. Die Aktivität der Frauen in der Küche hatte abgenommen. Sie waren weitergezogen in das nebenan gelegene Fernsehzimmer.
Draußen konzentrierte sich das Gespräch mittlerweile auf Stoffbergs Lamm.
»Du brauchst ihm keine weitere Spritze zu geben, Stoffs. Es ist tot.«
»Ich will noch vor Sonnenaufgang essen, Stoffs. Ich muß morgen den Laden aufmachen.«
»Vergiß es. Dieses kleine Lämmchen ist erst im Februar fertig.«
»Und dann schmeckt’s wie Hammel.«
Jouberts Blick folgte den Sätzen von Gesicht zu Gesicht, aber er selbst sagte nichts. Still, so kannten sie ihn. Selbst vor Laras Tod war er kein großer Redner gewesen.
Die Stimmen der Kinder wurden leiser, die der Männer lauter. Stoffberg schickte einen Botschafter aus, um die Gäste zu rufen. Das Tempo der Party veränderte sich. Die Frauen riefen die Kinder und gingen dann mit Tellern voller Beilagen zu Stoffberg hin, der begonnen hatte, das Lamm zu tranchieren.
Joubert nippte an einem Castle, während er wartete, bis er drankam. Der Alkohol hatte seine Sinne betäubt. Er war nicht hungrig, er aß nur aus Gewohnheit und Höflichkeit mit ein paar anderen Männern an einem Gartentisch.
Drinnen spielte jemand Musik, die Teenager tanzten. Joubert bot wieder Zigaretten an. Frauen holten ihre Männer, um auch mit ihnen zu tanzen. Die Musik wurde immer älter, aber nicht leiser. Joubert stand schließlich auf, um nicht draußen allein zu bleiben, und auf dem Weg ins Wohnzimmer holte er sich noch ein Bier.
Stoffberg hatte die normalen Glühbirnen im Wohnzimmer durch farbige ersetzt. Zuckende Körper badeten in gedämpftem Rot, Blau und Gelb. Joubert saß im Eßzimmer und schaute hinüber zu den Tänzern. Wessels’ kleiner Körper zuckte spastisch, während er tat, als sei er Elvis. Die Bewegungen der Teenager waren gekonnter. Als Storridges hübsche, schlanke Frau an einem roten Licht vorbeitanzte, wurde ihr Körper illuminiert. Joubert schaute weg. Die Tochter des Hauses, Yvonne Stoffberg, ließ ihre Brüste jugendlich unter einem engen T-Shirt hopsen. Joubert zündete sich eine weitere Zigarette an.
Myburghs fette Frau bat Joubert um einen traditionellen Walzer. Er erklärte sich einverstanden. Sie führte ihn geschickt um die anderen Paare herum. Als das nächste Stück begann, lächelte sie mitleidig und ließ ihn los. Er holte sich noch ein Castle. Die Musik wurde langsamer. Die Tänzer näherten sich einander, ein neuer Abschnitt des Abends begann.
Joubert ging hinaus. Das Licht im Garten war ausgeschaltet worden. Die Kohlen unter den Überresten des Lammes glühten noch rot. Er ging in eine Ecke des Gartens, erleichterte sich und kehrte zurück. Eine Sternschnuppe blitzte über dem dunklen Dach des Hauses auf. Joubert blieb stehen und schaute zum Himmel hoch, sah aber nur Dunkelheit.
»Hi, Mat.«
Sie tauchte plötzlich neben ihm auf, ein nymphenhafter Schatten der Nacht.
»Ich kann Sie doch so nennen, oder? Ich bin mit der Schule fertig.« Sie bildete eine Silhouette vor der hellen Hintertür, ihre runden, jungen Kurven modellierten T-Shirt und Hose.
»Natürlich«, sagte er zögernd, überrascht. Sie trat näher, hinein in den Schutzraum seiner Einsamkeit.
»Du hast nicht einmal mit mir getanzt, Mat.«
Er stand wie erstarrt da, unsicher, entgeistert durch sieben Castles und zahllose Monate seelenzerfetzender Selbstbetrachtung. Er verschränkte schützend die Arme.
Yvonne Stoffberg legte ihre Hand auf seinen Arm. Ihre linke Brust streifte seinen Ellenbogen.
»Du bist der einzige richtige Mann hier heute abend, Mat.«
Großer Gott, dachte er, das ist die Tochter meines Nachbarn. Er erinnerte sich daran, was die Teenager auf der stoep getrunken hatten.
»Yvonne …«
»Alle nennen mich Bonnie.«
Zum ersten Mal schaute er ihr ins Gesicht. Sie starrte ihn an, ihre Augen leuchteten, leidenschaftlich und entschlossen. Ihr Mund war wie eine Frucht, reif, leicht geöffnet. Sie war nicht mehr länger ein Kind.
Joubert verspürte die Angst vor der Demütigung in sich.
Dann sprach sein Körper leise zu ihm, ein rostiger Augenblick kam und ging. Sein Schritt erinnerte sich an die aufsteigenden Vergnügungen der Vergangenheit, aber seine Angst war zu groß. Er wußte nicht, ob dieser Teil des Lebens in ihm abgestorben war. Es war mehr als zwei Jahre her … Er wollte ihr Einhalt gebieten. Er löste seine Arme voneinander und wollte sie wegschieben.
Sie jedoch interpretierte seine Bewegung anders, sie trat zwischen seine Hände, sie zog ihn zu sich heran und preßte ihren feuchten Mund auf seinen. Ihre Zunge zwängte sich zwischen seine Lippen, sie flatterte. Sie drückte ihren Körper an ihn, ihre Brüste waren warme Hügel.
In der Küche rief jemand ein Kind, und der besorgte Klang durchbrach Mat Jouberts Aufstieg ins Leben. Er löste sich von ihr und ging sofort in Richtung Küche.
»Tut mir leid«, sagte er über die Schulter, ohne daß er genau wußte, warum eigentlich.
»Ich bin mit der Schule fertig, Mat.« In ihrer Stimme lag kein Tadel.
Er kehrte wie ein Flüchtling in sein Haus zurück, seine Gedanken drehten sich um seine Bestimmung, nicht um seine Geschichte. Jubel hieß das neue Jahr willkommen. Feuerwerk, sogar eine Trompete.
Sein Zuhause. Er ging vorbei an Bäumen, Büschen und Blumenbeeten, die Lara gepflanzt hatte, er mühte sich mit dem Schloß, er ging durch den Flur ins Schlafzimmer. Dort stand das Bett, in dem Lara und er geschlafen hatten. Das war ihr Schrank, jetzt war er leer. Da hing ein Bild, das sie auf dem Flohmarkt in Green Point gekauft hatte. Die Wächter seiner Zelle.
Er zog sich aus, zog die schwarzen Shorts an, schlug das Laken beiseite und legte sich hin.
Er wollte nicht daran denken.
Aber sein Ellenbogen spürte immer noch diese unglaubliche Sanftheit, ihre Zunge schob sich immer noch in seinen Mund.
Zwei Jahre und drei Monate nach Laras Tod.
In letzter Zeit hatte er am späten Nachmittag oder frühen Abend auf der Voortrekker Road gestanden und die Straße entlanggeschaut. Er sah die Parkuhren, die sich einen Kilometer lang oder noch weiter aneinanderreihten, so weit er sehen konnte, es war eine schnurgerade Straße. Die Parkuhren, die so nutzlos und stolz dort wachten, wurden nach dem Ende des Arbeitstages nicht mehr gebraucht. Ihm wurde klar, daß Lara ihn zu etwas Ähnlichem gemacht hatte – am Tag nervte er, nachts war er nutzlos.
Sein Körper glaubte ihm nicht.
Wie ein vernachlässigter Motor knirschte und hustete und quietschte er, während die Räder sich zu drehen begannen. Sein Unterbewußtsein erinnerte sich noch an das Öl, das im Hirn auf seinen Einsatz wartete, chemische Botschaften des Verlangens, die Blut und Speichel an die Front schickten. Der Motor seufzte, eine Zündkerze blitzte auf, ein Gang stotterte.
Er öffnete die Augen und schaute an die Decke.
Ein Virus in seinem Blut. Er konnte die ersten unscharfen Symptome spüren. Noch war es nichts Körperliches, hatte noch kein Eigenleben entwickelt. Noch war es ein zartes Fieber, das sich langsam, wie die Flut, durch seinen Körper ausbreitete und den Alkohol vertrieb, den Schlaf.
Er wälzte sich hin und her, er stand auf, um ein Fenster zu öffnen. Der Schweiß auf seinem Oberkörper schimmerte im Licht der Straßenlaterne. Er legte sich wieder hin, auf den Rücken, er suchte nach einem Mittel gegen Verlangen und Demütigung.
Die Sehnsucht in seinem Schritt und seinem Kopf war gleichermaßen schmerzhaft.
Seine Gedanken wurden von einem Wirbelwind getrieben, sie ergossen sich über die Dämme.
Gefühle, Lust und Erinnerungen vermischten sich. Lara. Er vermißte sie. Er haßte sie. Wegen des Schmerzes. Herrgott, sie war so schön gewesen. Ein verführerischer Sturm. Eine Verräterin.
Die Zartheit einer Brust an seinem Ellenbogen. Die Tochter seines Nachbarn.
Lara, die ihn in eine Parkuhr verwandelt hatte. Lara, die tot war.
Sein Hirn suchte nach einer Ausflucht, jagte seine Gedankengänge in die trostlose Sicherheit einer grauen Depression, innerhalb derer er in den vergangenen Monaten zu überleben gelernt hatte.
Aber zum ersten Mal seit zwei Jahren und drei Monaten wollte Mat Joubert diesen Notausgang nicht nutzen. Der große Schalthebel war zwischen die rostigen Kugellager gerammt worden, die Kolben bewegten sich in ihren Zylindern. Der Motor war eine Allianz mit Yvonne Stoffberg eingegangen. Gemeinsam kämpften sie gegen das allumfassende Grau.
Yvonne Stoffberg flatterte wieder in seinen Mund.
Lara war tot. Er schlief ein. Ein Duell ohne Sieger, eine neue Erfahrung.
Irgendwo im Grenzbereich zum Schlaf wurde ihm klar, daß das Leben zurückkehren wollte, aber er schlief ein, bevor die Angst sich in ihm ausbreiten konnte.
3
Detective Sergeant Benny Griessel nannte das Gebäude der Mordkommission in der Kasselsvlei Road, Bellville Süd, den »Kreml«.
Benny Griessel verfügte über einen ironischen Humor, gestählt im Feuer seiner neun Jahre im Dienste der Verbrechensbekämpfung. Griessel nannte die allmorgendliche Parade im Paradesaal des Kremls den »Zirkus«.
Diese zynische Bemerkung stammte allerdings aus der Zeit des asketischen Colonel Willy Theal, über den der dicke Sergeant Tony O’Grady bemerkt hatte: »Wenn es nicht schon einen Gott gäbe, wäre er ein guter Kandidat.« O’Grady hatte laut gelacht und niemandem gesagt, daß er den Satz von Churchill gestohlen hatte. Und keiner der anderen Detectives hatte es gewußt.
An diesem Morgen war es anders. Theal, der Leiter der Mordkommission, war am 31. Dezember in Frührente gegangen und züchtete nun Gemüse auf seinem Grundstück in Philippi.
An seine Stelle trat Colonel Bart de Wit, eingesetzt vom Minister für innere Sicherheit, dem neuen schwarzen Minister für innere Sicherheit. Vom 1. Januar an gehörte die Mordkommission offiziell zum neuen Südafrika. Denn Bart de Wit war ein ehemaliges Mitglied des African National Congress. Er hatte seine Mitgliedschaft niedergelegt, bevor er die Aufgabe antrat. Ein Polizist mußte unparteiisch sein.
Als Joubert am 1. Januar um sieben Minuten nach sieben in den Paradesaal kam, saßen vierzig Detectives schon auf den blaugrauen Stühlen, die ein großes Rechteck vor den vier Wänden formten. Gedämpft spekulierten sie über den Neuen, diesen Bart de Wit.
Benny Griessel und Captain Gerbrand Vos begrüßten Mat Joubert. Die anderen spekulierten weiter. Joubert setzte sich in eine Ecke.
Um genau Viertel nach sieben kam der Brigadier in voller Uniform in den Paradesaal. Hinter ihm Colonel Bart de Wit.
Einundvierzig Augenpaare richteten sich auf die beiden. Der Brigadier stand vorn neben dem Fernseher. De Wit setzte sich auf einen der zwei leeren Stühle. Der Brigadier begrüßte die Anwesenden und wünschte ihnen allen ein gutes neues Jahr. Dann begann er mit seiner Rede, aber die Detectives hörten nicht wirklich zu. Ihr Interesse an Menschen, ihre Fähigkeit, andere einzuschätzen, galten dem neuen Chef.
Bart de Wit war klein und schlank. Sein schwarzes Haar dünnte an der Stirn aus, auf dem Kopf selbst war es noch recht dicht. Seine Nase war ein schöner Zinken, und am Übergang zwischen Nase und Wange befand sich eine dicke Warze. Er war keine beeindruckende Gestalt.
Die Rede des Brigadiers über die sich verändernde Welt und die sich mit ihr verändernde Polizei näherte sich dem Ende. Er stellte de Wit vor. Der neue Chef erhob sich, räusperte sich und rieb seine Warze mit dem Zeigefinger.
»Kollegen, es ist mir eine Ehre«, sagte er. Seine Stimme war nasal und schrill wie eine elektrische Bandsäge. Er verschränkte die Hände hinter dem Rücken, sein kleiner Körper war steif wie eine Ramme, er drückte die Schultern durch.
»Der Brigadier ist ein vielbeschäftigter Mann und hat darum gebeten, daß wir ihn entschuldigen.« Er lächelte den Brigadier an, der sich daraufhin abwandte und zur Tür hinausstolzierte.
Dann waren sie allein, der neue Chef und seine Truppe. Sie schauten einander interessiert an.
»Nun, Kollegen, es ist Zeit, daß wir einander kennenlernen. Ich kenne Sie bereits, denn ich habe Ihre Akten eingesehen, aber Sie kennen mich nicht. Und ich weiß, wie leicht sich Gerüchte über einen neuen Chef verbreiten. Deswegen nehme ich mir die Freiheit, Ihnen kurz meinen Lebenslauf darzustellen. Es ist wahr, ich habe keine Erfahrung mit Polizeieinsätzen hierzulande. Aber dafür müssen Sie sich bei der Apartheid-Regierung bedanken. Ich nahm Unterricht in Polizeiarbeit bei Unisa, als meine politische Überzeugung es mir unmöglich machte, in meinem Heimatland zu bleiben …«
Über de Wits Lippen spielte ein schwaches Lächeln. Seine Zähne waren ein wenig vergilbt, aber gleichmäßig. Jedes Wort war makellos gesprochen, perfekt.
»Im Exil konnte ich, umgeben von tapferen Patrioten, meine Studien Gott sei Dank fortsetzen. Und 1992 gehörte ich zu den ANC-Mitgliedern, die das Angebot der Briten zu einer Ausbildung annahmen. Ich verbrachte mehr als ein Jahr bei Scotland Yard.«
De Wit schaute sich im Paradesaal um, als erwartete er Applaus. Er rieb wieder mit dem Finger die Warze.
»Letztes Jahr stellte ich bei Scotland Yard Untersuchungen für meine Doktorarbeit an. Ich weiß also genau über die meisten modernen Methoden zur Verbrechensbekämpfung Bescheid, die derzeit in der Welt entwickelt werden. Und Sie …« Mit dem Warzenfinger malte er eilig ein Quadrat in die Luft, um alle einundvierzig Anwesenden einzuschließen. »… und Sie werden von diesem Wissen profitieren.«
Eine weitere Gelegenheit für Applaus. Die Stille hallte durch den Raum.
Gerbrand Vos schaute Joubert an. Vos’ Lippen formten stumm das Wort »Patrioten«, er blickte himmelwärts. Joubert schaute zu Boden.
»Soviel zu meinem beruflichen Werdegang. Kollegen, wir fürchten uns alle vor Veränderungen. Sie wissen, daß Toffler sagt, man darf niemals den Eindruck von Veränderungen auf die menschliche Psyche unterschätzen. Aber letztlich müssen wir uns mit der Veränderung arrangieren. Erst einmal werde ich Ihnen sagen, was ich von Ihnen erwarte. Wenn ich Sie auf die anstehenden Veränderungen vorbereite, können Sie besser damit umgehen …«
Benny Griessel schlug sich mit der Handfläche knapp oberhalb des Ohrs gegen den Kopf, als wollte er die Rädchen dort wieder in Bewegung setzen. De Wit sah es nicht.
»Ich erwarte nur eines von Ihnen, Kollegen. Erfolg. Der Minister hat mich eingesetzt, weil er bestimmte Erwartungen hat. Und ich werde alles dafür tun, daß diese Erwartungen erfüllt werden.« Er stieß den Zeigefinger in die Luft. »Ich werde versuchen, ein Umfeld zu schaffen, in dem Sie erfolgreich sein können – durch gesündere, modernere Managementverfahren und durch zusätzliche Ausbildungen in den neuesten Techniken der Verbrechensbekämpfung. Aber was erwarte ich von Ihnen? Wie sieht Ihr Teil des Vertrages aus? Drei Dinge …« Zu dem Zeigefinger gesellten sich zwei weitere, die de Wit dramatisch vor sich in die Luft reckte. »Erstens: Loyalität. Zur Polizei und ihren Zielen, zu Ihrer Einheit, Ihren Kollegen und zu mir. Zweitens: Einsatz. Ich erwarte erstklassige Arbeit. Nicht neunzig Prozent, sondern hundert Prozent. Ja, Kollegen, auch wir müssen auf Fehlerlosigkeit aus sein.«
Die Detectives begannen sich zu entspannen. Der neue Mann sprach eine neue Sprache, aber die Botschaft blieb dieselbe. Er erwartete nicht mehr als jeder beliebige seiner Vorgänger. Mehr Arbeit für die gleiche unangemessene Bezahlung. Ergebnisse, solange er seinen Vorgesetzten gegenüber abgesichert war. Solange seine Beförderung gesichert war. Das waren sie gewöhnt. Damit konnten sie leben. Selbst wenn er Mitglied des ANC gewesen war.
Joubert zog das rote Päckchen Winston aus seiner Tasche und zündete sich eine an. Ein paar andere folgten seinem Beispiel.
»Drittens: körperliche und geistige Gesundheit. Kollegen, ich glaube fest daran, daß in einem gesunden Körper ein gesunder Geist wohnt. Ich weiß, daß Sie mich kurzfristig dafür hassen werden, aber ich bin bereit, dieses Risiko einzugehen.«
De Wit verknotete seine Hände hinter seinem Rücken und drückte seine Schultern wieder durch, als müßte er mit einem Angriff rechnen. »Jeder von Ihnen muß zweimal im Jahr ärztlich untersucht werden. Das Ergebnis bleibt vertraulich zwischen uns. Aber wenn der Arzt bestimmte … Defizite feststellt, erwarte ich, daß Sie diese korrigieren.« Er ließ die Hände hinter seinem Rücken frei. Die Handflächen schnellten nach vorn, als wollte er einen Angreifer abwehren. »Ich weiß, wie schwer es ist, stets fit zu sein. Ich weiß um Ihren Streß, die Arbeitszeiten. Aber Kollegen, je fitter Sie sind, desto leichter ist es, diese Hindernisse zu bewältigen. Ich will nicht persönlich werden, aber einige von Ihnen sind übergewichtig. Dann sind da diejenigen, die rauchen und trinken …«
Joubert starrte die Zigarette in seiner Hand an.
»Aber wir werden das gemeinsam angehen. Gemeinsam werden wir Ihren Lebensstil ändern, wir werden Ihnen helfen, die schlechten Angewohnheiten abzulegen. Vergessen Sie nicht, Kollegen, Sie sind die besten aller Polizisten. Sie stellen intern wie extern das Bild dar, das wahrgenommen wird, Sie sind Botschafter, PR-Spezialisten. Aber vor allem haben Sie auch die Verpflichtung sich selbst gegenüber, Ihren Körper und Geist in Form zu halten.«
Wieder ein leichtes Zögern, eine Pause für Beifall. Joubert drückte die Zigarette aus. Er sah, wie Vos seinen Kopf in die Hände sinken ließ. Vos rauchte nicht, hatte aber einen Bierbauch.
»Gut«, sagte Colonel Bart de Wit, »dann kommen wir zum heutigen Tag.« Er zog ein Notizbuch aus seiner Jackentasche und schlug es auf.
»Captain Marcus Joubert … Wo ist Captain Joubert?«
Joubert hob den Arm auf Halbmast.
»Ja, wir werden uns ein wenig später genauer kennenlernen, Captain. Sie heißen Marcus? Nennt man Sie …?«
»Mat«, sagte Joubert.
»Wie?«
»Wie ›Depp‹«, rief eine Stimme vom anderen Ende des Saals, und ein paar Detectives lachten leise.
»Man nennt mich Mat«, sagte Joubert etwas lauter. De Wit mißverstand ihn dennoch.
»Sehr gut, Captain Max Joubert wird in der kommenden Woche das Einsatzkommando leiten. Ihm unterstehen Lieutenant Leon Petersen, die Adjutanten Louw und Griessel, Sergeant O’Grady, die Constables Turner, Maponya und Snyman. Wir werden uns alle kennenlernen, Kollegen. Und Captain Gerbrand Vos hat das Einsatzkommando über die Feiertage geleitet. Captain, haben Sie uns etwas zu sagen?«
Der Arbeitsalltag eines Mitgliedes der Mordkommission ließ nicht viel Raum für Mitgefühl, wenn ein Kollege aus dem Gleichgewicht geriet. Man fühlte mit, weil es jedem passieren konnte. Man war dankbar, daß es einem nicht selbst geschehen war. Und ein oder zwei Monate lang hat man sogar richtig Mitleid, bis der entsprechende Kollege nur noch ein Mühlstein um den eigenen Hals war, den man bei der Arbeit mitschleppte.
Zwei Kollegen der Mordkommission hatten zwei ganze Jahre lang Mitleid mit Mat Joubert gehabt – jeder aus seinen eigenen Gründen.
Bei Gerbrand Vos war es Nostalgie. Joubert und er hatten zusammen als Detective Sergeants bei der Mordkommission angefangen. Zwei leuchtende neue Sterne. Willie Theal hatte es ihnen erlaubt, zu wetteifern, mehr und mehr Auszeichnungen einzuheimsen, aber sie wurden gemeinsam Adjutanten, Lieutenants. Innerhalb der Polizei waren sie landesweit bekannt. Die afrikaanse Zeitung Die Burger veröffentlichte einen wunderbaren Artikel über sie, als sie zeitgleich zum Captain befördert wurden. Immer zeitgleich. Die junge Reporterin war offensichtlich von beiden beeindruckt gewesen. Captain Vos ist der Extrovertierte, ein großgewachsener Mann mit dem Gesicht eines Engels, er hat Grübchen und babyblaue Augen. Captain Mat Joubert ist der stillere von beiden. Er ist noch größer, seine Schultern haben die Breite eines Schranks, und er hat das Gesicht eines Falken – braune Augen, mit denener direkt durch einen hindurchzusehen scheint, hatte sie damals geschrieben.
Dann aber starb Lara, und Vos akzeptierte, daß sein Kollege sich nicht mehr länger messen wollte. Und er wartete darauf, daß Joubert seinen Trauerprozeß abschloß. Gerbrand Vos wartete noch immer.
Joubert war mit der ersten Akte des Tages beschäftigt. Siebzehn weitere lagen in drei Stapeln auf seinem Schreibtisch, gelbgraue Akten, die sein Leben regelten. Er hörte Vos’ kräftige Schritte auf den schlichten grauen Fliesen im Flur, er hörte, daß sie nicht im Büro nebenan verschwanden. Dann stand Vos in der Tür, seine Stimme gedämpft, als wäre de Wit in der Nähe.
»Allgemeine Wettervorhersage: große Scheiße«, sagte er. Für Gerbrand Vos war Sprache ein Schlaginstrument.
Joubert nickte. Vos setzte sich auf einen der blaugrauen Stühle. »Patrioten! Teufel, die machen mich so wütend. Und Scotland Yard. Was weiß Scotland Yard denn schon von Afrika, Mat? Und dauernd ›Kollegen‹. Was für ein Chef nennt seine Leute denn ›Kollegen‹?«
»Er ist neu, Gerry. Das geht vorbei.«
»Er will uns sehen. Er hat mich in der Teeküche angesprochen und gesagt, er will jeden einzelnen von uns allein sprechen. Ich soll …« – Vos schaute auf seine Uhr – »… jetzt bei ihm sein. Und du bist als nächster dran. Wir müssen zusammenhalten, Mat. Wir sind die beiden Dienstältesten hier. Wir müssen es diesem Arschloch von Anfang an zeigen. Hast du ihn über Fitneß reden gehört? Ich sehe uns schon jeden Morgen auf dem Parkplatz trainieren.«
Joubert lächelte schwach.
Vos stand auf. »Ich sag dir Bescheid, wenn ich fertig bin. Aber vergiß nicht: Wir müssen zusammenhalten. Selbst wenn wir keine gottverdammten Patrioten sind.«
»Ist schon okay, alles nur Gerede, Mat«, sagte Vos fünfunddreißig Minuten später, als er wieder hereinkam. »Er wartet auf dich. Sehr freundlich und voller Komplimente.«
Joubert seufzte, zog sein Jackett an und ging durch den Flur.
Colonel Bart de Wit hatte Willie Theals Büro in sein eigenes verwandelt, stellte Joubert fest, nachdem er geklopft hatte und hereingebeten worden war.
Die Mannschaftsfotos an der Wand waren verschwunden, ebenso der schmutziggrüne Teppich auf dem Boden und die kranke Topfpflanze in der Ecke. Drei Diplome hingen jetzt an der frisch gestrichenen weißen Wand. Der Boden war mit polizeiblauem Teppich ausgelegt, und in der Ecke stand ein Tischchen, auf dem ein kleines Schild verkündete ICH ZIEHE ES VOR, NICHT ZU RAUCHEN. Auf dem Schreibtisch stand ein Rahmen mit vier Fotos – eine lächelnde Frau mit einem dicken Brillengestell, ein Junge mit der Nase seines Vaters, ein Mädchen mit einem dicken Brillengestell. Das letzte Bild zeigte de Wit mit dem Minister für innere Sicherheit.
»Setzen Sie sich, Captain«, sagte de Wit und deutete auf den blaugrauen Stuhl. Er setzte sich ebenfalls. Sofort begann er freundlich zu lächeln.
Dann richtete er die dicke Personalakte vor sich aus und schlug sie auf. »Was haben Sie gesagt? Man nennt Sie Max?«
»Mat.«
»Mat?«
»Das sind meine Initialen, Colonel. Ich wurde Marcus Andreas Tobias getauft. M. A. T. So hat mein Vater mich genannt.« Jouberts Stimme klang sanft, geduldig.
»Ihr Vater war auch Polizist, wie ich sehe.«
»Ja, Colonel.«
»Aber nur in Uniform?«
»Ja, Colonel.«
»Aha.«
Ein unbequemes Schweigen folgte. Dann griff de Wit nach der Personalakte.
»Ich mache aus meinem Herzen keine Mördergrube, Captain. Nicht, was meine politischen Ansichten angeht, und auch nicht bei der Arbeit. Also werde ich schmerzhaft ehrlich mit Ihnen sein. Es läuft nicht gut. Seit dem Tod Ihrer Frau.«
Das Lächeln in de Wits Gesicht paßte nicht zur Ernsthaftigkeit seiner Stimme. Das verwirrte Mat Joubert.
»Auch sie war Polizistin, nicht wahr?«
Joubert nickte. Er fragte sich, was der Mann auf der anderen Seite des Schreibtisches wußte.
»Sie starb im Dienst?«
Wieder nickte Joubert, und sein Herz schlug schneller.
»Eine Tragödie. Aber bei allem Respekt, Captain, seitdem sieht das nicht gut mit Ihnen aus …« Er schaute wieder in die Akte. »Eine ernsthafte Verwarnung und zwei Beschwerden von sieben Ihrer Kollegen. Eine deutliche Abnahme gelöster Straftaten …«
Joubert starrte das Foto von de Wit und dem Minister an. Der Minister war einen halben Meter größer. Beide strahlten breit. Es war ein gutes Bild. Man konnte die Warze sehen.
»Möchten Sie dazu Stellung nehmen, Captain?«
Das fragende Lächeln auf de Wits Gesicht störte Joubert.
»Es steht alles in der Akte, Colonel.«
»Das Disziplinarverfahren.« De Wit überflog den Eintrag vor sich. »Der Fall Wasserman. Sie haben sich geweigert, eine Aussage abzugeben …« Er wartete auf Jouberts Reaktion. Das Schweigen zog sich hin.
»Es steht alles in der Akte, Colonel. Ich habe keine Aussage gemacht, denn Adjutant Potgieters Aussage war korrekt.«
»Sie haben sich also unangemessen verhalten.«
»Laut Definition ja, Colonel.«
»Und die zwei Beschwerden von insgesamt sieben Kollegen, die erklärten, daß sie nicht wieder Ihrem Einsatzkommando zugeteilt werden wollen?«
»Das kann ich ihnen nicht übelnehmen, Colonel.«
De Wit lehnte sich auf seinem Stuhl zurück, ein Herrscher. »Ich mag Ihre Ehrlichkeit, Captain.«
Joubert war erstaunt, daß der Mann gleichzeitig sprechen und lächeln konnte.
»Aber ich weiß nicht, ob das reicht, um Sie zu retten. Sehen Sie, Captain, wir befinden uns im neuen Südafrika. Wir müssen alle unseren Beitrag leisten. Man kriegt’s hin, oder man läßt es bleiben. Es gibt Leute in benachteiligten Bevölkerungsschichten, denen man helfen muß. Das gilt auch für den Polizeidienst. Wir können die Posten nicht aus sentimentalen Gründen besetzt halten. Verstehen Sie?«
Joubert nickte.
»Und außerdem erwartet man von mir Erfolge. Der Druck ist groß. Nicht nur auf mich – auf die neue Regierung. Alle warten auf Fehler. Die Weißen würden liebend gern sehen, daß die schwarze Regierung Fehler macht, damit sie sagen können: Wir haben es doch gleich gesagt.« De Wit beugte sich vor. Sein Lächeln wurde noch breiter. »Aber hier wird es keine Fehler geben. Verstehen wir einander?«
»Ja, Colonel.«
»Man kriegt’s hin, oder man läßt es bleiben.«
»Ja, Colonel.«
»Fragen Sie sich selbst, Captain: Bin ich ein Sieger? Dann werden Sie hier stets willkommen sein.«
»Ja, Colonel.«
De Wit seufzte tief, lächelte dabei aber weiter. »Ihre erste ärztliche Untersuchung findet heute nachmittag um 14.00 Uhr statt. Und noch etwas: Die Polizei hat zwei Psychologen unter Vertrag genommen, die unseren Mitarbeitern behilflich sein können. Ich habe Sie empfohlen. Man wird sich bei Ihnen melden. Vielleicht schon morgen. Einen schönen Tag noch, Captain.«
4
Die Premier Bank war vor fünfundsiebzig Jahren als Baugenossenschaft gegründet worden, aber ein solches Finanzinstitut war aus der Mode gekommen. Also hatte man den Geschäftsbereich erweitert. Nun konnten die Kunden neben Baufinanzierungen auch noch in Dispositionskrediten, Kleinkrediten und allen anderen denkbaren Möglichkeiten ersaufen, mit denen man aus Menschen Zinsen herausquetschte.
Für den Durchschnittskunden gab es das Rubin-Konto mit einem Scheckbuch in Grau und einem blassen Malventon sowie dem Aufdruck des roten Edelsteins. Wer über ein höheres Einkommen und größere Schulden verfügte, qualifizierte sich für das Smaragd-Konto – mit einem grünen Edelstein. Vor allem aber wollte Premier, daß alle Kunden versuchten, ein Diamant-Konto zu erlangen.
Susan Ploos van Amstel sah den attraktiven Mann mit der Goldbrille, dem blonden Haar, der gebräunten Haut und dem stahlgrauen Anzug auf ihr Kassenhäuschen zukommen und wußte gleich, daß es sich um einen Diamant-Kunden handelte.
Susan war dick, vierunddreißig Jahre alt und hatte drei Kinder, die ihre Nachmittage in der Kinderbetreuung verbrachten, und einen Mann, der seine Abende in der Garage damit verbrachte, an seinem 1962er Anglia herumzuschrauben. Als der blonde Mann lächelte, fühlte sie sich jung. Seine Zähne strahlten in makellosem Weiß. Sein Gesicht war schmal, aber kräftig. Er sah aus wie ein Filmstar.
»Schönen guten Tag, Sir. Was kann ich für Sie tun?« Susan lächelte ihn freundlich an.
»Hi«, sagte er, und seine Stimme war tief und voll. »Ich habe mir sagen lassen, daß es in dieser Zweigstelle die hübschesten Kassiererinnen am ganzen Kap gibt. Und das stimmt ganz offensichtlich.«
Susan errötete und sah zu Boden. Sie genoß den Augenblick.
»Süße, könnten Sie mir einen großen Gefallen tun?«
Susan schaute wieder auf. Er würde ihr doch kein unmoralisches Angebot machen? »Aber sicher, Sir. Was Sie wollen.«
»Oh, das ist gefährlich, Süße«, sagte er, und in seiner Stimme schwang Zweideutigkeit mit. Susan kicherte und errötete noch tiefer.
»Aber wir müssen auf ein andermal warten. Können Sie jetzt bitte eine dieser großen alten Banktaschen nehmen und mit Scheinen füllen – Fünfziger und größer? Ich habe hier unter meiner Jacke eine große alte Knarre …«
Er öffnete sein Jackett ein wenig. Susan erkannte den Griff einer Waffe.
»… und ich will sie nicht benutzen müssen. Aber Sie scheinen ein hübsches, kluges Mädchen zu sein. Wenn Sie mir schnell helfen, bin ich weg, bevor etwas Schlimmes passieren kann.« Seine Stimme blieb ruhig, der Tonfall gelassen.
Susan wartete auf das Lächeln, mit dem er anzeigen würde, daß er scherzte, doch er lächelte nicht.
»Sie meinen es ernst.«
»Sicher, Süße.«
»Großer Gott.«
»Nein, Süße, schöne große Scheine.«
Susans Hände begannen zu zittern. Sie erinnerte sich an ihre Ausbildung. Der Alarmknopf befindet sich auf dem Boden. Drück ihn! Ihre Beine waren aus Götterspeise. Mechanisch griff sie nach einem Leinenbeutel. Sie öffnete die Schublade mit dem Geld und begann Scheine einzupacken. Drück ihn!
»Ihr Parfüm riecht gut. Wie heißt es?« fragte er mit seiner wunderbaren Stimme.
»Royal Secret«, sagte sie und errötete trotz der gegebenen Umstände. Sie hatte keine Fünfziger mehr. Sie gab ihm die Tasche. Drück auf den Knopf!
»Sie sind großartig. Vielen Dank! Sagen Sie Ihrem Mann, er soll auf Sie aufpassen. Sonst brennt vielleicht noch jemand mit Ihnen durch.«
Er schenkte ihr ein breites Lächeln, nahm die Tasche und ging. Als er durch die Glastür hinausmarschierte, drückte Susan Ploos van Amstel mit dem Zeh auf den Alarmknopf.
»Es könnte eine Perücke sein, aber wir werden ein Phantombild erstellen lassen«, erklärte Mat den drei Reportern. Er bearbeitete den Premier-Überfall, weil er ohnehin am Oberen Kap im Einsatz war, wo ein Obdachloser einen Freund mit Hilfe reinsten Fusels in Brand gesteckt hatte, in Brackenfell, wo in einem Fischladen bei einem Überfall eine Schießerei stattgefunden hatte, und in Mitchells Plain, wo ein dreizehnjähriges Mädchen von vierzehn Mitgliedern einer Gang vergewaltigt worden war.
»Nur 7000 Rand. Das muß ein Amateur sein«, sagte die Reporterin vom The Cape Argus und lutschte an ihrem Kugelschreiber. Joubert sagte nichts, sondern schaute durch die Glastür zum Büro des Zweigstellenleiters, hinter der Susan Ploos van Amstel ihre Geschichte weiteren Kunden erzählte.
»Der ›Süße‹-Bankräuber. Könnte eine nette Geschichte werden. Glauben Sie, er versucht es wieder, Captain?« fragte der Mann vom Burger. Joubert zuckte mit den Achseln.
Es gab keine weiteren Fragen. Die Reporter entschuldigten sich, Joubert sagte ihnen auf Wiedersehen und setzte sich. Die Phantombildzeichner waren schon unterwegs.
Er fuhr den Dienstwagen, einen blauen Sierra, weil er Bereitschaftsdienst hatte. Auf dem Weg nach Hause hielt er bei dem Secondhand-Buchladen in der Koeberg Road. Billy Wolfaardt stand in der Tür.
»Hi, Captain. Wie läuft’s mit den Morden?«
»Immer gleich, Billy.«
»Zwei Ben Bovas sind reingekommen. Aber ich glaube, die haben Sie schon.«
Joubert ging zu den Science-Fiction-Büchern hinüber.
»Und ein neuer William Gibson.«
Joubert fuhr mit dem Finger über die Rücken der Bücher. Billy Wolfaardt wandte sich ab und ging zur Kasse an der Tür. Er wußte, daß der Captain kein großer Redner war.
Joubert schaute die Bovas an, stellte sie zurück ins Regal, nahm den Gibson und zahlte dafür. Er verabschiedete sich und fuhr davon. Auf dem Nachhauseweg holte er sich Kentucky-Chicken.
Jemand hatte einen Umschlag unter seiner Tür hindurchgeschoben. Er trug ihn zusammen mit dem Taschenbuch und dem Essen in die Küche.
Der Umschlag war mit Zeichnungen von Blumen in blassen Pastellfarben verziert. Er legte die anderen Sachen hin, holte ein Messer aus der Schublade und schlitzte den Umschlag auf. Darin lag ein einzelnes Blatt Papier mit demselben Blumenmuster, in der Mitte gefaltet. Es roch süß. Parfüm. Er faltete es auseinander. Die Handschrift gehörte unverkennbar einer Frau. Er las:
Die hitzige Umarmung
Meines tiefsten Verlangens
Entfacht die Flamme
Deines lodernden Feuers
Schmeck mich, berühr mich, nimm mich
Spieß mich auf wie einen Schmetterling
Mein Liebster, du wirst sehen
Mich lieben heißt mich sterben lassen.
Keine Unterschrift. Das Parfüm war die Unterschrift. Er erkannte es.
Joubert setzte sich an den Küchentisch. Warum tat sie ihm das an? Er brauchte nicht noch so eine Nacht wie die letzte.
Er las es noch einmal. Die offenherzigen Verse ließen Bilder in seinem Geist erscheinen – Yvonne Stoffberg, ihr junger Körper nackt, unter ihm, Schweiß glitzerte auf den vollen, runden Brüsten …
Er warf das Gedicht samt Umschlag in den Mülleimer und ging in sein Zimmer. Nicht noch so eine Nacht. Das würde er nicht durchhalten. Er warf seine Krawatte auf das Bett, ging das Taschenbuch holen und nahm es mit ins Wohnzimmer.
Es fiel ihm schwer, sich zu konzentrieren. Nach sieben mühsamen Seiten holte er das Gedicht aus dem Mülleimer und las es noch einmal. Er ärgerte sich über seine mangelnde Disziplin.
Sollte er sie anrufen? Nur um sich zu bedanken.
Nein.
Vielleicht ging ihr Vater an den Apparat, und er wollte nichts anfangen.
Nur um sich zu bedanken.
Er dachte, das Verlangen wäre in ihm abgestorben. Um dieselbe Zeit gestern hatte er noch geglaubt, das Verlangen wäre tot.
Das Telefon klingelte. Joubert erschrak, stand auf, ging ins Schlafzimmer.
»Joubert.«
»Einsatzzentrale, Captain. Schüsse vor dem Holiday Inn in Newlands. Ein Toter, männlich, weiß.«
»Bin schon unterwegs.«
5
Der andere Kollege, der Mat Joubert noch nicht aufgegeben hatte, war Detective Sergeant Benny Griessel. Denn trotz allen zynischen Gehabes – Griessel verstand Jouberts Rückzug absolut. Er war überzeugt, daß ein Detective der Mordkommission in irgendeinem Bereich einknicken mußte, denn der Tod war sein ständiger Begleiter, war Brot und Butter für ihn.
Etwas mehr als ein Jahr lang hatte Griessel zugeschaut, wie Joubert tiefer und tiefer im Treibsand der Depression versank und nicht fähig war, sich daraus zu befreien. Und Griessel hatte sich gesagt: besser das als die Flasche. Benny Griessel kannte sich aus mit Flaschen. Der Alkohol erlaubte es ihm, den Schatten des Todes zu vergessen, aber gleichzeitig flohen seine Frau und die zwei Kinder Hals über Kopf vor dem widerwärtigen, hartherzigen Trinker, der am Samstagabend ihr Leben zur Hölle machte. Und auch an vielen anderen Abenden der Woche.
Nein, Mat Joubert war immer noch besser dran.
Griessel war der erste am Tatort. Er war mittelgroß und hatte ein slawisches Gesicht, eine gebrochene Nase und verhältnismäßig lange schwarze Haare. Er trug einen zerknitterten blauen Anzug.
Joubert drängelte sich durch die Zuschauermenge, bückte sich unter dem gelben Plastikband hindurch, mit dessen Hilfe die Uniformierten den Tatort abgesperrt hatten, und ging hinüber zu Griessel, der am Rande des Parkplatzes mit einem jungen, blonden Mann redete. Die Polizisten hatten ein Tuch über die Leiche gebreitet. Es lag formlos im Schatten eines stahlblauen BMW.
»Captain«, begrüßte ihn Griessel. »Mr. Merryck hier hat die Leiche gefunden und die Polizei gerufen. Von der Rezeption des Hotels aus.« Joubert roch den Alkohol in Griessels Atem. Er schaute Merryck an, sah die Goldbrille und den schütteren Schnauzbart. Ein wenig Erbrochenes klebte noch an seinem Kinn. Die Leiche konnte kein schöner Anblick gewesen sein.
»Mr. Merryck ist Gast des Hotels. Er hat dort drüben geparkt und wollte hineingehen, als er die Leiche sah.«
»Es war schrecklich. Grauenvoll«, sagte Merryck. »Aber man muß seine Pflicht tun.«
Griessel klopfte ihm auf die Schulter. »Sie können jetzt gehen. Wenn wir Sie noch brauchen, wissen wir, wo Sie zu finden sind«, sagte er in seinem fehlerfreien Englisch. Joubert und er gingen hinüber zu der Leiche. »Der Fotograf ist schon unterwegs. Ich habe einen Leichenbeschauer angefordert, Spurensicherung und Leute für Fingerabdrücke. Und den Großteil der Leute vom Einsatzkommando. Es ist ein Weißer«, sagte Griessel und zog das Tuch beiseite.
Zwischen zwei leer starrenden Augen befand sich der kleine Blutsee einer Schußwunde, offen, höhnisch, in makelloser Symmetrie.
»Aber sieh dir das an«, sagte Griessel und zog das Tuch ein wenig weiter herunter. Joubert entdeckte eine weitere Wunde, ein blutig schwarzrotes Loch in der Brust, in der Mitte eines hübschen Anzugs mit Hemd und Krawatte.
»Herrgott«, sagte Mat Joubert und wußte plötzlich, warum Merryck sich übergeben hatte.
»Ein großes Kaliber.«
»Genau«, sagte Griessel. »Eine Kanone.«
»Sieh in seine Taschen«, sagte Joubert.
»Kein Raubüberfall«, erklärten sie praktisch gleichzeitig, als sie die goldene Rolex an seinem Arm entdeckten, und sie wußten beide, daß das den Fall unendlich verkomplizierte.
Jouberts Hand flog schnell über die leblosen Augen, schob die Augenlider herunter. Er erkannte die Machtlosigkeit im Angesicht des Todes, so lagen alle Leichen da, verwundbar, Hände und Arme würden nie mehr verschränkt werden, um das Leben zu schützen, das Gesicht. Er zwang sich, wieder an seine Arbeit zu denken.
Stimmen hinter ihnen begrüßten sich. Detectives aus dem Einsatzkommando. Joubert erhob sich. Sie kamen und sahen sich die Leiche an. Griessel scheuchte sie davon, als sie das blasse Licht der Straßenlampe blockierten.
»Fangt hier an! Sucht den ganzen Bereich ab! Jeden Zentimeter.«
Das übliche Gestöhne begann, aber sie gehorchten, sie wußten, wie wichtig die erste Suche nach frischen Spuren war. Griessel ging vorsichtig die Taschen des Verstorbenen durch. Dann erhob er sich mit einem Scheckbuch und Wagenschlüsseln in der Hand. Er warf Adjutant Basie Louw die Schlüssel hin.
»Sie sind für einen BMW. Versuchen Sie es mit dem hier.«
Griessel öffnete das in graues Leder eingeschlagene Scheckbuch. »Wir haben einen Namen«, sagte er. »JJ Wallace. Und eine Adresse. Oxford Street 96, Constantia.«
»Der Schlüssel paßt«, sagte Louw und zog ihn vorsichtig wieder heraus, um keine Fingerabdrücke am Wagen zu hinterlassen.
»Ein reicher Sack«, sagte Griessel. »Das wird Schlagzeilen machen.«
Gerrit Snyman, ein junger Detective Constable, fand die Patrone unter einem in der Nähe stehenden Wagen. »Captain«, rief er. Er war noch unerfahren genug, um sofort begeistert zu sein. Joubert und Griessel gingen zu ihm. Snyman leuchtete mit seiner Taschenlampe auf die leere Patronenhülse. Joubert nahm sie hoch und hielt sie ins Licht. Griessel beugte sich vor, er las die Zahlen auf der Rückseite ab.
»Sieben Komma sechs drei.«
»Unmöglich. Sie ist zu kurz. Das muß eine Pistole gewesen sein.«
»Da, lies doch selber. Sieben Komma sechs … drei. So sieht es jedenfalls aus. Vielleicht ist es schlecht gedruckt.«
»Vielleicht auch sechs zwei.«
Benny Griessel schaute Joubert an. »So muß es sein. Und das bedeutet nur eines.«
»Die Waffe ist eine Tokarew«, seufzte Joubert.
»Apla«, seufzte Benny. »Scheißpolitik.«
Joubert ging zu seinem Dienstwagen. »Ich rufe den Colonel.«
»De Wit? Der kotzt sich doch nur die Lunge aus dem Leib.« Griessels Grinsen glänzte silbern im Licht der Straßenlaterne.
Einen Augenblick lang hatte Joubert vergessen, daß Willie Theal nie mehr wieder an einen Tatort kommen würde. Er fühlte sich niedergeschlagen.
Das Haus in der Oxford Street Nummer 96 war ein großes Einzelhaus auf einem riesigen Grundstück. Der Garten drückte eine Üppigkeit aus, die selbst in der Dämmerung beeindruckte.
Irgendwo tief im Haus war die Türklingel zu hören und übertönte für einen Moment das Fernsehprogramm. Sekunden verstrichen. Drinnen ging die sorglose Zeit zu Ende, dachte Joubert. Der Engel des Todes stand vor der Haustür. Die Nachricht, die sie überbrachten, würde wie ein Parasit Freude und Frieden aus ihrem Leben saugen.
Eine Frau öffnete die Tür, irritiert, mit gerunzelter Stirn. Langes, dichtes braunes Haar hing ihr über eine Schulter, es bedeckte einen Teil ihrer gelb gemusterten Schürze und lenkte den Blick von ihren Augen ab.
Ihre Stimme war melodiös und gereizt. »Kann ich Ihnen helfen?«
»Mrs. Wallace?« fragte er. Dann sah er ihre Augen. Griessel ebenfalls. Sie paßten nicht zusammen, das eine war hellblau und strahlte, das andere war braun, irgendwo zwischen hell und dunkel. Joubert bemühte sich, sie nicht anzustarren.
»Ja«, sagte die Frau, und sie erkannte, daß die beiden Herren keine Vertreter waren. Die Furcht zog wie ein Schatten über ihr Gesicht.
»Es geht um James, nicht wahr?«
Ein etwa zehnjähriger Junge erschien hinter ihr. »Was ist, Mom?«
Sie sah sich besorgt um. »Jeremy, bitte geh auf dein Zimmer.« Ihre Stimme klang sanft, aber bestimmt. Der Junge wandte sich ab. Sie schaute zurück zu den Detectives.
»Wir sind von der Polizei«, sagte Joubert.
»Kommen Sie am besten herein.« Die Frau öffnete die Tür weit und nahm ihre Schürze ab.
Mrs. Margaret Wallace schluchzte voll hilfloser Trauer, die Hände in den Schoß gelegt, die Schultern leicht vorgebeugt. Tränen blieben an der gelben Wolle ihres Sweaters hängen und glitzerten im strahlenden Licht eines Kandelabers.
Joubert und Griessel starrten auf den Teppich.
Joubert konzentrierte sich auf die Kugel und die Klaue unten am Bein des Couchtisches. Er wollte in seinem Sessel zu Hause sitzen, sein Taschenbuch im Schoß, ein Bier in der Hand.
Der Junge kam einen Flur herunter, hinter sich ein Mädchen, das zwischen acht und zehn sein mochte.
»Mom?« Seine Stimme jung und furchtsam.
Margaret Wallace richtete sich auf, wischte sich mit dem Handrücken über das Gesicht. Sie erhob sich voller Würde. »Entschuldigen Sie mich.« Sie nahm die Hände ihrer Kinder und führte sie durch einen Flur. Eine Tür wurde geschlossen. Die Stille war ohrenbetäubend. Jemand weinte. Dann wieder Stille.
Sie sahen einander nicht an, denn das wäre ein Eingeständnis.
Schließlich kehrte Margaret Wallace zurück. Ihre Schultern immer noch aufrecht, als könnte sie ihre Gefühle körperlich zurückhalten. Aber sie wußten es besser.
»Ich muß meine Mutter anrufen. Sie wohnt in Tokai. Sie kann mir mit den Kindern helfen. Ich bin sicher, Sie werden viele Fragen haben.« Ihre Stimme war tonlos wie die einer Schlafwandlerin.
Joubert wollte ihr am liebsten sagen, daß sie später zurückkämen, aber das konnte er nicht.
Margaret Wallace war nach wenigen Minuten zurück. »Meine Mutter kommt her. Sie ist stark. Mein Vater … Ich habe das Mädchen gebeten, uns Tee zu machen. Ich nehme an, Sie trinken Tee?«
»Danke, aber …« Jouberts Stimme war ein wenig heiser. Er räusperte sich.
»Wenn Sie mich entschuldigen, dann bleibe ich bei den Kindern, bis sie kommt.« Sie wartete nicht auf eine Antwort und entfernte sich durch den halbdunklen Flur.
Jouberts Pieper piepte. Er schaute auf die Nachricht: ADJ LOUW ANR. Dann folgte eine Telefonnummer.
Er hatte Louw und drei weitere Detectives ins Hotel geschickt, weil es dort Zimmer mit Ausblick auf den Parkplatz gab. Erst hatte der Leichenbeschauer über der Leiche vor sich hin gemurmelt. Dann war Bart de Wit aufgetaucht und hatte eine Pressekonferenz über einen Mord einberufen, bei dem es noch keine Spuren gab. Benny und er waren in die Oxford Street geflohen, nachdem er angefangen hatte.
»Der Mann ist ein Clown«, hatte Benny unterwegs gesagt. »Der schafft es nicht lang.« Joubert fragte sich, ob der Chef auch die niederrangigen Mitarbeiter einen nach dem anderen hereingerufen hatte. Und ob de Wit etwas von Griessels Alkoholproblem wußte.
»Basie will mich sprechen«, brach er die deprimierende Stille und erhob sich. Er ging in das Zimmer, aus dem Margaret Wallace zuvor ihren Anruf getätigt hatte. Er hörte das Hausmädchen in der Küche mit Porzellan klirren.
Es sah aus wie ein Arbeitszimmer. Ein Schreibtisch mit einem Computer und ein Telefon standen in der Mitte. An der Rückwand befand sich ein Bücherregal mit Akten, ein paar Büchern über Geschäftstechniken und einer Handvoll Reader’s-Digest-Zusammenfassungen von Bestsellern in ihren übertriebenen Kunstledereinbänden. Die Wand neben der Tür hing voller Fotos und Abschlußzertifikate. Außerdem eine große Zeichnung eines Cartoonisten, der aus dem Ort kam. Sie zeigte James Wallace – dichtes schwarzes Haar, prächtigen Schnauzer, leicht vorstehende Wangen. Seine Karikatur trug einen edlen Anzug. In einer Hand hielt sie eine Aktentasche mit dem Logo WALLACE QUICKMAIL. Unter dem anderen Arm klemmte ein Cricket-Schläger, in der Hand hielt er eine Flagge, auf der WP CRICKET stand.
Joubert wählte die Nummer. Es war der Anschluß einer Hotelrezeption. Er verlangte Basie zu sprechen und wartete kurz.
»Captain?«
»Ja, Basie.«
»Wir haben jemanden gefunden, Captain. Eine Frau, blond. Sie sagt, Wallace sei bei ihr auf dem Zimmer gewesen. Aber wir haben sie nicht weiter befragt. Wir warten auf Sie.«
»Können Sie bei ihr bleiben? Benny und ich werden noch eine Weile hier sein.«
»Kein Problem, Captain.« Louw klang begeistert. »Oh, und da war noch eine Patronenhülse. Unter der Leiche.«
Als Joubert das Arbeitszimmer verließ, schaute er noch einmal auf die Zeichnung an der Wand. Ihm wurde bewußt, daß die Bedeutungslosigkeit des Lebens genau so tragisch war wie die Endgültigkeit des Todes.
»Er hat sein Geschäft ganz alleine gegründet«, sagte Margaret Wallace. Sie saß auf der Kante des großen, gemütlichen Sessels, die Hände im Schoß, die Stimme gleichmäßig, ohne Ausdruck, kontrolliert.
»Er bekam den Auftrag, Kommunalobligationen zuzustellen. Am Anfang war es schwer. Er mußte eine Adressiermaschine und einen Computer aus den Vereinigten Staaten importieren, aber damals wurde noch jeder Brief von Hand in die Umschläge gesteckt und dann zugeklebt. Ich habe ihm geholfen. Wir haben oft Nächte durchgearbeitet. Er hat vor zwei Jahren siebzig Prozent der Firma an Promail International verkauft, aber sie haben den Namen beibehalten. Er ist immer noch Vorstandsmitglied und fungiert als Berater.«
Joubert bemerkte, daß sie über ihren Mann immer noch im Präsens sprach. Aber er wußte, daß sich das am nächsten Tag ändern würde, nach der Nacht.
»War Ihr Ehemann politisch engagiert?«
»Politisch?« fragte Margaret Wallace, die überhaupt nicht zu verstehen schien, was sie sagen wollten.
»War Mr. Wallace Mitglied einer politischen Partei?« fragte Griessel.
»Nein, er …« Ihre Stimme brach. Sie warteten. »Er war … unpolitisch. Er hat nicht einmal gewählt. Er sagt, die Politiker seien alle gleich. Sie wollen nur an die Macht. Sie kümmern sich nicht wirklich um die Menschen.« Ihre Stirnfalten vertieften sich.
»Hatte er mit Townships zu tun? Sozialarbeit?«
»Nein.«
»Seine Firma?«
»Nein.«
Joubert versuchte es aus einer anderen Richtung. »Wissen Sie von irgendwelchen Problemen bei der Arbeit, in der letzten Zeit?«
Sie schüttelte leicht den Kopf, ihr braunes Haar bewegte sich. »Nein.«
Die verschiedenfarbigen Augen zwinkerten. Sie riß sich zusammen, das wußte Joubert. Er half ihr: »Wir sind sicher, daß es eine logische Erklärung für diese schreckliche Tat geben muß, Mrs. Wallace.«
»Wer kann so etwas tun? Gibt es nicht schon genug Tod und Zerstörung in diesem Land? James war nicht perfekt, aber …«
»Es könnte ein Unfall gewesen sein, Mrs. Wallace. Oder ein Raubüberfall. Das Motiv für solche Dinge ist normalerweise Geldgier«, sagte Griessel.
Oder Sex, dachte Joubert.
»Wissen Sie, ob jemand Ihrem Mann Geld schuldete? Irgendwelche anderen Firmen, Transaktionen …«
Sie schüttelte wieder den Kopf. »James ging sehr verantwortungsvoll mit Geld um. Er hat nicht einmal gespielt. Wir sind letztes Jahr nach Sun City gefahren, mit den Leuten von Promail. Er nahm 5000 Rand mit und sagte, wenn die weg seien, würde er aufhören. Und das tat er. Unser Haus ist sogar abbezahlt, Gott sei Dank …«
Griessel räusperte sich. »Sie waren glücklich verheiratet.« Eine Feststellung.
Margaret Wallace schaute Griessel an und runzelte wieder die Stirn. »Ja, das glaube ich schon. Wir haben natürlich auch mal gestritten. James liebte Cricket. Manchmal kam er nach einer Nacht mit den Jungs angetrunken nach Hause. Und manchmal bin ich da zu empfindlich. Ich kann ganz schön launisch sein, schätze ich. Aber unsere Ehe funktioniert, auf ihre eigenartige Art. Die Kinder … mittlerweile dreht sich unsere Existenz um die Kinder.« Sie schaute in Richtung des Schlafzimmers, in dem ihre Mutter nun die Kinder betreute.
Die Stille wuchs. Dann sprach Joubert. Er fand seine Stimme künstlich und übermäßig mitleidig. »Mrs. Wallace, laut Gesetz müssen Sie Ihren Mann im Leichenschauhaus identifizieren …«
»Das kann ich nicht.« Ihre Stimme war gedämpft; gleich würden ihr wieder die Tränen kommen.
»Gibt es jemand, der das könnte?«
»Das muß jemand aus dem Büro machen. Walter Schutte vielleicht, der geschäftsführende Direktor.« Sie nannte ihnen eine Telefonnummer, die Joubert aufschrieb.
»Ich werde ihn anrufen.«
Sie standen auf. Sie tat es ihnen gleich, aber sie zögerte, denn sie wußte, daß nun die Nacht vor ihr lag.
»Wenn wir etwas für Sie tun können …«, sagte Griessel, und er klang, als meinte er es ernst.
»Wir schaffen das schon«, sagte Margaret Wallace und begann wieder bitterlich zu weinen.
Die Blondine hockte auf einem der Schlafzimmerstühle des Hotels. Sie hieß Elizabeth Daphne van der Merwe.
Joubert saß auf dem anderen Stuhl. Griessel, Louw und O’Grady hatten auf dem Rand des großen Doppelbettes Platz genommen, die Arme überkreuzt, wie Richter.
Ihr Haar war strohfarben getönt. Ihr Gesicht lang und schmal, die Augen groß und braun, mit langen Wimpern, die Nase klein und schmal. Tränen hatten Mascara-Spuren über ihre Wangen gezogen. Lizzie van der Merwe hatte echte Schönheit knapp verfehlt, denn ihr Mund paßte nicht zu ihrem Gesicht. Ihre Schneidezähne sahen ein wenig hasenhaft aus, die Unterlippe war zu dünn, zu nah an dem schwachen Kinn. Sie war schlank und großgewachsen und hatte kleine, feste Brüste unter einer weißen Bluse. Über ihren hervorstehenden Hüftknochen spannte sich ein schwarzer Rock, der zuviel von ihren Beinen zeigte, die in beigefarbenen Strumpfhosen steckten, die in eleganten hochhackigen Schuhen endeten.
»Wo haben Sie den Verstorbenen kennengelernt?« Jetzt lag kein Mitgefühl mehr in Jouberts Stimme.
»Ich habe ihn heute nachmittag kennengelernt.« Sie zögerte und sah auf. Die Detectives starrten sie alle an, die Gesichter ungerührt. Die langen Wimpern tanzten über ihre Wangen. Keiner reagierte.
»Ich arbeite für ›Zeus Computer‹. In Johannesburg. Ich habe letzte Woche angerufen. Wir bieten neue Produkte an … James … äh … Mr. Wallace … Sie haben mich an ihn verwiesen. Er ist ihr Berater in Sachen Computer. Also bin ich heute morgen hierhergeflogen. Ich hatte einen Termin um elf. Dann hat er mich zum Mittagessen eingeladen …« Ihr Blick wanderte von Gesicht zu Gesicht. Sie suchte nach einem, das Mitgefühl zeigte.
Sie warteten schweigend. Wieder tanzten ihre Wimpern. Die Unterlippe zitterte und betonte dadurch noch die beiden Schneidezähne, die sie zu verbergen versuchte.
»Und dann?« fragte Joubert sanft. Sie schätzte seinen Tonfall und wandte ihm ihre großen Augen zu.
»Er … Wir tranken Wein. Und wir redeten. Er sagte, er sei unglücklich mit seiner Ehe … seine Frau würde ihn nicht verstehen. Da war etwas zwischen uns. Er war so verständnisvoll. Er ist Widder. Ich bin Jungfrau.«
Joubert runzelte die Stirn.
»Sternzeichen …«
Die Stirnfalten verschwanden. »Dann kamen wir her. Ich habe ein Zimmer, weil ich über Nacht bleibe. Ich habe morgen noch einen Termin. Mit jemandem von einer anderen Firma. Er ist nach sechs gegangen. Ich bin nicht sicher, wann genau. Aber da habe ich ihn das letzte Mal gesehen.« Wieder klimperte sie mit den Wimpern.
Basie Louw räusperte sich. »Was ist hier geschehen? In diesem Zimmer?«
Sie weinte noch mehr.
Sie stand auf und ging ins Bad. Die Polizisten hörten, wie sie sich schneuzte. Wasser wurde aufgedreht. Dann Stille. Dann schneuzte sie sich noch einmal. Sie kam zurück und setzte sich. Die Mascara-Spuren waren verschwunden.
»Sie wissen, was hier geschehen ist. Hier …«
Die drei Polizisten schauten sie erwartungsvoll an.
»Wir haben uns geliebt.« Sie weinte wieder. »Er war so zärtlich …«
»Miss, kennen Sie noch jemand anderen in Kapstadt?« fragte Mat Joubert.
Sie zog ein Taschentuch aus dem Ärmel ihrer weißen Bluse und putzte sich erneut die Nase. »Ich habe Freunde hier, aber ich habe sie seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen.«
»Gibt es jemanden, der … unglücklich wäre, wenn Sie mit anderen Männern schlafen?«
Ihr Kopf zuckte hoch. »Ich schlafe nicht mit anderen Männern …«
Die Augenbrauen der drei Detectives auf dem Bett hoben sich mit militärischer Präzision.
»Verstehen Sie denn nicht? Da war etwas zwischen uns. Wir … wir waren … Es war wundervoll.«
Joubert formulierte die Frage anders: »Miss, wir wollen wissen, ob Sie mit jemandem zusammen sind, den es stören würde, daß Sie und der Verstorbene zusammen geschlafen haben.«
»Oh, Sie meinen … Nein, auf keinen Fall. Ich habe nicht einmal einen festen Freund.«
»Gehören Sie einer politischen Partei oder Gruppierung an, Miss van der Merwe?«
»Ja.«
»Welcher?«
»Ich bin Mitglied der Demokratischen Partei. Aber was hat das …«
Griessel gab ihr keine Chance. »Hatten Sie jemals Verbindungen zum Pan African Congress?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Apla?«
»Nein, ich …«
»Kennen Sie jemanden, der diesen Gruppierungen angehört?«
»Nein.«
»Was hat der Verstorbene gesagt, als er ging? Hatte er noch einen weiteren Termin?« fragte Griessel.
»Er sagte, er müsse nach Hause, zu seinen Kindern. Er ist … Er war ein guter Mann …« Sie ließ den Kopf sinken. »Da war etwas zwischen uns. Es war so schön.«
Mat Joubert seufzte und erhob sich.
6
Er träumte von Yvonne Stoffberg.
Sie waren in den Bergen. Sie rannte vor ihm her, ihr weißer Po schimmerte im Mondlicht, ihr braunes Haar umschwirrte sie. Sie lachte, sie sprang über die Flußsteine, an einem rauschenden Bach entlang. Er lachte ebenfalls, sein steifer Schwanz hart in der Abendluft. Dann schrie sie plötzlich, es war ein Schrei voll Angst und Überraschung. Ihre Hände flogen hoch zu ihren Brüsten, sie versuchte sie zu verstecken. Vor ihnen auf dem Bergweg stand Bart de Wit. Zwischen seinen Augen befand sich ein drittes Auge, ein vorwurfsvolles rotes Loch. Aber er konnte immer noch sprechen: »Fragen Sie sich, Captain. Sind Sie ein Sieger?« Wieder und wieder, wie eine verkratzte Platte mit dieser hohen, nasalen Stimme. Er sah sich um, er suchte nach Yvonne Stoffberg, aber sie war verschwunden. Plötzlich war auch de Wit verschwunden. Die Dunkelheit umfing ihn. Er spürte, wie er starb. Er schloß die Augen. Langes braunes Haar floß über sein Gesicht. Er lag in den Armen von Margaret Wallace. »Alles wird in Ordnung kommen«, sagte sie. Er begann zu weinen.
An der Ampel starrte Joubert auf das Werbeposter des Burger