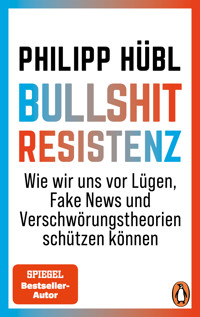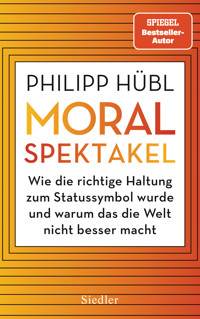10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Eine grundlegende philosophische Analyse unbewusster Vorgänge Unser Bewusstsein ist das größte Rätsel der Wissenschaft: Wir bestehen aus Milliarden von Molekülen, die weder denken noch fühlen können – und doch machen sie zusammen unsere Persönlichkeit und unser subjektives Erleben aus. Das Unbewusste ist ebenso rätselhaft; was dort passiert, kann niemand so genau sagen. Wie bestimmen unbewusste Eindrücke, Wünsche und Informationen unser Denken, Fühlen und Handeln? Die gute Nachricht: Wir sind die Herren im eigenen Haus, auch wenn wir manchmal nicht wissen, wer im Keller umherschleicht. Die schlechte Nachricht: Wir überschätzen manchmal unseren Einfluss und reden uns fälschlicherweise ein, wir hätten gute Gründe für unsere Taten. Der Philosoph Philipp Hübl entlarvt den Mythos von der Macht des Unbewussten – er zeigt, wie Vernunft und kontrollierte Aufmerksamkeit uns vor Manipulation schützen. Ein ebenso grundlegendes wie provozierendes Buch. «Luzide geschrieben, wärmstens zu empfehlen.» Frankfurter Allgemeine Zeitung über «Folge dem weißen Kaninchen»
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 612
Ähnliche
Philipp Hübl
Der Untergrund des Denkens
Eine Philosophie des Unbewussten
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Eine grundlegende philosophische Analyse unbewusster Vorgänge
Unser Bewusstsein ist das größte Rätsel der Wissenschaft: Wir bestehen aus Milliarden von Molekülen, die weder denken noch fühlen können – und doch machen sie zusammen unsere Persönlichkeit und unser subjektives Erleben aus. Das Unbewusste ist ebenso rätselhaft; was dort passiert, kann niemand so genau sagen. Wie bestimmen unbewusste Eindrücke, Wünsche und Informationen unser Denken, Fühlen und Handeln? Die gute Nachricht: Wir sind die Herren im eigenen Haus, auch wenn wir manchmal nicht wissen, wer im Keller umherschleicht. Die schlechte Nachricht: Wir überschätzen manchmal unseren Einfluss und reden uns fälschlicherweise ein, wir hätten gute Gründe für unsere Taten.
Der Philosoph Philipp Hübl entlarvt den Mythos von der Macht des Unbewussten – er zeigt, wie Vernunft und kontrollierte Aufmerksamkeit uns vor Manipulation schützen. Ein ebenso grundlegendes wie provozierendes Buch.
«Luzide geschrieben, wärmstens zu empfehlen.»
Über Philipp Hübl
Philipp Hübl, geboren 1975 in Hannover, ist Juniorprofessor für Theoretische Philosophie an der Universität Stuttgart. Er studierte Philosophie und Linguistik in Berlin, Berkeley, New York und Oxford und lehrte in Aachen und Berlin.
Inhaltsübersicht
Einführung: Das entfesselte Unbewusste
«Wenn wir uns verlieben, sind wir Marionetten der Pheromone.»
«Die Gesellschaft zwingt uns zur Selbst-Optimierung.»
«Die Werbung zielt auf unser Reptilienhirn.»
Solche Thesen hören und lesen wir oft: in Fernsehsendungen und Zeitungen, in Hörsälen und auf Konferenzen. So oft, dass wir schon fast daran glauben könnten. Ein großes Thema unserer Zeit, neben Klimawandel und Digitalisierung, ist der unvernünftige und verführbare Mensch, der der Macht des Unbewussten hilflos ausgeliefert ist.
Das war nicht immer so. Von der antiken griechischen Philosophie über die europäische Aufklärung bis in die Moderne galt eigentlich die Vernunft als dasjenige Merkmal, das uns Menschen von Tieren unterscheidet. Dabei ist die Vernunft kein Organ wie das Herz oder die Augen, sondern zeigt sich in der Art und Weise, wie wir etwas tun, nämlich wenn wir gründlich nachdenken und bewusst handeln.
In der Kulturgeschichte konkurrieren also, grob gesprochen, zwei Bilder über die Natur des Menschen. Das klassische Bild stellt uns als selbstbestimmte Personen dar, die bewusst über sich und die Welt nachdenken und vernünftige Entscheidungen treffen. Seit mehr als 100 Jahren skizzieren allerdings Forscher[*] vieler Fachrichtungen ein Gegenbild, manchmal mit feiner Linie, oft mit breitem Pinselstrich. Sie stützen sich dabei auf Kulturbeobachtungen, klinische Fälle sowie auf psychologische und neurologische Experimente. Sosehr sich die Fachrichtungen wie Psychologie, Kulturwissenschaft und Hirnforschung auch unterscheiden, so überraschend einig sind sich viele Forscher in einem Punkt – sie stellen das klassische Bild in Frage. Der Gegenentwurf besteht aus einer Familie von verwandten Ideen und Theorien, die auf unterschiedliche Weise unbewusste Kräfte betonen und so die Macht der Vernunft und des Bewusstseins bezweifeln. Typische Thesen sind beispielsweise, verdrängte Wünsche würden unser Handeln leiten, unsere Muttersprache determiniere unser Denken, das Ich sei eine Illusion und das Hirn entscheide für uns. Entsprechend suggestiv sind aktuelle Buchtitel zum Thema im Stile von: Die Intelligenz des Bauches, Die Konstruktion des Ich, Die Hirn-Fiktion, Der Selbst-Wahn, Die Illusion des freien Willens.
In diesem Buch verteidige ich das klassische Bild gegen seine Kritiker. Ich werfe einen Blick in den Untergrund des Denkens, auf das Fundament und die Katakomben darunter, und rücke die unbewussten Effekte ins rechte Licht. Dabei geht es um Themen wie Vergnügen, Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Identität, Wünschen, Wahrnehmen, Sprechen, Denken, Entscheiden und Handeln.
Vorab ein paar Beispiele: Versuche zeigen, dass wir tatsächlich einige Milliliter Cola mehr trinken, wenn wir einen Film gesehen haben, in den ein fröhliches Gesicht unbemerkt hineingeschnitten wurde, und weniger, wenn das Gesicht wütend war. Doch keine unterschwellige Botschaft kann uns dazu bringen, auf einen Schlag eine ganze Flasche zu leeren. Wir kaufen mehr Schokolade ein, wenn wir unterzuckert sind, sind aber gegen Impulskäufe gefeit, sobald wir mit dem Einkaufszettel losgehen. Mehr als zwei Drittel aller Menschen halten sich zwar für überdurchschnittlich gute Autofahrer, aber daraus folgt nicht, dass wir einer dauerhaften Selbsttäuschung erlegen sind. Wir können uns Farben leichter merken, wenn wir ein Wort dafür haben, doch das heißt nicht, dass unsere Muttersprache unser Denken oder unser Weltbild festlegt. Zugegeben, ohne Hirn können wir nicht denken, doch daraus folgt nicht, dass das Hirn für uns denkt, und schon gar nicht, dass unser «Ich», genauer unser Bewusstsein, eine Konstruktion ist.
Meine Diagnose für diese und viele andere Beispiele lautet, dass wir so weiterleben können wie bisher. Erstens entpuppen sich die meisten Thesen von der Macht des Unbewussten als maßlose Übertreibungen. Zweitens machen uns die wenigen unbewussten Einflüsse nicht zwingend hilflos oder unvernünftig. Und drittens zeichnet uns Menschen die kritische Vernunft aus, die wir bewusst einsetzen und durch Training verbessern können, um uns gegen Einfluss zu schützen.
Aristoteles, Kant und ein paar ihrer Kollegen hatten doch recht. Philosophie ist nichts anderes als die Anwendung der kritischen Vernunft. Der philosophische ist oft der zweite Blick. Man nimmt die richtige Distanz ein, kneift die Augen etwas zusammen und sieht die Dinge plötzlich schärfer.
Auf den ersten Blick entsteht in den populären Medien der Eindruck, wir würden wie ferngesteuerte Zombies durch die Welt wanken. Wenn Beiträge mit den Worten beginnen: «Wissenschaftler haben herausgefunden», ist es erst einmal naheliegend, die Inhalte für bare Münze zu nehmen. Wer sollte es besser wissen als eben die Wissenschaftler?
Doch auf den zweiten, den kritischen Blick merkt man, dass die meisten unbewussten Phänomene vielschichtig sind, die Experimente oft mehrere Interpretationen zulassen und die Theorien daher allenfalls vorläufig sein müssten, präsentiert als vorsichtig formulierte Hypothesen. Die populären Medien, und inzwischen auch viele Wissenschaftler, tendieren jedoch dazu, Beobachtungen und Forschungsergebnisse als «big idea» zu verkaufen, als große Entdeckung, als revolutionären Ansatz. Natürlich handelt es sich bei dieser Einschätzung selbst nur um eine bloß allgemein charakterisierte Tendenz. In jeder Disziplin gibt es auch die ausgewogenen Stimmen. Doch das sind selten jene, die am lautesten erschallen und so an die breite Öffentlichkeit gelangen.
Krassen Ankündigungen von der Macht des Unbewussten, von Hirnen, die uns steuern, oder gesellschaftlichen Zwängen, denen wir nicht entrinnen können, muss man mit denselben argwöhnischen Nachfragen gegenübertreten wie jeder anderen unglaubwürdigen Geschichte. Das ist eine philosophische Haltung, denn kritische Fragen sind die Werkzeuge der Philosophie. Richtig angesetzt, kann man damit Experimente auseinandernehmen und zeigen, dass sich hinter populären Zeitgeist-Diagnosen manchmal erstaunlich wenig verbirgt.
Auf den zweiten Blick zeigt sich, dass das klassische Bild von uns als selbstbestimmte, kontrollierte, vernünftige Menschen weder falsch noch naiv, sondern korrekt ist. Das heißt natürlich nicht, dass kein Mensch je etwas Dummes getan hat; auch nicht, dass wir jede Sekunde unseres Lebens bewusst und aufmerksam erleben oder immer alles unter Kontrolle haben. Natürlich sind Menschen nicht perfekt vernünftig. Um das zu bemerken, muss man nur die Nachrichten einschalten.
Der Spielraum für unbewusste Manipulationen fällt jedoch verschwindend klein aus. Sobald wir die Aufmerksamkeit ein- und damit die Vernunft auf Alarm schalten, sind wir kaum noch anfällig für Manipulationen oder Täuschungen. Und wenn wir herausfinden, wie unbewusste Prozesse in uns walten, können wir sie kontrollieren oder sogar für uns arbeiten lassen. Das machen Sportler, wenn sie ihre automatisierten Reaktionen trainieren, Künstler, wenn sie sich in einen kreativen Flow bringen, und jeder, der tanzt, als gäbe es kein Morgen.
Die dunklen Seiten des Bewusstseins
Die Frage, die hinter alldem steht, lautet natürlich: Was ist eigentlich das Unbewusste? Und was geht dort vor? Bevor man sich zu schnell auf eine Antwort stürzt, hilft erst einmal der Blick auf die Alltagssprache. Das Wort «unbewusst» ist dort allgegenwärtig, doch es kann ganz Verschiedenes bedeuten. Man kann diese Lesarten verdeutlichen, indem man jeweils Synonyme für das Wort «unbewusst» einsetzt.
Wenn ich mit Rückenschmerzen einschlafe, wache ich morgens manchmal in einer Schonposition auf. Im Schlaf hat wohl irgendein Mechanismus den Schmerz registriert und meine Bewegung gesteuert. Hier können wir sagen, dass das «unbewusst» war, und zwar in der Lesart von «Ich habe es nicht erlebt».
Meine Träume hingegen erlebe ich bewusst, denn ich spüre, wie ich zum Beispiel fliege und mich dabei freue. Doch den Inhalt kann ich nicht kontrollieren. Träume sind also meistens unbewusst in der Bedeutung von «nicht unter meiner Kontrolle».
Bei bildlichen Vorstellungen ist das anders, aber auch sie entgleiten mir manchmal und werden zu Tagträumereien. Ohrwürmer erlebe ich ebenfalls passiv, aber ich kann sie willentlich unterbrechen, indem ich mich ablenke. Tagträume und Ohrwürmer sind unbewusst, nämlich «passiv erlebt, aber im Prinzip kontrollierbar».
Ich weiß, dass Madrid die Hauptstadt von Spanien ist, auch wenn ich gerade nicht daran denke. Diese Information ist unbewusst, genauer: «in meinem Gedächtnis gespeichert und potenziell abrufbar». Ich weiß allerdings nicht mehr, wann und wo ich sie aufgenommen habe. Die Lernsituation ist als Quellenamnesie dauerhaft unbewusst: «Ich habe keine Erinnerung daran.»
Beim Blinzeln schließen wir kurz die Augen, aber die Welt wird dadurch nicht schwarz. Irgendetwas rechnet den Eindruck der Dunkelheit heraus. Er bleibt unbewusst im Sinne von «unbemerkt» oder sogar «gelöscht».
Der Name des Regisseurs von Le Mépris – Die Verachtung liegt mir auf der Zunge, will mir aber nicht einfallen. Später unter der Dusche ist er plötzlich da: «Jean-Luc Godard». Etwas in mir hat weitergesucht. In der Psychologie nennt man das «unbewusstes Problemlösen».
Als deutscher Muttersprachler bilde ich meistens korrekte grammatische Sätze. Die zugrundeliegenden Regeln sind mir jedoch nicht bewusst, kurz: «Ich kenne sie nicht.»
Neulich in der S-Bahn wollte ich mich festhalten und habe jemanden angerempelt. Das passierte unbewusst, genauer: «versehentlich». Wenn ich nicht lange darüber nachdenke, kann ich noch ein paar Klavierstücke von früher anschlagen. Ich habe zwar das Gefühl, selbst zu spielen, bin allerdings überrascht, wohin die Finger wandern. Die Bewegungen bleiben unbewusst im Sinne von «routiniert».
Meinen Schluckauf hingegen steuere ich nicht selbst, er läuft unbewusst ab, nämlich «automatisch».
In Gegenwart anderer halte ich mir beim Gähnen die Hand vor den Mund. Wenn ich allein bin, nicht immer. Anscheinend üben andere einen Einfluss auf mich aus, der unbewusst ist, denn «ich denke nicht darüber nach».
Von der OP unter Vollnarkose schließlich habe ich nichts mitbekommen, weil ich «nicht bei Bewusstsein» war.
Das sind nur einige der Lesarten von «unbewusst». Wir können zwar in vielen Fällen «unbewusst» sagen, meinen aber nicht immer dasselbe, sondern benennen damit ganz unterschiedliche Phänomene. Die haben allerdings eines gemein: Sie bilden einen Kontrast zur idealtypischen menschlichen Handlung, die wir vernünftig, überlegt, kontrolliert und aufmerksam ausführen. Das zeigen auch die unzähligen Synonyme von «unbewusst». Die meisten wie «unaufmerksam», «achtlos», «übereilt», «gedankenlos», «nachlässig», «unbedacht» oder «vorschnell» drücken das Gegenteil von Aufmerksamkeit beim Handeln aus. Schon das Wort «Bewusstsein» hat viele Bedeutungen: Wachsein, Aufmerksamkeit, Absicht, Gedächtniszugang, Wissen, Erleben, Selbstbezug, Kontrolle, Überlegung. So hat es nicht nur ein einziges Gegenteil, sondern mindestens ein Dutzend.
Einer der Gründe für die Popularität des Unbewussten liegt also in der Bedeutungsvielfalt des Wortes «unbewusst». Das bedenken wir im Alltag nicht, weil im Kontext meist klar ist, was wir meinen. Doch die Vielfalt der Bedeutungen sickert oft ungefiltert in die Wissenschaften. So untersuchen Psychologen und Neurowissenschaftler häufig das Unbewusste, ohne sich der Dimensionen des Wortfeldes bewusst zu sein. Umgekehrt fassen sie den Begriff des Unbewussten an anderen Stellen zu weit, indem sie etwas für unbewusst erklären, wenn wir nicht genau wissen, wie es funktioniert. Damit macht man auch aus dem Wachsen der Haare einen unbewussten Vorgang. Somit wird die Ursprungsthese über die Macht des Unbewussten allerdings witzlos. Sicher, ein Mediziner kann sich bewusstmachen, wie das Haarwachstum funktioniert, aber dadurch erlebt er nicht bewusst, wie die Haarwurzeln sprießen, er weiß lediglich etwas darüber. Einen sinnvollen Begriff vom Unbewussten hat man erst, wenn man den Gegenbegriff verstanden hat: «Bewusstsein». Und wenn man weiß, wie Bewusstsein, Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Vernunft und Handeln zusammenspielen.
Das Modell
Bei der Wissenschaft vom Unbewussten denkt man spontan an Freuds Psychoanalyse, speziell seine Theorie der Verdrängung. Freud glaubte, es gebe einen Bereich in unserem Geist, das Es, in dem gesellschaftlich inakzeptable Wünsche, die sexuellen und aggressiven, lauern, ohne dass unser Bewusstsein, das Ich, das mitbekommt. Ein Zensor formatiert sie symbolisch um, sodass sie oft verschleiert ins Bewusstsein dringen. Wer sich eine erotische Phantasie verkneift, träumt vielleicht später davon, der Nachbarin den Ofen zu reinigen oder mit dem Nachbarn eine Zigarre zu schmauchen. Zudem wird das Ich ständig von seinem Gewissen geplagt, dem Über-Ich, in dem die Normen und Verbote der Eltern und der Gesellschaft gespeichert sind. Das Ich ist also eingeklemmt. Unter ihm in der Tiefe lauern die dunklen Triebe, und über ihm wehen die unerreichbar hehren Kulturideale. Heute benutzen viele das Wort «Unterbewusstsein», wenn sie über Freuds Psychoanalyse reden, obwohl er selbst nur vom «Unbewussten» sprach. Sein Bild einer dreistöckigen Psyche scheint diese vertikale Sichtweise allerdings nahezulegen.
Wenn die heutigen Psychologen und Neurowissenschaftler von «unbewusster Informationsverarbeitung» sprechen, dann meinen sie etwas anderes als Freud, nämlich unbewusstes Denken, unbewusste Wahrnehmung oder unbewusste Gefühle. Das sind Prozesse, die in uns ablaufen, ohne dass wir es merken, sie haben aber nichts mit Verdrängung oder Traumsymbolen zu tun. Zeigt man beispielsweise Versuchspersonen das Bild einer Schlange für 100 Millisekunden, also eine Zehntelsekunde, und danach ein neutrales Bild einer Blume, dann sagen alle, sie hätten die Blume gesehen, aber niemand, dass da auch eine Schlange war. Das zweite Bild maskiert das erste, daher heißen diese Versuche Maskierungs-Experimente.
Dennoch hinterlässt das Bild der Schlange Spuren. Das Herz der Probanden schlägt etwas schneller, und Schweiß bildet sich auf ihren Fingerspitzen, zwei typische Anzeichen für Angst, die solche Schlangenbilder normalerweise auslösen. Gibt man den Versuchspersonen die Aufgabe, Wörter zu vervollständigen, sodass sich Tiernamen ergeben, und sie lesen «Sch», so sagen sie eher «Schlange» als «Schnecke», selbst wenn beide Wörter etwa gleich häufig vorkommen. Auch das ist ein Zeichen, dass die Probanden das Bild irgendwie wahrgenommen haben und von der Verarbeitung beeinflusst wurden. Doch der Reiz ist nicht bis ins Bewusstsein vorgedrungen.
Die Idee hinter der Annahme dieses kognitiven Unbewussten ist dieselbe wie die hinter dem freudianischen Unbewussten, nämlich dass man als Forscher nicht einfach spekulativ von «unbewussten» Vorgängen spricht, sondern sie nur dann annimmt, wenn sie sich in irgendeiner Form im Bewusstsein zeigen und so messbar sind. Freud meinte, die Verdrängung zeige sich in Träumen, Versprechern und Neurosen. Seine Theorie kann mittlerweile als widerlegt gelten, wie ich in späteren Kapiteln zeigen werde. Die heutigen Psychologen und Neurowissenschaftler verwenden dagegen physiologische Messmethoden oder eben indirekte Tests wie Wortergänzungen, um unbewusste Prozesse nachzuweisen.
Das kognitive und das freudianische Unbewusste sind nur zwei Beispiele für Theorien über unbewusste Vorgänge. Was ist mit den unzähligen anderen Lesarten des Wortes «unbewusst»? In solch einem Fall ergeben sich zwei Möglichkeiten. Entweder man geht von einem einzigen Phänomen aus, nämlich dem «Unbewussten», das viele Spielarten hat. Oder man nimmt an, dass viele unterschiedliche Phänomene existieren, die wir ärgerlicherweise mit demselben Wort bezeichnen. Ich tendiere zur zweiten Option und schlage vor, dass man für «das war unbewusst» immer ein anderes Wort einsetzen sollte, sofern es möglich ist, wie im Fall von «ich erinnere mich nicht» oder «ich weiß es nicht».
Was bleibt übrig? Oder anders gefragt, an welchen Stellen ist der Begriff des Unbewussten überhaupt sinnvoll? Nur im Fall des kognitiven Unbewussten, also bei der Informationsverarbeitung unterhalb der Bewusstseinsschwelle.
Zum ersten Überblick und zur groben Orientierung schlage ich folgendes Modell vor, das ich kurz skizzieren und in den nächsten Kapiteln schrittweise ausbauen werde: Die meisten Prozesse in unserem Hirn wie der Blutfluss und viele elektrische Entladungen sind weder bewusst noch unbewusst, sondern nichtbewusst. Sie laufen einfach ab wie die Zellteilung in unserem Körper etwa beim Haarwachstum, ohne dass ihnen etwas im Bewusstsein entspricht.
Einige wenige Prozesse sind unbewusst. Typische Beispiele sind die schon erwähnte Namenssuche, Vorgänge, die zu kreativen Ideen führen, oder eben die Wahrnehmung von maskierten Schlangenbildern. Sie alle weisen eine gewisse Ähnlichkeit mit bewussten Vorgängen auf, doch wir bekommen nichts von ihnen mit. Wenn wir hingegen etwas bewusst wahrnehmen, dann sind die entsprechenden Vorgänge vielschichtiger, und wir erhalten reichhaltigere Details über die Welt. Zu jedem Zeitpunkt erleben wir allerdings mehr im Bewusstsein, als wir weiterverarbeiten oder uns merken können. Um das zu verdeutlichen, reicht ein Blick aus dem Fenster. Man sieht die Baumwipfel, die sich in den Himmel recken, und die Wolken darüber, die Giebel und Dächer in ihrer bunten Vielfalt. Doch sobald man die Augen schließt, sind viele dieser Details verloren. Wie viele Wipfel waren das? Wie genau sind die Wolken geformt? Welche Farbe haben die Schindeln vom Spitzdach?
Wir benötigen unsere Aufmerksamkeit, um solche Informationen zu erfassen, also in den sogenannten Arbeitsspeicher zu laden, wie die Psychologen sagen. Nur so können wir sie dann in Worte kleiden, darüber nachdenken und sie uns langfristig merken. Unser Wissen ist zwar im Gedächtnis abgelegt, doch wir können es uns ins Bewusstsein rufen, wir tragen es immer mit uns wie eine Kontrastfolie, vor der sich das Bewusstsein abzeichnet. Die aktive Aufmerksamkeit ist der Schlüssel für Selbstkontrolle und langfristiges, vernünftiges Denken. Das lernen wir schon als Kinder, und wir können uns darin immer weiter verbessern.
Die Popularität von Freuds Psychoanalyse hat zwar dazu beigetragen, die Idee vom manipulierbaren Menschen zu erhärten und für andere Disziplinen fruchtbar zu machen. Dazu sage ich später noch mehr. Man kann Freud aber auch so verstehen, dass er gerade das Ich stärken wollte. Wir als bewusst denkende Personen sollten uns gegenüber den sexuellen und aggressiven Impulsen emanzipieren, die in unserem Unbewussten schlummern, und ebenso gegenüber dem Über-Ich, also den Zwängen der Kultur. In diesem Sinne ziehe ich an Freuds Strang. Allerdings muss man unserem Bewusstsein gar nicht mehr Raum verschaffen, denn es hat mehr als genug Platz. Man kann vielmehr zeigen, wie schwach die Prozesse oft sind, die im Untergrund des Wahrnehmens, Denkens und Wollens ablaufen, und wie gut wir die überindividuellen Prozesse der Kultur, also die Zwänge, Moden und Diskurse, bewusst kontrollieren können.
In diesem Buch geht es um zentrale philosophische Themen wie die Frage, was unsere Identität ausmacht: unser Gedächtnis, unser Charakter, unser Körper oder unser Bewusstsein? Außerdem diskutiere ich erstaunliche Versuche aus der Psychologie wie etwa eine Untersuchung an Richtern, die kurz vor dem Mittagessen keine einzige Bewährung bewilligten, aber später mit vollem Magen bei zwei Drittel aller Delinquenten Gnade walten ließen. Ich behandle das Paradox der Selbsttäuschung: «Wie kann ich mich dazu bringen, etwas zu glauben, was ich selbst für falsch halte?», ebenso wie bizarre neurologische Fälle, zum Beispiel Split-Brain-Patienten, bei denen Ärzte die Hirnhälften durchtrennt haben. Die Beispiele für unbewusste Phänomene reichen von eingebildeten Erinnerungen, unsichtbaren Gorillas und Mentalmagiern bis zu den stillen Aufforderungen des iPhones.
Freud sagt, das Ich sei nicht «Herr» im «eigenen Hause». Nietzsche meint, für den Höhenflug des Denkens müsste «Ruhe in allen Souterrains» sein, «alle Hunde hübsch an die Kette gelegt». Die folgenden Kapitel zeigen, dass wir es uns als Hausherren und Hausdamen im Wohnzimmer bequem machen können, auch wenn wir nicht immer wissen, was im Keller passiert. Und wenn der Hund manchmal zu laut im Untergrund kläfft, hilft nur eins: Licht anmachen, runtergehen, nachschauen und für Ordnung sorgen.
Philosophisches Handwerk
Schönheit durch Wiederholung: der Vertrautheitseffekt
Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Reise nach Rom gewonnen, in das beste Hotel der Stadt. Sie sind das erste Mal in Italien. Schon bei ihrer Ankunft sind sie überwältigt. Die Sprache enthält zahllose wohlklingende Vokale, und die Menschen gestikulieren ungewohnt lebhaft. Ihre Spaziergänge mit dem Stadtplan in der einen Hand und dem Smartphone in der anderen fordern ihre ganze Konzentration. Aber es lohnt sich, denn die historischen Bauwerke sind beeindruckend. Fremde Gerüche strömen aus den Geschäften und Cafés. Alles ist neu und unheimlich aufregend, und trotzdem sind Sie froh, als Sie wieder daheim sind, auch wenn Ihre Inneneinrichtung nicht mit der Hotelsuite mithalten kann und in Ihrem Garten keine Zitronen blühen. Der Grund lautet, dass die eigene Wohnung einem so angenehm vertraut ist. Kurz nach dem Einzug war das vermutlich noch nicht so, doch hat man sich erst einmal eingelebt, fühlt man sich zu Hause besonders geborgen. Wie kommt das? Der amerikanische Psychologe Robert Zajonc gibt eine einfache Antwort: durch bloße Wiederholung. Alles, was wir mehrmals sehen, hören und erleben, bekommt allein dadurch einen positiven Wert, sofern wir damit keine Gefahr oder andere negative Dinge verbinden. Robert Zajonc nennt dieses Phänomen Mere-Exposure-Effect, also in etwa Effekt durch bloßen Kontakt oder kürzer Vertrautheitseffekt.
Er führte dazu vor knapp 50 Jahren die ersten Experimente durch. Inzwischen haben Psychologen unzählige Spielarten des Effekts untersucht. Zum Beispiel hat Zajonc mit Kollegen in einer Uni-Zeitung fingierte Werbeanzeigen geschaltet, in denen erfundene Symbole abgedruckt waren, die an asiatische Schriftzeichen erinnerten. Nach einigen Monaten bekamen Studenten in einem Versuch eine Reihe von Symbolen präsentiert und mussten raten, ob die Zeichen wohl eher eine positive oder negative Bedeutung hätten. Darunter waren auch die der Werbeanzeige. Obwohl niemand angab, die Schriftzeichen zu kennen, sprachen die Testpersonen den vorher abgedruckten signifikant häufiger positive Bedeutungen zu als den unbekannten. Anders ausgedrückt: Die Teilnehmer hatten eine gewisse Vorliebe für diese Zeichen erworben.
Vorlieben oder «Präferenzen», wie die Psychologen sagen, können sich auf vielen Wegen formen. Einige sind angeboren, wie die Lust auf Süßes oder die Abneigung gegenüber bitteren Speisen. Andere werden erlernt. Das wiederholte Lob der Eltern beispielsweise verstärkt in Kindern die Neigung, alles aufzuessen. Wieder andere entstehen durch Nachahmung oder Gruppenzwang, man denke dabei an Modesünden aus der eigenen Jugend. Doch der Vertrautheitseffekt ist unabhängig von all diesen Vorgängen, denn er läuft vollkommen passiv, also ohne jedwede Anweisung, ab. Gleichzeitig ist der Vertrautheitseffekt sehr stabil. Man findet ihn bei allen Menschen, unabhängig von der Kultur oder sozialen Herkunft. Der Effekt ist auch nicht an eine bestimmte Sinnesmodalität gebunden. Wie eine Studie zum Eurovison Song Contest zeigt, ziehen wir bekannte Melodien unbekannten vor, wenn man von Extremen einmal absieht wie zum Beispiel Schlagern, die man zu oft gehört hat. Wir finden bekannte Gemälde ansprechender als unbekannte. Menschen aus unserem Freundeskreis halten wir für attraktiver, als es neutrale Außenstehende tun. Sogar bei Tieren kann man den Effekt nachweisen. Hören ungeborene Küken einen Ton durch die Eischale hindurch, reagieren sie nach dem Schlüpfen positiv auf diesen Ton, im Gegensatz zu den übrigen Küken, die davor Angst haben. Wachsen Küken ohne Kontakt zu ihren Artgenossen auf, etwa mit einer Streichholzschachtel als Spielkamerad, dann interessieren sie sich später mehr für solche Schachteln als für ihresgleichen.
Entscheidend für Versuche bei Menschen ist, dass man den Effekt selbst dann nachweisen kann, wenn die Stimuli den Probanden wenig oder gar nicht bewusst waren. Bei den asiatischen Symbolen in der Uni-Zeitung wird kaum jemand genauer hingesehen haben. Andere Versuche sind noch deutlicher. Der Psychologe William Wilson hat seinen Teilnehmern Kopfhörer aufgesetzt. Auf einem Ohr lief Musik, während auf dem anderen Ohr Wörter zu hören waren, die die Probanden präzise wiedergeben mussten. Das erscheint einfach, erfordert aber viel Konzentration. Nach dem Versuch konnte kaum jemand angeben, welche Melodien erklungen waren. Dennoch drückten die Teilnehmer bei einer Befragung eine deutliche Vorliebe für eben diejenigen Klänge aus, die sie allenfalls am Rande des Bewusstseins gehört hatten.
Zajonc hat für den Vertrautheitseffekt eine evolutionäre Erklärung parat. Für die Vorfahren der heutigen Tiere sei es von Vorteil gewesen, dem Neuen vorsichtig zu begegnen, denn es konnte eine Gefahr bedeuten. Das kann man gut bei Katzen beobachten, wenn sie zum ersten Mal ein ferngesteuertes Auto sehen und zwischen Neugier und Scheu buchstäblich hin- und hergerissen sind. Nach einiger Zeit können Tiere allerdings lernen, dass von bestimmten Dingen oder Orten keine Gefahren ausgehen. Dann ist es von Vorteil, wenn sie eine Vorliebe dafür behalten, denn sonst würden sie nie zur Ruhe kommen.
Bei uns Menschen drückt sich die Vertrautheit in einem speziellen Vertrautheitsgefühl im Bewusstsein aus. Vertrautes hat diesen eigenartig wohligen Nimbus. So freut man sich sogar, wenn man sehr flüchtig Bekannte zufällig im Ausland trifft. Der Vertrautheitseffekt kann das Gefühl erklären, dass es zu Hause doch am schönsten ist, er äußert sich in Redewendungen wie «Was der Bauer nicht kennt, isst er nicht», und er findet ganz praktische Anwendung in der Werbung. Effektiver als provokante Werbespots oder lustige virale Kampagnen ist die dauerhafte und flächendeckende Präsenz des Firmenlogos. Das beste Beispiel sind rote Schilder mit einer weißen Schreibschrift für ein koffeinhaltiges Zuckergetränk.
Der philosophische Werkzeugkasten
Wer das Unbewusste verstehen will, kommt am Vertrautheitsgefühl nicht vorbei, denn es kann von einem Stimulus stammen, den wir nicht mitbekommen haben, der also in einer Lesart des Wortes unbewusst war. Dieser Effekt ist vor allem deshalb einschlägig, weil er Teil der menschlichen Natur ist, in vielen Formen unseren Alltag bestimmt und gleichzeitig systematisch untersucht wurde. An ihm lässt sich also gut zeigen, wie man Experimente aus der Forschung philosophisch einordnet. Nach einem kleinen Ausflug in die Grundlagen der Wissenschaften werde ich den Vertrautheitseffekt deshalb mit philosophischen Werkzeugen behutsam auseinanderschrauben.
Worum geht es in der Wissenschaft überhaupt? Ihre Leitfrage lautet: Was soll erklärt werden? Jede Theorie, Hypothese oder Beobachtung sollte dabei helfen, die Welt besser zu verstehen, Dinge genauer zu bestimmen, viele kleine Phänomene als Ausdruck grundlegender Prinzipien zu beschreiben und sie dabei idealerweise mathematisch so präzise zu formulieren, dass man die Ergebnisse berechnen und vorhersagen kann. Bei der Theorie des Vertrautheitseffekts sind es auf den ersten Blick so vielfältige Phänomene wie Geborgenheit, Schönheit und positive Wortbedeutungen, die offenbar alle vom Vertrautheitsgefühl beeinflusst sein können.
In der Philosophie hingegen, genauer der Wissenschaftstheorie, fragt man vor allem, was eine gute Erklärung ist. Dabei ging es lange Zeit fast ausschließlich um die Naturwissenschaften, genauer die Physik – um Fragen wie «Sind Naturgesetze ausnahmslos gültig?», «Was sind die kleinsten Bestandteile des Universums?», «Sind Raum und Zeit absolut oder relativ?». In den Anfängen stand die Suche nach der Weltformel im Vordergrund, der umfassenden Theorie von allem. Seit einigen Jahrzehnten ist die Euphorie etwas verklungen. Nancy Cartwright und andere einflussreiche Philosophen gehen inzwischen davon aus, dass wir in einem unordentlichen Universum leben und daher Abschied nehmen sollten von der Hoffnung auf das eine mathematisch exakte Supernaturgesetz.
Doch selbst wenn die Physik solch ein Gesetz einmal fände, wird das in anderen Disziplinen nicht der Fall sein. Keiner glaubt zum Beispiel an strenge Naturgesetze in der Geologie. Vor allem in den Wissenschaften, die sich mit dem Menschen beschäftigen, also Psychologie, Soziologie, Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaft herrscht traditionell eine große Vielfalt an Thesen und Methoden.
Der Mensch ist einfach zu komplex. Wir unterscheiden uns in zu vielen Parametern. Ein Beispiel: Einige Menschen mögen Klassik, andere lieber Jazz. Liegt das an den Genen, der Erziehung, der frühkindlichen Prägung, dem Geschlecht, der Schulbildung, der sozialen Schicht oder einfach nur an der Tagesform? Kann man einzelne dieser Faktoren überhaupt sicher ausschließen? Wie soll man sie mathematisch messen? Und selbst wenn man unser Denken, Fühlen und Handeln sprachlich fassen und vermessen könnte, ließen sich die Daten nicht beliebig präzisieren wie in der Physik. Es macht schon Mühe, beim Orthopäden seinen Schmerz auf einer Skala von 1 bis 10 zu bewerten. Absurd wäre zu sagen, dass der Rücken mit der Stärke von 7,293 weh tut.
Mangelnde Präzisierbarkeit muss aber niemanden daran hindern, den Menschen zu erforschen. Nur ist dabei Vorsicht geboten, denn jede Forschung wirkt sich auf unser Leben aus. In den Naturwissenschaften ist das die Technik. Ohne Physik gäbe es kein Internet, ohne Chemie keine Antibiotika. In den Humanwissenschaften sind es eher die Folgen für unser Menschenbild. Einige Neurowissenschaftler fordern, man solle das Rechtssystem vollkommen überarbeiten. Einige Soziologen wollen Großstädte von Grund auf umbauen. Einige Kulturwissenschaftler_innen wollen die Sprache reformieren. All diese Forderungen mögen berechtigt sein. Doch weil sie teils radikal sind, muss man sie auch gut begründen.
Die Frage lautet daher, ob die Forschung, auf die sich die Forderungen stützen, hieb- und stichfest ist. Hier lohnt sich ein Griff in den philosophischen Werkzeugkasten. Die Instrumente der philosophischen Analyse sind dabei kritische Fragen, denn Philosophen sind in begrifflicher Genauigkeit, im logischen Schließen und im Argumentieren geschult. Diese Expertise bringen Natur- und Kulturwissenschaftler nicht immer mit. Gerade weil sie Themen diskutieren, die für uns Menschen zentral sind, kann man ihnen nicht die alleinige Interpretation ihrer Forschung überlassen. Wer in den Wissenschaften hingegen Fragen zu den Grundlagen seiner Disziplinen stellt, der betreibt ohnehin Philosophie. Je nach Problem und Naturell kann man mit dem Hammer philosophieren oder mit dem Skalpell an die Feinarbeit gehen. So lassen sich zu jedem Versuch aus der Psychologie oder Neurowissenschaft, aber auch zu Theorien aus der Soziologie oder Kulturwissenschaft philosophische Fragen stellen. An Zajoncs Vertrautheitseffekt kann man die sieben wichtigsten gut veranschaulichen. Das mag an einigen Stellen pedantisch oder technisch klingen, aber es lohnt sich, denn oft kann man nur so Übertreibungen und Unsinn entlarven.
Wie man mit dem Skalpell philosophiert
Die erste dieser sieben kritischen Fragen lautet: Was ist damit gemeint? Hier geht es um die Begriffe. Wer beispielsweise behauptet, «Bewusstsein» zu untersuchen, muss sagen, ob er damit «Aufmerksamkeit» oder «Wissen» meint oder etwas ganz anderes. In Zajoncs Fall geht es um einen klar definierten Effekt, nämlich Vorliebe durch Vertrautheit.
Die zweite Frage lautet: Was wird untersucht? Hier geht es um die Daten. Im Falle des Vertrautheitseffekts sind es Urteile von Probanden und Verhaltensweisen von Tieren. Diese Vielfalt ist gut. In vielen Versuchen macht es nämlich einen Unterschied aus, ob die Personen nur auf einen Knopf drücken oder einen Fragebogen beantworten, denn das Frage-Antwort-Spiel appelliert an unser soziales Selbstbild. Auf die Frage «Wie oft in der Woche haben Sie Sex?», antwortet man vielleicht weniger ehrlich als auf die Fragen «Wie oft duschen Sie?», weil man vor sich und anderen in einem bestimmten Licht erscheinen will. Der Vertrautheitseffekt von Zajonc und seinen Kollegen ist gerade deshalb so gut abgesichert, weil sie die Daten sowohl sprachlich durch Fragebögen als auch nicht-sprachlich durch anderes Verhalten ermittelt haben. Weitere Möglichkeiten für nichtsprachliche Verfahren sind die Messung von Reaktionszeiten oder die Darstellung aktiver Hirnareale.
Die dritte Frage lautet: Was hängt womit zusammen? Hier geht es um Verursachung oder in unserem Fall um die Mechanismen und Strukturen des Geistes. Beim Vertrautheitseffekt ist die Verursachung klar. Man sieht eine Person und merkt sich dabei ganz automatisch ihr Gesicht. Anders ausgedrückt: Das Gesicht verursacht eine Spur im Gedächtnis. Jedes weitere Treffen verstärkt die emotionale Markierung für Vertrautheit, selbst wenn man vergessen hat, wer die Person eigentlich ist oder woher man sie kennt.
Die vierte Frage aus dem Werkzeugkasten lautet: Gibt es Versuche, die die Theorie belegen? Dabei geht es nicht nur um einzelne Daten für eine These, sondern um Hinweise für eine ganze Theorie. Für den Vertrautheitseffekt sprechen Hunderte von Versuchen. Der Fall ist also ganz klar. Doch andere Theorien sind weniger gut belegt, manche befinden sich allenfalls im Stadium einer Arbeitshypothese. Während meines Studiums dachte ich noch, dass eine Theorie verworfen wird, sobald man zeigen kann, dass sie falsch ist. Ein einziges Gegenbeispiel reicht aus, wie Karl Popper dargelegt hat. Grundsätzlich ist das auch richtig. Aber in der Psychologie sind so viele Parameter im Spiel, dass man ein vermeintliches Gegenbeispiel oft mit einem ganz anderen Effekt wegerklären kann. Erst wenn man systematisch viele Aspekte eines Experiments oder einer Forschungsthese in Frage stellen kann, handelt es sich um eine echte Widerlegung.
Umgekehrt reicht ein einziger Versuch nicht aus, um ein Phänomen wie den Vertrautheitseffekt nachzuweisen. Für eine Bestätigung müssen Hinweise aus vielen Versuchen auf dasselbe hinauslaufen. Das garantiert zwar immer noch nicht, dass die These dann wahr ist, denn es kann immer sein, dass spätere Untersuchungen alles wieder über den Haufen werfen. Doch man hat dann immerhin gute Gründe, erst einmal von der Wahrheit auszugehen. Die empirischen Wissenschaften bleiben in diesem Sinne immer vorläufig. Unbezweifelbare Beweise gibt es, wenn überhaupt, nur in den formalen Wissenschaften, also in der Mathematik und in der Logik.
Die fünfte Frage lautet: Was zeigt das Experiment? Darin geht es um die Folgerungen. Zajonc beispielsweise schließt aus dem Vertrautheitseffekt, dass es zwei Speicherformate im Gedächtnis gibt. Inhaltliche Informationen über eine Person wie «Arbeitskollegin», «Nachbar» oder «Mutter» sind kognitiv gespeichert, Informationen über die Bekanntheit allerdings emotional, nämlich über das Vertrautheitsgefühl. Beides geht oft Hand in Hand. Doch wann immer wir denken «Die kenn’ ich doch irgendwoher», haben wir lediglich Zugriff auf das emotionale Format, nicht auf das kognitive.
Die sechste Frage lautet: Ist das Ergebnis auf andere Bereiche übertragbar? Darin geht es um die Verallgemeinerung, speziell die Übertragung auf unser Leben und unseren Alltag. Auch hier ist der Vertrautheitseffekt beispielhaft. Er findet sich bei Tieren und Menschen und lässt sich auf viele Phänomene wie Attraktivität, Kunst und Effekte der Werbung anwenden.
Die siebte Frage schließlich lautet: Ist die These neu? Darin geht es um Originalität. Der Vertrautheitseffekt widerspricht zwar nicht gängigen Auffassungen, aber es ist eine echte Entdeckung, dass er auch mit unbewussten Stimuli wirken und dabei Gefühle wie Wohligkeit und Wohlgefallen sowie positive Bedeutungen erzeugen und verstärken kann. Zudem zeigt er, dass im Gedächtnis kognitive Inhalte unabhängig von emotionalen wie dem Vertrautheitsgefühl gespeichert sind, auch wenn wir sie oft zusammen erleben und deshalb nicht ohne weiteres als unabhängig voneinander betrachten würden.
Das sind also die sieben philosophischen Werkzeuge, nämlich Fragen nach Begriffen, Daten, Verursachung, Hinweisen, Folgerungen, Verallgemeinerung und Originalität. Setzt man sie beim Vertrautheitseffekt an, zeigt sich, dass die Theorie gut funktioniert. Nur an einer Stelle verwechselt Zajonc zwei Begriffe, denn er glaubt, der Vertrautheitseffekt habe nichts mit dem Bewusstsein, speziell dem erlebten Vertrautheitsgefühl, zu tun. Er begründet das damit, dass ja auch unbewusste Reize wie unhörbare Melodien im Kopfhörer-Versuch zu einem Vertrautheitseffekt führen. Doch während die Auslöser des Effekts unbewusst sein können, hat das Vertrautsein unser Bewusstsein sehr wohl emotional getönt. Vielleicht würden wir diese zarte Einfärbung nicht unbedingt als «Vertrautheitsgefühl» bezeichnen, aber da ist doch etwas, was die Melodie ein bisschen wohlklingender, das Bild ein bisschen schöner, das Gesicht ein bisschen attraktiver gemacht hat, auch wenn wir das gar nicht so genau beschreiben können.
Einfach ausgedrückt, wird im Gedächtnis alles Bekannte mit einem emotionalen Textmarker unterstrichen, selbst wenn dort keine weiteren Informationen gespeichert werden. Diese Markierung erleben wir bewusst als Vertrautheitsgefühl, das so Informationen über unsere Umwelt enthält. Zajonc meint, der Vertrautheitseffekt sei die «Eingangstür zum Unbewussten». Genau genommen jedoch ist er das Tor zum emotionalen Gedächtnis. Zajoncs Theorie benötigt hier also eine kleine, aber entscheidende Feinjustierung.
Bei anderen Versuchen aus der Psychologie und Neurowissenschaft sieht die Sache ganz anders aus. Die Jünger des Unbewussten, die an dessen Macht glauben, übertreiben meist bei den letzten drei Fragen, denn sie folgern mehr, als ihre Versuche hergeben, sie schließen von Einzelbeobachtungen auf die Verfassung der gesamten Menschheit und stellen ihre Ergebnisse als besonders originell dar, indem sie eine Karikatur der Standardposition zeichnen, um sie dann umso leichter zu entkräften. Hier kommt das Beispiel einer Demontage. Passenderweise geht es um Autos.
Unbewusstes Denken. Oder: Wie man mit dem Hammer philosophiert
Sie haben sich entschieden, ein neues Auto zu kaufen. Ihr Budget beläuft sich auf 20000 Euro. Um das Beispiel einfach zu halten, können Sie für diesen Preis eines von vier Modellen erwerben, von verschiedenen Herstellern. Wie wählen Sie den passenden Wagen aus? Ein typisches Verfahren sieht ungefähr so aus: Man macht sich eine Liste mit Kriterien wie Benzinverbrauch, Design, Farbe, Beinfreiheit und Halter für Kaffeebecher. Verständlicherweise haben nicht alle Kriterien dasselbe Gewicht. Benzinverbrauch ist meistens wichtiger als die Farbe, die Farbe wichtiger als die Halterung für Heißgetränke. Hat man alles gewichtet, sich mit Freunden ausgetauscht, im Internet recherchiert, trifft man seine Entscheidung. Solange man keinen wichtigen Faktor übersehen hat, klingt das auch ganz vernünftig.
Der niederländische Psychologe Ap Dijksterhuis hat in einem vieldiskutierten Experiment gerade diese Vernunft des Abwägens in Frage gestellt. Seine provokante These lautet: Bei komplexen Entscheidungen wie einem Autokauf hilft bewusstes Nachdenken nicht weiter. Besser sei, sich keinen Kopf zu machen, eine Nacht darüber zu schlafen und dann spontan zu entscheiden. Das jedenfalls scheint sein Experiment nahezulegen.
Dijksterhuis hat Versuchspersonen eine Liste mit vier Autos von fiktiven Herstellern vorgelegt, die sich in jeweils zwölf Attributen unterschieden. Eine Gruppe durfte wie gewohnt gründlich über ihre Entscheidung nachdenken. Eine andere musste unmittelbar nach dem Lesen der Liste Aufgaben lösen, die die ganze Konzentration beanspruchten. Zuvor hatte Dijsterhuis noch ermittelt, wie die Testgruppen die Attribute bewerteten. Auch hier war beispielsweise der Verbrauch wichtiger als ein Sonnendach. Am Ende verglich er die Ergebnisse. Von der Gruppe der Nachdenker hatten sich nur etwa 25 Prozent für das vermeintlich «beste» Auto entschieden. Bei den Abgelenkten hingegen waren es 60 Prozent. Dijksterhuis erklärt das Ergebnis damit, dass dem unbewussten Denken mehr Kapazitäten zur Verfügung stünden und es daher dem bewussten Abwägen überlegen sei. Seinen Ansatz nennt er Theorie des unbewussten Denkens. Hätte er recht, wären die Konsequenzen radikal. Bei allen wichtigen Lebensentscheidungen wie Studienwahl, Jobsuche oder Wohnungskauf müssten wir schleunigst aufhören, unseren Verstand einzusetzen.
Zum Glück trifft nichts davon zu. Das wird deutlich, sobald man die passenden Werkzeuge hervorholt. Schon bei den Hinweisen ist Dijksterhuis Theorie fragwürdig. Einige seiner Folgeversuche scheinen den Effekt zwar zu bestätigen, doch etwa ein Dutzend Experimente von anderen Forschern widersprechen seinen Annahmen. Da all diese in Einzelheiten abweichen, hat die niederländische Psychologin Hilde Huizenga mit Kollegen den Originalversuch systematisch variiert, um die einzelnen Thesen zu präzisieren. Das bringt uns zu den Folgerungen. Dijksterhuis vertritt vier Thesen: Erstens seien bei komplexen Problemen unbewusste Entscheidungen den bewussten überlegen. Zweitens seien Entscheidungen umso besser, je länger die Phase des unbewussten Abwägens anhält. Ein langer Tiefschlaf sei die beste Hilfe. Drittens schlage das Phänomen auf alle Lebensbereiche durch. Und viertens sei sorgfältig gewichtendes Abwägen typisch für das unbewusste Entscheiden, während wir beim bewussten Entscheiden eher nach einem einzigen herausstechenden Merkmal gingen wie zum Beispiel dem Benzinverbrauch.
Die Folge-Experimente der Huizenga-Gruppe haben all das widerlegt. Unbewusste Entscheidungen fielen darin eher dürftig aus, denn nur etwa die Hälfte war optimal. Lange Zeiträume etwa durch Schlaf änderten daran nichts. Probanden schnitten deutlich besser ab, wenn sie bewusst abwägen konnten. Durften sie ihre Kaufkriterien zusätzlich in einer Liste sortieren, war der Effekt noch deutlicher. Fast alle wählten dann das Auto mit den meisten positiven Attributen, was klar für das bewusste Gewichten spricht. Besonders Dijksterhuis’ These über die Strategien des Abwägens sind fragwürdig. Um das zu sehen, muss man wissen, dass Menschen ganz unterschiedlich an Entscheidungen herangehen.
Die oben genannte Strategie der Gewichtung ist relativ üblich. Darin listet man alle Kriterien auf und versieht sie mit Zahlen. Bekommt Benzinverbrauch eine «6», ist er doppelt so wichtig wie die Beinfreiheit mit dem Wert «3» und dreimal so wichtig wie das Design mit dem Wert «2». Aus der Summe aller Werte ergibt sich, welches Auto gewinnt. Eine andere Strategie richtet sich nach der bloßen Rangordnung. Darin geht man nach dem wichtigsten Attribut, zum Beispiel dem Benzinverbrauch. Nur wenn zwei Modelle in diesem Punkt identisch sind, wechselt man zum nächsten, den Fahreigenschaften. Das macht man so lange, bis sich ein Unterschied ergibt. Neben diesen beiden Strategien verwenden Menschen noch ein Dutzend weiterer, die sie je nach Situation untereinander kombinieren.
Der springende Punkt ist nun, dass Dijksterhuis seine Liste so gewählt hat, dass das Phantasie-Modell «Hatsdun» in allen Fällen unabhängig von der Strategie am besten abschnitt. Man konnte also gerade nicht sagen, ob die Probanden der Strategie der Rangordnung oder der Strategie der Gewichtung folgten. Als Huizenga und Kollegen die Attribute sinnvoller verteilten, zeigte sich genau das Gegenteil zu Dijksterhuis’ Behauptung. Bewusst gewichten wir gründlich, unbewusst hingegen lassen wir uns von nur einem hervorstechenden Merkmal in der Rangordnung leiten.
Damit ist auch die Frage der Verallgemeinerung angesprochen. Der Versuch sagt nichts über unseren Alltag aus. Im Gegenteil, die sauber durchgeführten Versuche der Huizenga-Gruppe passen eher zu unserer Lebenserfahrung. Am besten entscheidet, wer bewussten Zugriff auf alle Informationen hat. Die Kapazitäten des unbewussten Denkens hingegen sind arg beschränkt. Das ist auch evolutionär plausibel. Bewusstsein hat vermutlich die Funktion, reichhaltige Details über die Welt zu entschlüsseln. Im Gegensatz zu Tieren können wir Menschen diese Informationen langfristig verwerten. Aufmerksamkeit funktioniert dabei wie ein Filter. Was die Aufmerksamkeit aus dem Bewusstseinsstrom herausfischt, kann man sprachlich kategorisieren und im Gedächtnis speichern. Genau darauf greifen wir zu, wenn wir wichtige Lebensentscheidungen treffen.
Dijksterhuis’ Theorie hat also eine philosophische Dimension. Hätte er recht darin, dass unbewusstes Denken dem bewussten überlegen ist, dann wäre Bewusstsein eine Illusion. Varianten dieser Bewusstsein-ist-wirkungslos-Theorie, die auch Epiphänomenalismus heißt, sind zwar unter Psychologen und Neurowissenschaftlern beliebt, sie erscheint jedoch evolutionär wenig plausibel, wie ich in späteren Kapiteln zeigen werde. Grundsätzlich stellt sich die Frage, warum sich ein so aufwendiger Mechanismus wie Bewusstsein in der Entwicklungsgeschichte gehalten haben sollte, wenn er zu nichts nütze ist? Man fragt sich auch sofort, ob Dijksterhuis bei der Vorbereitung auf das Experiment seinem eigenen Ratschlag gefolgt ist. Hat er lange geschlafen und sich nach dem Aufwachen spontan entschieden, Fragebögen zu gestalten und Probanden einzuladen? Originalität kann man der Theorie also nicht absprechen, denn sie widerspricht radikal unserer Alltagserfahrung. Doch sie sagt etwas Neues auf Kosten von Wahrheit und Genauigkeit, mit der verheerenden Empfehlung, ein Nickerchen zu machen statt gründlich nachzudenken. Doch einmal auf Probleme abgeklopft, fällt seine Theorie auseinander.
Freiwillige Selbstkontrolle
Die Folgeversuche der Huizenga-Gruppe zeigen, dass die Selbstkontrolle der Wissenschaften gut funktioniert und man nicht immer Philosophen braucht, um fragwürdige Theorien zu entlarven. Dennoch hat die Forschung einen Systemfehler, denn diese Art der Überprüfung ist selten. Wissenschaftler können nämlich nur originelle Ergebnisse in prominenten Zeitschriften wie Nature oder Science veröffentlichen. Das bloße Replizieren eines bekannten Versuchs bringt nur wenige der begehrten «impact points», die den Stellenwert einer Publikation ausdrücken. Doch gerade in den Naturwissenschaften gilt das Prinzip «publish or perish» – veröffentliche oder stirb. Der Anreiz für kritische Überprüfung ist daher gering. So bleibt die Fragwürdigkeit von Studien oft lange unentdeckt, und sie schaffen es sogar manchmal in die Lehrbücher. Der Franzose Stanislas Dehaene beispielsweise, einer der einflussreichsten Neurowissenschaftler unserer Zeit, schätzt Dijksterhuis’ Versuch als «sehr vielsagend» ein. Auch der österreichisch-amerikanische Neurophysiologe und Nobelpreisträger Eric Kandel hält die Experimente für einschlägig.
Aufsehen erregt allenfalls die Überführung von echten Fälschern, die man in der Wissenschaft zum Glück selten antrifft. Da Forscher zudem nur positive Ergebnisse publizieren können, dokumentiert auch niemand systematisch das Scheitern einer Versuchsanordnung. Das wäre aber sinnvoll, damit nicht andere dieselben Fehler wiederholen.
Nur bei sensiblen Themen sehen alle genauer hin, deshalb ist die Datenlage dort besser, aber oft auch heftig umstritten. Ein gutes Beispiel sind vermeintliche kognitive Unterschiede zwischen Männern und Frauen, wie sie der englische Neuropsychologe Simon Baron-Cohen annimmt, einer der führenden Autismusforscher. Er unterscheidet zwischen Neuro-Normalen und Autisten. Typisch für Menschen im Autismusspektrum ist, dass sie Mühe haben, die Gefühle anderer an deren Gesichtsausdruck abzulesen. Außerdem fällt es ihnen schwer, sich in andere hineinzuversetzen und eine fremde Perspektive zu übernehmen. Gleichzeitig können sie oft gut mit Zahlen umgehen, begeistern sich für technische Details und sortieren und systematisieren gerne Dinge. Diese Beschreibung passt auch auf viele Männer. Baron-Cohens zugespitzte These lautet daher, das autistische Hirn sei nur die Extremform des männlichen Hirns. Dafür spricht immerhin, dass etwa viermal mehr Männer als Frauen Autisten sind.
Baron-Cohens Versuche scheinen einen Unterschied zwischen Männern und Frauen zu belegen. Dazu machte er Fotos von Menschen mit einem emotionalen Gesichtsausdruck, schnitt dann lediglich die Augenpaare heraus und bat seine Probanden, das dazu passende Gefühlswort aus einer Viererliste zu nennen, beispielsweise: verspielt, nervös, gelangweilt, tröstend. Frauen waren dabei signifikant besser als Männer und Männer besser als Autisten.
Heißt das, dass Frauen eine höhere soziale Intelligenz besitzen? Nicht unbedingt. In einem ähnlichen Versuch versprachen die Psychologinnen Kristi Klein und Sara Hodges den Probanden Geld für gute Ergebnisse. Und siehe da, die Unterscheide zwischen Männern und Frauen verschwanden. Während Baron-Cohen von unterschiedlichen Fähigkeiten ausging, deutet der zweite Versuch eher auf einen Unterschied in der Motivation hin. Auch das würde für eine Differenz zwischen Männern und Frauen sprechen, aber eben an anderer Stelle. Weitere Faktoren können im Spiel sein. Die deutsche Psychologin Isabel Dziobek und ihre Kollegen konnten zum Beispiel nachweisen, dass Autisten Gesichtsausdrücke in Filmen besser deuten konnten als auf Fotos. Offenbar helfen ihnen dabei Hinweise aus der Gesamtsituation, die auf unbewegten Bildern fehlen. Wie auch immer die Debatte nun ausgehen mag, sie nährt einen Verdacht. Wären alle Themen so sensibel, wäre die Vielfalt widersprechender Theorien vermutlich deutlich größer. Daher drücken sich gute Wissenschaftler vorsichtig aus und sprechen nicht von «Beweisen», sondern von «Tendenzen» oder davon, dass ein Experiment einen «guten Grund zu einer Annahme» liefert.
Die Vermarktung der Wissenschaft
Nicht bei allen Freunden des Unbewussten ist diese Gewissenhaftigkeit anzutreffen. Mir scheint das in vielen Fällen schlicht Öffentlichkeitsarbeit zu sein. Eine wissenschaftliche These muss zugleich wahr und neu sein. Da die plausiblen Positionen schon besetzt sind, versuchen einige Forscher wie Dijksterhuis, auf Kosten der Wahrheit originell zu sein und so Aufmerksamkeit zu erregen. Dabei sind, wie gesagt, viele Versuche in Psychologie und Neurowissenschaft für sich genommen einwandfrei, doch die Konsequenzen, die sie dann für unser Menschenbild haben sollen, klingen wie eine Karikatur.
Das ist sicherlich zum Teil der Medialisierung der Wissenschaften geschuldet. Die hat den positiven Effekt, dass Forscher deutlicher als zuvor die gesellschaftliche Tragweite ihrer Entdeckungen betonen. Der negative ist, dass sie auch umso entschlossener um die Aufmerksamkeit der Leser buhlen. In einem Versuch hielten Studenten der Neurowissenschaften den Text einer fiktiven Studie für deutlich überzeugender, wenn sie ein buntes Bild von einem Hirnscan enthielt. Auch die Titel der Aufsätze klingen immer mehr wie Schlagzeilen. Der Wahrnehmungsforscher Ernst Pöppel nannte seine epochemachende Veröffentlichung über Blindsicht im Jahre 1973 im Stil dieser Zeit noch sinngemäß «Visuelle Restfunktion bei Menschen nach Hirnverletzungen, die den zentralen visuellen Pfad involvieren». Etwa drei Jahrzehnte später veröffentlichte der Sozialpsychologe Jonathan Haidt einen inzwischen ebenso berühmten Aufsatz, der typisch für zeitgenössische Publikationen ist und auch übersetzt etwas einprägsamer klingt: «Der emotionale Hund und sein rationaler Schwanz».
Ein weiterer Grund für die Begeisterung für das Unbewusste liegt im Selbstverständnis der Disziplinen, Effekte jenseits der Selbstbeobachtung zu erforschen. Hätte man perfekten Einblick ins eigene Seelenleben, bräuchte es keine Psychologie. Würden wir alle Einflüsse der Umwelt auf uns kennen, benötigten wir keine Soziologie oder Kulturwissenschaft. Gerade weil die vermeintlichen Entdeckungen in diesen Disziplinen nicht unmittelbar einsichtig sind, präsentieren die Forscher sie oft mit einem Überlegenheitsgefühl.
Allen voran Freud, der meinte, die Widerstände gegen seine Theorie der Verdrängung rührten daher, dass er «starke Gefühle der Menschheit verletzt» habe. Durch diese «Kränkung» sah Freud sich in einer Reihe mit Kopernikus, der nachgewiesen hat, dass die Erde nicht im Mittelpunkt des Universums steht, und Darwin, der zeigte, dass wir von den Tieren abstammen. Man kann sich darüber streiten, ob vernünftige Mensch wirklich gekränkt sind, wenn Wissenschaftler falsche und ideologische Thesen revidieren. Als Vermarktungsstrategie ist Freuds Dreiklang «Kopernikus – Darwin – ich» jedenfalls sehr suggestiv.
In der Zeit nach Freud entwickelte die kognitive Psychologie und die damit verwandte Künstliche-Intelligenz-Forschung das Computermodell des Geistes, dem zufolge der Geist sich zum Gehirn verhält wie Software zur Hardware. Wenn der Geist ein Programm und das Hirn eine Festplatte ist, dann kann man Denken als ein Rechenvorgang ansehen. Dieses Modell erlaubte Forschern, über Prozesse als «Berechnungen» zu sprechen, die sie als mental ansahen, die aber unbewusst in dem Sinne waren, dass sie jenseits des Bewusstseins lagen. Klarer wäre gewesen, wenn man den Bereich der Rechenoperationen von Anfang an als den des Nichtbewussten bezeichnete hätte. Das Computermodell des Geistes lieferte jedenfalls zahlreiche mathematische Modelle für innere Vorgänge, entwickelt für die Sprachwissenschaft von Noam Chomsky und für die Wahrnehmungstheorie von David Marr.
Gleichzeitig wurden in den sechziger Jahren die Soziologie und die Kulturwissenschaft unter Intellektuellen populär. Plötzlich galten wir nur noch als Spielball der Umstände, geprägt von Herkunft, Schicht, sozialer Rolle und kulturellen Zufälligkeiten. Doch spätestens seit der amerikanische Präsident George Bush senior die neunziger Jahre zum Jahrzehnt des Gehirns ausrief, trat die Neurologie auf den Plan. Nun sind wir plötzlich die Marionetten unserer nervlichen Verschaltungen.
Mit dieser leicht gekürzten Erfolgsgeschichte des Unbewussten will ich andeuten, dass sich die wissenschaftliche Faszination über die dunklen Seiten des Bewusstseins aus vielen Quellen speist. Es macht zwar den Eindruck, als hätten die Disziplinen um die Deutungshoheit über den Menschen gerungen. Doch tatsächlich war immer schon die Psychologie die Leitdisziplin. Die Neurowissenschaft kann es nicht sein. Zwar hängen alle geistigen Phänomene wie Gefühle, Gedanken oder Erinnerungen vom Hirn ab – mehr dazu im Kapitel Rätselhaftes Bewusstsein. Doch sie sind nicht im Vokabular von «Nervenzellen» oder «elektrischen Impulsen» ausdrückbar. Um die biologischen Grundlagen des Denkens zu finden, muss man zuallererst wissen, was Denken überhaupt ist, und dazu gehört, wie wir es im Bewusstsein erleben. Die Soziologie und die Kulturwissenschaften wiederum sind von der Psychologie abhängig, aber unmittelbarer, weil sie stillschweigende Annahmen über die Psyche des Menschen machen. Wer beispielsweise meint, die Gesellschaft würde uns prägen, der unterstellt einen Lernmechanismus in unserem Geist, der auf Verstärkung reagiert. Um das gut zu begründen, braucht man eine psychologische Theorie.
Vom Elfenbeinturm ins Labor und zurück
Natürlich gibt es auch in der Philosophie die Verführung, für den Überraschungseffekt alles zu tun. Das ist nicht mehr nur in der eher französisch geprägten Kulturphilosophie zu beobachten, sondern auch in der im englischsprachigen Raum dominierenden analytischen Philosophie. Normalerweise gilt: Je mehr zwei Menschen über ein Phänomen wissen, desto mehr stimmen sie in ihren Ansichten dazu überein. In der Physik beispielsweise gibt es nur wenige konkurrierende Theorien, während vermutlich bei über 99 Prozent des Lehrbuchwissens Einigkeit unter den Experten herrscht.
In der analytischen Philosophie sieht die Sache anders aus. Hier besteht der Fortschritt allenfalls darin, dass bestimmte Denkfehler oder absurde Thesen gebrandmarkt sind. Die Zahl der Lehrmeinungen hat jedoch in den letzten Jahrzehnten drastisch zugenommen. Erkenntnistheoretisch sind diese Meinungsverschiedenheiten, wie gesagt, im Vergleich zur Physik oder zu anderen Naturwissenschaften ein Rätsel. Die Diagnose lautet manchmal, die Philosophie stecke in den Kinderschuhen und sei noch keine reife Wissenschaft. Ich vermute eher soziale Gründe, denn besonders in den USA vergeben die Universitäten Festanstellungen nur an Philosophen mit originellen Positionen. Der Karriere-Ratschlag von Stephen Schiffer für seine Doktoranden an der weltweit führenden New York University lautet daher: Suche dir einen weißen Fleck auf der Landkarte der Theorien, fülle diese Position aus und verteidige sie gegen alle Angriffe.
Auch hier sind die zentralen Stellen oft schon besetzt. Das hat immerhin den positiven Effekt, dass Randpositionen inzwischen an Kontur gewonnen haben, weil scharfsinnige und belesene Denker sie verteidigen. Gleichzeitig erinnert diese Strategie an die Rhetorik der antiken Sophisten, denen es nicht um die Sache ging, sondern bloß darum, ein Argument um des Argumentierens willen zu präsentieren. Und da Widerlegungen in der Philosophie schwieriger und langwieriger ausfallen, macht das den Fortschritt noch zäher als zuvor.
Gerade Philosophen, die sich als Wissenschaftsberater sehen, stehen daher vor einer Doppelaufgabe. Sie müssen gegen die Hypes der anderen Wissenschaften gewappnet sein und dürfen gleichzeitig nicht den Moden des eigenen Faches erliegen. Der amerikanische Philosoph Daniel Dennett gehörte zu den Ersten, die den Elfenbeinturm verlassen und nebenan im Labor seinen Kollegen aus der Naturwissenschaft über die Schulter geschaut haben. In der Philosophie des Geistes folgen heutzutage fast alle seinem Beispiel, indem sie sich mit der naturwissenschaftlichen Forschung, mit Experimenten und Studien, vertraut machen. Das Verfallsdatum des empirischen Wissens muss man dabei in Kauf nehmen. Schon in 20 Jahren könnten viele Versuche völlig überholt sein.
Dennoch ist das Denken um des Denkens willen keine Option mehr. Noch bis zur Mitte des letzten Jahrhunderts nämlich haben Philosophen es sich in ihren sprichwörtlichen Lehnstühlen bequem gemacht und über Begriffe nachgedacht, also über die Kategorien des Denkens. Man kann sich zum Beispiel fragen, ob «Wahrnehmung» ein kausaler Begriff ist oder ob der Ausdruck «unbewusste Schmerzen» einen Widerspruch in sich darstellt. Das funktioniert ganz gut, denn Begriffe hat jeder gespeichert, der eine Muttersprache erworben hat.
Dieser Lehnstuhl-Philosophie lag die Idee zugrunde, man könne die Begriffsarbeit strikt von der empirischen Forschung trennen, also von Beobachtungen und Experimenten. Bei näherem Hinsehen hätten aber schon immer Zweifel aufkommen müssen. Erstens ist unser Begriffswissen in unserem Gedächtnis gespeichert. So ist es eine empirische Frage, wie Begriffe strukturiert sind, wie wir eine Sprache lernen und wie wir andere Menschen verstehen. Dazu forschen Linguisten, Psychologen und inzwischen auch die experimentelle Philosophie, die die philosophischen Intuitionen von Fachleuten und Laien mit Fragebögen testet. Zweitens haben viele philosophische Themen eine empirische Komponente, die man nicht allein durch Selbstbeobachtung erfassen kann, wie beispielsweise Gefühle, Wahrnehmung oder eben das Bewusstsein.
Auch wenn die wichtigsten Erkenntnisse über den menschlichen Geist aus den anderen Wissenschaften kommen, gibt es für Philosophen immer noch genug zu tun. Neben der Analyse der alten und neuen Begriffe stellen sich nach wie vor die großen Theoriefragen: Wie hängen Geist und Gehirn zusammen? Gibt es in der Welt buchstäblich «Informationen», also Einheiten mit Bedeutung, oder lediglich rohe Reize, die wir bloß als Informationen interpretieren? Verarbeiten wir Sprache wie ein Computer, oder ist das nur eine hilfreiche Metapher? Wenn eine Beleidigung mich wütend macht, ist dann dieselbe Art der Verursachung im Gange, wie wenn ein Stein eine Scheibe zerbricht?
Auch die größere, gesellschaftliche Perspektive gerät so in den Blick. Seit vielen Jahrzehnten verkünden Kulturwissenschaftler, Psychologen und Hirnforscher Revolutionen unseres Menschenbildes, aber das Leben geht einfach so weiter wie bisher. Die wichtige philosophische Entdeckung scheint eher zu sein, dass die Natur des Menschen ein Trägheitsmoment enthält, das sich gegen alle Umwälzungen sperrt. Wer glaubt, die Revolution stünde kurz bevor, lebt ohnehin mit einer Spannung. Er argumentiert mit vernünftigen Gründen dafür, dass die Vernunft keine Rolle spielt. Er entscheidet sich frei, die Willensfreiheit anzuzweifeln. Er denkt bewusst darüber nach, wie das Unbewusste sein Denken steuert.
Das Gegenprojekt scheint mir entspannter zu sein, nämlich mit den Mitteln von Bewusstsein und Vernunft zu zeigen, was Bewusstsein und Vernunft können und wo das Unbewusste seinen Platz hat.
Uneinsichtiger Geist
Phänomenale Farben
Stellen Sie sich vor, Sie wachen morgens auf und sehen die Welt nur noch in Schwarzweiß. Der Wecker neben ihnen zeigt «8.00» an. Sie wissen, dass er eigentlich dunkelrot ist, doch er sieht jetzt dunkelgrau aus. In der Küche gießen sie ihren zartgrauen Gemüsegarten auf der Fensterbank, bevor sie einen buchstäblich schwarzen Kaffee trinken. Bei Sonnenschein und strahlend grauem Himmel machen sie sich auf den Weg zur Arbeit. An der Ampel halten Sie, wenn das hellgraue Licht oben leuchtet, und fahren los, wenn dasselbe Licht unten leuchtet. Immerhin sieht das zementgraue Bürogebäude aus wie immer. Solange Sie ihre missliche Lage verschweigen, wird Freunden und Kollegen vermutlich erst einmal nichts auffallen.
Worin liegt der Defekt? Offenbar nicht in Ihrer Erinnerung, denn Sie wissen ja noch, dass der Himmel blau und die Ampel rot, gelb oder grün ist. Anders als wenn sie erblindet wären, ist auch Ihre Orientierungsfähigkeit nicht sonderlich eingeschränkt. Was fehlt, sind jedoch bestimmte Erlebnisqualitäten, die bisher Ihr Bewusstsein ausmachten. Oder noch genauer: Der phänomenale Charakter Ihres Bewusstseins ist vermindert. Ganz verschwunden ist Ihre Wahrnehmung von Farben ja nicht. Nur ist sie eben ausschließlich auf das Grauspektrum beschränkt zwischen den Polen Schwarz und Weiß.
Etwa 3000 Menschen in Deutschland leiden an dieser Form von Achromatopsie, also völliger Farbenblindheit. Im Gegensatz zur Rot-Grün-Schwäche verwechseln sie nicht nur zwei Farben, sondern können Dinge lediglich nach hell oder dunkel sortieren. Farbenblinde sehen die Welt also monochrom, aber man kann nur schwer herausfinden, ob ihre Eindrücke so sind, wie wenn Normalsichtige alles in Schwarzweiß sehen würden.
Einer meiner Bekannten hat trotz dieser Einschränkung seinen Führerschein geschafft. Er redet über gelbe Bananen und rote Tomaten, als würde er die Farben sehen. Doch würde man ihm das Foto einer grauen Banane oder einer grünen Tomate zeigen, könnte er den Unterschied nicht erkennen. Deshalb fragt er im Kaufhaus das Fachpersonal, ob Hose und Pullover zusammenpassen, und legt sich dann Notizzettel in die Kleidungsstücke.
Zwei Folgerungen lassen sich von dem Gedankenexperiment des Schwarzweißsehens ableiten. Erstens, dass unser Bewusstsein einen phänomenalen Charakter hat, und zwar nicht in der Lesart von «großartig» oder «toll», sondern in der von «wie es einem erscheint». Alles, was wir wahrnehmen oder erleben, hat einen bestimmten Wie-es-ist-Charakter, wie es ist, Rot zu sehen, Pfefferminzbonbons zu schmecken oder einen Muskelkater zu spüren. Der phänomenale Charakter ist so allgegenwärtig, dass man dessen Verlust erst erleben oder sich vorstellen muss, um ihn richtig wertzuschätzen. Wir büßten in der Reichhaltigkeit unseres Erlebens etwas ein, wenn wir keine Farben wie Rot, Grün oder Blau mehr sehen würden.
Umgekehrt könnte die Farbvielfalt noch reichhaltiger sein. Einige Menschen, fast ausschließlich Frauen, haben vier statt der üblichen drei Farbrezeptoren in der Netzhaut – sie sind Tetrachromatinnen. Während Normalsichtige etwa eine Million Farben unterscheiden können, sind es bei ihnen 100 Millionen. In Experimenten zur Farberkennung schlagen sie Normalsichtige um Wellenlängen. Wo wir nur grünes Gras sehen, erblicken Menschen mit dieser Hypersensitivität Hunderte von anderen Farben, nämlich Abstufungen von Rot- und Goldtönen, Violett-Schattierungen und Farbnuancen wie Smaragd, Limette und Braunoliv. Viele Amphibien, Fische und Insekten sind ebenfalls tetrachromatisch, doch die meisten Säugetiere haben diese Fähigkeit in der Entwicklungsgeschichte verloren. Eine seltene Gen-Mutation ist für die abweichende Farbauflösung beim Menschen verantwortlich.