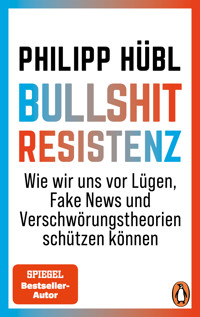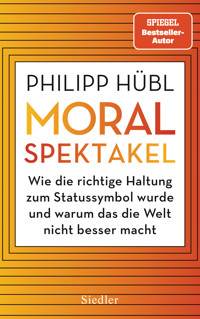19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Eine Gesellschaftsdiagnose aus philosophischer Sicht voller überraschender Erkenntnisse
Konservative Landbewohner mögen Hunde, moderne Städter lieber Katzen. Wutbürger sind eigentlich Ekelbürger. Angst macht nicht fremdenfeindlich. Politische Korrektheit ist ein Erkennungszeichen für Gruppenzugehörigkeit. Menschen leben dort streng religiös, wo es viele Parasiten gibt. Erkenntnisse wie diese präsentiert Philipp Hübl aus weltweiten wissenschaftlichen Untersuchungen. Seine Erklärung lautet: Emotionen prägen unsere moralische Identität und damit unsere politischen Präferenzen. Zwischen Traditionalisten und Kosmopoliten verstärkt sich die Polarisierung, wir leben in einer immer aufgeregteren Gesellschaft. Dabei geht es um die Frage, welche Werte ein gutes Leben ausmachen. Die Bruchlinien verlaufen zwischen Alt und Jung, Land und Stadt, Auto und Fahrrad, Tatort und Netflix, Vergangenheit und Zukunft. Wir sind der Aufregung aber nicht hilflos ausgeliefert, sondern in der Lage, selbst zu entscheiden, nach welchen Werten wir leben wollen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 555
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Buch
Konservative Landbewohner mögen Hunde, moderne Städter lieber Katzen. Wutbürger sind eigentlich Ekelbürger. Angst macht nicht fremdenfeindlich. Politische Korrektheit ist ein Erkennungszeichen für Gruppenzugehörigkeit. Menschen leben dort streng religiös, wo es viele Parasiten gibt. Erkenntnisse wie diese präsentiert Philipp Hübl aus weltweiten wissenschaftlichen Untersuchungen. Seine Erklärung lautet: Emotionen prägen unsere moralische Identität und damit unsere politischen Präferenzen. Zwischen Traditionalisten und Kosmopoliten verstärkt sich die Polarisierung, wir leben in einer immer aufgeregteren Gesellschaft. Dabei geht es um die Frage, welche Werte ein gutes Leben ausmachen. Die Bruchlinien verlaufen zwischen Alt und Jung, Land und Stadt, Auto und Fahrrad, Tatort und Netflix, Vergangenheit und Zukunft. Wir sind der Aufregung aber nicht hilflos ausgeliefert, sondern in der Lage, selbst zu entscheiden, nach welchen Werten wir leben wollen.
Autor
Philipp Hübl ist Philosoph und Autor des Bestsellers Folge dem weißen Kaninchen … in die Welt der Philosophie (2012), der Bücher Der Untergrund des Denkens (2015) und Bullshit-Resistenz (2018) sowie von Beiträgen zu gesellschaftlichen und politischen Themen in der Zeit, FAZ, taz, NZZ, auf Deutschlandradio und im Philosophie Magazin. Hübl hat nach einem Studium der Philosophie und Sprachwissenschaft in Berlin, Berkeley, New York und Oxford Philosophie in Aachen, Berlin und zuletzt als Juniorprofessor an der Universität in Stuttgart gelehrt.
Philipp Hübl
Die aufgeregte Gesellschaft
Wie Emotionen unsere Moral prägen und die Polarisierung verstärken
C. Bertelsmann
Inhalt
EinleitungDer Mensch, das moralische Tier
Teil I: Moral
1 Neurotisch, freundlich, pflichtbewusst:Wie prägt die Persönlichkeit die Moral?
2 Abitur, Armut und Atomunfall: Wovor haben wir Angst?
3 Mücken und andere Naturkatastrophen: Wie vernünftig ist Angst?
4 Der Terrorist, die Passagiere und der Mann auf der Brücke: Darf man zwischen Menschenleben abwägen?
5 Heiße Gefühle oder kalte Vernunft: Wo entsteht die Moral?
6 Mord, Inzest und gebratene Hunde: Wie weit reicht die Moral?
7 Die Sentimentalisten schlagen zurück: Wie emotional ist die Moral?
8 Eiter, Blut und Käse: Warum ekeln wir uns?
9 Das Dilemma der Allesfresser: Wann ist Ekel politisch?
10 Wir gegen die anderen: Warum haben wir Sehnsucht nach einem eigenen Stamm?
11 Allein unter Wölfen: Was hält Gruppen zusammen?
Teil II: Politik
12 Konservative gegen Progressive: Warum ist die Welt so polarisiert?
13 Globalisierung als Bedrohung: Wie kann man den Rechtsruck erklären?
14 Konservative Grüne, fremdenfeindliche Linke, autoritäre Liberale: Kann man rechts und links verwechseln?
15 Status, Rang und Dominanz: Warum sehnen sich Menschen nach Hierarchie?
16 Starke Führer und glorreiche Nationen: Wie werden Menschen autoritär?
17 Der Abscheu vor dem Anderen: Wie entsteht Fremdenfeindlichkeit?
18 Framing und Populismus: Wie bestimmt die Sprache die Politik?
19 Verletzende Worte und hasserfüllte Taten: Wie entsteht politische Gewalt?
20 Anders gleich oder gemeinsam verschieden: Wie prägt uns die Gruppenidentität?
21 Gesinnungsterror oder Minderheitenschutz: Warum ist politische Korrektheit so umstritten?
Teil III : Gesellschaft
22 Jung, neugierig und migrantisch: Warum beginnt Fortschritt in den Städten?
23 Mitgefühl statt Autorität: Warum ist die Zukunft weiblich?
24 Schmeckt nicht gut, aber teuer: Inwiefern ist ein Dinner ein politisches Manifest?
25 Detox, Bio und Impfverweigerung: Wie heilig ist die Natur?
26 Katzen, Kleidung und Körper: Wann ist das Private politisch?
27 Identität und moralische Eindeutigkeit: Was wäre ich ohne meinen Charakter?
28 Emotionaler Elefant und vernünftiger Reiter: Denkt man besser mit dem Bauch oder dem Kopf?
29 Die progressive Revolution: Warum ist Offenheit die Tugend der Zukunft?
Ausblick:Die Zukunft der freien Gesellschaft
Anhang
Dank
Anmerkungen
Literatur
Personenregister
Sachregister
Einleitung Der Mensch, das moralische Tier
Motivation
Konservative Landbewohner* mögen Hunde, moderne Städter lieber Katzen. Wer im Schlafzimmer bügelt, wählt eher rechts, und wer sich nackt auf dem Sofa lümmelt, eher links. In diesem Buch geht es um Erkenntnisse wie diese aus weltweiten Untersuchungen: inwiefern Kleidung unsere politische Gesinnung widerspiegelt, warum Menschen in Ländern, in denen es viele Parasiten gibt, streng religiös leben und warum mit der Globalisierung das Zeitalter der Neophilie angebrochen ist, die Verehrung des Neuen. Es geht um die alten Stämme, die durch Herkunft und Tradition bestimmt sind, und die neuen digitalen Stämme, die eine gemeinsame Vision von der Zukunft verbindet. Ich zeige, warum Angst nicht fremdenfeindlich macht und wie Persönlichkeitstests an Kindern verraten, welche politischen Vorlieben sie als Erwachsene haben werden. In all den Fällen wird deutlich: Unsere Emotionen prägen unsere Moral und damit unsere politischen Präferenzen.
Die Idee zu diesem Buch entstand, nachdem mich, wie viele andere, zwei Ereignisse politisch aufgerüttelt hatten, die mich intensiver über Polarisierung in der Politik und den sozialen Medien nachdenken ließen.
Das erste war die Finanzkrise 2008. Sie hat Millionen in den Ruin getrieben. Viele Staaten haben mit Steuergeldern Banken gerettet, doch die Verantwortlichen wurden nicht zur Rechenschaft gezogen. Die Geschehnisse ließen mich ratlos zurück.
Das zweite Ereignis war die Flüchtlingssituation im Sommer 2015. Tausende ertranken im Meer, und keiner hat ihnen geholfen. Über eine Millionen Migranten kamen nach Deutschland, und niemand hatte einen Plan, ob und wie man sie integrieren kann. Durch ganz Europa ging ein Rechtsruck, und in den USA kam kurz darauf Donald Trump an die Macht.
Die Welt ist in Unruhe. Besonders in den sozialen Netzen eskalieren die Diskussionen. Nur wenige sind bereit, ihren selbst gewählten Gegnern offen und neutral zuzuhören und sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Selbst Wissenschaftler und Journalisten stürzen sich vorschnell in überhitzte Debatten. Die Angst vor den Rechtspopulisten lähmt seitdem die progressiven (linksliberalen) wie die konservativen Parteien in Deutschland. Drängende Themen wie der Klimawandel oder globale Gerechtigkeit sind in den Hintergrund getreten. Politikern, die Probleme durchdenken wollen, wird Tatenlosigkeit vorgeworfen.
In mir und vielen Kollegen hat das die Überzeugung verstärkt, dass auch Philosophen Farbe bekennen müssen. Seit 2015 entstanden so Konferenzen zum Populismus, Initiativen für die Demokratie und Ratgeber zum Umgang mit Fake News. Wenn sich der Weltgeist beim Erfolg autoritärer Politiker etwas gedacht hat, dann vielleicht, dass Wahrheit, Freiheit und Demokratie jetzt keine Selbstverständlichkeiten mehr sind. Sie sind mehr als die angenehme Hintergrundmusik, deren Verschwinden erst ins Bewusstsein tritt, wenn der Plattenspieler leerläuft. Spätestens am Rechtsruck zeigt sich, dass der zivilisatorische Fortschritt seit Ende des Zweiten Weltkrieges kein Automatismus ist, sondern dass wir die Werte der freien Gesellschaft aktiv verteidigen müssen.
Die Grundidee
Beim Thema »Polarisierung« drängte sich mir vor allem eine Frage auf: Wie kann man den Rechtsruck erklären? Die Wähler der Rechtsparteien in Europa sind ökonomisch abgehängt und haben Abstiegsängste, sagen einige Politologen und Soziologen.1 Das ist wenig überzeugend, wie Untersuchungen zeigen. Ein erheblicher Teil der Rechtswähler ist nämlich gebildet und gut situiert. Außerdem macht Angst allein Menschen nicht fremdenfeindlich. Auch die Diagnose »Systemkritiker« trifft die Sache nicht, denn als Systemkritiker könnte man auch linke Parteien wählen.
Nicht nur der Rechtsruck, sondern auch Phänomene wie der Individualismus akademischer Großstädter oder die Motivation radikaler Impfgegner erscheinen in einem neuen Licht, wenn man aus dem Blickwinkel der Moralpsychologie fragt: Was passiert in uns, wenn wir moralisch und politisch denken, entscheiden und handeln?
Wer sich mit Moralpsychologie beschäftigt, hat ständig Aha-Erlebnisse, besonders bei radikalen Gedankenexperimenten, die einen lange nicht loslassen, wie etwa »Dürfen unfruchtbare erwachsene Geschwister einvernehmlichen Sex haben?« oder »Darf man einen Unschuldigen töten, um fünf andere zu retten?«.2 Versuchspersonen antworten innerhalb einer Fünftelsekunde, so schnell, wie ein Doppelklick auf dem Touchpad dauert.3 Viele Probanden urteilen spontan und dennoch mit starker Gewissheit. Sie sagen: »Beides fühlt sich falsch an.« Doch kaum jemand kann seine Intuition rational mit moralischen Prinzipien begründen.4 Auch wenn die Versuchspersonen das gar nicht bemerken, löst der Fall der Geschwister bei ihnen Unbehagen und die Frage nach dem Töten Angst aus, wie Versuche zeigen.
Die Grundidee dieses Buches lautet daher: Emotionen prägen unsere Moral und damit auch die Politik. Anhand unserer moralischen Emotionen kann man nicht nur den Rechtsruck besser verstehen, sondern auch, warum sich Stadtbewohner und junge Menschen nach Freiheit, Vielfalt und Offenheit sehnen und Ältere und Landbewohner nach Struktur und Tradition, kurz: warum die Welt polarisiert ist.
Inzwischen wurden Hunderte von Studien zu moralischen und politischen Emotionen mit mehr als einer halben Million Versuchspersonen in allen Kulturkreisen der Welt durchgeführt. Aus den Ergebnissen dieser Forschung entspringen die vier Thesen dieses Buches.
Erstens: Moral ist emotional.
Unsere moralischen und damit auch politischen Werte stammen selten aus edlen Prinzipien, die wir aus der Vernunft herleiten, sondern zum Großteil aus Emotionen wie Angst, Zorn, Ekel, Scham und Schuld. Darum lässt uns Moral nicht kalt. Allerdings zählen zu den moralischen Emotionen nicht nur irrationale Ängste oder die Wut der aufgewiegelten Masse, sondern auch das Mitgefühl mit Schwachen oder die Hemmung, anderen zu schaden. Unsere Gefühle bewerten automatisch unsere Handlungen, indem sie sinngemäß sagen: »Das ist falsch« oder »Das ist richtig«, »Das sollst Du tun« oder »Das sollst Du lassen«.
Zweitens: Moral ist biologisch.
Wer den Menschen verstehen will, darf nicht nur auf Einkommen, Bildungsstand und Schichtzugehörigkeit achten oder auf das, was er sagt. Wir sind nicht nur Kulturwesen, sondern ebenso Naturwesen. Der Mensch hat einen Verstand und ist dennoch Tier geblieben. Er ist anfällig für Stammesdenken, empfänglich für Hierarchien, giert nach Anerkennung und ist ausgestattet mit einer angeborenen Neigung, Angst vor dem Neuen und Unbehagen gegenüber dem Fremden zu empfinden. Diese Neigungen äußern die wenigsten unmittelbar mit Worten, sondern durch ihre Taten, ohne sich dessen immer bewusst zu sein.
Drittens: Moral polarisiert.
Weltweit klafft zwischen Modernisten und Traditionalisten, zwischen Progressiven und Konservativen ein Riss, der größer wird. Es geht dabei um unsere moralische Identität, um die grundlegende Frage, welche Werte und Normen ein gutes Leben und eine gute Gesellschaft ausmachen. Der Riss zeigt sich nicht nur in der Politik, er geht durch die ganze Gesellschaft und betrifft uns alle im Alltag. Die neuen Bruchlinien verlaufen zwischen Alt und Jung, Land und Stadt, Tatort und Netflix, Auto und Fahrrad, Kaufhaus und Amazon, Ehe und Polyamorie, Nationalismus und Internationalismus, zwischen Vergangenheit und Zukunft.
Viertens: Moral ist eine Entscheidung.
Auch wenn unsere Werte oft archaischen Instinkten entspringen, sind wir unseren Emotionen nicht hilflos ausgeliefert, sonst gäbe es keinen moralischen Fortschritt, und wir würden immer noch so denken und handeln wie in der Steinzeit. Die Evolution hat uns mit der Fähigkeit zur Selbsterkenntnis ausgestattet, mit der wir spontane Impulse überdenken und aktiv kontrollieren können. Die gute Nachricht lautet: Wir sind grundsätzlich autonom und können unsere Moral und unsere politische Gesinnung überdenken. Die schlechte: Wir machen von unserer Selbstbestimmung zu selten Gebrauch.
Eine Linse für neue Einblicke
Wer in Kopenhagen groß wurde, hält andere Werte für unumstößlich als jemand, der in einem Dorf in Afghanistan aufwuchs. Die Kultur prägt unsere Moral. Das ist eine Plattitüde und gleichzeitig nur die halbe Wahrheit. Denn wenn Erziehung und Kultur uns zu moralischen Wesen machen, stellt sich die Frage: Warum haben wir in unserem Kulturkreis nicht alle ungefähr dieselben Werte? Warum empfanden einige im Jahr 2015 Mitgefühl mit den Flüchtlingen und erlebten ihre Ankunft als Bereicherung, während andere die Fremden als Bedrohung sahen und ihnen mit Verachtung begegneten?
Hier spielt nicht Angst die Hauptrolle, wie viele annehmen, sondern eine andere Emotion: Ekel.5 Das ist eine der vielen Überraschungen aus der Forschung. Ekel kann eine moralische Emotion sein, die den Umgang mit Fremden bestimmt. Im Deutschen trifft das Wort »Abscheu« diesen moralisch relevanten Ekel am besten.
Eine Vielzahl an Studien zeigt: Je stärker sich Menschen ekeln, desto traditioneller und konservativer sind sie, und desto »unreiner« und »unnatürlicher« erscheint ihnen alles, was von der Normvorstellung von Leben, Tod und Sex abweicht: Homosexualität, Prostitution, Abtreibung oder Sterbehilfe. Man kann anhand der Ekelneigung weltweit politische Präferenzen zuverlässiger vorhersagen als anhand klassischer Merkmale wie Bildungsstand oder Einkommen.6 In archaischen Zeiten war Ekel vor verdorbener Nahrung und offenen Wunden ein wichtiger Schutz vor Infektionen.7 Dazu zählte auch der Abscheu gegenüber Fremden, die Keime und Parasiten übertragen konnten, gegen die es im heimischen Stamm keine Resistenzen gab. In der heutigen Zeit führt dieser Schutzmechanismus im Extremfall zur Fremdenfeindlichkeit.8
Wer die menschliche Natur ergründen will, darf daher Ekel und andere Emotionen nicht ignorieren, denn sie bilden die Grundlage für sechs moralische Grundprinzipien, die man bei allen Menschen auf der Welt in unterschiedlicher Ausprägung findet: Fürsorge, Fairness und Freiheit auf der einen Seite, sowie Autorität, Loyalität und Reinheit auf der anderen.9 Alle Menschen legen Wert auf die Prinzipien Fürsorge, Fairness und Freiheit. Werden sie verletzt, reagieren wir empört, also mit moralischem Zorn. Bei vielen im Westen stehen diese drei Prinzipien im Mittelpunkt ihrer Moral, daher kann man sie auch die drei progressiven »F«s nennen. Aber in der ganzen übrigen Welt und im Westen insbesondere unter den Konservativen und Rechten spielen daneben die anderen Prinzipien eine wichtige Rolle: Autorität, Loyalität und Reinheit. Werden sie verletzt, verspüren Menschen Abscheu, selbst wenn sie das so nicht beschreiben würden.
In diesem Buch zeige ich, dass die sechs Prinzipien eine heuristische Schablone darstellen, eine Linse, durch die viele gesellschaftliche Phänomene in einem neuen Licht erscheinen. Natürlich gehören nicht alle Menschen eindeutig dem einen oder anderen Lager an, sie verteilen sich auf einem kontinuierlichen Spektrum. Und auch innerhalb einer Person können die sechs Prinzipien ganz unterschiedlich ausgeprägt sein. Typisch ist dennoch, dass die drei progressiven und die drei konservativen Prinzipien im Block zusammen auftauchen.
Moralische Konflikte
Viele wundert es, dass Systemkritik, die einst von links ertönte, heute verstärkt am rechten Rand zu hören ist. Doch diese Parallele besteht nur oberflächlich. Linke Systemkritik ist eher antiautoritär. Sie richtet sich gegen die Machthaber, weil Macht grundsätzlich als suspekt gilt. Rechtsradikale Systemkritik hingegen ist autoritär. Die Rechten stellen Macht nicht prinzipiell infrage, sie sind vielmehr überzeugt, dass die Falschen an der Macht sind und dort sitzen, wo sie selbst schalten und walten wollen. Diesen Unterschied kann man ebenfalls mit der Schablone der sechs Prinzipien Fürsorge, Fairness und Freiheit sowie Autorität, Loyalität und Reinheit besser verstehen.
Ein anderes Beispiel ist der Streit um das Kopftuch in Deutschland, der inzwischen zu einer der großen Stellvertreterdebatten geworden ist. Dabei sind die politischen Lager auf den ersten Blick nicht leicht auseinanderzuhalten. Gegen das Kopftuch, das muslimische Frauen tragen, argumentieren sowohl die Konservativen als auch die Linken, doch ihre Motivation ist grundverschieden. Die Konservativen sehen im Kopftuch das Symbol einer fremden Kultur, die sie als Bedrohung betrachten. Die Linken fassen das Kopftuch als ein Mittel zur Unterdrückung der Frau auf. Nur für die Liberalen kann das im Westen getragene Kopftuch ein Ausdruck von Autonomie sein. Mit anderen Worten: Die Konservativen motiviert das Prinzip Loyalität (wir gegen die anderen), die Linken das Prinzip Fürsorge (Schutz vor Unterdrückung) und die Liberalen das Prinzip Freiheit (selbstbestimmtes Leben).10
Ein drittes Beispiel: Wer verfeindete Gruppen wie Neonazis und Islamisten vergleicht, die auf den ersten Blick wenig miteinander gemein haben, entdeckt erstaunliche Parallelen: Die Gruppen bestehen aus Männern, die loyal und homophob sind, Frauen nicht als gleichwertig ansehen und den Mainstream verachten: das hedonistische, liberale Bürgertum. Und sie sind reaktionär, sie sehnen sich nach einer Vergangenheit, die sie verklären. Beide Gruppen unterscheiden sich also kaum, sie legen Wert auf Extremformen der Prinzipien Autorität, Loyalität und Reinheit. Mit welcher historischen Verklärung sie ihre moralischen Emotionen dann rationalisieren, hängt vom Umfeld ab. Die einen träumen von Großdeutschland, die anderen vom Kalifat.
Identitätsschutz
Moralische Fragen bewegen uns, weil sie uns am Herzen liegen. Die Fragen nach Gut und Böse, nach dem gelungenen Leben und der richtigen Politik können wir nicht ignorieren. Unsere Werte machen unsere moralische Identität aus, sie machen uns zu dem, was wir sind.11 Weil die Themen aufgeladen sind, reagieren viele oft erst einmal mit einer Abwehrhaltung gegen neue Argumente, ungewohnte Gedankenexperimente und unwillkommene Erkenntnisse. Das habe ich oft als Reaktion auf meine Vorträge erlebt, aber auch an mir selbst beobachtet. Die wenigsten von uns leben nach hohen ethischen Standards. Stattdessen haben wir uns Strategien angewöhnt, kein schlechtes Gewissen haben zu müssen, wenn wir uns zum Beispiel einreden: »Nicht ich, der Staat muss den Obdachlosen helfen«, »Die anderen essen auch Fleisch« oder »Man kann ohnehin nie alles richtig machen«.
Viele Untersuchungen zeigen, dass unsere Moral den Kern unserer Identität bildet. Daher sind wir für identitätsschützende Denkfehler anfällig: Wir neigen eher dazu, unliebsame Fakten zu ignorieren oder umzudeuten, als dass wir unsere Moral überdenken und unsere Lebensweise ändern.12 Um das zu vermeiden, muss man sich konsequent mit Gegenpositionen konfrontieren – nur so kann man Klarheit über sich selbst gewinnen.
Moralische Vereindeutigung
Ich verstehe Moral hier in einem weiten Sinne. Darin geht es nicht nur um Leben und Tod, um Freiheit oder Gerechtigkeit, sondern auch um Urteile über Ernährung, Kleidung, Sex oder Drogen.13 Moral gibt Antworten auf die Frage, was wir für richtig halten und was wir tun sollen. Darum sind Politik und Recht immer schon moralisch, weil sie auf Werten und Normen beruhen.
Außerdem spiegelt die Gegenüberstellung von Progressiven und Konservativen nicht die deutsche Parteienlandschaft wider. Eine sogenannte »konservative« Partei kann progressive Prinzipien vertreten und eine »linke« Partei konservative. Seit Kriegsende haben sich die Werte in Deutschland deutlich zur progressiven Seite verschoben. Wer sich heute als »konservativ« bezeichnet, würde in den USA gerade noch als »Liberaler« durchgehen und in Saudi-Arabien als Revolutionär gelten. Die beiden Lager sind also immer als Gegenpole zu verstehen. In den Wörtern »progressiv« und »konservativ« ist auch keine Wertung enthalten. Sie beschreiben lediglich zwei Lebensstile. Allerdings vertrete ich am Ende des Buches die These, dass sich progressive Prinzipien besser in eine universelle Ethik überführen lassen.
Emotionen bringen uns dazu, so oder so zu handeln, aber sie nötigen oder determinieren uns nicht. Viele Faktoren bestimmen unser Handeln: Erziehung, erlernte Routinen, vernünftige Überlegungen und Grundbedürfnisse wie Hunger und Schlaf. Doch diese Faktoren beruhen oft auf den sechs emotionalen Prinzipien. Wer sich schnell ekelt, wählt zwar nicht zwingend eine konservative Partei, doch die unbewusste Ekelneigung macht ein solches Votum etwas wahrscheinlicher. Aber natürlich sind in der empirischen Welt alle Übergänge fließend, und es gibt immer Ausnahmen.
Das gilt in gleichem Maße für die Polarisierung selbst. Zwischen »Gut« und »Böse« finden sich zahllose Graustufen. Dennoch hegen viele Menschen den Wunsch nach moralischer Eindeutigkeit. Sie wollen andere klar in Freund und Feind und ihre Taten in richtig und falsch einteilen. Moralische Gefühle bestimmen unsere Identität und unsere Gruppenzugehörigkeit, daher ist es ihnen vor allem in sozialen Netzen wichtiger, die richtige Gesinnung zu kommunizieren, als ein moralisch umstrittenes Thema ausgewogen zu diskutieren.14 Doch Moral ist selten so eindeutig, wie sie auf den ersten Blick erscheint. Wir führen ein Leben, das wir nicht verstehen, verstricken uns in Widersprüche und sind uns oft selbst ein Rätsel. Absolute moralische Gewissheit entspringt meist aus einer Naivität, die Nuancen und Schattierungen missachtet.
Eine Natur und zwei Strömungen
Dieses Buch liefert eine Diagnose von Moral und Kultur, die sich auf weltweite psychologische Studien stützt. Für eine Gesellschaftsanalyse mag es übergründlich wirken, so deutlich auf messbaren Daten zu bestehen. Doch der Ansatz ist bewusst als Gegenmodell zu freihändigen Kulturdiagnosen konzipiert, die oft einem weit verbreiteten Denkfehler aufsitzen, dem Bestätigungsirrtum: Wir alle neigen nämlich dazu, eher nach Hinweisen zu suchen, die unsere eigenen Thesen bestätigen, als nach solchen, die ihnen widersprechen.15 Die moderne Kultur ist aber so vielfältig, dass man für jede noch so abstruse These Belege findet, daher braucht man Daten.
Der Bestätigungsirrtum wirkt auch in der Theorie. Wer beispielsweise durch die Schriften von Freud, Foucault oder Adorno geprägt ist, neigt dazu, sich in diesen Gedankengebäuden heimisch zu fühlen und die Welt durch ihre schwarzen Hornbrillen zu sehen. Doch auch hier muss man sich immer fragen, ob die Theorien dem empirischen Test standhalten. Die Moralpsychologie bestätigt manche ihrer Annahmen, widerlegt allerdings auch andere.
Nicht nur die Politik, auch die Erforschung des Menschen ist polarisiert, denn sowohl Natur- als auch Geisteswissenschaftler wollen ihn ergründen. Psychologen und Evolutionsbiologen überschätzen tendenziell den Einfluss der Natur, Geisteswissenschaftler den der Kultur. Allen ist gemein, dass sie stillschweigend Annahmen über den Menschen voraussetzen, die sie selten explizit formulieren.
Beide Strömungen gehören zusammen. Geisteswissenschaften ohne Naturwissenschaften sind leer, Naturwissenschaften ohne Geisteswissenschaften sind blind. Mein Buch steht daher im Geiste einer »dritten Kultur«, wie der britische Physiker und Schriftsteller Charles Percy Snow sie nennt.16 Es schlägt die Brücke zwischen den beiden Lagern, indem es sie gleichermaßen ernst nimmt – in der Hoffnung, zumindest die offensichtlichen Fallstricke auf beiden Seiten zu vermeiden.
Wer nicht fühlen will, muss denken
Das Buch ist in drei große Abschnitte unterteilt: Moral, Politik und Gesellschaft. In den Kapiteln über Moral geht es auch um Leben und Tod, also um Themen, die so fundamental sind, dass man sich manchmal etwas mehr Zeit nehmen muss, um sie zu durchdenken. Fragen wie »Darf man einen Menschen töten, um fünf zu retten?« betreffen nicht nur den Kern unserer Werte, mit ihnen sichert man sich auch die volle Aufmerksamkeit beim nächsten Familientreffen.
Emotionen prägen nicht nur unsere Moral, sondern spalten auch die Gesellschaft. Diese Polarisierung steht im Mittelpunkt der Abschnitte »Politik« und »Gesellschaft«. Doch obwohl Moral eine biologische Grundlage hat, sind wir unseren Emotionen nicht hilflos ausgeliefert, sondern können lernen, die gefährlichen zu überdenken, denn auch unsere Vernunft ist ein Ergebnis der Evolution.
Aristoteles sagt, als vernünftige Tiere seien wir nicht nur für unsere Taten, sondern auch für unseren Charakter verantwortlich.17 Bei Albert Camus heißt es: »Von einem bestimmten Alter an ist jeder Mensch für sein Gesicht verantwortlich.«18 Ganz besonders jedoch sind wir für unsere Moral verantwortlich. Wir müssen uns mit unseren Emotionen auseinandersetzen, um uns selbst besser zu verstehen.
* Aus stilistischen Gründen stehen Personalpronomen und allgemeine Ausdrücke für Frauen, Männer und andere. Das grammatische Geschlecht spiegelt nicht das biologische oder soziale wider.
TEIL IMoral
1 Neurotisch, freundlich, pflichtbewusst:Wie prägt die Persönlichkeit die Moral?
Die großen Fünf
Laufen Sie gerne nackt in Ihrer Wohnung herum? Bestellen Sie sich im Restaurant immer ein unbekanntes Gericht? Stehen Sie oft im Mittelpunkt der Party? Neigen Sie zu Melancholie? Macht es Ihnen Spaß, anderen zu helfen?
Solche Fragen verwenden Psychologen, um die Persönlichkeit von Menschen zu analysieren. Wer sich ohne Kleidung auf seinem Sofa fläzt, hat üblicherweise einen niedrigen Wert bei Gewissenhaftigkeit, und wer neue Speisen probiert, einen hohen bei Offenheit. Wer Partys liebt, befindet sich, wenig überraschend, weit oben auf der Skala der Extrovertiertheit. Melancholie deutet auf emotionale Instabilität hin. Und wer anderen hilft, hat einen hohen Wert bei Verträglichkeit.
Diese Zusammenhänge haben Psychologen seit über vierzig Jahren in Tausenden von Versuchen in allen Teilen der Welt erforscht. Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Extrovertiertheit, Verträglichkeit und emotionale Instabilität werden wegen der englischen Anfangsbuchstaben »OCEAN-Merkmale« oder auch »BIG-5-Merkmale« genannt.19 Die fünf Persönlichkeitsmerkmale sind jeweils unabhängig voneinander ausgeprägt. Ihre Werte variieren zwischen Individuen stark, und sie bleiben über das ganze Leben hinweg relativ konstant.20 Der BIG-5-Persönlichkeitstest ist einer der verlässlichsten in der Psychologie.21 Allerdings ist bis heute umstritten, welche Untermerkmale die bekannten fünf haben und ob man der Vollständigkeit halber noch weitere Merkmale annehmen sollte.22 Die Ergebnisse der Forschung finden jedenfalls breite Anwendung, bei der Partnervermittlung auf Online-Dating-Plattformen ebenso wie in den Personalabteilungen von Unternehmen.
Was genau verbirgt sich hinter den Merkmalen? Statt von Offenheit könnte man auch von Aufgeschlossenheit oder Neugier sprechen. Wer offen ist, mag neue Eindrücke, abstrakte Ideen und extraordinäre Wörter. Besonders gut erkennbar sind offene Menschen laut einer Studie an einem oder mehreren der folgenden Merkmale: Sie schreiben Gedichte, besuchen Kunstaustellungen, lesen Bücher und basteln Geschenke für andere.23
Statt »Gewissenhaftigkeit« könnte man auch »Pflichtbewusstsein« oder »Verlässlichkeit« sagen. Gewissenhafte Personen lieben Ordnung, Details und Struktur. Sie haben immer einen Plan und geben sich selten Tagträumen hin. Typisch ist, dass sie hart arbeiten, sich selten bei Terminen verspäten und ihre T-Shirts im Schrank akkurat zusammenlegen. Ein anderes Wort für »Extrovertiertheit« ist »Geselligkeit«. Extrovertierte sind gerne von Leuten umgeben. Starke Indikatoren für extrovertierte Personen sind den Untersuchungen zufolge, dass sie ins Solarium gehen, sich die Haare färben, schmutzige Witze erzählen und immer mal wieder nachts in einer schummrigen Bar versacken. Manchmal genau in dieser Reihenfolge.
Wer einen hohen Wert bei Verträglichkeit hat, man könnte auch sagen: bei Rücksichtnahme und Kooperationsbereitschaft, ist empathisch, freundlich und generös. Verträgliche Personen sehnen sich nach Bindung und sozialer Harmonie, gehen Konflikten aus dem Weg und verurteilen Aggression. Sie neigen dazu, Bettlern Geld zu geben und Ehrenämter zu übernehmen.
Andere Wörter für emotionale Instabilität sind »Labilität« und »Verletzlichkeit«. Emotional labile Personen sind neurotisch, leiden unter Ängsten, Stimmungsschwankungen und fühlen sich schnell angespannt. Laut der Forschung ist besonders typisch für Personen mit emotionaler Instabilität, wenig überraschend, dass sie Antidepressiva und Schlaftabletten nehmen und schon mal bei einem Psychotherapeuten waren.
In der Arbeitswelt kann man den Einfluss der Persönlichkeitsmerkmale gut nachweisen. So sind beispielsweise Gewissenhaftigkeit und emotionale starke Faktoren für beruflichen Erfolg.24 Die fünf Persönlichkeitsmerkmale wirken sich allerdings auf die gesamte Lebensführung aus. Sind Menschen offen oder verschlossen? Leicht zu verunsichern oder nicht aus der Ruhe zu bringen? Ist ihnen Pflichterfüllung wichtig, Fürsorge oder Autonomie? Oder alles zusammen? Der Schritt von diesen grundlegenden Charaktermerkmalen zu moralischen und politischen Vorlieben ist nicht weit.
Politische Persönlichkeiten
Das Persönlichkeitsmerkmal Offenheit sagt besonders zuverlässig vorher, dass jemand progressiv wählt, also links oder liberal. Die Progressiven haben auch durchgängig höhere Werte bei Verträglichkeit, besonders bei einem der Untermerkmale, nämlich Mitgefühl. Das kam in einer großen Vergleichsstudie heraus, in der die Testergebnisse von 20000 Probanden aus zahlreichen Untersuchungen zusammenliefen.25 Ein hoher Wert bei Gewissenhaftigkeit hingegen bedeutet nicht nur, dass Versuchspersonen ordentlich, systematisch und überlegt sind. Er zeigt auch an, dass sie eher konservative oder traditionalistische Parteien wählen.26 Ist bei Konservativen das Merkmal Verträglichkeit ausgeprägt, handelt es sich dabei eher um den Aspekt Höflichkeit als um den Aspekt Mitgefühl.27
Die amerikanische Sozialpsychologin Dana Carney und ihre Kollegen wollten herausfinden, ob man die politische Orientierung auch ohne Fragebögen bestimmen kann.28 Dazu schauten sich die Forscher zum Beispiel die Schlafzimmer und Schreibtische von Versuchspersonen an. Ein guter Indikator für Offenheit ist, wenn jemand Andenken und Fotos von Reisen in seiner Wohnung ausstellt und wenn Kunst an den Wänden hängt. Gewissenhafte Menschen halten Ordnung. Auf ihren Schreibtischen liegen oft Verwaltungsutensilien wie Kalender und Briefmarken. Zudem sind ihre Schlafzimmer gut gelüftet und man findet dort Haushaltsgeräte wie Bügeleisen.
Man merkt: Auch was im Schlafzimmer passiert, hängt von Persönlichkeitsmerkmalen ab.
Übrigens können auch beide Merkmale, Gewissenhaftigkeit und Offenheit, ausgeprägt sein. Darüber schweigt die Studie zwar, aber man denkt sofort an jemanden, der seine Urlaubsbilder akkurat auf dem Schreibtisch aufreiht.
Anhand der Schlaf- und Arbeitszimmer jedenfalls konnten die Forscher die politische Orientierung ihrer Testpersonen gut vorhersagen. Manchmal bestätigt die Forschung also auch altbekannte Klischees. Tagträumer, die sich nackt aufs Sofa fläzen und in einem Einmachglas Sand aus Ko Samui aufbewahren, wählen eher linksliberal. Menschen mit aufgeräumten Schreibtischen, die gerne bügeln, wählen eher konservativ.
Inzwischen hat sich diese Analyse verfeinert, weil Forscher auf die Daten aus sozialen Netzen zugreifen können. So untersuchten die Psychologen Michal Kosinski und David Stillwell von der Universität Cambridge 58000 amerikanische Facebook-User mit einer App, die gleichzeitig ein Persönlichkeitstest ist und Informationen über die »Likes« der Nutzer abfragt.29 Zusammen erstellten die Forscher so ein Datenprofil der Teilnehmer und konnten das Wahlverhalten anhand von Vorlieben vorhersagen. Politische Neigungen sind mit Persönlichkeitsmerkmalen verbunden und diese wiederum mit Likes. Das zeigen Kosinski und Stillwell mit einem Beispiel: Wer die Kinderfigur »Hello Kitty« mag, eine rosa Stummelschwanzkatze mit Schleife im Haar, hat einen hohen Wert bei Offenheit, einen niedrigen bei Gewissenhaftigkeit und wählt mit hoher Wahrscheinlichkeit die Demokraten.
Sowohl Offenheit als auch Gewissenhaftigkeit hängen also mit moralischen und politischen Vorlieben zusammen. Wer sehr offen ist, bestellt sich gerne unbekannte Speisen im Restaurant und legt Wert auf Vielfalt, Freiheit und Selbstverwirklichung. Wer hingegen eher verschlossen ist, verhält sich Unbekanntem gegenüber scheu und vorsichtig, würde sich zum Beispiel unter keinen Umständen auf öffentliche Toiletten setzen und legt Wert auf Ordnung, Vertrautheit und Tradition.
Auch ein hoher Wert bei Gewissenhaftigkeit sagt politische Vorlieben voraus. Wer als US-Bürger zu den Gewissenhaften zählt, hält die Todesstrafe tendenziell für richtig und verhält sich eher regelkonform. Wer wenig gewissenhaft ist, spricht sich gegen die Todesstrafe aus und neigt dazu, Autoritäten anzuzweifeln.30 Ein hoher Wert bei Gewissenhaftigkeit macht es zudem wahrscheinlicher, dass Menschen zum Autoritarismus neigen, was man als Extremform des konservativen Denkens ansehen kann.31 Ein niedriger Wert bei Offenheit macht es wahrscheinlicher, dass Menschen ihre Loyalität zu einer Gruppe so stark betonen, dass sie »sozial dominant« denken und handeln, also andere Gruppen als minderwertig ansehen.32
Polarisierte Kinder und polarisierte Erwachsene
Kann man am Verhalten von vierjährigen Kindern vorhersagen, was sie als Erwachsene über Abtreibung oder eine gesetzliche Krankenversicherung denken? Ein Versuch in den USA hat genau das nachgewiesen. In einer Langzeitstudie, die 1969 begann, verfolgten Forscher das Leben von über hundert Personen vom Kindergarten an bis in das Berufsleben hinein.33 Dabei entdeckten sie einen erstaunlichen Zusammenhang zwischen Charaktermerkmalen der Kinder und ihrem späteren Wahlverhalten. Kinder, die von ihren Betreuern in der Vorschule als vital, aufgeschlossen, motiviert, weniger konform und mit starken ästhetischen Interessen beschrieben wurden, gaben im Erwachsenenalter häufiger an, politisch progressiv ausgerichtet zu sein. Kinder, die als ängstlich, vorsichtig, gehemmt, starrköpfig, unsicher, konventionell, ruhig und aufrichtig galten, wählten später eher konservativ. Nicht nur das. Die »konservativen« Kinder, und zwar sowohl Jungen als auch Mädchen, hatten deutlich mehr stereotype Auffassungen von Geschlechterrollen als die »progressiven« Kinder. Vor allem die konservativen Jungen fielen dadurch auf, dass sie oft ungefragt Ratschläge erteilten. Mansplaining, also männliche Besserwisserei, beginnt offenbar schon im Kindergarten. Im Intelligenzquotienten unterschieden sich die zwei Gruppen allerdings nicht.
Erziehung spielt bei den Persönlichkeitsmerkmalen ebenso eine Rolle wie angeborene Neigungen. Zwar kommen Kinder mit einem neugierigen oder einem vorsichtigen Temperament auf die Welt, werden dann aber noch von den Eltern in die eine oder andere Richtung gelenkt. Dabei geht der Einfluss etwa zu gleichen Teilen auf Natur und Kultur zurück, wie eine Metastudie gezeigt hat, in die über 2700 Veröffentlichungen zu 15 Millionen Zwillingen einflossen.34 Noch genauer ausgedrückt: Die Varianz, also die Streuung zwischen den IQ-Werten, ist nur zur Hälfte von Umweltfaktoren bestimmt. Ganz gleich, wie gut oder schlecht Eltern ihre Kinder erziehen, für das Endergebnis sind sie nur zum Teil verantwortlich. Der andere Teil geht auf die Gene zurück. Selbst bei Affen und Hunden kann man unterschiedlich ausgeprägte Temperamente wie Neugier oder Reizbarkeit beobachten – mögliche Vorformen von Offenheit und emotionaler Labilität.35 So oder so können sich beim Menschen Persönlichkeitsmerkmale im Laufe des Lebens weiterhin verändern. Das braucht allerdings Zeit. Gut nachgewiesen ist, dass wir im Alter tatsächlich reifer werden, also etwas verträglicher, gewissenhafter und emotional stabiler.36
Stabilität oder Flexibilität
Offenheit zeigt progressives Denken an, Gewissenhaftigkeit hingegen eher traditionelles. Da beide Merkmale unabhängig voneinander sind, lautete die Preisfrage: Wie verhält sich jemand, der sowohl offen als auch gewissenhaft ist, und zwar nicht nur in der Politik, sondern bei der Arbeit und im Leben? Meine Vermutung ist, dass erfolgreiche Wissenschaftler, Unternehmer, Erfinder und Künstler beide Eigenschaften verbinden. Sie müssen einerseits offen sein und neue Ideen entwickeln; Kreativität ist für Offenheit der Indikator schlechthin. Andererseits müssen sie diszipliniert, strukturiert und ehrgeizig arbeiten, um Erfolg zu haben. Dazu benötigen sie Gewissenhaftigkeit. Sie neigen also sowohl zum progressiven als auch zum konservativen Denken und liegen damit zumindest ihrem Persönlichkeitsprofil nach in der Mitte der Gesellschaft.
Noch allgemeiner kann man alle fünf Persönlichkeitsmerkmale zwei übergeordneten Neigungen des Menschen zuordnen, nämlich Stabilität und Flexibilität.37 Beide Neigungen findet man auch bei Tieren und anderen Organismen.38 Stabilität als Metaeigenschaft umfasst Gewissenhaftigkeit, Verträglichkeit und emotionale Stabilität, und sorgt dafür, dass ein Organismus seine Funktionen aufrechterhält. Flexibilität als Metaeigenschaft umfasst Offenheit und Extrovertiertheit und drückt sich im Bedürfnis von Organismen aus, neue Informationen über ihre Umgebung zu gewinnen. Beim Menschen beruhen diese Neigungen vermutlich auf unterschiedlichen Systemen für Botenstoffe im Hirn. Der Neurotransmitter Serotonin sorgt eher für Stabilität und Erhaltung, der Neurotransmitter Dopamin eher für Flexibilität und Neugier.39 Stabilität zeigt sich unter anderem in festem Schlaf,40 Flexibilität hingegen in Tätigkeiten, die in die Welt hinausgreifen, wie beispielsweise in der Nahrungssuche, im Forschungsdrang oder im Bedürfnis, neue Leute kennenzulernen.
Bei unserer Persönlichkeit, aber auch bei unseren Emotionen, wie sich in den folgenden Kapiteln zeigen wird, läuft die Zweiteilung immer auf dasselbe hinaus. Der progressive Typus ist offen und neugierig; der konservative Typus hingegen traditionell, verschlossen und im Extremfall fremdenfeindlich.
Diese Zweitteilung betrifft ein zentrales Thema des Buches, nämlich die Frage, warum die Globalisierung und die Digitalisierung die Spaltung der Gesellschaften vergrößern. Noch vor wenigen Jahrzehnten war es leicht, Traditionalist zu sein: die Religion übernahm man von den Eltern, zum Dating ging man zum Tanztee oder in die Disco, Freundschaften schloss man beim Sport oder im Beruf, die Ausbildung führte unmittelbar zu einem Arbeitsplatz, den man bis zum Lebensende behielt, und das eigene Auto war ein Symbol für Status und Autonomie und damit der größte Stolz. In Zeiten von Tinder, Snapchat, Home Office und selbstfahrenden Autos herrscht hingegen ein Zwang zum Progressiven. Das sieht man schon daran, dass die Phänomene meist englische Label haben. Vielfalt zeichnet nun gerade Großstädte und das Ideal der jüngeren Generation aus, die Offenheit zum Lebensstil erkoren hat. Wer die neuesten Apps und Hashtags nicht kennt, gehört nicht zur digitalen Bohème.41
Als Persönlichkeitsmerkmal ist Offenheit damit die Voraussetzung und zugleich die Folge der Globalisierung: Waren, Kapital, Menschen, Nahrungsmittel, Sitten und Ideen bewegen sich weltweit. Sie durchdringen nicht nur die Grenzen, sondern lösen sie oft sogar auf – die Staatsgrenzen, die kulturellen Identitäten, die Unterschiede zwischen Mann und Frau, die Barrieren des Patriarchats, die Demarkationslinien von Kategorien und damit den gesamten alten moralischen Rahmen. Offene, also neugierige und experimentierfreudige Menschen haben diese Entwicklung befördert. Diese Entwicklung wiederum fordert von allen Offenheit und belohnt diejenigen, bei denen dieses Persönlichkeitsmerkmal ausgeprägt ist.
In den folgenden Kapiteln geht es darum, warum Persönlichkeitsmerkmale und besonders Emotionen wie Angst, Zorn, Ekel, Mitgefühl, Scham und Schuld unsere Moral und unsere politischen Neigungen prägen, kurz: warum sie den Kern unserer moralischen Identität ausmachen.
Kurz gefasst
Wir haben fünf voneinander unabhängige Persönlichkeitsmerkmale, die sich in früher Kindheit äußern und deren Werte sich im Leben wenig verändern: Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Extrovertiertheit, Verträglichkeit und emotionale Instabilität. Ein hoher Wert bei Offenheit sagt eine progressive Moral voraus, ein hoher Wert bei Gewissenhaftigkeit eine konservative. Das zeigt sich nicht nur im Wahlverhalten der Menschen, sondern auch in ihrer Einrichtung und ihrem Konsum. Persönlichkeitsmerkmale gehen zur Hälfte auf Gene, zur anderen auf Erziehung zurück. Daher kann man am Charakter von Vorschulkindern mit hoher Treffsicherheit ihr Wahlverhalten als Erwachsene ablesen. Die Globalisierung belohnt die Progressiven, die offen und neugierig sind. Die Jahrhunderte zuvor war Konservativismus eine erfolgreichere Strategie.
2 Abitur, Armut und Atomunfall: Wovor haben wir Angst?
Nervenkitzel beim Selbstversuch
Charles Darwin ging gerne in den Zoo. Der Begründer der Evolutionstheorie hat nicht nur die Weltmeere auf dem Zweimaster Beagle bereist, um Tiere in ihrer natürlichen Umgebung zu erforschen. Er hat auch regelmäßig den Zoologischen Garten in London besucht, der als erster wissenschaftlicher Zoo der Welt im Jahr 1828 seine Tore für Besucher öffnete. Dort beobachtete Darwin unter anderem, dass Orang-Utans wie ungezogene Kinder treten und brüllen, wenn man sie neckt.42
Als Naturforscher machte er sich im Londoner Zoo selbst zum Forschungsobjekt.43 Besonders faszinierend fand Darwin den menschlichen Angstreflex. Bei seinen Selbstversuchen näherte er sich immer wieder mit seinem Gesicht der dicken Glasplatte eines Terrariums, hinter der eine afrikanische Puffotter aus der Familie der Vipern lauerte. Er nahm sich fest vor, nicht zurückzuweichen. Doch jedes Mal, wenn die Giftschlange hinter dem Glas auf ihn losschnellte, sprang er unwillkürlich einen Meter zurück. »Mein Wille und mein Verstand waren kraftlos«, so Darwin.44
Dieses Erlebnis beschreibt er in seinem Buch Der Ausdruck der Gemütsbewegungen bei dem Menschen und den Tieren, das im Jahr 1872 erschien, dreizehn Jahre nach seinem revolutionären Werk Über die Entstehung der Arten. Wieder sorgte Darwin für Aufsehen. Die These, dass Tiere erstens Emotionen hätten und zweitens darin dem Menschen ähnelten, widersprach nicht nur der kirchlichen Lehre vom Menschen als Krone der Schöpfung. Sie stieß auch auf heftigen Widerspruch in der Fachwelt.45
Aus heutiger Sicht hatte Darwin in vielen wesentlichen Punkten recht. Sein Buch kann man als erste Arbeit zur wissenschaftlichen Psychologie ansehen.46 Zwar haben schon Philosophen in den Jahrhunderten zuvor über menschliche Gefühle nachgedacht. Und auch ihre Theorien waren empirisch in dem Sinne, dass sie von Alltagsbeobachtungen ausgingen, wie etwa Spinoza47, der über Eifersucht schrieb. Doch Darwins Projekt war das erste, das auf systematischen Beobachtungen und dem Vergleich von Mensch und Tier beruhte. Darwins Versuchskaninchen waren übrigens seine eigenen Kinder, die er von klein auf genau studierte.
Warnungen des Körpers
Im Zoo hatte Darwin Angst vor der Viper und konnte dieses Gefühl nicht willentlich abstellen. Angst ist vermutlich die typischste aller Emotionen. Manche Forscher unterscheiden terminologisch zwischen »Emotion« und »Gefühl«, aber in der Alltagssprache sind diese Ausdrücke meist austauschbar. Weil wir im Deutschen das Wort »Gefühl« allerdings auch für Körperempfindungen wie Schmerz und Kälte verwenden oder für motorische Fähigkeiten wie das Ballgefühl, muss man sich vergegenwärtigen, dass Emotionen eine besondere Klasse unserer Gefühle, oder allgemeiner: unserer mentalen Zustände, darstellen.
Neben Angst kennen wir noch andere Emotionen: Wut, Traurigkeit, Freude, Ekel, Scham, Gewissensbisse, Neid, Eifersucht oder Hoffnung. Fast jede Emotion kann auch bei moralischen oder politischen Fragen eine Rolle spielen. Die Angst vor Kriminellen, vorm Rechtsruck, vor Terroranschlägen, der Arbeitslosigkeit oder vorm Reaktorunglück sind nur einige der offensichtlichen Beispiele, daher muss man zuallererst besser verstehen, was Emotionen eigentlich sind. Alle Emotionen zeichnen sich durch dieselben Merkmale aus.48 An Darwins Angst vor der Schlange kann man das gut verdeutlichen. Erstens sind Emotionen automatische Verhaltensmuster.49 Wie Darwin beschreibt, haben wir kaum aktive Kontrolle darüber, dass sie auftauchen und wie wir dann reagieren. Wir können uns zwar manchmal selbst beruhigen, nachdem wir uns erschreckt haben, oder uns Ängste abtrainieren, zum Beispiel Flugangst. Doch das sind immer nur indirekte Wege der Kontrolle. Selbst geübte Bungee-Springer müssen sich einen Ruck geben, um in die Tiefe zu springen.50
Angst ist, zweitens, immer auf etwas in unserer Umwelt gerichtet, in Darwins Fall die Schlange. Alle Emotionen haben diesen Bezug, eine »Intentionalität«, wie Philosophen sagen.51 Wir erleben nicht einfach so Angst, sondern haben immer Angst vor etwas. Ebenso bei anderen Emotionen: Wir ärgern uns über den Computerabsturz oder hoffen auf gutes Wetter. Die Objekte der Angst müssen dabei nicht tatsächlich existieren, es reicht schon, wenn wir es glauben, wie bei der Angst vor dem Monster unterm Bett. Angst erleben wir, drittens, subjektiv in unserem Bewusstsein, und zwar auf einer Skala der Intensität, die von leichter Nervosität bis zu blanker Panik reicht.52 Viertens äußern sich Angst und viele andere Emotionen durch einen typischen körperlichen Ausdruck: Die Augen weiten sich, und die Stimme schnellt in die Höhe. Das fünfte Merkmal schließlich ist das entscheidende: Angst bezieht sich nicht einfach nur auf Objekte wie Schlangen, sondern als Emotion gibt sie eine Bewertung der Situation ab. Die Angst sagt: »Vorsicht, da ist eine Gefahr!«, nur eben nicht mit Worten.53
Emotionen sind Mechanismen, die wichtige »Lebensthemen« abbilden, wie der amerikanische Psychologe Richard Lazarus sagt. Dadurch konnten unsere Vorfahren besser in der Wildnis überleben und sich in die Gruppe integrieren.54 Wie unsere Angst uns mitteilt: »Das ist gefährlich«, sagt uns Ekel: »Das ist unrein«, Wut: »Das ist eine Störung oder ein Angriff«, Eifersucht: »Jemand bedroht meine enge Sozialbeziehung«, und so weiter. Diese Bewertungen sind aber keine Sätze oder bewusste Gedanken, sondern schnelle und automatische Einschätzungen einer Situation.
Der amerikanische Philosoph Jesse Prinz hat Lazarus’ Idee zu einer raffinierten Theorie ausgebaut.55 Prinz zufolge sind Gefühle »verkörperte Bewertungen«. Die Angst vor der Schlange zum Beispiel beruht auf einem typischen Körpererleben: Herzklopfen, Aufregung, Zittern. Dieses Erleben, so Prinz, bewertet die Schlange als eine Gefahr. Angst funktioniert wie ein Rauchmelder. Wenn es piept, zeigt er Rauch an und warnt so vor Feuer, auch wenn er nicht wörtlich sagt: »Da ist ein Feuer!« Ebenso meldet uns Angst über einen Körperalarm eine Gefahr, ohne das zu verbalisieren.
Im Deutschen und in anderen natürlichen Sprachen finden sich Hunderte von Emotionswörtern wie »Grausen«, »Verblüffung«, »Verzweiflung«, »Irritation« oder »Erleichterung«. Folgt daraus, dass wir Hunderte von Emotionen erleben? Aus biologischer Sicht spricht viel dafür, dass Menschen weltweit nur etwa ein Dutzend Grundemotionen hegen. Klare Kandidaten sind Angst, Zorn, Ekel, Traurigkeit und Freude; andere wie Staunen, Eifersucht und Peinlichkeit sind umstrittener.56
Die Nuancen der Grundemotionen fächern wir allerdings sprachlich sehr fein auf, und zwar oft nach den eben genannten Dimensionen von Emotionen: Verhalten, Bezug, Bewusstsein, Ausdruck, Bewertung.57
Ganz gleich, wie wir uns ausdrücken, wenn wir über »Angst« sprechen: Am Ende pulsiert immer die Amygdala, also der Mandelkern, ein Neuronenhaufen, der nussgroß jeweils rechts und links im unteren Schläfenlappen liegt. Die Amygdala ist Teil des neuronalen Schaltkreises der Angst.58 Innerhalb der Gruppe der Ängste kann man aber viele Spielarten unterscheiden. Lampenfieber zum Beispiel ist eine Angst mit einem speziellen Bezug, nämlich vor anderen aufzutreten. Bei Wörtern wie »Flugangst« und »Prüfungsangst« nennen wir die Situation der Angst im Wort gleich mit. Nicht nur auf der Intensitätsskala unterscheiden wir zwischen leichter Aufregung und Heidenangst. Auch die Dimension der Bewertung kennt Abstufungen: Grusel ist die Angst vor dem Unheimlichen und zeigt uns eine latente, lauernde Gefahr an. Panik hingegen sagt: akute Lebensgefahr!
Manche Geisteswissenschaftler unterscheiden stipulativ zwischen »Furcht« und »Angst«, aber im Alltag gibt es zwischen beiden keinen Unterschied, außer dass »Furcht« altertümlicher klingt, weil wir das Wort aus Märchen und der Bibel kennen. Mischt sich Angst mit Vergnügen, etwa während wir einen Thriller schauen, wird sie zur Spannung. Sind wir selbst dabei beteiligt wie beim Bungee-Jumping, erleben wir diese Angstlust als Nervenkitzel. Und wenn uns die Angst daran hindert, jemanden zu töten, äußert sie sich als Scheu, mit anderen Worten: in einer Tötungshemmung.
Nicht nur für Angst, sondern für alle grundlegenden Emotionen kann man diese Nuancen durchspielen. Zur Zorn-Gruppe gehören unter anderen Wut, Ärger, Genervtsein, Aggression, Groll und, wie wir noch sehen werden, Empörung als moralischer Zorn.
Wer nicht denken will, muss fühlen
Stellen wir uns vor, ein Steinzeitmensch stößt auf eine Schlange im Unterholz. Er könnte Folgendes denken: »Die Schlange ist sehr nah an meinem Bein. Sie könnte hervorschießen und mich beißen. Andere sind nach solchen Angriffen gestorben. Vermutlich ist der Biss giftig. Ich sollte ihr lieber nicht zu nahe kommen.« Bevor er diesen Gedanken zu Ende führen kann, hat die Schlange längst zugebissen. In so einer Situation funktioniert Angst als automatischer Warnmechanismus viel effizienter als ein bewusster Gedanke. Sie lässt den Urmenschen zurückschnellen, bevor er überhaupt weiß, was los ist. Genau wie Darwin vor der Schlange im Terrarium.
Zwei evolutionäre Funktionen zeigen sich in diesem Automatismus. Angst warnt uns vor Gefahren, und sie leitet einen Abwehrmechanismus ein. In den meisten Fällen ist das die Flucht, oder zumindest ein Vermeidungsverhalten. Angst hat allerdings noch eine dritte Funktion, die Darwin überraschenderweise nur in einem einzigen Absatz erwähnt, und die liegt in der zwischenmenschlichen Kommunikation. Angst sieht man anderen an: Die Augen sind geweitet, das Kinn zur Brust geneigt, die Mundwinkel gerade nach hinten gezogen. Jeder kennt diesen Blick aus Hollywoodfilmen. Wenn einen alle plötzlich anstarren, dann sollte man lieber weglaufen, denn das Monster lauert direkt hinter einem.59 Thriller und Horrorfilme wirken überhaupt nur, weil Angst diese kommunikative Funktion hat. Obwohl das Publikum weiß, dass es nicht in Gefahr ist, erzeugen die bloßen Bilder der bedrohten Figuren ein mulmiges Gefühl.60 Angst kann man anderen natürlich nicht nur ansehen, sondern man kann sie auch hören. Schreien kleine Kinder »Mami« oder »Papi«, hören die Eltern sofort, ob die Kleinen bloß bockig sind oder ob Angst in ihrer Stimme liegt.
Emotionen haben also diese drei Funktionen: Sie informieren uns durch eine automatische Bewertung über unsere Umwelt, sie leiten ein Verhalten ein und sie sind Teil der nichtsprachlichen Kommunikation, denn andere können an unserem Verhalten ablesen, wie es uns geht.61
Angeboren und erlernt
Was spricht dafür, dass der Mechanismus der Angst angeboren ist? Erstens hat Angst einen festen Schaltkreis im Hirn, zu dem die Amygdala gehört. Der Angst-Schaltkreis arbeitet schnell, automatisch und ohne willentliche Kontrolle.62 Man findet ihn in den Köpfen von Affen, Hunden und Ratten. Biologen vermuten, dass er schon vor gut 500 Millionen Jahren im Hirn der ersten Wirbeltiere verdrahtet war.63 Angst beruht also auf einer Urschaltung.
Außerdem ist der Gesichtsausdruck vieler Emotionen universell. Selbst blind geborene Menschen lachen bei Freude, runzeln die Brauen bei Zorn und ziehen ihre Nasenlippenfurchen bei Ekel hoch. Das können sie aber nicht erlernt haben.64 Der amerikanische Psychologe Paul Ekman, einer der einflussreichsten Emotionsforscher des 20. Jahrhunderts, hat gezeigt, dass Bewohner von Papua-Neuguinea, die damals kaum Kontakt mit der westlichen Zivilisation hatten, Emotionen in den Gesichtsausdrücken von Amerikanern genauso gut erkennen konnten wie diese in ihren.65 Auch das spricht für ein biologisches Programm, das unabhängig von der Kultur abläuft.
Emotionen sind komplexe Verhaltensmuster. Daher ist es unwahrscheinlich, dass sie sich in der Evolution ohne eine adaptive Funktion für das Überleben der Spezies entwickeln und halten konnten. Der Überlebensvorteil der drei Funktionen »Bewertung«, »Verhalten«, »Kommunikation« zeigt sich in vielen Fällen. Wer zum Beispiel Angst vor Schlangen hat, hält sich von ihnen fern, wird seltener gebissen und kann sich erfolgreicher fortpflanzen.
Nicht nur der Mechanismus der Angst ist angeboren, sondern auch die Voreinstellung für einige ihrer Auslöser: Schlangen, Spinnen, Raubtiere und Abgründe beispielsweise. Wer schon einmal im Zoo im Raubtiergehege war, weiß, dass allein der Geruch von Tigern zu starken Reaktionen führt. Er beschleunigt den Herzschlag, erhöht den Adrenalinspiegel, lässt Blut in unsere Beine laufen und bereitet uns so auf die Flucht vor. Die Angst vor Untiefen ist ebenfalls angeboren, wie Versuche an Kleinkindern zeigen. Sie wollen nicht über eine Glasplatte krabbeln, die so präpariert ist, dass sich ein Abgrund darunter aufzutun scheint. Mit anderen Worten: Sie haben schon Höhenangst, bevor sie überhaupt wissen, was das ist.66
Das zeigt die Forschung auch für Schlangen. Wenn man Affen Bilder von Blumen zeigt und ihnen gleichzeitig einen harmlosen Stromstoß verpasst, entwickelten sie ziemlich schnell Angst vor Blumen.67 Lässt man die Stromstöße eine Zeit lang weg, verflüchtigt sich dieser Effekt wieder. Bei Schlangenbildern und Stromstößen ist das nicht so. Einmal aktiviert, bleibt die Schlangenangst bei Affen und auch bei Menschen ein Leben lang bestehen. Das Hirn von Primaten hat also eine klare Voreinstellung für die Kategorie »Gefahr: Schlange!«
An diesem letzten Versuch zeigt sich, dass wir vor so gut wie allem Angst haben können. Neben angeborenen Voreinstellungen gibt es auch kulturell erlernte wie die Angst vor Abiturprüfungen, Amokläufern oder dem Atomkrieg.
Natur und Kultur
Wachstum ist angeboren. Die Maximalgröße, die ein Mensch erreichen kann, ist in den Genen festgelegt. Kinder wachsen aber nicht einfach so, sondern sie müssen gut ernährt werden, sonst können sie sich nicht dem Bauplan entsprechend entwickeln.
Beim Wachstum kann wie bei allen angeborenen Fähigkeiten etwas dazwischenkommen. Ebenso bei der Farbwahrnehmung, die man Kindern nicht beibringen kann. Sind jedoch die zuständigen Gene geschädigt, kommen sie farbblind zur Welt.
Angeboren heißt also nicht: »tritt zwingend auf« oder »ist unveränderlich«. Darin liegt ein verbreitetes Fehlurteil über evolutionäre Thesen. Dass beispielsweise Angst als Warnmechanismus angeboren ist, bedeutet vielmehr, dass es eine biologische Voreinstellung gibt. Ein guter Beleg dafür ist, dass Angst bei allen Menschen vorkommt, sich unabhängig von der individuellen Prägung ausbildet und nicht erlernbar ist.68 Man kann Kindern zwar Angst machen, aber man kann sie nicht dazu erziehen, in dunklen Kellern Herzklopfen zu bekommen.
Geistes- und Sozialwissenschaftler hegen oft einen starken Abwehrreflex gegen die These, dass Eigenschaften und Fähigkeiten angeboren sind. Das hat historische Gründe: Rassisten und Sexisten haben mit der Angeborenheitsthese oft erschütternde Missstände gerechtfertigt. Ein Argument ging ungefähr so: Männer sind stärker als Frauen, also sollen Männer über Frauen das Sagen haben. Oder: Weiße sind von Natur aus anderen »Rassen« überlegen, deshalb ist es richtig, dass sie über sie herrschen.
Die falsche Folgerung von Fakten, oder oftmals vermeintlichen Fakten, auf die Moral nennt man in der Ethik den naturalistischen Fehlschluss.69 Schon David Hume, der schottische Philosoph der Aufklärung, hat das sinngemäß so ausgedrückt: Aus einem Sein kann man kein Sollen ableiten.70 Selbst wenn Männer im Durchschnitt stärker als Frauen sind, folgt daraus nicht, dass sie sie beherrschen sollen. Aus Fakten folgen keine Normen. Abgesehen davon kann man oft auch die Prämissen dieser kurzschlüssigen Argumente widerlegen. Die Biologie kennt bei der Spezies Mensch ohnehin keine Rassen, geschweige denn bessere und schlechtere.
Doch anstatt den Fehlschluss als Ganzes anzugreifen, stellen viele Geistes- und Sozialwissenschaftler vorsichtshalber grundsätzlich die These infrage, dass irgendetwas angeboren ist. Mit diesem argumentativen Schachzug geht man auf den ersten Blick auf Nummer sicher. Das Manöver entspringt dem ehrenwerten Impuls, Rassismus und Sexismus zu bekämpfen, und es passt zur Idee der Gesellschaftskritik, dass wir als unbeschriebene Blätter auf die Welt kommen und nur durch unsere Umwelt oder Kultur geprägt werden. Aus wissenschaftlicher Sicht ist es trotzdem falsch. Auch wenn uns die Gesellschaft prägt, kommen wir nicht als unbeschriebene Blätter auf die Welt. Wenn wir den Menschen zum Besseren wenden wollen, müssen wir also erst einmal seine Natur verstehen – und dazu gehören auch seine angeborenen Neigungen.
Kurz gefasst
Angst ist ein Warnmechanismus des Körpers, der unsere Umwelt bewertet, indem er sagt: »Da ist eine Gefahr!« Die Empfänglichkeit für einige Auslöser der Angst ist angeboren wie die für Schlangen und Spinnen, andere Auslöser sind kulturell erlernt wie die Angst vor der Abiturprüfung oder vor Terrorismus. Angst reguliert unsere Kommunikation und unser Handeln: Sie äußert sich in einem universellen Gesichtsausdruck, der anderen eine Gefahr anzeigt, und sie motiviert uns zur Flucht und zu Vermeidungsverhalten. Angst ist dann eine moralische Emotion, wenn sie uns hindert, andere zu töten, oder uns dazu verleitet, unsere Umwelt als bedrohlich anzusehen.
3 Mücken und andere Naturkatastrophen: Wie vernünftig ist Angst?
Politische Ängste
Die Angst vor der Schlange zeigt uns: Da ist eine Gefahr. Die Angst bewertet eine Situation also, indem sie sagt, dass ein Schaden entstehen kann. Spannend ist dabei folgende Parallele: Bei unseren moralischen Prinzipien geht es ebenfalls darum, Schaden zu vermeiden. Warum gilt: »Du sollst nicht töten« und »Du sollst nicht stehlen«? Weil die Folge einen Schaden für jemanden darstellt: den Verlust des Lebens und des Besitzes. Unsere moralischen Urteile drücken also Wertungen aus. Und unsere Emotionen in gewisser Weise auch.
Eine Spielart der Angst ist die Hemmung, andere zu töten. Auf der Seite der Moral ist das Tötungsverbot für alle Menschen und Kulturen ein universelles Gesetz. Jedem ist klar, dass das Leben einen Wert darstellt und der Tod als die Verkürzung des Lebens somit einen Schaden anrichtet.
Bei anderen Werten sieht die Sache schon ganz anders aus. Entsteht ein Schaden, wenn die weltweite Ungleichheit groß ist? Wenn Fremde ins Land kommen? Man nicht all das sagen darf, was man will? Jemand Marihuana raucht? Sich Menschen prostituieren? Offenbar kann die Stärke der Angst für die moralische Einschätzung eine Rolle spielen.
Ein kurioses Ergebnis der Forschung lautet, dass Angst auch mit politischen Vorlieben korreliert ist. Weltweit unterscheiden sich »Konservative« (conservatives), man könnte auch sagen: Traditionalisten, und »Progressive« (liberals), man könnte auch sagen: Linksliberale, darin, wie ausgeprägt ihre Angst ist.71 Ein Beispiel: Ein Forscher hat Fotos von Personen aufgenommen, die absichtlich sonderbare Gesichtsausdrücke machten, und die Fotos zusätzlich mit einem Bearbeitungsprogramm verfremdet. In diesen Bildern konnte man danach keine eindeutigen Emotionen erkennen. Als er die Fotos seinen Testpersonen präsentierte, sahen Konservative darin bedrohliche Gesichtsausdrücke, Progressive hingegen eher nicht.72 Der amerikanische Verhaltensforscher Robert Sapolsky drückt das scherzhaft so aus: »Ein Progressiver ist ein Konservativer, der noch nie überfallen wurde.«73
Viele Versuche deuten in dieselbe Richtung. Testpersonen sollten einen Knopf drücken, sobald sie negative Wörter wie »Giftgas« oder »Schlange« lasen. Konservative reagierten dabei deutlich schneller als Progressive. Schauen Probanden auf Collagen, auf denen viele Dinge abgebildet sind, verweilen Progressive länger auf positiv besetzten Objekten wie etwa weißen Kaninchen, Konservative eher auf solchen, die Gefahr signalisieren wie Spinnen.74 Konservative reagieren zudem physiologisch messbar stärker, wenn man sie mit lauten Geräuschen erschreckt oder ihnen grausame Bilder zeigt.75 In den USA haben Republikaner nach eigenen Angaben dreimal so viele Albträume wie Demokraten.76 Man kann Menschen sogar durch Angst konservativer machen. Sobald man Progressive in den USA mit ihrer eigenen Sterblichkeit konfrontiert, fällen sie konservativere Urteile als üblicherweise.77 Sie sind dann zum Beispiel bereit, mehr für das Militär auszugeben, und lehnen häufiger eine gesetzliche Krankenversicherung ab.
Konservative halten die Welt für bedrohlicher als Progressive. Das ist inzwischen auch neurologisch nachgewiesen. Im Vergleich zu Progressiven haben Konservative im Schnitt eine größere Amygdala, die Schaltstelle der Angst im Hirn.78 Die unterschiedlichen Angstneigungen passen auch gut zu dem Bild, das beide Gruppen vom Staat haben. Konservative sagen, die Regierung soll die Bevölkerung vor Gefahren schützen, Progressive hingegen, die Regierung soll für die Bürger sorgen. Wenn ein Krankenwagen also mit heulenden Sirenen vorbeifährt, denken Konservative: »Es ist etwas Schlimmes passiert«, Progressive hingegen: »Hilfe ist unterwegs.«
Macht uns Angst zu Extremisten?
Viele Analysen über die Spaltung der Gesellschaft nennen Angst als Grund für den erstarkten Rechtspopulismus in Europa.79 So schließen sich beispielweise der Politikwissenschaftler Franz Walter und seine Kollegen der Analyse des amerikanischen Soziologen Seymour Lipset an, dass »Abstiegsängste« zum Extremismus führen.80 Und der Psychologe Borwin Bandelow meint, Fremdenfeindlichkeit entspringe »irrationalen Ängsten«.81
Doch oft fehlt hier ein Bezug zur aktuellen Emotionsforschung. Angst allein macht Menschen nicht fremdenfeindlich oder antidemokratisch, sondern zunächst einmal empfänglich für Themen wie »Ordnung«, »Schutz« und »Sicherheit«, zum Beispiel für erhöhte Polizeipräsenz, Videoüberwachung oder den Einbau von Haustüren der Widerstandsklasse 6.82 Wie in den Folgekapiteln noch deutlicher wird, sind Angst und andere Emotionen keine niederen Instinkte, sondern komplexe Zustände, und es ist vor allem ein übersteigertes Ekelempfinden, das für rechtsradikales Denken verantwortlich ist.
Genau genommen spricht jede Partei Ängste an, die sich auf ganz unterschiedliche Bedrohungen beziehen. Die Linke und die SPD treibt die Angst vor dem sozialen Abstieg und der Altersarmut um. Die FDP hat Angst, dass Bürgerrechte und die unternehmerische Freiheit eingeschränkt werden. Die Wähler der Grünen haben Angst, dass die Natur Schaden nimmt, was man schon daran sieht, dass die Grünen immer dann in den Umfragen zulegen, wenn die Umwelt sichtbar in Gefahr ist: nach dem Atomunglück in Fukushima und nach dem langen Sommer 2018, einem der heißesten seit 130 Jahren. Die CDU und ein Teil der CSU setzen bei ihren Wählern auf die Angst vor dem Traditionsverlust und vor der Kriminalität. Die AfD schließlich und der andere Teil der CSU haben im Jahr 2018 die Angst vor Flüchtlingen in das Zentrum ihrer Agenda gerückt.
Ängste sind für sich genommen nichts Verwerfliches, denn sie zeigen erst einmal an, dass wir etwas als bedroht ansehen, das wir wertschätzen. Wir haben Angst vor Krankheit, weil uns an unserer Gesundheit gelegen ist, und Angst um unsere Kinder, weil wir sie lieben. Eine Schutzfunktion der Angst liegt auch darin, dass sie uns vorsichtig macht. In vielen Fällen ist das hilfreich, in manchen hingegen nicht, besonders wenn einige aus ihren ungerechtfertigten Ängsten auch noch die falschen Konsequenzen ziehen.
Rationale und irrationale Ängste
Einer Langzeitstudie zufolge haben die Deutschen am meisten Angst vor Terrorismus.83 Auch wenn viele diese Angst real verspüren, ist sie statistisch nicht gerechtfertigt. Anschläge sind gewiss schrecklich, aber zum Glück auch sehr selten: In den letzten 17 Jahren wurden in Deutschland 14 Menschen durch islamistischen Terror getötet.84 Im selben Zeitraum gab es 6500 andere Morde.85 Außerdem sind knapp 80000 Menschen bei Verkehrsunfällen und über 160000 bei Haushaltsunfällen umgekommen.86 Statt vor Attentätern müssten die Deutschen viel mehr Angst davor haben, über Teppichkanten zu stolpern oder auf glitschigen Badezimmerböden auszurutschen.
Zeigt die Angst vor dem Terrorismus, dass Emotionen grundsätzlich irrational sind? Sicherlich nicht. Es ist beispielsweise durchaus vernünftig, aus einer Angst heraus im Unterholz Schlangen zu meiden. Doch in der modernen Gesellschaft muss man immer die automatische Bewertung einer Emotion mit der Statistik abgleichen. Angst ist dann ein schlechter Ratgeber, wenn wir uns blind auf sie verlassen. So wittern wir Gefahren, bloß weil uns jemand fremd ist, und übersehen gleichzeitig Risiken, wenn das vertraute Umfeld uns Alltäglichkeit suggeriert. Der Denkfehler besteht darin, die subjektive Empfindung von Bedrohlichkeit mit der tatsächlichen Gefährlichkeit, also dem objektiven Risiko gleichzusetzen.87 Weil uns zum Beispiel die Vorstellung eines Terroranschlags stark verängstigt, schließen wir irrtümlich darauf, dass er uns jederzeit treffen kann. Doch die Intensität des Gefühls repräsentiert die Gefahr selten korrekt.
Dieser Fehlschluss zeigt sich auch in anderen Zusammenhängen. Was ist gefährlicher: Mücken oder Haie? Hunde oder Wölfe? Intuitiv antworten wir: Haie und Wölfe. Beide Tiere wirken bedrohlich. Mücken hingegen erscheinen harmlos, und Hunde sind unsere treuen Begleiter. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind jedoch Mücken die gefährlichsten Tiere der Welt, weil sie Malaria übertragen.88 So starben nach Angaben mehrerer Studien im Jahr 2014 etwa 750000 Menschen durch Mücken im Vergleich zu zehn tödlichen Hai-Attacken. Im selben Jahr kosteten tollwütige Hunde 25000 Menschen das Leben, während Wölfe wiederum für nur zehn Todesfälle verantwortlich waren.89
Ein anderes Beispiel: Wer regelmäßig Nachrichten schaut, kann den Eindruck gewinnen, dass die Kriminalitätsrate in Deutschland steigt. Tatsächlich ist sie seit fünfzig Jahren mit kleinen Ausnahmen kontinuierlich gesunken.90 Das aus dem Medienkonsum resultierende Angstgefühl ist irrational, denn es stellt die Welt gefährlicher dar, als sie tatsächlich ist. Die Schwerpunkte in der Berichterstattung führen dazu, dass wir nicht nur den Terrorismus, sondern besonders Naturkatastrophen, Morde und Flugzeugabstürze fürchten. Alles zusammen macht aber weltweit nur etwa 1 Prozent aller Sterbefälle aus.91 Allein Durchfall fordert jedes Jahr mehr Opfer, davon eine halbe Million Kinder unter fünf Jahren.92 Selbst wenn man nur Tod durch Gewalteinwirkung in den Blick nimmt, sind unsere größten Feinde immer noch wir selbst: Selbstmord ist eine häufigere Todesursache als Mord.93
In der modernen Gesellschaft läuft die Angst als archaischer Schutzmechanismus immer wieder ins Leere, denn die Gefahren haben sich so fundamental verändert, dass die Stärke des Gefühls nicht mehr die tatsächliche Bedrohung abbildet. Daher unterschätzen wir oft, was bekannt und harmlos wirkt. Wir denken beispielsweise, der typische Vergewaltiger lauere nachts im Park, obwohl sexuelle Gewalt am häufigsten im Freundes- und Familienkreis auftritt.94
Die Angst kann, wie jede andere Bewertung auch, auf zwei verschiedene Weisen danebenliegen. »Falsche Negative«, wie Statistiker sagen, liegen dann vor, wenn jemand im Angesicht einer Gefahr, etwa einer Giftschlange, keine Angst hat. »Falsche Positive« treten auf, wenn man Angst vor Dingen hat, die ungefährlich sind, wie zum Beispiel Hausspinnen in Deutschland.
Warum gibt es bei Angst so viele falsche Positive? Der Warnmechanismus »Angst« ist offenbar so fein eingestellt, dass er oft Fehlalarm schlägt. Der amerikanische Psychologe David Buss und seine Kollegin Martie G. Haselton erklären das mit ihrer Fehler-Management-Theorie. Evolutionär ist es besser, zu vorsichtig als zu risikofreudig zu sein. Die Unvorsichtigen sind gestorben, bevor sie ihre Gene weitergeben konnten. Die Vorsichtigen sind einfach öfter als nötig weggerannt. Diese vorteilhafte Hypersensibilität findet sich bei fast allen Emotionen.95
Bis zum Aufkommen der evolutionären Psychologie galten Emotionen in der Geistesgeschichte als Störfaktoren, die der Vernunft in die Quere kommen. Selbst Darwin hielt menschliche Emotionen trotz der Parallelen zu anderen Tieren für Rudimente: für Überbleibsel der Evolution wie Körperbehaarung oder den Blinddarm. Inzwischen ist klar, dass Angst und andere Emotionen Warn- und Schutzmechanismen sind, die unsere Umwelt bewerten. In Urzeiten haben sie das Überleben in der Wildnis und der Gruppe sichergestellt.
Die Verbindung zur Moral liegt auf der Hand, denn auch hier geht es darum, nach Prinzipien zu leben, die Schaden verhindern. Worin genau ein Schaden besteht, ist allerdings umstritten, wie die unterschiedlichen politischen Einstellungen und Ängste zeigen.
Kurz gefasst
Angst prägt unsere moralischen und politischen Intuitionen. Viele Untersuchungen zeigen, dass Konservative mehr Angst als Progressive haben und die Welt als bedrohlich wahrnehmen. Allerdings sprechen alle Parteien Ängste an: vor dem sozialen Abstieg, dem Klimawandel, dem Verlust der Freiheit oder vor der Kriminalität. Die Rechtspopulisten schüren die Angst vor den Fremden. Als Warnmechanismus läuft Angst oft ins Leere, weil das subjektive Gefühl von Bedrohlichkeit selten die tatsächliche Gefahr abbildet. Die Angst vor Terror beispielsweise ist irrational, denn es ist mehr als zehntausend Mal wahrscheinlicher, im Straßenverkehr oder bei einem Unfall im Haushalt zu sterben.