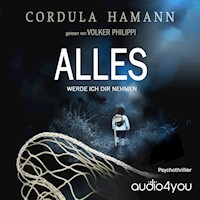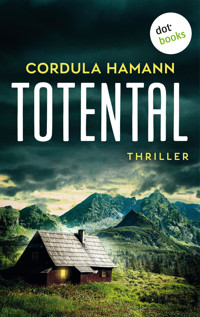5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Ohne ein Wort spurlos verschwunden: Der fesselnde Thriller »Der Untergrund – Im Visier des Sandkartells« von Cordula Hamann als eBook bei dotbooks. Wenn die Öffentlichkeit ahnungslos ist, haben dunkle Kräfte leichtes Spiel … Eine der begehrtesten Ressourcen unserer Zeit geht langsam zur Neige – der unbarmherzige Verteilungskampf kann die Welt gefährlich ins Wanken bringen. Von all dem ahnt Alexandra nichts, als sie ihren Mann zu einem wissenschaftlichen Vortrag begleiten will. Doch plötzlich ist Jürgen verschwunden. Die Polizei glaubt nicht an ein Verbrechen. Alexandra hat keine andere Wahl, als selbst zu ermitteln: Ist ihr Mann überhaupt der, für den sie ihn immer gehalten hat? Oder war er längst viel tiefer in die Machenschaften verstrickt, als sie glauben will? Gefangen in einem Albtraum aus Lügen und Täuschung muss Alexandra alles daran setzen, ihren Mann zu finden – und gerät damit selbst ins Fadenkreuz eines mächtigen Kartells, das kein Erbarmen kennt … Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der fesselnde Thriller »Der Untergrund – Im Visier des Sandkartells« von Cordula Hamann verbindet die politische Brisanz um einen der am härtesten umkämpften Rohstoffe der Welt mit der atemlosen Suche der Protagonistin nach ihrem verschwundenen Mann. Fans von Marc Elsberg und seinen Themen werden begeistert sein. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 394
Ähnliche
Über dieses Buch:
Wenn die Öffentlichkeit ahnungslos ist, haben dunkle Kräfte leichtes Spiel … Eine der begehrtesten Ressourcen unserer Zeit geht langsam zur Neige – der unbarmherzige Verteilungskampf kann die Welt gefährlich ins Wanken bringen. Von all dem ahnt Alexandra nichts, als sie ihren Mann zu einem wissenschaftlichen Vortrag begleiten will. Doch plötzlich ist Jürgen verschwunden. Die Polizei glaubt nicht an ein Verbrechen. Alexandra hat keine andere Wahl, als selbst zu ermitteln: Ist ihr Mann überhaupt der, für den sie ihn immer gehalten hat? Oder war er längst viel tiefer in die Machenschaften verstrickt, als sie glauben will? Gefangen in einem Albtraum aus Lügen und Täuschung muss Alexandra alles daran setzen, ihren Mann zu finden – und gerät damit selbst ins Fadenkreuz eines mächtigen Kartells, das kein Erbarmen kennt …
Über die Autorin:
Cordula Hamann, geboren 1959 in Hannover, arbeitete nach einer juristischen Ausbildung lange als Unternehmerin im Immobilienbereich, bevor sie begann, Thriller zu schreiben. Sie lebt mit ihrer Familie abwechselnd in Berlin und Spanien.
Cordula Hamann veröffentlichte bei dotbooks bereits ihre Thriller »Glasgesichter« und »Wo die Angst lauert«.
Die Autorin im Internet: www.cordulahamann.de
***
Originalausgabe Februar 2019
Copyright © der Originalausgabe 2019 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Redaktion: Ralf Reiter
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Studiosmart und Min C. Chiu
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (aks)
ISBN 978-3-96148-680-9
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Der Untergrund« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Cordula Hamann
Der Untergrund – Im Visier des Sandkartells
Thriller
dotbooks.
»Es gibt kein angenehmeres Geschäft, als dem Leichenbegräbnis eines Feindes zu folgen.«Heinrich Heine
Die folgende Geschichte ist fiktiv und ihre Charaktere sind frei erfunden. Doch alles, was Sie, liebe Leserin, lieber Leser, hier über die Sandproblematik erfahren werden, ist längst globale Realität. Viele wissen es nur noch nicht. Und leider gibt es – anders als in der folgenden Geschichte – auch noch keine Lösung.
Prolog
Philipp stieg aus dem Auto, schulterte den Rucksack und machte sich auf den Weg zu seiner neuen Schule.
»Das wird schon«, rief ihm sein Vater aufmunternd zu, winkte kurz und ging dann mit Lisa an der Hand Richtung Eingang der Meldestelle, um dort Lisas ersten eigenen Kinderausweis abzuholen. Sie waren nun deutsche Staatsbürger, dabei wäre Philipp lieber in Moskau geblieben. Wenn es nach ihm gegangen wäre, bräuchte er auch diese letzte Schulklasse nicht mehr. Viel lieber würde er arbeiten gehen, um eigenes Geld zu verdienen. Schließlich hatte ihm Dimitri Jefimov, der Arbeitgeber seines Vaters, mehrfach angeboten, für ihn zu arbeiten. Und alle in Philipps Moskauer Viertel wussten, dass Jefimov gut zahlte. Warum nur hatte sein Vater diesen sicheren Job aufgegeben und auf eine schnelle Auswanderung nach Deutschland gedrängt? Was sollten sie hier in diesem fremden Land? Philipp sah sich noch einmal zu seinem Vater und seiner Schwester um.
Mindestens zehn weitere Personen warteten auf dem Bürgersteig vor der Meldestelle auf Einlass. Lisa lief ungeduldig um ihren Vater herum, den Kopf in den Nacken gelegt, den Mund ohne Pause in Bewegung. Philipp glaubte, die quengelnden Worte seiner kleinen Schwester trotz der Entfernung zu hören, und musste lächeln. Ja, Lisa konnte ganz schön nervig sein. Sein Vater hob sie etwas an, bis sie ihre Füße auf seine gestellt hatte. Dann stolzierte er auf diese Weise mit ihr ein paar Schritte hin und her. Lisa juchzte so laut, dass Philipp ihre helle Stimme nun tatsächlich hören konnte.
Aus den Augenwinkeln nahm er ein herannahendes Fahrzeug mit verdunkelten Scheiben wahr. Es verlangsamte die Geschwindigkeit, als suche der Fahrer einen geeigneten Parkplatz. Das Fahrzeug wechselte die Straßenseite und fuhr dort im Schritttempo entgegen der Fahrtrichtung an den geparkten Autos entlang. Auf der Fahrerseite öffnete sich die hintere Scheibe einen Spalt, und blitzend reflektierte irgendetwas die Sonnenstrahlen. Dann schloss sich das Fenster wieder, der Wagen kehrte zügig auf die rechte Straßenseite zurück und setzte seine Fahrt mit normaler Geschwindigkeit fort.
Philipp drehte sich um und wollte seinen Schulweg fortsetzen, als er Schreie hörte. Erneut sah er zur Meldestelle. Die Wartenden stoben auseinander. Ein Mann und eine Frau warfen sich auf den Boden, zwei weitere Männer rannten um eine Gebäudeecke davon. Der Rest drängte sich in dem etwas zurückgesetzten Eingangsbereich des Gebäudes an die Mauern. Nur sein Vater bewegte sich nicht. Er stand wie festgewurzelt mitten auf dem Bürgersteig, genau wie zuvor mit Lisa auf seinen Füßen.
Doch dann ging er zu Boden wie eine gelenklose Marionette, der man die Fäden durchgeschnitten hatte. Lisas und seine Hände lösten sich voneinander. Sein Vater fiel vornüber auf den Gehsteig, direkt auf Lisa, und kippte anschließend zur Seite, drehte sich weiter und blieb, die Arme seitlich ausgestreckt, neben seiner Tochter auf dem Rücken liegen.
Philipp begriff nicht, was geschehen war, aber er spürte, dass es alles verändern würde. Dann wurde ihm schlagartig bewusst, was dieses Bild vor ihm bedeutete. Jemand hatte auf seinen Vater geschossen. Er rang nach Luft. »Papa!«, schrie er und rannte los.
Wie aus dem Nichts hatte sich eine Menschenansammlung um die am Boden liegenden Körper gebildet. Philipp drängte sich dazwischen.
»Papa? Lisa?«
Das Gesicht seines Vaters war bleich. Ein dünnes rotes Rinnsal floss aus seinem Mundwinkel. Es bildete den gleichen starken Kontrast zum Gesicht wie das mit Blut eingefasste Loch im weißen Oberhemd. In den geöffneten Augen erkannte Philipp Ungläubigkeit. Er selbst spürte nur noch Angst. Er warf den Rucksack von sich und ließ sich auf die Knie fallen. Vorsichtig berührte er das Gesicht seines Vaters, nahm seine Hand und drückte sie fest. »Papa«, rief er noch einmal, aber er wusste bereits: Sein Vater war tot.
Menschen kamen dichter heran und redeten aufgeregt durcheinander. Philipp sah zu seiner kleinen Schwester. Er musste sich um sie kümmern. Sie durfte ihren Papa so nicht sehen.
»Lisa, Mäuschen, komm, steh auf. Alles wird gut.«
Nichts würde gut werden, aber außer diesem blöden Spruch fiel ihm nichts ein.
Doch seine Schwester rührte sich nicht. Vorsichtig schob er einen Arm unter ihr Genick. In diesem Moment entdeckte er das Blut, das oberhalb der Stirn in ihre dichten Locken sickerte. Erschrocken berührte er die feuchten Haare. Wieso blutete sie an der Stirn, wenn sie doch auf den Hinterkopf gefallen war? Ihr Mund stand leicht offen, und ihr kleines Gesicht war ebenso weiß wie das seines Vaters, dabei wirkte sie trotzig, fast schon empört über denjenigen, der sie so brutal umgeworfen hatte. Philipp hob sie hoch. Leicht wie eine Feder lag ihr Körper in seinen Armen. Blut tropfte aus ihren Locken auf die Gehwegplatten. »Wir fahren jetzt in ein Krankenhaus. Da kriegst du ein riesengroßes buntes Pflaster. Es wird nicht wehtun, hörst du?«
Er fühlte eine Hand auf seiner Schulter. »Junge, die Kleine ist auch tot«, sagte eine dunkle Stimme, die fast wie die seines Vaters klang. Er hob erschrocken den Kopf und blickte in Gesichter, die alle gleich aussahen. Gesichter voller Mitleid und Entsetzen. In der Ferne heulten Sirenen.
»Nein!«, schrie er immer wieder und krümmte sich über den Körper seiner Schwester. Plötzlich sah er das Bild seiner Mutter vor sich, als sie heute Morgen das Frühstücksgeschirr abgeräumt und dabei zur Musik aus der Stereoanlage gesummt hatte, wie sie es immer bei der Hausarbeit tat. Zum Abschied hatte sie ihm aufmunternd zugelächelt. In diesem Augenblick erfreute sie sich wahrscheinlich gerade wieder an der neuen Wohnung, in der jetzt jeder von ihnen ein eigenes Zimmer hatte. Wie sollte Mutter jemals wieder lächeln können? Wie sollte er ihr beibringen, was gerade passiert war? Er blieb auf dem Boden hocken, Lisa im Arm, legte den Kopf in den Nacken und starrte in einen Himmel, der sich gnadenlos blau über Berlin wölbte, als sei das alles gerade nicht geschehen.
Marokko, 18 Jahre später
Philipp sah besorgt zum Himmel. Kräftiger Wind schob eine dicke Wolkenwand vor sich her, die in Kürze über ihnen sein würde. Wenn die Männer nicht bald kämen, fiel das heutige Geschäft buchstäblich ins Wasser. Er richtete den Blick wieder auf das vor ihm liegende Gebirge. In sanften Schwüngen führte ein schmaler Trampelpfad durch die karge Landschaft Nordmarokkos.
Endlich erkannte er sie. Eine lange Schlange aus Mensch und Tier bewegte sich in seine Richtung. Je ein Mann führte einen Esel locker am Seil hinter sich her und trottete dabei ebenso langsam wie sein schwer bepacktes Tier. Links und rechts der kräftigen Eselskörper hingen prall gefüllte Säcke. An besonders schmalen Stellen des Pfades verlangsamten die Führer ihren Gang. Sie drehten sich zu den Tieren um und achteten sorgsam darauf, dass die rauen Felskanten die Säcke nicht aufrissen. Das Ergebnis schwerer Arbeit würde nutzlos auf den Pfad rieseln.
Es grollte bereits am Horizont. Hinter Philipp saßen junge Männer auf der Ladefläche eines Lastwagens, teilweise noch Halbwüchsige. Sie dösten, rauchten oder sprachen leise miteinander. Als die ersten Lastenträger am LKW anlangten, trieb Philipp die Männer zur Eile an. Die Ruhe wich einem lautstarken Stimmengewirr. Philipp sprach zwar etwas Arabisch, doch Einzelheiten verstand er nicht, weil die Männer in ihren Berberdialekten durcheinander riefen. Kräftige Arme lösten die Eselsfracht, und Sack für Sack wurde per Menschenkette weitergereicht und der Inhalt gleichmäßig auf der Ladefläche verteilt. Philipp hatte sich auf einen der Reifen gestellt und hielt sich an der Seitenwand fest. Bei jeder Leerung kontrollierte er den Sand auf größere Teile aus Glas, Metall oder Kunststoff. Hinter ihm standen die Männer und Jungs, die mit den Eseln gekommen waren, fingen die leeren Säcke auf und falteten sie ordentlich zusammen. Einige stritten brüllend mit den Männern oben auf dem Laster, die die wertvollen Transporthüllen angeblich so rücksichtslos leerten, dass sie Risse davontrugen. Für die Säcke mussten die Männer selbst sorgen, ebenso wie für die Tiere. Ihren Ärger verstand Philipp gut. Auch er musste rechnen. Das letzte Mal hatte sein Auftraggeber doch glatt zehn Prozent des vereinbarten Preises abgezogen. »Für Strandgut zahle ich nicht.« Und Philipp hatte geschwiegen, denn es gab zu viele Konkurrenten, die sein Geschäft nur zu gern übernehmen würden. In letzter Zeit lagen sowieso bei allen die Nerven blank. Es gab kein anderes Thema mehr als diese blöde Tagung in Wien. Selbst ein Kartell hatten sie gebildet, die Inder, die Malaien, die Russen und weiß Gott wer noch. Und dieses Kartell vertraute ausgerechnet auf Dimitri Jefimov. Köstlich. Wenn alles gut ginge, würde Philipp morgen in Cádiz endlich die Branche wechseln. Und dann konnten ihm Jefimov und das Sandgeschäft gestohlen bleiben. Er sprang vom Wagen und klopfte sich die staubige Hose sauber.
Eine Stunde später und gerade rechtzeitig vor dem Regen waren alle Männer bezahlt. Der Laster fuhr zurück in die Stadt. Philipp saß auf dem Beifahrersitz und kontrollierte sein Handy. Als sie endlich aus dem Funkloch der einsamen Gebirgsgegend herausfuhren, tippte er Jefimovs Nummer ein.
»Ich habe so schnell keinen Flug mehr bekommen«, sagte er, als sich der Russe meldete. »Aber meine Freunde sind bereits in Berlin und kümmern sich drum. Ich fliege dann nach, Sir.« Philipp hatte zwischen den oberen Schneidezähnen einen breiten Spalt und liebte es, S- und Th-Laute hindurchzujagen, besonders, wenn ihm Jefimov in Spuckweite gegenüberstand. Doch leider weilte der gerade rund 3000 Kilometer entfernt.
»Ich hatte dir aber gesagt, du sollst heute Mittag fliegen. Ihr werdet ein paar Tage brauchen. Du weißt, wie wichtig der Kongress in Wien für uns alle ist. Schließlich verdienst du ebenfalls daran.«
Philipp schwieg.
»Und sag deinen Leuten: Nichts, was uns die Polizei auf den Hals hetzt, verstanden? Lass dir etwas einfallen. Dafür bezahle ich dich.«
»Ich muss Schluss machen.« Ohne eine Reaktion abzuwarten, beendete Philipp das Gespräch. Kurz darauf erreichten sie die Baustelle, wo ein Wagen der Gendarmerie gleichzeitig mit ihnen eintraf. Auch das noch. Ihm blieb heute auch nichts erspart. Bevor er ausstieg, kramte er im Handschuhfach die Papiere für die Sandlieferung hervor. Jeder von ihnen hatte solche offiziellen Papiere von legal angeliefertem Sand. Gegen einen kleinen Aufpreis wechselten sie rasch den Besitzer. Schließlich konnte die Polizei nicht jeden Laster kontrollieren, der Sand anlieferte, und andererseits konnten die Firmen nicht ausschließlich mit illegalen Lieferungen vom Strand bauen. Beton, der allein mit ungewaschenem Sand hergestellt wurde, würde nicht einmal bis zur Endabnahme des Gebäudes halten. Also stellten sie Duplikate der legalen Lieferscheine her, auf denen das Datum allerdings offenblieb. Rasch trug Philipp das aktuelle Datum in den Kopf der Formulare ein und stieg aus. Eigentlich wussten die Polizisten, wie die Sache lief, trotzdem nahmen die Kontrollen in letzter Zeit zu, allerdings in den seltensten Fällen mit Erfolg.
Während einer der Uniformierten den Frachtbrief und Philipps Ausweispapiere in Empfang nahm, prüfte und abfotografierte, löste sein Kollege auf einer Seite des Lastwagens die Plane und musterte argwöhnisch die Ladung. Philipps penible Kontrolle auf verräterisches Strandgut zahlte sich aus. Der Polizist ließ die Plane wieder sinken. Philipps Handy klingelte, und das Display zeigte Jefimovs Nummer. Er drückte das Gespräch weg.
»Merkwürdige Fahrtroute, die ihr vom Hafen hierher gewählt habt. Ich könnte schwören, ihr kamt genau aus der entgegengesetzten Richtung«, sagte der Polizist und reichte die Papiere zurück.
»Gut beobachtet, Herr Kommissar. Ich hatte einen Termin auf der anderen Seite der Stadt. Mein Fahrer war so nett und hat mich dort abgeholt. Ich liefere öfter hier. Sie kennen mich doch.«
»Eben«, entgegnete der Polizist mit düsterem Blick.
Wieder klingelte das Telefon. Philipp ließ es läuten. Die Beamten stiegen in ihr Fahrzeug und rauschten davon. Philipp bezweifelte, dass sie ernsthaft etwas gegen den illegalen Abbau der Strände ausrichten wollten. Wurde jemand auf frischer Tat ertappt, regelte man das Problem mit Geld. Dass ihnen dieser Zusatzverdienst heute entgangen war, war mit Sicherheit der einzige Grund für den Frust der beiden Männer.
Philipp widmete sich dem Vorarbeiter, der das Abladen des Sandes überwachte, und gab ihm die für weitere Lieferungen vom Strand nun wertlosen Frachtpapiere.
»Du musst morgen wiederkommen und dir neue Blankoformulare holen. Im Büro ist jetzt keiner mehr«, sagte der Vorarbeiter. Philipp nickte. Er ging ein paar Schritte beiseite und wählte Jefimovs Nummer.
»Leg nicht noch einmal einfach auf. Nicht bei mir. Verstanden? Wann genau geht dein Flieger?«, fragte Jefimov, und Philipp sah den Russen im Geist vor sich, wie in diesem Moment sein Gesicht eine leichte Rötung annahm und er mit der freien Hand das Oberhemd glattstrich, das seit einigen Jahren etwas lockerer saß, um den Bauch zu überdecken, so wie der Ein-Zentimeter-Haarschnitt den fortschreitenden Haarausfall vertuschen sollte.
»Heute Abend«, log er.
»Gut. Melde dich, sobald du in Berlin bist.«
»Sicher.«
Philipp beendete das Gespräch und schaltete das Telefon auf stumm. Wenn Jefimov dachte, er würde jetzt mit dem Auto nach Marrakesch oder Casablanca fahren, nur um von dort noch einen Flug nach Deutschland zu bekommen, dann hatte er sich geschnitten. Er würde heute Abend wie geplant seinen Termin in Cádiz in Südspanien wahrnehmen und dann morgen Mittag von dort aus nach Berlin fliegen. Trotzdem wählte er die Nummer seines Berliner Kontaktmanns.
»Wie läuft es?«, fragte er.
»Alles klar. Nur eines ...«
»Was?«
»Vielleicht sind’s ja nur Gerüchte. Kennst du einen Laurentzi Garcia Santoz? Soll aus Venezuela kommen. Dimitri Jefimov hat uns das gefragt.«
Philipp überlegte einen Moment. »Noch nie gehört«, antwortete er dann. »Was ist mit diesem Mann?«
»Wie gesagt, merkwürdige Gerüchte. Angeblich ist er ebenfalls an der Sache dran.«
»Hmm. Hört euch weiter um. Ich werde es ebenfalls tun.«
Philipp drückte das Gespräch weg. Wenn die Südamerikaner ihre Hände jetzt ins Sandgeschäft steckten, müsste er das eigentlich wissen. Sie waren seit eh und je im Drogengeschäft unterwegs, aber im illegalen Sandhandel? Aber vielleicht wusste sein neuer Geschäftspartner in Cádiz mehr über diesen möglichen Eindringling aus Venezuela.
Als er wenig später sein Pensionszimmer auf der Rue Vicente erreicht hatte, sah er durch das Fenster. Der Regenhimmel über Tanger legte sich wie ein Schleier auf das sonst so bunte Bild. Sollte er Jefimov nach diesem Laurentzi fragen? Aber Jefimov schon wieder am Telefon zu haben, verursachte ihm beinahe Übelkeit.
Das Telefon klingelte, und das Display zeigte eine spanische Nummer an. Bitte keine Absage aus Cádiz, flehte er in Gedanken.
»Dime«, meldete er sich.
»Guten Abend, Philipp. Hier ist Konstantin Radlof. Weißt du noch, wer ich bin?«
Philipp fiel beinahe das Telefon aus der Hand. Welch eine bescheuerte Frage! Wie könnte er den Mörder seines Vaters und seiner kleinen Schwester vergessen?
»Was wollen Sie?«, fragte er mit heiserer Stimme.
»Dich treffen.«
Er war so perplex, dass er nichts herausbrachte.
»Bitte! Es ist wichtig, und zwar in erster Linie für dich.«
»Ich habe keine Zeit. Ich muss heute noch nach Cádiz.« Philipp biss sich verärgert auf die Unterlippe. Was gingen jemand anderen seine Pläne in Cádiz an? Im Schrecken über den Anruf war es ihm einfach herausgerutscht.
»Woher haben Sie meine Nummer?«, fragte er.
»Welche Fähre nimmst du? Die nach Algeciras oder das Schnellboot nach Tarifa?«
»Das Schnellboot.«
»Welche Uhrzeit?«
»Das geht Sie einen feuchten Kehricht an.«
»Es gehen heute nur noch drei Fähren. Dann fahre ich notfalls immer hin und her. Irgendwann müssen wir uns ja dann treffen. Es ist wirklich wichtig.«
»Das letzte Schiff«, gab Philipp preis und hatte das Gefühl, jemand anderes sprach für ihn.
»Danke. Ich werde auf dem Vorderdeck auf dich warten.«
Philipp wollte etwas erwidern, aber der Anrufer hatte das Gespräch bereits beendet und er selbst fühlte sich wie damals als Jugendlicher im Gerichtssaal: ohnmächtig, wütend und unendlich traurig.
Er trat wieder ans Fenster. Die Menschen liefen dicht gedrängt an den Häusern entlang, viele Frauen hielten mit einer Hand ihr Kopftuch fest, während sich ihre Djellaba im Sturm aufblähte. Radlof musste sich auf der iberischen Halbinsel ganz in der Nähe der Meerenge von Gibraltar aufhalten, sonst könnte er es nicht bis zum Abend schaffen, in Tarifa die Fähre zu besteigen. Was wollte der Mann von ihm? Er hatte lebenslänglich bekommen. Wieso war er überhaupt auf freiem Fuß?
Durch eine Lücke in den dicht gedrängten Häusern konnte Philipp ein kleines Stück vom Hafen erkennen. Wenn das Wetter sich nicht bald beruhigte, würde die Fahrt ziemlich ungemütlich werden, vielleicht sogar ganz ausfallen. Er wusste nicht, ob er sich darüber freuen oder es bedauern sollte. Denn ein winziger Teil in ihm wollte den Mann wiedertreffen, den er als Kind und Jugendlicher gemochte hatte.
Das Leben spielte gerade ebenso verrückt wie das Wetter. Dimitri Jefimov war er in seinem Leben leider nie ganz losgeworden. Bisher. Aber nun kreuzte auch Jefimovs Erzfeind wieder seinen Weg. Das konnte doch kein Zufall sein. Waren die beiden alten Männer an der gleichen Sache dran? Als Konkurrenten? Denn Philipp konnte sich beileibe nicht vorstellen, dass die beiden jetzt wieder Freunde waren.
Der Sturm hatte sich Richtung Kanarische Inseln verzogen, und daher wurde der Fährbetrieb zwischen Tanger und Tarifa nicht eingestellt. Leider, denn so hatte Philipp keinen Grund mehr, die Überfahrt und damit das Treffen mit Radlof zu vermeiden.
Er ging zur vereinbarten Stelle auf das vordere Deck. Nun gut. Jetzt war er da, und der Kerl sollte sich eine überzeugende Geschichte ausdenken, warum er ihn unbedingt treffen sollte. Sein Kopf schmerzte vom Druck der Bilder, die er jahrelang beiseitegeschoben hatte und die jetzt wieder ins Bewusstsein zurückdrängten, ebenso mächtig, wie die Wellen auf den Bug der Fähre trafen.
Jetzt
Vom Flur her ruft Maria, sie möge sich beeilen. Hektisch greift Alexandra zu Stift und Notizblock. Den Aktenordner mit den Unterlagen und Skizzen klemmt sie sich unter den Arm. Sie sieht sich auf ihrem Schreibtisch um. Hat sie etwas vergessen? Wie schon die vergangenen Wochen über fühlt sie sich hin- und hergerissen zwischen der freudigen Hoffnung, dieses Mal vielleicht die Ausschreibung zu gewinnen, und der Befürchtung, das Projekt könne eine Nummer zu groß für ihr Zwei-Personen-Unternehmen sein. Fieberhaft arbeiteten Marie und sie deshalb an den Entwürfen für den Hotelneubau, planten, verwarfen, hatten immer wieder neue Ideen und bestellten schließlich mit Herzklopfen den Kurier, um die finale Version ihrer Bewerbungsunterlagen auf den Weg zu bringen. Was für eine positive Überraschung, als der Bauträger vor wenigen Tagen seinen persönlichen Besuch ankündigte. Maria und sie räumten das Büro auf, putzten das große Schaufenster und gestalteten es anschließend neu, so aufgeregt wie Teenager vor dem ersten Date.
Nun ist der Investor endlich eingetroffen. Alexandra verlässt eilig ihr Büro und läuft zum Besprechungsraum. Als sie eintritt und vor Maria und dem Besucher steht, fällt der Aktenordner unter ihrem Arm zu Boden, denn sie erkennt den älteren Mann, obwohl sie ihn seit fast zwanzig Jahren nicht mehr gesehen hat. Ihr Puls rast, und sprechen kann sie nicht. Also starrt sie ihn nur wortlos an. Was macht Konstantin Radlof hier in diesem Büro? Was macht ihr Vater in ihrem Leben, in ihrer Welt, zu der er seit Langem nicht mehr gehört?
»Alexandra, das ist Herr ... Ach was, ich brauche euch ja nicht vorzustellen.« Maria strahlt sie an und kann doch nicht ganz die Angst in ihrem Gesicht verbergen. In diesem Moment hasst Alexandra ihre Freundin. Sie hat also gewusst, wer der potenzielle Auftraggeber ist. Alexandra dreht sich abrupt um und rennt förmlich zurück in ihr eigenes Büro. Hinter sich hört sie Marias Schritte, und nur Sekunden später stehen sie sich gegenüber. Keine Spur mehr von Angst in Marias Gesicht.
»Wie konntest du? Wieso hast du mir nicht gesagt, wer er ist?«, fährt Alexandra sie wütend an.
»Vielleicht wird es Zeit, dich deiner Vergangenheit zu stellen, damit wir arbeiten und Geld verdienen können«, antwortet Maria. »Also, komm gefälligst wieder mit.«
»Ich verzichte auf den Auftrag.«
»Es ist unser Büro. Unser Auftrag.«
»Du schaukelst das hier schon allein«, antwortet Alexandra und setzt sich demonstrativ an ihren Schreibtisch. Sie öffnet den Laptop und starrt auf den Monitor, bis Maria endlich den Raum verlässt und lautstark die Tür hinter sich zuzieht.
»Herr Radlof, bitte warten Sie«, hört Alexandra ihre Partnerin kurze Zeit später rufen. Stille. Dann Marias Absätze im Flur und das Klappen der Bürotür nebenan.
Alexandra schaut aus dem Fenster auf die große Kastanie im Innenhof. Sie kann jetzt nicht mit Maria über ihren Vater sprechen. Zu tief sitzen Schrecken und Wut. Warum hat sie jede seiner Kontaktbemühung im Keim erstickt, wenn er sich jetzt quasi durch die Hintertür einer geschäftlichen Verbindung Eintritt in ihr Leben verschafft? Und Maria hilft ihm auch noch dabei.
Brauche dringend Urlaub, schreibt sie auf einen Zettel, den sie nachher auf den Tisch im Eingang legen wird. Dann öffnet sie im Internet die Seite eines Hotelbuchungsportals und gibt Prag als gewünschten Ort ein. Sie klickt sich durch einige Angebote und bucht das teuerste. Ein gediegenes Hotel aus der Gründerzeit im Herzen der schönen Stadt. Leise schleicht sie den Flur entlang und verlässt das Büro.
Der Fahrstuhl scheint erst nach einer Ewigkeit zu halten. Der Schlüssel dreht sich viel zu langsam im Schloss, und die schwere Wohnungstür klemmt. Endlich steht Alexandra im Flur, wirft ihre Aktentasche auf den Boden und öffnet die Tür zum Arbeitszimmer. Wie fast immer um diese Zeit sitzt Jürgen dort am Schreibtisch, die hohe Stirn seitlich mit der Hand abgestützt.
»Hallo, mein Schatz«, ruft sie und stürmt zu ihm.
»Hi, Liebling.« Er legt für einen Augenblick den Kugelschreiber zur Seite, wirkt aber abwesend und konzentriert sich sofort wieder auf seine Arbeit. Alexandra tritt neben ihn, küsst ihn auf die Stirn und bleibt dicht an ihn gedrängt stehen. Sie hat sich im Laufe der Jahre an seine mangelnde Aufmerksamkeit gewöhnt, sobald er sich in diesem Zimmer aufhält. Er ist ein Meister im Konzentrieren und ein blutiger Anfänger im Multitasking.
»Worüber brütest du?«, fragt sie mit Blick auf die handbeschriebenen Blätter auf der Schreibtischplatte, obwohl sie ihm viel lieber ihre Überraschung verkünden würde.
»Ach, nichts Wichtiges.« Er schiebt die Blätter übereinander und legt seinen Timer auf den Stapel.
Sie schluckt ihren Ärger über diese ungewohnte Geheimniskrämerei hinunter und fragt: »Musst du die nächsten Tage unbedingt ins Institut?« Sie hält den Atem an.
Er schüttelt den Kopf. »Nein. Warum?«
Sein verständnisloser Blick gefällt ihr. Sie kostet seine ungeteilte Aufmerksamkeit aus, dann unterbreitet sie ihm, was sie sich auf der Herfahrt schon in den schönsten Farben ausgemalt hat: »Ich finde, es wird Zeit für einen Kurzurlaub. Wir fliegen nicht erst am Freitag zu deiner Tagung nach Wien, sondern fahren schon zwei Tage früher mit dem Auto, und zwar über Prag. Dort bleiben wir einen Tag und schauen uns die Stadt an.«
Sie beobachtet sein kluges Gesicht. Er scheint nachzudenken, und ihre Vorfreude fliegt davon. »Du findest die Idee doof?«
Endlich lächelt er. »Ein wenig plötzlich, aber ich find’s super. Hast du bereits ein Hotel gebucht? Sonst könnten wir es nachher gemeinsam aussuchen.«
»Alles schon erledigt. Ich habe ein herrlich altmodisches Hotel gefunden. Mit exzellenten Empfehlungen und einer traumhaften Juniorsuite, einem Wellnessbereich mit Sauna und kleinem Schwimmbad. Ich habe uns sogar schon einen Massagetermin reservieren lassen«, kommt sie ins Schwärmen.
Jürgen steht auf und umarmt sie und sie küsst ihn erfreut auf den Mund. Erst in der Küche, als sie das Abendessen vorbereitet, fällt ihr seine zögerliche Zustimmung wieder ein. Es ist noch immer schwer, seine Reaktionen einzuordnen. Dabei haben sie schon vor drei Jahren geheiratet, nur ein halbes Jahr nach ihrem ersten Treffen. Jürgen hatte sie auf einer Gefühlsebene berührt, die sie zuvor nicht kannte. Die vorherige Beziehung zu ihrem Studienkollegen Jan ist einfach gewesen, berechenbar. Und langweilig. Aber mit Jürgen kann sie streiten und sich versöhnen, mit Worten und im Sport gegeneinander kämpfen oder gemeinsam siegen, Lachflashs haben. Jürgens Liebe kann sie wie in einem offenen Buch lesen, einem Buch, bei dem allerdings zwischendrin immer wieder einige Seiten miteinander verklebt scheinen.
Sie hat mir keine Luft zum Atmen gelassen. Dieser Satz über seine Ex-Freundin hängt in ihrem Kopf wie die Warnung ihrer Mutter vor fast dreißig Jahren, bloß nicht auf die heiße Herdplatte zu fassen. Seine Nähe fehlt ihr manchmal, oft, eigentlich immer, aber sie wird den Teufel tun und den gleichen Fehler machen wie seine Ex. Schließlich gibt es auch in ihrem Leben einige verklebte Seiten, die Jürgen auszuhalten hat.
Als sie die Spaghetti in ein Sieb gießt, hört sie ihn in die Küche eintreten. Plötzlich schlingt er die Arme von hinten um sie und gibt ihr einen Kuss auf die Wange. Gemeinsam mit dem Dampf der Nudeln lösen sich ihre Zweifel in Luft auf.
Nach dem Abendessen am großen Küchentisch gießt Jürgen zwei Gläser Rotwein ein.
»Nimm mein Glas mit rüber«, bittet sie und zeigt in Richtung Wohnraum. »Ich werde noch eine Waschmaschine anstellen.«
»Wie lief deine Besprechung mit Maria und dem Investor für das Hotelprojekt?«, fragt er unvermittelt, obwohl sie schon beinahe aus der Tür heraus ist. Abrupt bleibt sie stehen und wendet sich ihm wieder zu.
»Der Investor ist mein Vater«, antwortet sie.
Er schluckt hörbar. »Wusste das Maria?«
Alexandra nickt.
»Warum hat sie dich nicht informiert? Du hättest dich darauf vorbereiten können.«
»Angeblich aus Angst, dass ich an der Besprechung nicht teilnehme, wenn ich es vorher gewusst hätte. Als ich ihn erkannte, habe ich sofort das Büro verlassen.«
Er schweigt, und sie will sich schon wieder zum Gehen wenden.
»Ist das nicht ein wenig unprofessionell?«, fragt er dann, aber sein Ton ist sanft.
Sie hält seinem prüfenden Blick nicht stand und zuckt mit den Schultern. Natürlich ist es unprofessionell, die lukrative Zusammenarbeit mit einer Bauträgerfirma zu verweigern, nur weil der Geschäftsführer dieser Firma Konstantin Radlof ist. Aber das wird sie Jürgen gegenüber keinesfalls zugeben. Er meint es gut, aber er hat keine Ahnung, wie schlimm die Sache mit ihrem Vater für sie ist.
»Ich finde, Maria könnte Rücksicht nehmen«, erwidert sie.
»Es ist fast zwanzig Jahre her.«
»Ach, und in zwanzig Jahren wird aus Unrecht langsam Recht, meinst du?« Ihre Stimme ist lauter als beabsichtigt.
»Natürlich nicht. Ich vermute nur, dass du es als Kind anders wahrgenommen hast, als du die Situation heute beurteilen würdest.«
»Mag sein. Ich muss mich jetzt um die Wäsche kümmern.« Sie steht auf.
»Ich freue mich auf unseren Kurzurlaub«, ruft er ihr hinterher, als sie das Zimmer verlässt.
Sie antwortet nicht.
Für ihre freien Tage muss sie vorarbeiten. Sie tut es von zu Hause aus, um Maria nicht über den Weg zu laufen. Das Thema Vater muss also bis zu ihrer Rückkehr warten, denn unter keinen Umständen will sie auf die Reise mit Jürgen nach Prag und Wien verzichten. Und er ist so einfühlsam, das heikle Thema in den kommenden Tagen nicht mehr anzusprechen. Allerdings kommt er auf die idiotische Idee, sie solle sich während seiner tagungsbedingten Abwesenheit die Stadt ansehen. Was soll sie ohne ihn durch eine fremde Stadt bummeln? Kurzerhand verlängert sie ihren Aufenthalt im Hotel, um am Tag nach der Tagung gemeinsam mit Jürgen durch die wunderschöne österreichische Hauptstadt schlendern zu können. Überraschenderweise ist es ihm auch gelungen, sie noch kurzfristig als Gast der Veranstaltung anzumelden, zu der ansonsten nur ausgewählte Personen zugelassen sind. Über ihre Vorfreude fällt es ihr leicht, alle Gedanken an Maria, ihren Vater und die Arbeit beiseitezuschieben. Gemeinsame Freizeit! Etwas, das in den drei Jahren ihrer Ehe eindeutig zu kurz kam.
Als sie am Mittwochmorgen endlich losfahren, betrachtet sie Jürgen liebevoll von der Seite. Irgendwie passt der Wagen zu ihm. Der Jaguar ist ein Youngtimer aus dem Baujahr 1994. Längst nicht mehr so viel wert, wie es noch immer den Anschein hat, weil Jürgen ihn entsprechend hegt und pflegt. Elegant, gediegen, nicht rasant, aber dennoch so viel PS unter der Haube, dass er es mit fast allen anderen Limousinen aufnehmen kann. Ja, er passt zu ihm. Wieder einmal fühlt sie eine tiefe Dankbarkeit, dass er sie so sein lässt, wie sie ist. Auch mit ihren Unzulänglichkeiten. Auch mit dem Konflikt mit ihrem Vater.
Als sie aus dem Berliner Stadtgebiet heraus sind, verstellt Alexandra die Rückenlehne ihres Sitzes weiter nach hinten. »Willst du mir deine Rede vortragen?«, fragt sie.
»Schlaf doch lieber ein bisschen.«
»Es wäre ein guter Test. Wenn ich dabei einschlafe, müsstest du sie dringend verbessern.« Sie lacht und streichelt über seine Halbglatze. Dann dreht sie sich zur Rückbank und greift nach den Unterlagen, die Jürgen dort abgelegt hat. Eine rote Mappe mit dem Entwurf seiner Laudatio auf den Wissenschaftler Prof. Dr. Walter Dörfler, der Hauptgrund für die Einladung zur Veranstaltung in Wien.
Alexandra öffnet die Mappe, und ein gefütterter Briefumschlag fällt ihr entgegen. Er ist verschlossen. Eine Plastikhülle klebt auf ihm, in der ein Frachtbrief von UPS steckt.
»Bitte leg den Umschlag wieder nach hinten«, fordert Jürgen sie auf, als sie die Eintragungen auf dem Formular eingehender studieren will. Sie sieht überrascht auf. Nicht seine ungewohnt schroffe Stimmlage erschreckt sie, sondern sein Gesichtsausdruck. Sein Blick hetzt zwischen Kontrolle des Verkehrs und dem Umschlag hin und her, als läge gerade eine Handgranate auf ihrem Schoß und ihre Finger spielten am Sicherungsstift.
»Was ist mit dem ...«
»Bitte! Leg ihn zurück«, unterbricht Jürgen sie, löst eine Hand vom Lenkrad und will nach dem Umschlag greifen.
»Schon gut, schon gut.« Sie deponiert den Brief wieder auf der Rückbank. »Schon komisch, dass du solche Geheimnisse vor mir hast. Aber deine Rede darf ich aufschlagen, ja?«, fragt sie schnippisch.
Jürgen scheint erleichtert. »Es tut mir leid, mein Schatz. Ich erkläre es dir später. Versprochen! Hat nichts mit dir zu tun. Wirklich nicht«, beteuert er.
Sie zuckt mit den Schultern und schweigt.
»Na gut. Mal sehen, ob ich die Laudatio ohne Spickzettel hinbekomme«, fährt Jürgen mit betont munterer Stimme fort.
»Meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich habe die große Ehre und Freude, Ihnen heute das Lebenswerk eines Mannes vorzustellen, dessen Forschung globale Auswirkungen haben wird. Ausnahmsweise einmal positive Auswirkungen.« Jürgen atmet tief ein und betont das nächste Wort bedeutungsvoll: »Sand. Es handelt sich hier um einen wenig beachteten Rohstoff. Dabei ist er allgegenwärtig, in unserer Wirtschaft ebenso wie in unserem Alltag. Nur wissen es die wenigsten Menschen. Das Siliziumdioxid im quarzhaltigen Sand findet sich in Wein, in Wasch- und Reinigungsmitteln, Kosmetik, Papier, in unseren Computern und Mobiltelefonen, in den Mikroprozessoren der Geldautomaten, der Chips und Kreditkarten. Sand ist der elementare Stoff unserer modernen Gesellschaft ...«
Alexandra schreckt hoch. Sofort bekommt sie ein schlechtes Gewissen, eingeschlafen zu sein. Doch Jürgen lacht nur.
»Okay, ich hab’s verstanden. Ich werde meinen Text überarbeiten.«
»Ich arbeite nur zu viel«, antwortet sie. »Wie lange habe ich geschlafen?«
»Eine Stunde. Wir sind schon in Tschechien«, antwortet er und scheucht mit einem liebevollen Schmunzeln ihr schlechtes Gewissen fort.
»Könnten wir an der nächsten Raststätte anhalten? Ich muss mal. Und ein Kaffee wäre auch nicht schlecht. Wollen wir wechseln?«
Er schüttelt den Kopf. »Das lohnt nicht mehr.«
Sie halten Ausschau nach einem Hinweisschild. Zehn Minuten später fahren sie auf den Parkplatz einer Raststätte. In der Nähe des Eingangs zum Restaurantgebäude findet Jürgen einen freien Platz. Wenige Meter von ihnen entfernt öffnet ein Bus seine Türen. Die Reisenden strömen heraus und laufen mit steifen Schritten in Richtung Gebäude.
»Ach du meine Güte. Egal, ich muss so nötig.« Alexandra kramt in der Mittelkonsole nach Kleingeld, reißt die Tür auf und rennt los. Im Gebäude folgt sie den Hinweisschildern die Treppe hinunter, wirft die Münzen in den Automaten und erreicht erleichtert die leeren Toilettenräume.
Als sie anschließend in den Waschraum tritt, ist er bereits gefüllt wie eine Bahnhofshalle zu Stoßzeiten. Mehrfach muss Alexandra Menschen zur Seite bitten, bevor sie wieder an den Ausgang gelangt. Drei Männer kämpfen sich gegen den Strom der Reisenden, die wieder nach oben steigen. Doch in ihren dunklen Hosen und weißen Hemden passen sie nicht zu den übrigen Reisenden in bunter Freizeitkleidung. Als Alexandra mit einem dieser Männer auf einer Stufe zusammentrifft, berührt seine Hand ihren Ellenbogen.
»So eng ist es nun wirklich nicht«, fährt sie ihn ärgerlich an.
Am obersten Treppenabsatz teilt sich die Menge. Einige Reisende gesellen sich zu den vor der Eingangstür stehenden Rauchern, während sich die übrigen nach links zum Selbstbedienungsrestaurant wenden. Alexandra folgt ihnen, denn durch die geöffnete Glastür zum Restaurant dringen Essensgerüche in ihre Nase und machen Appetit auf eine Bratwurst. Sie kramt in den Hosentaschen und hat Glück. Neben ihrem Handy findet sie einen Zwanzigeuroschein, den sie versehentlich mitgewaschen hat. Sie steht schon beinahe in der Schlange, als sie plötzlich unsicher wird, ob Jürgen ihre Lust auf eine zünftige Bratwurst überhaupt teilt. Sie verlässt das Restaurant wieder und läuft in Richtung Auto.
Etwas abseits der Hektik sitzt ein Ehepaar mit zwei Kindern auf einer der hölzernen Sitzgruppen. Sie essen mitgebrachte Brote, die den Kindern sogar zu schmecken scheinen. Ein Happy Meal längst vergangener Zeiten. Ein Mann spaziert mit seinem Hund am Zaun der Raststätte entlang, auf der Suche nach einem geeigneten grünen Fleckchen, und auf einer Bank im Schatten genießt ein altes Paar ein Sahneeis. Alexandras Gedanken kehren ganz kurz zurück nach Berlin. Wie schön, heute einmal nicht Teil der üblichen Hektik zu sein. Sie lächelt dem Paar auf der Bank zu und erreicht, nun vollends in Urlaubsstimmung, die Stelle, an der Jürgen das Auto geparkt hat und an der jetzt ein anderes Fahrzeug steht. Suchend blickt sie sich um, entdeckt aber nirgends den Jaguar. Vielleicht ist Jürgen bereits vorgefahren und sie hat ihn übersehen? Sie dreht sich in Richtung Gebäudeeingang, aber dort wartet kein Fahrzeug. Die Tankstelle fällt ihr ein. Sicher wollte er die Zeit nutzen und ist die paar Meter dorthin zurückgefahren. Gut, dass nicht auch noch ihr Handy im Wagen liegt. Sie zieht es aus der Hosentasche, und während sie in Richtung Tankstelle läuft, drückt sie Jürgens Nummer. Sofort springt die Mailbox an. Ist der Akku seines Handys leer? Er hat doch ein Ladekabel für den Zigarettenanzünder dabei.
Als sie das Gelände der Tankstelle erreicht, steht der Jaguar an keiner der Zapfsäulen. Trotzdem betritt sie den Kassen- und Verkaufsraum. Doch auch hier ist Jürgen nicht. In ihrer Brust wird es eng, und ihr Pulsschlag erhöht sich rasant. Während sie zur Gaststätte zurückrennt, versucht sie, sich selbst zu beruhigen. Es muss eine einfache Erklärung geben. Ein Versehen, vielleicht eine bisher nicht entdeckte Ecke hinter dem Gebäude, wo Jürgen Schatten gesucht hat? Sie verlangsamt ihre Schritte und drückt erneut seine Nummer. Sie lächelt, denn gleich wird er sich über sie amüsieren und ihr klarmachen, dass auch Männer mal müssen oder sich einfach nur die Beine vertreten. Irgendwo dort am Zaun, hinter dem sich die Felder bis zum Horizont ziehen. Genauso wie schon einmal, als sie sich bei einem Konzert verloren haben. Dabei stand nur eine große Säule im Weg, und beide liefen suchend um sie herum, jeweils verdeckt für den anderen. Sie haben Tränen gelacht. Wieder sucht sie mit ihrem Blick das Gelände ab, während sie das Telefon am Ohr hält und das Freizeichen hört. Also ist der Akku doch nicht leer. Aber warum meldet er sich dann nicht? Stattdessen knackt es, und anschließend tönt ihr erneut die Mailboxansage mit Jürgens vertrauter Stimme ins Ohr. Alexandra drückt die Verbindung weg, bleibt stehen und schüttelt den Kopf. So, als könne sie ihre Gedanken damit zwingen, sich zu einer neuen Ordnung zusammenzusetzen. Irgendetwas hat sie übersehen, irgendetwas nicht geschlussfolgert, was doch klar auf der Hand liegt. Nur was ist das? Erneut betätigt sie die Wahlwiederholung, und dieses Mal spricht sie auf den Anrufbeantworter. »Jürgen, Liebling. Wo um Himmels willen bist du? So verpeilt, weiterzufahren und nicht zu merken, dass deine Frau nicht im Auto ist, kannst nicht einmal du sein.« Sie lacht. »Also, nimm die nächste Ausfahrt und kehr um.« Sie macht eine Pause. »Und geh an dein verdammtes Handy.«
Sich über ihn zu ärgern, tut gut und verdrängt die Beklemmung in ihrem Herzen. Zurück im Restaurant, bestellt sie an der Theke eine Rostbratwurst und eine Portion Kartoffelsalat. Wenn Jürgen schon so verwirrt ist und ohne sie losfährt, warum soll sie dann nicht wenigstens die Zeit nutzen, um etwas zu essen? Am Tisch drückt sie erneut die Anruftaste des Handys.
»Jürgen Weber.« Sie braucht einen Moment, um zu erfassen, dass es zwar der gleiche mechanische Klang ist wie zuvor, nicht aber seine Mailbox.
»Verdammt. Wo bist du? Was ist los? Wieso bist du weggefahren? Ich suche dich überall.« Erleichterung lässt sie auflachen. Aber nur kurz, bis Jürgen antwortet.
»Wer sind Sie, und was wollen Sie von mir? Ich kenne Sie nicht. Bitte lassen Sie mich in Ruhe.« Ein Knacken, ein leises Rauschen in der Leitung, und Alexandras Gabel mit dem aufgespießten Bratwurstbissen sinkt langsam zurück auf den Teller. Aus dem Spiegel an der gegenüberliegenden Wand starrt sie ihr fassungsloses Gesicht an. Sie fährt sich durch den kurzen Haarschopf. Dann kontrolliert sie die Anrufliste in der wahnwitzigen Hoffnung, sie könnte sich verwählt, oder besser verdrückt, haben. Aber ein heutiges Smartphone ist unbestechlich. Es zeigt nicht den Namen Jürgen für eine andere, eine fremde Nummer.
Es dauert, bis sie sich so weit gefasst hat und in der Lage ist, Jürgen erneut anzurufen, doch sie hört eindeutig, dass er ihren Anruf wegdrückt. Sie schiebt das Tablett vor sich zur Seite, stützt die Arme auf der Tischplatte ab und legt den Kopf in beide Hände. Es gibt keine Erklärung. Nein, das stimmt nicht. Sie muss sich nur anstrengen, sie zu finden. Was auch immer mit Jürgen passiert sein mochte, er muss einen schwerwiegenden Grund haben, so zu reagieren, einen, der von außen auf ihn einwirkt. Von sich aus würde er sich jedenfalls niemals so verhalten. Vielleicht ist er gefallen, hat sich den Kopf verletzt und leidet jetzt unter einer Amnesie? Oder er hat etwas Schreckliches gesehen und steht unter Schock, in dessen Folge er kopflos losgefahren ist. So oder so, Jürgen braucht Hilfe. Ohne länger zu zögern, steht sie auf.
»Entschuldigung. Wie ist die Notrufnummer der Polizei? 110?«, fragt sie auf Englisch die Bedienung der Bratwursttheke.
»Sind Sie bestohlen worden? Soll ich für Sie anrufen?«, antwortet die junge Frau auf Deutsch.
Alexandra schüttelt den Kopf.
»Die Polizei hat die 158. Aber besser, Sie rufen die internationale Notrufnummer 112. Da sprechen sie auch Deutsch und Englisch.«
Obwohl inzwischen zwei Kunden neben ihr warten, hält die Bedienung in ihrer Arbeit inne, bis Alexandra die angegebene Nummer gewählt hat und sich umdreht, um in Richtung Ausgang zu gehen.
»My husband was kidnapped«, ruft sie aufgeregt, als sich am Ende der Leitung jemand auf Tschechisch meldet. »Mein Mann wurde entführt«, fügt sie auf Deutsch hinzu. Einige Reisende, die ihr entgegenkommen, bleiben stehen und sehen sie mit einer Mischung aus Schrecken und Neugierde an. Sie dämpft ihre Stimme und beantwortet dem deutschsprachigen Beamten, zu dem sie sofort weitergestellt worden ist, seine Fragen nach ihrer Person und ihrem Standort.
Sie setzt sich auf eine niedrige Mauer in den Schatten und versucht, sich an jedes Wort zwischen Jürgen und ihr seit der Abfahrt in Berlin zu erinnern. Warum hat sie wegen des ominösen Umschlags auf dem Rücksitz auch so unwirsch reagiert? Was verbirgt Jürgen vor ihr?
Sie friert, aber die blendende Sonne erträgt sie nicht. Wie mechanisch drückt ihr Finger die Wahlwiederholung für Jürgens Nummer, und die Ansage, der Angerufene sei momentan nicht erreichbar, betäubt sie.
Endlich kommen zwei Beamte in grauschwarzen Uniformen auf sie zu und fragen in gebrochenem Englisch, ob sie die Deutsche sei, die angerufen hat. Alexandra steht auf, schließt für einen kurzen Moment die Augen, um Kraft und Konzentration zu sammeln.
Die Beamten stellen eine Menge Fragen über Jürgen, dann zu ihr, zum Grund ihrer Reise, zu ihren Berufen und zu ihren persönlichen Daten. Alexandra beantwortet sie ungeduldig, bis sie endlich berichten darf, was geschehen ist. Auch wenn die Beamten einen gelangweilten Eindruck machen, sie können ihrer Erzählung offenbar folgen. Aber als ihr Bericht an den entscheidenden Punkt kommt – ihre Rückkehr zu einem Auto, das nicht mehr da ist, zu einem Ehemann, der am Telefon so tut, als kenne er sie nicht –, ändert sich schlagartig der Gesichtsausdruck der beiden Polizisten, so als würden sie lieber einen Verkehrsunfall oder den Diebstahl einer Handtasche aufnehmen, als sich mit einer Ausländerin herumzuplagen, die ganz offenbar von ihrem Ehemann verlassen wurde.
Dass die Beamten von einem freiwilligen Verschwinden Jürgens ausgehen, formulieren sie dann auch in leisen und bedächtigen Worten und stellen erneut viele Fragen. Zur Dauer und Qualität ihrer Ehe. Ob ihr Ehemann möglicherweise eine Geliebte habe. Mit ihren zugleich mitleidigen und forschenden Blicken scheinen sie einen Makel in Alexandras Aussehen oder Auftreten zu suchen, der ein so schmähliches Verhalten eines Ehemanns rechtfertigen könnte.
»Sie vermuten, mein Mann hat mich verlassen?« Ihre Stimme klingt fremd und viel zu sachlich. »Es mag sein, dass das alles für Sie merkwürdig klingt, aber stellen Sie sich doch bitte einmal vor, Sie irren sich und mein Mann hat nicht freiwillig gehandelt. Dann müssen Sie mir recht geben, dass er sich in Gefahr befindet. Ich verlange von Ihnen, dass Sie ...«
»Und Sie haben gar nichts bei sich, was Sie in irgendeiner Art ausweisen könnte?«, unterbricht sie der Polizist.
»Nur mein Handy. Bitte sehr.« Sie streckt es ihm entgegen. »Sie können ja reinschauen in die Kontakte. Oder rufen Sie jemanden aus meinen Kontakten an, der Ihnen bestätigt, dass er mich kennt. Oder prüfen Sie den Vertrag. Rufen Sie meinen Anbieter an. Ich kann Ihnen das Passwort nennen.«
Keiner der Beamten nimmt das angebotene Gerät entgegen. »Das ist alles kein wirklicher Beweis. Sie können das Handy gestohlen haben oder es gehört einer Freundin. Eine Vertragsüberprüfung können wir in der Eile nicht durchführen. Außerdem haben wir hierfür keine Handhabe, weil es bisher keinen Anhaltspunkt für ein Verbrechen gibt.«
Es ist schwierig, sich zu beherrschen und nicht loszuschreien. Kein Verbrechen? Alexandra drückt erneut die Taste der Wahlwiederholung. Ein Freizeichen, dann ein Knacken und die Mailbox springt an. »Rufen Sie bitte von Ihren Handys meinen Mann an, meine Anrufe darf er offenbar nicht entgegennehmen. Versuchen Sie es wenigstens.«
Die Polizisten sehen sich erst ratlos an, drehen sich dann zur Seite und beratschlagen sich auf Tschechisch. Alexandra würde die beiden am liebsten an den Armen packen und schütteln. Sie ist kurz davor, vor Wut loszuheulen. Ihre Augen brennen bereits. Bloß das nicht, dann glauben die Beamten endgültig das Märchen einer verlassenen Ehefrau. Ein paarmal atmet sie betont langsam. Das hilft. Was würde sie denn glauben, wenn sie an der Stelle der Beamten wäre? Wahrscheinlich Ähnliches.
»Ich bezahle auch die Gebühren. Vielleicht geht mein Mann dann ans Telefon.«
»Genau das werden wir tun«, antwortet der Ältere der Beamten, während sich der Jüngere telefonierend von ihnen entfernt. »Aber wir werden einen Kollegen bitten. Seine Mutter ist Österreicherin, und er spricht fließend Ihre Sprache. Vielleicht kann er – wie sagt man? – zwischen den Zeilen hören, ob Ihr Mann unter Zwang handelt. Bitte warten Sie.«
Alexandra nickt und zieht sich wieder auf die kleine Steinmauer zurück. Unter Zwang. Wie ein Stich in den Kopf fühlt sich dieses Wort an. Wie würde ein solcher Zwang aussehen? Bilder von Pistolen, Baseballschlägern, Giftspritzen und Elektroschockern drängeln sich in ihren Kopf. Sie beginnt zu zittern. Reiß dich zusammen. Jetzt, da die Polizisten endlich eine Entführung in Erwägung ziehen. Denk nach. Aber in ihrem Privatleben gibt es nichts, was eine Entführung plausibel macht. Andererseits muss es etwas geben, denn niemals würde Jürgen sie verlassen, und schon gar nicht auf diese Art und Weise. Undenkbar. Sie sollte am besten sofort in seinem Institut anrufen. Beim Blick aufs Handy stellt sie mit Schrecken fest, dass es bereits vierzehn Uhr ist. Ab dieser Zeit ist im Institut telefonisch niemand mehr erreichbar, und die Privat- oder Durchwahlnummern von Jürgens Kollegen kennt sie nicht. Warum auch? Er geht seiner Geologenarbeit nach, schreibt Bodengutachten und arbeitet Hand in Hand mit den geologischen Landesämtern der gesamten Republik. Außerdem ist er Mitglied eines Forschungsteams, das sich mit der Verwüstung der Erde, deren Ursache und der Möglichkeiten zur Vermeidung beschäftigt. In diesem Zusammenhang reist er hin und wieder durch die Welt. Doch im Großen und Ganzen stellt seine Tätigkeit eine eher trockene wissenschaftliche Arbeit dar, keinesfalls spektakulär zu nennen. Die Zeiten, in denen er selbst ständig im Gelände unterwegs war, liegen nach seinen eigenen Aussagen ewig zurück, als er noch jung und dynamisch war.
In der Hoffnung, ein Kollege nimmt das Gespräch an, tippt sie Jürgens Büronummer ein. Sie lässt es mindestens zehnmal klingeln, bevor sie auflegt, weil der angekündigte deutschsprachige Polizist eintrifft. Er lässt sich durch seine Kollegen informieren, die beim Sprechen wild gestikulieren. Wenigstens ihre Teilnahmslosigkeit haben die beiden verloren. Dann kommt der neu eingetroffene Polizist auf sie zu, mit einem Lächeln, das Zuversicht ausstrahlt.
»Guten Tag. Mein Name ist Branko Malik. Geben Sie mir bitte die Nummer Ihres Ehemanns.«
Alexandra diktiert die Zahlen, die Malik in sein Handy eintippt. Sie hält die Luft an und stößt sie heftig aus, als der Beamte zu sprechen beginnt. Jürgen hat das Gespräch angenommen. Ihr Herz rast. Sie gestikuliert, der Polizist möge doch den Lautsprecher anmachen. Sie stellt sich so dicht an ihn, dass sich ihre Arme berühren. Doch er dreht sich um und läuft ein paar Schritte auf und ab, während er in sachlichem und ruhigem Ton dem Angerufenen erklärt, wer er ist und was er sich von dem Anruf verspricht. Alexandra bleibt ihm dicht auf den Fersen.
»Ich verstehe. Ihre Ehefrau sitzt in diesem Moment neben Ihnen.«
Ein Gefühl völliger Hilflosigkeit lähmt Alexandras Schritte. Sie bleibt stehen.