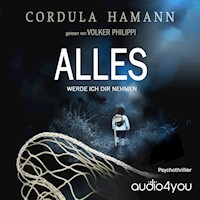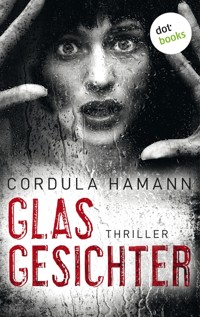3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: MIRA Taschenbuch
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kurz nach dem Tod ihrer Mutter erhält Daniela ein unerwartetes Schreiben: Ein Mann aus den USA hat ihr eine große Erbschaft hinterlassen. Daniela kann sich nicht daran erinnern, dass ihr Mutter den Erblasser, Jayden Hanson, je erwähnt hätte, und auch ihre mittlerweile demente Großmutter ist keine große Hilfe auf der Suche nach Antworten. Um herauszufinden, was sie mit Jayden Hanson verbindet, macht Daniela sich auf den Weg in die USA. Dort stößt sie aufein Familiengeheimnis, das seine Anfänge im Berlin der Nachkriegsjahre genommen hat, als ihre Großmutter Opfer eines Verbrechens wurde.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 315
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
MIRA® TASCHENBUCH
Copyright © 2020 by MIRA Taschenbuch in der HarperCollins Germany GmbH, Hamburg
Titel der Spuren der Zeit Copyright © 2020 by MIRA Taschenbuch
Covergestaltung: HarperCollins Germany GmbH / Deborah Kuschel Coverabbildung: Ysbrand Cosijn, Wylius, phokin, LiliGraphie / Getty Images, Patryk Michalski, Prill / Shutterstock E-Book-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN E-Book 9783745750782
www.harpercollins.de Werden Sie Fan von MIRA Taschenbuch auf Facebook!
Stammbaum
1. KAPITEL
Als Daniela die Wohnungstür öffnet, schlägt ihr der vertraute Geruch ihrer Mutter entgegen. Sie spürt die Hände ihrer Freundin auf dem Rücken, die sie mit sanfter Gewalt in die Diele hineinschieben.
»Lass es uns hinter uns bringen«, sagt Miriam leise und lehnt die zusammengefalteten Umzugskartons an die Wand neben den Garderobenschrank.
Wie kann der Geruch eines Menschen so intensiv sein, wenn sein Körper schon seit einer Woche unter der Erde liegt? Eingezwängt in einen Sarg. Dabei sind ihrer Mutter großzügige Räume immer so wichtig gewesen. Daniela gibt sich einen innerlichen Ruck und tritt ins Wohnzimmer.
Sie beginnt mit dem Zierrat auf Tischen, Regalen, Fensterbrettern und Schränkchen und wickelt ihn sorgfältig in altes Zeitungspapier. Sie kennt die Geschichte aller Gegenstände. Mit ihnen sind auch die Stimme und das Bild ihrer Mutter in Danielas Kopf gespeichert, Momente, in denen sie nebeneinandergesessen und von vergangenen Zeiten gesprochen haben, weil die Gegenwart so unerträglich schien. Wie gerne würde Daniela die Dinge aufbewahren, aber im Gegensatz zu dieser Wohnung ist ihre eigene winzig. Sie kann nicht alles behalten, ganz abgesehen davon, dass sich ihr eigener Geschmack, was Kleidung und Wohnungseinrichtung angeht, erheblich von dem ihrer Mutter unterscheidet.
Das Ausräumen kostet sie mehr Kraft, als sie erwartet hat. Dabei stehen ihr die schwierigen Dinge noch bevor: persönliche Unterlagen, Fotoalben, Briefe. Mutlos sitzt sie auf der Couch. Auf ihrem Schoß liegt das aufgeschlagene Poesiealbum ihrer Mutter.
»Schau nicht alles einzeln an!«, ruft Miriam aus dem Schlafzimmer.
»Es kommt mir vor, als würde ich ihr Leben wegwerfen«, antwortet Daniela und schlägt die nächste Seite des Poesiealbums auf.
Kurze Zeit später tritt Miriam mit dem ersten gepackten Umzugskarton ins Wohnzimmer und sieht sich unschlüssig um.
»Wohin?«
Daniela weist auf die gegenüberliegende Wand.
»Dort stehen die Sachen für die Altkleidersammlung.«
Miriam stellt den Karton ab und faltet in Sekunden eine neue Umzugskiste auseinander. »Hopp hopp«, fordert sie sie auf und klatscht dabei mehrmals in die Hände, sodass Daniela trotz ihrer Traurigkeit lächeln muss. Miriam kann nicht verbergen, dass sie Grundschullehrerin ist. Ab und zu führt Miriams autoritäre Art zu heftigen Diskussionen zwischen ihnen, aber in diesen Tagen empfindet Daniela sie als hilfreich, beinahe tröstend.
»Pack die Sachen, von denen du dich noch nicht trennen kannst, in diese Kiste, und nimm sie mit nach Hause. Du hast noch dein ganzes Leben lang Zeit, dir alles anzuschauen. Die Lebensmittel in der Küche dürften weniger Zeit haben.«
Nachdem sie dieses Problem auf ihre pragmatische Art gelöst hat, lächelt Miriam sie kurz an und verschwindet wieder im Schlafzimmer.
Daniela klappt das Poesiealbum zu und legt es in den leeren Umzugskarton. Dann tritt sie vor den großen Wohnzimmerschrank aus Eiche, öffnet nacheinander alle Türen und Schubladen. Aber der Anblick des Inhalts lähmt sie erneut. Wie soll sie entscheiden, was sie aufbewahren und was sie entsorgen soll? Wenn es ihrer Mutter wichtig gewesen ist, diese Dinge aufzubewahren, müsste sie das dann nicht ebenfalls tun? Sie denkt an die fleißige Miriam im Nebenzimmer und packt alles in die Kiste zu dem Poesiealbum. Auch bei den Fotoalben widersteht sie der Versuchung, sie zu öffnen.
»Kann man Bücher auch irgendwo spenden?«, fragt sie.
»Ich glaub, ja. Pack sie doch in einen extra Karton«, kommt Miriams hohl klingende Anweisung aus den Tiefen des Schlafzimmerschrankes.
Daniela greift nach den Taschenbüchern. Ihre Mutter hat vorwiegend Krimis gelesen, die so gar nicht Danielas Ding sind. Sie selbst liest wenig und wenn, dann Liebesromane. Schlimme Dinge gibt es genug auf der Welt.
In einem der unteren Fächer finden sie Kontoauszüge und Bankbriefe. Ihre Mutter hat keine Reichtümer angesammelt, aber trotzdem muss sich Daniela demnächst auch um die Abwicklung der Vermögensdinge kümmern. Das Testament hatte ihre Mutter ihr bereits im Krankenhaus übergeben.
Die Erinnerung an diesen Moment treibt Daniela die Tränen in die Augen. Schmal und bleich hat ihre Mutter in den Kissen gelegen. Ihre Stimme war dünn. »Nimm, Dani. Du wirst es brauchen, um einen Erbschein zu beantragen. Für die Bank und die Sterbeversicherung und solche Dinge.«
Am liebsten hätte Daniela ihr den Brief aus den Händen gerissen und aus dem Fenster geworfen. Mein letzter Wille. Ihre Mutter hätte noch viele Willen haben sollen. Und ganz oben auf dieser Liste hätte stehen müssen: »Ich will diese Scheißleukämie besiegen.«
Daniela wirft die Kontoauszüge in die Kiste und setzt sich erneut auf die Couch. Sie kann ihre Tränen nicht länger zurückhalten. Sie weint so laut, dass Miriam erschrocken aus dem Nebenzimmer stürzt, sich neben sie setzt und ihr den Arm um die Schultern legt.
»Es ist hart. Ich weiß. Ich darf gar nicht daran denken, wie es mir an deiner Stelle gehen würde.« Sie zieht Daniela an sich und streichelt beruhigend ihren Rücken, bis das Weinen nachlässt.
»Entschuldige«, sagt Daniela.
»Quatsch!«
»Du bist so fleißig, und ich sitze hier nur heulend rum.«
»Trauer braucht mehr als ein paar Wochen.«
»Geht sie überhaupt jemals wieder?«
Miriam nickt.
Sie zeigt auf den geöffneten Schrank. »Wow. Du warst jetzt aber auch ganz schön schnell. Er ist ja schon fast leer.« Ihre Stimme klingt bemüht munter. »Wollen wir mal eine Pause machen? Wir könnten rausgehen. Da ist doch ein Café …«
Aber Daniela schüttelt den Kopf. Energisch greift sie nach ihrem langen Haar und formt es zu einem Pferdeschwanz. Mit der freien Hand streift sie ein Haargummi vom Handgelenk und befestigt damit die Frisur. Sie steht auf.
»Ich nehme mir jetzt die Küche vor. Kannst du dann das Bad ausräumen?«, bittet sie.
»Klar, wer zuerst fertig ist, oder?«, antwortet Miriam scherzhaft und erhebt sich ebenfalls. Bevor sie ins Schlafzimmer zurückkehrt, weist sie auf eines der unteren geöffneten Schrankfächer. »Vergiss das da aber nicht.«
Daniela folgt ihrem Blick. Dort, wo sie gerade die Kontoauszüge herausgenommen hat, steht noch etwas, was sie zuvor übersehen hat. Sie zieht eine Schachtel in der Größe eines Aktenordners hervor. Sie hat ein Blumenmuster und ist mit braunem Klebeband verschlossen Mit dem gleichen Band ist ein weißer Zettel auf den Deckel geklebt. Privat, liest Daniela die mit schwarzem Filzstift geschriebene Aufschrift.
Ihre Tatkraft von soeben droht, gleich wieder in sich zusammenzufallen. Obwohl es sich eindeutig um die Handschrift ihrer Mutter handelt, sind die Buchstaben krakeliger, als sie sie kennt. Annegret muss den Zettel angebracht haben, als die Krankheit sie schon fest im Griff hatte. Warum hat sie den Inhalt dann nicht gleich selbst vernichtet? Sie wusste, dass sie sterben würde.
Unschlüssig hält Daniela die Schachtel in den Händen. Annegret und sie haben sich vertraut. Was gab es im Leben ihrer Mutter, das sie der einzigen Tochter nicht anvertrauen wollte, nicht einmal nach ihrem Tod? Daniela kann die Schachtel schlecht zu den Dingen stellen, die bereits im Flur auf die Müllabfuhr warten. Sie muss sie verbrennen oder ganz tief in einer Plastiktüte im normalen Hausmüll verbergen. Kurzerhand legt sie die Schachtel in die Kiste, die sie mit zu sich nach Hause nimmt.
Noch einmal kontrolliert sie alle Fächer und Schubladen des Schrankes. Er ist nun wirklich leer und wird wie die anderen Möbel in den kommenden Tagen abgebaut und abgeholt und dann in einem Secondhandladen für kleines Geld an Bedürftige weiter veräußert.
Das Gleiche würde mit dem Porzellan in der Küche geschehen, den Gläsern, Töpfen und anderen brauchbaren Utensilien, die Daniela deutlich leichter verabschieden kann. Obwohl selbst einige der Lebensmittel Erinnerungen heraufbeschwören. Die endlose Diskussion mit ihrer Mutter über die angebliche Notwendigkeit, ordentlich zu frühstücken, obwohl Daniela erst am späten Vormittag etwas herunterbringt. Deshalb wandert die angebrochene Tüte mit Annegrets Lieblingsmüsli zu den Dingen für Danielas Wohnung. Wenn ihre Mutter in ihren letzten Tagen etwas gegessen hat, dann Weißbrotscheiben ohne Kruste, dünn bestrichen mit Pfälzer Leberwurst und in winzige Stückchen zerschnitten, die beim Schlucken nicht schmerzten. Daniela bringt es auch nicht übers Herz, das noch ungeöffnete Glas Leberwurst wegzuwerfen. Nicht jetzt. Nicht hier mit all dem anderen Kram.
Nach vier weiteren Stunden läuft sie ein letztes Mal durch alle Räume. Die große Umzugskiste und ein paar Tüten für ihre eigene Wohnung haben Miriam und sie bereits im Auto verstaut. Bis auf die Möbel und die ordentlich gestapelten Kartons, die zur Abholung bereitstehen, ist die Wohnung ihrer Mutter nun leer.
»Komm«, sagt Miriam und greift nach Danielas Hand. »Ich brauch jetzt wirklich eine Stärkung.«
»Aber nur kurz. Ich muss heute Abend auch noch zu Waltraud ins Heim.«
»Oh Shit«, entfährt es Miriam. Nach einem unsicheren Blick auf Daniela fügt sie wie entschuldigend hinzu: »Um deine Großmutter bist du wirklich nicht zu beneiden.«
Daniela verzieht den Mund. Schon den Begriff Großmutter hört sie im Zusammenhang mit Waltraud nur ungern, und Oma bringt sie schon lange nicht mehr über die Lippen. »Meine Mutter hat erzählt, sie sei zuletzt ab und zu netter gewesen.«
»Na, dann hat die Demenz ja auch etwas Gutes«, antwortet Miriam und drückt Daniela kurz an sich, bevor sie als Erste die Wohnung verlässt.
Daniela löscht das Licht und verschließt sorgfältig die Wohnungstür. Ein Schloss oben, ein Schloss in Höhe des Türknaufs. Den Schlüssel in jedem Schloss zwei Mal herumdrehen. So, wie es ihre Mutter getan hat, seit sie plötzlich als Witwe allein in der großen Wohnung hatte leben müssen.
Morgen würde sie nur noch den Abtransport überwachen müssen, denn die Renovierung hat der Vermieter ihr kulanterweise erlassen. Er wird die Wohnung sanieren und wieder vermieten. Für die dreifache Miete. Neue Tapeten, neue Mieter. Andere Schicksale.
Dann liegt der Fokus eher darauf, dass Annegrets Leben aus der Wohnung verschwindet.
Daniela parkt ihr Auto in zweiter Reihe, weil sie zwei Mal in ihre kleine Wohnung im dritten Stock steigen muss, um den Umzugskarton und die Tüten hinaufzuschleppen. Sie nimmt nur die Lebensmittel aus den Tüten und stellt den Rest in eine Ecke ihres Wohnzimmers. Zwischen Couch und Schrank verborgen, hinter einem kleinen Beistelltisch mit Leselampe. Für heute hat sie genug von der Vergangenheit.
Nachdem sie für ihr Auto einen Parkplatz gefunden hat, ruft sie Frau Gerbermann, Waltrauds Heimleiterin, an und bittet sie, ihren Termin auf den kommenden Tag zu verschieben. Zum Glück passt das Frau Gerbermann ebenfalls, sodass Daniela der Besuch im Heim für heute erspart bleibt. Denn sie ist müde, traurig, ihr Kopf schmerzt, und sie wünscht sich im Moment nichts sehnlicher als eine Badewanne. Aber genau das hat sie nicht. Eine lange heiße Dusche muss also genügen.
Nachdem sie die Lebensmittel in der Küche eingeräumt hat, fällt ihr Blick auf die Post, die sie aus dem Briefkasten im Hausflur genommen hat. Zwei der Briefe haben einen schwarzen Rand. Auch jetzt, zwei Wochen nach Annegrets Tod, erhält sie noch Kondolenzbriefe. Sie prüft die Absender und erkennt die Namen zweier Frauen aus der Nachbarschaft wieder. Eine von ihnen hat Annegret auch öfter im Krankenhaus besucht.
Daniela legt die beiden Briefe beiseite. Sie wird sie nachher lesen, nach der Dusche. Sie greift nach dem letzten Brief, der wie eine amtliche Zustellung wirkt: Hat sie etwas Wichtiges vergessen, abzumelden oder zu bezahlen? Ihre Mutter hat eine Sterbeversicherung abgeschlossen, und eigentlich sollten alle Kosten inzwischen bezahlt sein.
Daniela reißt den Umschlag auf und entnimmt ihm ein Schreiben sowie weitere Unterlagen in englischer Sprache. Die Papiere sind mit Stempeln und Unterschriften regelrecht übersät. Kopfschüttelnd legt sie sie beiseite und widmet sich dem Anschreiben, das in deutscher Sprache verfasst ist:
Sehr geehrte Frau Hofstetter,
ich bin über die Botschaft der Vereinigten Staaten beauftragt worden, eine Erbschaftsangelegenheit abzuwickeln. In der Anlage übersende ich Ihnen ein Anschreiben meines Kollegen in New York, Rechtsanwalt Martin Rosenberg, nebst den darin genannten Unterlagen sowie deren amtliche Übersetzungen ins Deutsche und der Apostille des Dolmetschers.
Wie Sie den Unterlagen entnehmen können, hat Herr Jayden Hanson, geboren 14.03.1923 in Plainfield, Otsego County, NY, gestorben am 27.02.2019 in New York, NY, Ihre Mutter, Frau Annegret Hofstetter, geboren 31.05.1948 in Berlin, gestorben 17.05.2019 in Berlin, ersatzweise deren Nachkommen, in seinem notariellen Testament begünstigt und die Testamentsvollstreckung hinsichtlich dieses Legats angeordnet.
Nach meinen Informationen haben Sie am 29.05.2019 einen Erbschein als Alleinerbin nach Ihrer Mutter beantragt. Die Erteilung des Erbscheines vom Amtsgericht Charlottenburg vorausgesetzt, sind Sie damit Erbin des Legats geworden.
Bitte vereinbaren Sie baldmöglichst einen Termin mit meiner Kanzlei, um die Abwicklung der Angelegenheit zu besprechen. Falls der Erbschein in den nächsten Tagen ausgestellt werden sollte, bringen Sie diesen bitte im Original mit.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Sabine Reichert
Rechtsanwältin und Notarin
Daniela lässt den Brief sinken, nimmt ihn wieder hoch, liest den Inhalt noch einmal. Dann schüttelt sie den Kopf. »Diese Betrüger werden immer frecher«, ruft sie wütend. Beinahe hätte sie diesen Stuss geglaubt. Normalerweise sind solche Schreiben gespickt mit Rechtschreib- und Formulierungsfehlern, weil sie mit Übersetzungsmaschinen im Internet ins Deutsche übertragen werden. Aber hier hat sich jemand richtig Mühe gegeben. Allein all diese Unterlagen zu fälschen – was für ein Aufwand! Am meisten ärgert es sie, dass ihr so ein Betrugsschreiben ausgerechnet jetzt zugestellt wird, so kurz nach dem Tod ihrer Mutter. Was sind das für Leute, die sich die Sterbedaten von Leuten besorgen und dann mit den Gefühlen der Angehörigen spielen? Widerlich!
Die warmen Wasserstrahlen entspannen ihren Körper, trotzdem kreisen ihre Gedanken weiter um dieses merkwürdige Schreiben. Und wenn es doch echt wäre? Aber ihre Familie hatte nie etwas mit einem US-Bürger zu tun. Verlangen Betrüger nicht normalerweise die Überweisung einer ersten Gebühr, um damit angebliche weitere Schritte einleiten zu können? Was haben die Betrüger also von einem Schreiben, in dem nur um telefonische Kontaktaufnahme gebeten wird. Wahrscheinlich würde sich unter der angegebenen Nummer lediglich ein Anrufbeantworter melden, oder sie würde mit irgendeinem Call-Center am anderen Ende der Welt verbunden werden und nach ihrer Kontoverbindung und anderen sensiblen Daten gefragt werden.
Daniela dreht den Wasserhahn zu, greift sich das Badetuch und trocknet sich notdürftig ab. In das große Handtuch eingewickelt, läuft sie in die Küche, greift sich die Unterlagen und öffnet ihren Laptop auf dem Wohnzimmertisch.
Sie sucht nach der Rechtsanwältin Dr. Sabine Reichert und findet sofort deren Webseite. Nun gut, das heißt noch gar nichts. Eine Homepage kann heutzutage jeder Idiot einrichten. Sie vergleicht die Kontaktinformationen auf dem Briefbogen mit den Angaben auf der Webseite, auf der die Anwältin mit Foto dargestellt ist. Eine Endvierzigerin mit hübschem Gesicht und sympathisch wirkendem Lächeln. Alles scheint echt. Die Verlinkungen zu den Unterseiten funktionieren. Nichts deutet auf eine Phishing-Seite hin.
Sie vergleicht die Telefonnummern mit denen auf der Homepage. Trotzdem gibt sie noch einmal den Namen der Anwältin in die Suchmaschine ein und kontrolliert, ob die Telefonnummer noch auf anderen Seiten verzeichnet ist.
Frau Dr. Sabine Reichert scheint eine große Kanzlei zu führen, denn Daniela findet sofort mindestens zehn andere Seiten mit den Angaben zu dieser Kanzlei. Alle stimmen mit denen auf dem Schreiben neben ihrem Laptop überein.
Ihr Herz klopft inzwischen wesentlich stärker. Doch dann ärgert sie sich erneut, verschwendet sie doch wahrscheinlich gerade Zeit an eine raffinierte Betrügerbande.
Sie wählt die Nummer der Kanzlei. Ein Anrufbeantworter informiert sie, dass die Sprechzeiten bereits vorüber sind. Sie hinterlässt keine Nachricht.
Sie kleidet sich an, und obwohl es abendlich frisch ist, setzt sie sich mit einem Glas Rotwein auf den kleinen Balkon, auf ihrem Schoß die beiden Kondolenzbriefe. Vom nahegelegenen Hohenzollerndamm dringt das ebenmäßige Rauschen des Verkehrs zu ihr. Die Sonne steht bereits tiefer als die umliegenden Häuser, aber wie immer haben die frische Luft und der leichte Wind eine beruhigende Wirkung auf sie. Eines Tages wird sie im Süden leben, das steht fest. Dort, wo man fast das ganze Jahr über auf einem Balkon oder einer Terrasse zubringen kann. Aber noch ist es nicht so weit. Ihr fehlen Geld, ein Job im Ausland und, wenn es ganz übel kommen sollte, könnte sie bald sogar ihre Anstellung hier in Berlin verlieren. Seit mehr als zehn Jahren ist sie Buchhalterin in einem großen Unternehmen, das jetzt aber in Liquiditätsprobleme geraten ist.
Geld. Da sind sie wieder, die Gedanken an den Brief der Rechtsanwältin. Sie seufzt, während sie den ersten Brief öffnet und sich auf die Worte der Nachbarin konzentriert.
Es sind die üblichen Formulierungen. Was soll man auch schreiben? Natürlich ist es schön zu erfahren, wie beliebt die eigene Mutter war, aber tröstet das wirklich? Daniela trinkt einen Schluck Rotwein und kommt zu dem Schluss: Ja, es tröstet. Zumindest ein wenig. Die Mitmenschen teilen ein Stück des eigenen Schmerzes. Anders als bei einem Menschen, der einem nicht nahegestanden hat, ist der Schmerz heftiger, aber auch mit der süßen Schwere schöner Erinnerungen verbunden.
»Bitte grüßen Sie auch Ihre Großmutter von mir«, hat die Nachbarin zum Schluss geschrieben, und schon sind die tröstenden Erinnerungen verschwunden. Wahrscheinlich hatte die Nachbarin den Satz aus Höflichkeit geschrieben. Oder sie wusste einfach nicht, wie sich Waltraud ihrer Tochter und ihrer Enkelin gegenüber verhalten hatte. Bei einem weiteren Glas Rotwein fragt sich Daniela, wie schon so viele Male zuvor, wie eine Mutter wie Waltraud eine so liebevolle und herzensgute Frau wie Annegret hatte aufziehen können? Und wie hatte Annegret die Ungerechtigkeiten ihrer Mutter nur so lange aushalten können?
Daniela kann das nicht. Sie will es auch gar nicht, deshalb hat sie bereits vor Jahren den Kontakt zu ihrer Großmutter abgebrochen. Sollen sich Großmutters Lieblingstochter Corinna und Danielas Cousin und Cousine um Waltraud kümmern.
»Warum tust du dir das an, Mama?«, hatte Daniela gefragt, als ihre Mutter die Großmutter vor zwei Jahren zu einem Notar begleitet hatte, um eine Vorsorge- und Generalvollmacht beurkunden zu lassen. »Warum kann das nicht Tante Corinna machen?«
»Weil Tante Corinna mit ihrem Job und der Scheidung zu viel um die Ohren hat und weil sie in Hamburg wohnt. Das ist viel zu weit weg«, hat sich ihre Mutter gerechtfertigt und hinzugefügt: »Sie ist nun einmal meine Mutter.«
Als sei diese Tatsache Grund genug.
Vielleicht kann Waltraud wegen ihrer Demenz ihre Enkelin gar nicht mehr erkennen. Das würde den Besuch morgen früh im Heim sicher leichter machen.
Daniela hat sich mit Frau Gerbermann für 8:30 Uhr verabredet, denn anschließend muss sie wegen der Abholung der Möbel und Kisten wieder in der Wohnung sein.
Die Rechtsanwaltskanzlei ist telefonisch erst ab 9 Uhr erreichbar. Also muss die Klärung dieser merkwürdigen Angelegenheit erst einmal warten.
Daniela quält ihr kleines rotes Auto durch den gewohnt zähflüssigen Morgenverkehr und betritt pünktlich das Büro der Heimleitung im zweiten Obergeschoss.
»Zunächst möchte ich Ihnen mein tief empfundenes Beileid ausdrücken. Ihre Mutter war hier sehr beliebt und eine wirklich treue Angehörige.« Frau Gerbermann greift nach Danielas Hand und drückt sie herzlich. »Bitte nehmen Sie Platz.« Während Daniela ihr zu einer kleinen Sitzgruppe in einer Ecke des geräumigen Büros folgt, mustert sie die Heimleiterin. Sie scheint kaum mehr als vier oder fünf Jahre älter als sie selbst zu sein. Daniela findet es bewundernswert, dass sie in diesem Alter bereits ein Heim leitet, in dem Alzheimer, Behinderung und Siechtum ebenso allgegenwärtig sind wie der Tod selbst. Ihre arme Mutter. Obwohl sie selbst schon so krank gewesen war, hatte sie Waltraud dennoch jede Woche mindestens einmal besucht.
»Was erwarten Sie nach dem Tod meiner Mutter jetzt von mir?«, fragt Daniela, nachdem sie Platz genommen hat, und hofft, dass ihre Stimme nicht zu abweisend klingt.
»Erwarten? Das ist vielleicht nicht das richtige Wort. Ihre Mutter hatte uns gegenüber erwähnt, dass Sie möglicherweise die Pflegschaft für ihre Großmutter weiterführen würden. Also, sie schien es jedenfalls gehofft zu haben. Haben Sie beide nie darüber gesprochen?«
»Ich werde die Pflegschaft nicht übernehmen. Haben Sie schon Kontakt mit meiner Tante, Frau Corinna Klinge, aufgenommen?«, antwortet Daniela der überrascht wirkenden Heimleiterin.
»Noch nicht, ich wollte erst mit Ihnen sprechen.«
»Rufen Sie sie an. Ich habe bereits mit meiner Tante gesprochen.«
»Ihre Mutter erzählte mir, ihre Schwester würde in Hamburg leben?«
Daniela nickt. »Sie muss dann eben hin und wieder herkommen. Meine Mutter hat sich lange genug um Waltraud gekümmert. Und außerdem wird meine Großmutter vermutlich bald weder mich noch ihre Tochter erkennen.«
»Sie und Ihre Großmutter standen sich wohl nicht besonders nah?«
»Sie mochte mich nicht. Das trifft es besser.« Daniela erhebt sich. »Muss ich noch irgendwelche Formalitäten erledigen?«
»Eine Kopie der Sterbeurkunde Ihrer Mutter wäre gut. Dann kann ich die Pflegschaft offiziell abmelden«, antwortet die Heimleiterin in merklich abgekühlter Stimmlage. Statt ihr zum Abschied die Hand zu reichen, tritt sie hinter ihren Schreibtisch und nickt Daniela zum Abschied nur kurz zu, bevor sie den Blick auf die Unterlagen senkt.
Mit einem stillen Seufzer verlässt Daniela das Büro. Es ist ihr unangenehm, wie eine kaltschnäuzige Angehörige zu wirken. Eigentlich ist sie das auch nicht, aber die jahrelange Enttäuschung über ihre Großmutter sitzt zu tief. Ein normaler Umgang ist schon lange nicht mehr möglich.
Sie läuft den Gang entlang Richtung Ausgang, doch ihre Schritte werden immer langsamer. Annegret hat ihre Mutter jede Woche besucht. Jetzt liegt ihr letzter Besuch schon über sechs Wochen zurück. Frau Gerbermann hat Waltraud über Annegrets Tod informiert, doch weiß Waltraud jetzt noch, dass ihre Tochter gestorben ist? Weiß sie überhaupt noch, was Tod bedeutet? Und nimmt sie noch wahr, wie die Zeit vergeht?
Ohne sich bewusst dafür zu entscheiden, drückt Daniela im Fahrstuhl die »1« statt der »0« für die Ausgangsetage. Auf der Station in der ersten Etage bewohnt Waltraud ein eigenes Zimmer. Eingerichtet mit einigen wenigen Möbelstücken aus ihrer ehemaligen Wohnung, die wahrscheinlich aber jeden Erinnerungswert verloren haben, wie alles andere auch.
»Waltraud?«
Ihre Großmutter sitzt mit dem Gesicht zum Fenster. Als sie die Stimme hört, dreht sie sich um. Still blickt sie Daniela ins Gesicht.
Wann standen sie sich das letzte Mal gegenüber? Es muss mehr als zwei Jahre her sein.
»Weißt du, wer ich bin?«, fragt sie.
»Natürlich. Du bist Daniela, meine Enkelin.«
Sie kann ihren Ohren kaum trauen. Wie oft hatte ihre Mutter ihr erzählt, dass Waltraud selbst sie nicht mehr erkannte. Woher kommt diese plötzliche Klarheit?
»Es gibt immer wieder sogenannte Erinnerungsinseln«, erklärt ihr wenig später die Stationsschwester. »Momente der Klarheit, in denen einige Synapsen dann doch noch ganz gut funktionieren. Dann kann man sich fast normal mit ihnen unterhalten.«
Sie unterhalten sich nicht. Großmutter und Enkelin haben sich nichts zu sagen.
Eigentlich müsste es Daniela sanftmütiger stimmen, dass ihre Großmutter nun von der Demenz ausgehöhlt wird. Aber das Gegenteil ist der Fall. Es macht sie wütend. Ihr kommt es so vor, als würde Waltraud sich durch ihre Krankheit aus jeder Verantwortung stehlen. Obwohl Daniela es nur zu gerne ignorieren möchte, gibt es immer noch den Wunsch in ihr, die Großmutter würde sich ihr gegenüber einmal erklären.
2. KAPITEL
Frühjahr 1947
Waltraud zog die Wohnungstür leise hinter sich ins Schloss und ihr erster Blick ging gewohnheitsmäßig nach oben. Der erste Treppenzug ins Obergeschoss endete im Nichts, nur eine behelfsmäßige Plane trennte den Raum vom Himmel.
Da oben im dritten Stock hatten sie gewohnt. Bis … bis zu jener schrecklichen Nacht. Rasch schob sie die Erinnerungen beiseite.
Auf der Straße atmete sie tief durch und bildete sich ein, den Frühling riechen zu können. Wie mild die Luft heute war!
Milder zeigten sich auch die Gesichter der Menschen. Sie trugen zwar noch Wintermäntel, aber Schals und Handschuhe waren zu Hause geblieben.
Waltraud machte sich auf den Weg zum Schwarzmarkt am Potsdamer Platz. Vielleicht hatte sie Glück und konnte dort eine Garnrolle und vielleicht sogar ein Gummiband ergattern. Im Bund ihres Rockes steckte eine Schachtel mit einigen Zigaretten. Noch besaßen sie einen wertvollen Vorrat, aber er schrumpfte beängstigend schnell.
Ein Junge kam ihr mit einem Leiterwagen entgegen. Lächelnd machte Waltraud ihm Platz. Ein wenig neidisch sah sie auf das wacklige Holzgefährt. Wie viel leichter wären ihre Besorgungen, wenn sie so etwas besäße. Vielleicht sollten sie doch eines der Bilder verkaufen, um sich ein Fahrrad zu beschaffen? Ach was, bisher waren sie irgendwie durchgekommen. Sie brauchten die Bilder, falls etwas Schlimmes passierte. Obwohl sie sich nichts Schlimmeres als Bomben und Hunger und den letzten besonders eisigen Winter vorstellen konnte. Im letzten Jahr hatten sie noch alles Mögliche direkt tauschen können. Jetzt zählten fast nur noch Zigaretten. Vielleicht auch Schnaps oder wirklich wertvolle Bilder und teurer Schmuck. Aber wer besaß so etwas noch?
Sie blieb kurz stehen, schloss die Augen und streckte das Gesicht der Sonne entgegen. Die Wärme auf der Haut schien sich auf ihrem gesamten Körper auszudehnen. Selbst der Anblick der zerstörten Stadt, an den sie längst gewohnt war, schien sich verändert zu haben. Die Sonne färbte das hässliche Grau der Trümmerhaufen und ließ sie wie sanfte Hügel in einer Landschaft wirken. Die Überreste der zerstörten Häuser ragten wie tote Baumstümpfe in einem abgebrannten Wald in den wolkenlosen Himmel. Auf Waltraud hatte der Anblick der Trümmerberge etwas Beruhigendes. Waltraud lächelte und schüttelte den Kopf. Ihrer Mutter durfte sie mit solchen Gedanken nicht kommen. Berlin war zerstört, aber für sie waren die Trümmer Zeugen, sie waren der Beweis dafür, dass die schrecklichsten Jahre hinter ihnen lagen. Sie hatte überlebt. Und der Tod hatte sich aus der Stadt zurückgezogen, nachdem er noch vor wenigen Wochen stärker gewütet hatte als in Kriegszeiten.
Je näher sie der Stadtmitte kam, umso höher türmten sich die Schuttberge links und rechts der geräumten Straßen. Einige der Frauen, die Steine klopften, hatten ihre Mäntel beiseitegelegt, Kopftücher schützten ihre Haare und Kittelschürzen oder alte Stoffe die Kleidung. Selbst ihre Gesichter zeigten heute so etwas wie Zuversicht.
Irgendwo am anderen Ende der Stadt stand auch ihre Mutter als Hilfsarbeiterin auf einem solchen Trümmerhaufen. Sie klopfte nicht freiwillig jeden Tag Hunderte von Steinen, sondern war als Parteimitglied und Ehefrau eines überzeugten NSDAP-Anhängers zwangsverpflichtet worden.
Es gelang Waltraud nicht, das von ihrer Mutter dringend benötigte Garn oder Gummiband zu besorgen, bis sie den Schwarzmarkt an der Brunnenstraße im Wedding erreichte. Dort traf sie endlich auf eine alte Frau, die Knöpfe anbot. Sie stützte sich auf einen Stock und ihr Rücken war so rund, dass sie Mühe hatte, zu Waltraud aufzuschauen.
»Ich war Näherin und hab noch jede Menge davon. Aber nun machen meine Augen nicht mehr mit. Was brauchst du denn Kind?«
»Weißes oder hellgraues Garn.«
»Muss ich gucken.«
»Aber ich nehme auch jede andere Farbe«, versicherte Waltraud. »Und Gummiband. Das wäre schön.«
Voller Vorfreude beobachte sie, wie die Alte etwas aus ihrer Manteltasche nestelte. Aber es war nur ein zerknitterter Zettel, den sie hervorzog und Waltraud entgegenhielt.
»Meine Adresse. Komm morgen mit drei Briketts. Noch so einen Winter überleb ich nicht und auf Kohlenklau kann ich nicht mehr.«
»Haben Sie denn keine Familie?«
»Alle tot. Kommst du? Um acht Uhr abends?«, fragte sie und Waltraud wurde in diesem Moment wieder einmal bewusst, wie viel Glück sie und ihre Mutter bisher gehabt hatten. Ihr Vater war gefallen, aber wenigstens hatten sie beide zusammen überlebt. Wie viele Menschen hatte der Krieg völlig allein zurückgelassen und wie viele Waisenkinder gab es in der Stadt, von denen etliche auf der Straße lebten.
Sie nickte der alten Frau zu und sah sich die Adresse genauer an. Sie lag ganz in der Nähe.
»Könnten wir nicht jetzt?«
»Hast du ein Brot für mich?«, fragte die Alte. »Siehste, deshalb muss ich jetzt verkaufen«, fuhr sie fort, als Waltraud den Kopf schüttelte.
»Ich kann nur bis sechs«, antwortete Waltraud, obwohl es nicht stimmte, aber später wollte sie den langen Weg auf keinen Fall riskieren. Die Briketts waren zu groß, um sie am Körper zu verstecken. Tagsüber kümmerte sich niemand um das Hin und Her an den Sektorengrenzen. Aber in der Nähe des Schwarzmarktes kam es immer wieder vor, dass die Soldaten die Menschen kontrollierten, und das besonders in der Dunkelheit. Die Angst vor einer Verhaftung saß tief. Da nutzte es auch nichts, wenn die Nachbarn Waltraud erzählten, die Strafen seien gering. Frauen, die erwischt wurden, mussten Kartoffeln schälen, Männer auf irgendeiner Baustelle arbeiten. Danach wurde man meist wieder entlassen. Zu viele der alliierten Soldaten trieben sich schließlich selbst auf dem Schwarzmarkt herum. Aber wer wusste schon, ob das stimmte? Waltraud hatte jedenfalls nicht vor, es herauszufinden. Berichte von Soldaten, die kurz nach Kriegsende Frauen vergewaltigt hatten, geisterten noch immer durch ihren Kopf. Wieder spürte sie ein warmes Gefühl der Dankbarkeit in sich aufsteigen. Sowohl ihre Mutter als auch sie selbst hatten dieses schreckliche Schicksal nicht erleben müssen.
Die Alte nickte. »Abgemacht.« Tief nach vorn gebeugt, schlurfte sie davon und verschwand in der dichten Menschenmenge.
Waltraud steckte den Zettel mit der Adresse in die Innentasche ihres Mantels. Würde ihre Mutter mit dem Handel einverstanden sein? Ach was, sie hatten noch den ganzen Sommer Zeit, Brennmaterial für den nächsten Winter zu beschaffen.
Fast schon beschwingt von ihrem kleinen Erfolg machte Waltraud sich auf den Weg nach Tempelhof. Nur, als sie der Frau am S-Bahn-Schalter das Fahrgeld hinlegte, tat es ihr in der Seele weh. Aber noch einmal fast zehn Kilometer laufen? Außerdem würde sie zu spät zu ihrer Verabredung mit Magda kommen.
Ihre Freundin arbeitete seit einigen Wochen in einer kleinen metallverarbeitenden Fabrik in Tempelhof. Der Besitzer der Fabrik war gestorben, und sein Sohn führte die Arbeit nun fort. Unter der strengen Kontrolle der Alliierten baute Wolfgang Sendling mit den Metall- und Eisenfunden aus den Trümmern der Stadt langsam wieder eine Produktion auf. Magda und sie hatten sich für die Mittagspause auf dem Fabrikhof verabredet und Waltraud hoffte, dass ihre beste Freundin ihr ebenfalls eine Stelle vermitteln könne.
»Willst du abbeißen?« Magda hielt ihr eine Stulle entgegen. Ohne Butter, hauchdünn geschnittene Jagdwurst. Waltraud schüttelte den Kopf, obwohl sie spürte, wie hungrig sie war. Aber ihre Freundin hatte das Brot weit nötiger. Schließlich brachte sie den ganzen Tag an einer Werkbank mit Feilen, Hämmern und Metall Sägen zu.
Verstohlen beobachtete Waltraud ihre Freundin von der Seite. Wie hatte Magda das alles so schnell lernen können? Ihre Kollegen waren ausnahmslos Männer. Magda war wie sie selbst erst 17 Jahre alt, aber, wie Waltraud oft genug bewundernd festgestellt hatte, sehr resolut und selbstbewusst. Sie hatte kurzerhand die Schule verlassen, eine Anstellung gesucht und ihren Vater vor vollendete Tatsache gestellt. Waltraud wollte es Magda nachmachen, aber im Gegensatz zu ihrer Freundin hatte sie nicht die geringste Ahnung, wie sie das ihrer Mutter beibringen sollte.
Sie saßen am Rande einer Lieferrampe in der Sonne und ließen die Beine baumeln. Magda biss von ihrem Brot ab und kaute so langsam, dass Waltraud ihr dabei nicht zusehen konnte, ohne dass ihr das Wasser im Mund zusammenlief. Also streckte sie ihr Gesicht der Sonne entgegen, schloss dabei die Augen und versuchte, die Leere in ihrem Magen zu ignorieren.
»Wie ist das eigentlich so mit diesem Noah?«
»Was soll sein?«
»Na, ich meine, so mit einem … einem mit schwarzer Haut. Ist schon irgendwie ungewohnt, oder?«
»Vielleicht am Anfang etwas. Ich kannte vorher ja auch niemanden, der schwarz ist. Aber jetzt fühlt es sich völlig normal an. Außerdem: Noah küsst gut.«
Waltraud riss die Augen auf und starrte Magda an.
»Was? Du hast … ihr habt …«
Magda lachte sie an.
»Na, dich kann man ja leicht ins Bockshorn jagen.«
»Also habt ihr noch nicht …«
»Er würde ja gerne. Aber, wenn man einen Mann lässt, dann bemüht er sich vielleicht gar nicht mehr um eine Frau.«
Magda kicherte, und Waltraud war sich nicht sicher, ob die Sonne das Gesicht ihrer Freundin gerötet hatte oder die Vorstellung, wie es wäre, wenn …
Aber Magdas Kichern steckte an, und auch sie konnte nicht länger ernst bleiben. »Wir benehmen uns wie dumme Hühner«, brachte sie unter Prusten hervor.
Eine Weile saßen sie still nebeneinander.
»Ich habe übrigens gefragt. In der Werkstatt haben sie keine Stelle mehr frei. Aber sie brauchen jemanden im Büro. Du warst doch immer gut im Rechnen«, sagte Magda.
»Ja, aber wieso rechnen? Ich dachte, im Büro muss man schreiben können?«
»Sie brauchen jemanden für die Buchhaltung.«
»Auch gut. Soll ich jetzt gleich mal ins Büro oder lieber erst eine richtige Bewerbung aufsetzen?«
Waltraud stand auf und strich sich den Rock glatt. War er sauber? Sie fuhr sich durch ihre schulterlangen Locken. Hoffentlich würde sie einen guten Eindruck machen. Könnte es mit einer Anstellung so rasch klappen?
»Schreibmaschine schreiben musst du trotzdem können«, sagte Magda und sah zu ihr hoch, das Gesicht skeptisch in Falten gezogen.
Enttäuscht setzte sich Waltraud wieder neben sie.
»Vielleicht kannst du es lernen?«
»So schnell? Wie denn? Wir haben noch nicht einmal eine Schreibmaschine.«
»Sie besetzen die Stelle erst in anderthalb Monaten. Du könntest dich schriftlich bewerben und behaupten, du lernst es gerade.«
»Willst du dich nicht lieber bewerben? Ist doch bestimmt leichter als deine Arbeit in der Werkstatt.«
Magda schüttelte energisch den Kopf. »Mir gefällt es dort, und der Meister hat mich schon ein paarmal gelobt.« Ihre Augen strahlten. »Vor den Kollegen«, fügte sie stolz hinzu.
»Na dann.« Sie schlugen die offenen Handflächen gegeneinander. »Abgemacht.«
Magda erhob sich. »Meine Pause ist zu Ende.«
»Wie spät ist es denn?« Waltraud wies auf das nackte Armgelenk ihrer Freundin. Sie wusste, dass ihre Freundin die goldene Armbanduhr ihrer verstorbenen Oma im letzten Winter schweren Herzens gegen Lebensmittel getauscht hatte.
»Für so was bekommt man ein Gefühl«, antwortete Magda und grinste. »Wir sollten uns übrigens langsam mal etwas für Maries Geburtstag überlegen.«
Waltraud erschrak. Sie hatte die gemeinsame Freundin über die aufregende Aussicht auf eine Arbeit ganz vergessen. Marie wohnte ein paar Häuser entfernt in der gleichen Straße, in der Waltraud und auch Magda lebten. Sie hatten sich mit der jungen Frau im Luftschutzbunker angefreundet. Marie würde in zwei Wochen 21 Jahre alt werden.
»Volljährig zu sein, muss schön sein«, schwärmte Waltraud. Dabei war ihre eigene Mutter, verglichen mit Maries strengen Eltern, regelrecht großzügig. Aber Herta musste auch den ganzen Tag arbeiten und hatte keine Zeit, ständig ein Auge auf ihre Tochter zu haben, während Marie noch beide Elternteile hatte. Ihre Mutter konnte zu Hause bleiben, weil der Vater als Professor an der Universität genug verdiente.
»Wollen wir ihr einen Kuchen backen?«, fragte Waltraud.
»Ich hab eine bessere Idee. Wir könnten ihr zwei Kinokarten schenken. Das ist billiger und sie hat viel länger etwas davon«, schlug Magda vor.
»Aber ein paar Zutaten für den Kuchen könnte ich von zu Hause abzwacken, Geld, Kinokarten zu kaufen, habe ich nicht«, stellte Waltraud traurig fest.
»Ich kann das übernehmen. Meinen ersten Lohn habe ich schon bekommen. Und wenn du die Stelle im Büro bekommst, zahlst du mir einfach die Hälfte zurück.«
»Und wenn nicht?«
Magda sah sie ernst an. »Du bekommst die Stelle. Hörst du? Wenn du willst, schaffst du das auch.«
»Du klingst wie eine Lehrerin. Warum eigentlich zwei Karten? Weißt du etwas, das ich nicht weiß?«
Statt einer Antwort legte Magda den Zeigefinger vor ihre zusammengepressten Lippen und drehte sich dann um. Kichernd näherte sie sich dem Gebäude und verschwand durch eine Stahltür ins Innere.
Auch Waltraud erhob sich und machte sich auf den Heimweg. An einigen von der Abholzung verschont gebliebenen Birken entdeckte Waltraud erstes Grün. Plötzlich fand sie: Es war eine aufregende Zeit, in der sie lebte. Und plötzlich hatte sie auch keine Angst mehr, am Abend in den Wedding zu fahren, um Garn und Gummiband zu holen. Sollte sie einer der Soldaten fragen, was sie im Rucksack hatte, würde sie sagen, sie brächte ihrer alten kranken Oma ein paar Briketts und beim Rückweg behaupten, sie hätte eben jene Oma nur besucht. Garnrolle und Gummiband konnte sie gut am Körper verstecken.
In der Ferne ertönte eine Sirene.
»Hört das denn nie auf?«, stöhnte Waltrauds Mutter.
»Mutti, es ist nur die Sirene der Feuerwehr. Wahrscheinlich brennt es mal wieder irgendwo. Kein Wunder, so wie sie alles zerbombt haben«, antwortete Herta und wickelte jedes der drei Briketts in eine Lage Zeitungspapier, während Waltraud sich bückte, um die Brikettkrümel sorgfältig aufzufegen und sie in einen kleinen Eimer zu schütten, der neben dem Ofen stand. Sie hatten sich vorgenommen, nach dem schrecklichen letzten Winter schon im Frühling mit dem Sammeln von Heizmaterial zu beginnen, weshalb ihre Mutter nicht begeistert gewesen war, als Waltraud ihr von dem Geschäft mit der alten Frau berichtet hatte. Es war schwierig genug. Sogar die Bäume und Büsche in den Straßen und im nahen Schlosspark, die man zersägen und abtransportieren konnte, hatten in der Dunkelheit der Winternächte dran glauben müssen oder waren der Bevölkerung als Brennholz zugewiesen worden. Inzwischen wurden die Kohlenzüge immer stärker bewacht, und ihre Möbel waren bereits auf das nötigste reduziert worden.
»Wenn dein Vater das hätte miterleben müssen.« Herta erhob sich mühsam und griff mit schmerzerfülltem Gesicht an ihren Rücken. Sie zog ihren braunen Rock zurecht, der ihr inzwischen viel zu weit geworden war. Aus Waltrauds properer vollschlanker Mutter war innerhalb von zwei Jahren eine hagere Frau geworden. In ihren halblangen Haaren überwog das Grau, obwohl Herta noch keine vierzig war. Aber körperlich harte Arbeit war sie nie gewohnt gewesen. Gelernt hatte sie ebenfalls nichts. Bereits mit neunzehn Jahren hatte sie mit Zustimmung der Eltern ihren Walter geheiratet. Nur ein Jahr später wurde Waltraud geboren. Anstatt sich nach dem Tod ihres Mannes selbst den praktischen Herausforderungen zu stellen, die der Krieg und die Zeit danach diktierten, hatte sie dankbar akzeptiert, dass ihre Tochter in diesen Dingen eher nach dem Vater kam.
Waltraud gab sich einen innerlichen Ruck. Es war an der Zeit, der Mutter ihren Entschluss mitzuteilen.
»Ich gehe nicht mehr in die Schule«, sagte sie. Dass sie bereits seit einer Woche das Unterrichtszimmer nicht mehr betreten hatte, behielt sie für sich.
»Wie bitte? Bist du noch ganz bei Trost?«
Mit aufgerissen Augen, die Arme in die Hüfte gestemmt, stand ihre Mutter kampflustig vor ihr. »Du solltest dankbar sein, dass du zur Schule gehen darfst. Dein Vater …«
»Lass Vati aus dem Spiel! Es hat keinen Zweck mehr. Wir haben kaum mehr richtigen Unterricht. Außerdem wollen sie das komplette Schulsystem ändern. Und wer weiß, ob ich dann überhaupt Abitur machen kann, als Kind von einem …« Sie sah Hertas böse Miene und schluckte das Wort herunter. »Außerdem sind wir jetzt in der elften Klasse nur noch wenige.«
»Ach? Es gibt also noch mehr undankbare Kinder wie dich.«