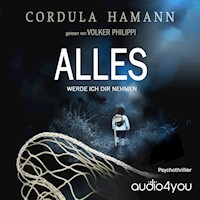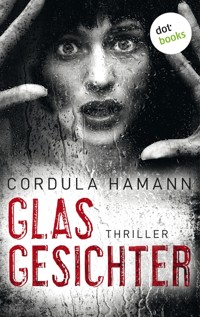
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Psychologische Spannung und menschliche Abgründe: Der aufsehenerregende Thriller "Glasgesichter" von Cordula Hamann jetzt als eBook bei dotbooks. Diese Bilder lassen niemanden kalt: farbenreiche, auf Glas gemalte Frauengesichter – wie im Todeskampf verzerrt. Die Galeristin Andrea Wahrig ist sicher, mit dieser Ausstellung den ganz großen Durchbruch feiern zu können. Doch dann erhält sie einen anonymen Drohbrief: "Sagen Sie die Ausstellung ab, oder jemand, den Sie lieben, wird sterben." Gleichzeitig zieht der Künstler seine Werke zurück und verweigert jedes Treffen. Was hat das zu bedeuten? Andrea beginnt nachzuforschen – und ahnt nicht, welcher dunkle Schatten dadurch auf sie fällt. Denn es gibt jemanden, der dafür mordet, das Geheimnis der Glasgesichter zu bewahren … Im Kopf eines Killers: "Die psychologische Tiefe ist enorm, geht weit über das hinaus, was man im Genre sonst findet. Ein Thriller, der so in Fahrt kommt, dass man das Lesen schlicht nicht mehr stoppen kann." missmesmerized.wordpress.com Jetzt als eBook kaufen und genießen: "Glasgesichter" von Cordula Hamann. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 326
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Diese Bilder lassen niemanden kalt: farbenreiche, auf Glas gemalte Frauengesichter – wie im Todeskampf verzerrt. Die Galeristin Andrea Wahrig ist sicher, mit dieser Ausstellung den ganz großen Durchbruch feiern zu können. Doch dann erhält sie einen anonymen Drohbrief: »Sagen Sie die Ausstellung ab, oder jemand, den Sie lieben, wird sterben.« Gleichzeitig zieht der Künstler seine Werke zurück und verweigert jedes Treffen. Was hat das zu bedeuten? Andrea beginnt nachzuforschen – und ahnt nicht, welcher dunkle Schatten dadurch auf sie fällt. Denn es gibt jemanden, der dafür mordet, das Geheimnis der Glasgesichter zu bewahren …
Über die Autorin:
Cordula Hamann, geboren 1959 in Hannover, arbeitete nach einer juristischen Ausbildung lange als Unternehmerin im Immobilienbereich, bevor sie begann, Thriller zu schreiben. Sie lebt mit ihrer Familie abwechselnd in Berlin und Spanien.
Cordula Hamann veröffentlichte bei dotbooks bereits ihre Thriller »Der Untergrund – Im Visier des Sandkartells« und »Wo die Angst lauert«.
Die Autorin im Internet: www.cordulahamann.de
***
Die Handlung und alle Figuren dieses Thrillers sind frei erfunden; Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen oder realen Kriminalfällen sind nicht beabsichtigt und wären rein zufällig
***
eBook-Neuausgabe Dezember 2017
Copyright © der Originalausgabe 2014 by MIRA Taschenbuch in der Harlequin Enterprises GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2017 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design, München, unter Verwendung eines Bildmotivs von shutterstock/Laurin Rinder
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ts)
ISBN 978-3-96148-110-1
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Glasgesichter« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Cordula Hamann
Glasgesichter
Thriller
dotbooks.
Kapitel 1
Marlies von Graefen war in Eile, denn wieder einmal war es im Büro viel zu spät geworden; ausgerechnet heute, wo der seit Langem vereinbarte Arzttermin anstand. Mit dem Fahrrad hastete sie durch den Feierabendverkehr der kleinen Stadt. Eine Stunde später, löste sie das Rezept in der Apotheke ein, das der Arzt ihr soeben ausgestellt hatte, und erledigte im Supermarkt gegenüber eilig ein paar Einkäufe. Dann machte sie sich auf den drei Kilometer langen Heimweg, um möglichst bald ihr Versprechen einzulösen: Ihre kleine Tochter Anna liebte Schokoladenpudding, und die kranke Oma, die auf sie aufpasste, konnte ihn im Moment nicht kochen. Marlies von Graefen hängte die Plastiktüte mit ihren Einkäufen über den Lenker und stieg auf ihr Fahrrad.
Er fuhr dicht hinter ihr. Seine Augen verfolgten die Bewegungen der Einkaufstüte, die im Rhythmus ihrer Fußtritte an den Vorderreifen schlug. Die Frau war höchstens dreißig, und sie passte hierher. Anschmiegsam, wie die gepflegten Vorgärten der Einfamilienhäuser. Ihre langen braunen Locken wehten im Fahrtwind; sie hatte es offenbar eilig. Seit Tagen schon war er die Gegend abgefahren und wusste: Dort hinten begann der Wald, an dem sie vorbeimusste.
Er ließ das Lenkrad los, hielt sich die Ohren zu und hörte sein Blut rauschen. Sein Herz hämmerte übereifrig. Rasch griff er wieder zum Lenkrad. Auch seine Gedanken beschleunigten sich, und er sah die Frau vor sich in seinem Keller an der Wand hängen. Dieses Bild jagte noch mehr Adrenalin durch seine Blutbahnen. Dabei gab es durchaus Tage, an denen sein Kopf bilderlos war. Aber das waren wenige, und dieser gehörte gewiss nicht dazu, denn das Monster hatte längst seine Arbeit begonnen. Es fraß ihn auf, bis nichts mehr von ihm übrig blieb als beherrschtes Planen, um ans Ziel zu kommen: intelligent – der Frau und allen anderen weit überlegen.
Wenn sie nicht auf ihn aufmerksam werden sollte, musste er jetzt vorbeifahren. Nicht zu langsam, aber auch nicht zu schnell. Hinter der Kurve hielt er am Straßenrand und blickte in den Rückspiegel. Er schaltete die Scheinwerfer aus, rutschte tiefer in den Sitz und verstellte den elektrischen Seitenspiegel so, dass er sie sehen konnte, sobald sie um die Kurve bog. Sie würde denken, einer, der vielleicht dringend pinkeln musste.
Alles in ihm verlangte nach Bewegung, aber er beherrschte sich. Eine mühsam antrainierte Fähigkeit. Endlich tauchte ihr Gesicht auf, ein heller Fleck in der Dämmerung, und er spannte die Muskeln an. Seine linke Hand lag auf dem Türgriff, in seiner rechten hielt er ein kleines Stück Leinen. Längst hatte er die dünnen OP-Handschuhe angezogen.
Nur noch wenige Meter. Eine Hitze stieg in ihm auf, die sich so angenehm anfühlte wie das letzte Ausfiebern nach einer Grippe, wenn man schon wusste, dass man das Schlimmste überstanden hat.
Ganz nah war sie jetzt. Ihr Kopf drehte sich zu ihm. Machte sie sich Gedanken, ob jemand im Wagen saß? Als sie direkt neben dem Auto fuhr, drückte er die Tür mit voller Kraft auf. Das Fahrrad kippte zur Seite. Mit ihm die Frau. Sie stürzte auf den Asphalt, lag halb unter dem Fahrrad. Die Tüte mit den Einkäufen platzte auf, und ein Milchkarton, Äpfel und Joghurtbecher verteilten sich auf dem Boden. Die Frau schrie auf und hielt sich ihren Ellenbogen. Sie jammerte. Was er sich einfallen ließe und wie er so rücksichtslos sein könne. Aus vor Zorn funkelnden Augen sah sie ihn an. Sie glaubte wohl, er käme, um ihr aufzuhelfen und sich zu entschuldigen. Sie musste doch sehen, wie er das Leinentuch mit dem Chloroform tränkte, und würde nun auch wissen, dass er nicht der nette, leicht verträumte Nachbar von nebenan war. Es würde der Tag kommen, an dem das nicht nur sie, sondern alle wussten.
Ehe sie sich von ihrem Fahrrad befreien und aufrappeln konnte, war er mit einem Satz bei ihr. Drückte ihren Oberkörper auf den Asphalt und presste ihr das Tuch auf Mund und Nase. Das Chloroform wirkte schnell, und ihr Kopf sank zur Seite.
Er sah sich vorsorglich um. Alles still. Inzwischen war es vollständig dunkel. Er zerrte den Körper der Frau hinter die rechte Fahrzeugseite, wo sie vor den Blicken Vorbeifahrender geschützt war. Ihr Fahrrad trug er in den Wald hinein. Drei, vier Baumreihen. Das reichte, damit es am nächsten Morgen von der Straße her nicht in der Sonne aufblitzen würde. Er rannte zurück; außer Atem stand er wieder auf der Straße.
Die Plastiktüte hatte ein großes Loch. Sie war unbrauchbar. Er fluchte und war kurz davor, auf den Milchkarton daneben zu springen und darauf herumzutrampeln. Warum hatte sie diesen blöden Kram gekauft? Doch dann gab er sich einen Ruck und sammelte die Einkäufe vom Asphalt. Ein wenig Puddingpulver blieb zurück, aber bis zum nächsten Tag würde der Wind es fortgeweht haben.
Kapitel 2
Er überlegte nicht mehr, denn in seinem Kopf war Hass, nichts weiter als blanker Hass auf die wehrlose Frau auf dem Boden vor ihm, deren Blicke um Gnade flehten und deren Mund unverständliche Worte gegen den grauen Klebestreifen presste. Sein Arm holte weit nach hinten aus. Es war nicht schwer, punktgenau ihr Herz zu treffen.
Andrea seufzte und klappte das Taschenbuch zu. Hier und jetzt rief ihr eigenes Leben. Eines schien trotzdem klar: Sie würde eine wesentlich bessere Ermittlerin abgeben als der dümmliche Kriminalkommissar ihres aktuellen Buches.
An der Haustür stoppte sie wie von unsichtbarer Hand. Es waren an die dreißig Grad, und die Luft war so staubig, dass das Atmen schwerfiel. Jeden Winter musste sie sich zusammenreißen, um nicht schwermütig zu werden. Mit jeder Faser ihres Körpers sehnte sie sich dann nach Sonne und Licht, aber heute war es selbst ihr zu heiß in Berlin.
Eine Viertelstunde später schloss sie die Tür ihrer kleinen Galerie in der Gubener Straße auf. Sie ließ wegen der Hitze die Jalousien vor dem großen Schaufenster unten und schaltete stattdessen die Decken- und Bilderbeleuchtung an. Dank ihrem »Ex«, Martin, war das Lichtkonzept der Galerie so genial, dass die Sonne am Himmel zu stehen schien, selbst wenn es draußen regnerisch und grau war. Leider hatte das Geld von Oma Pötti nicht mehr für eine vernünftige Klimaanlage gereicht.
Wie ein Iglu befand sich ihr Büroraum in der Mitte des großen Ausstellungsraumes, sodass man ihn komplett umrunden konnte. Sie selbst hatte diese Idee gehabt und nicht etwa der angehende Architekt Martin, und jeden Tag aufs Neue war sie stolz darauf. Am Schreibtisch angelangt, zog sie ihre Pumps aus. Sie hasste hochhackige Schuhe und weiße Blusen, die gebügelt werden mussten. Aber Jeans und Pulli würde sie sich in der Galerie erst leisten, wenn sie sich in der Branche einen Namen gemacht hatte. Dass dies unmittelbar bevorstand, daran hatte sie keine Zweifel.
Sie öffnete ihr MacBook und überflog prüfend den Pressetext, den sie gestern Abend begonnen hatte. Er betraf die Ausstellung eines Malers, der sehr verärgert war, um nicht zu sagen – stinksauer. Denn sie hatte seine Ausstellung zugunsten eines anderen Künstlers nach hinten verschoben. Dieser andere Künstler war Maximilian Ross, und den würde sie sich unter keinen Umständen entgehen lassen.
Das Glockenspiel ihrer Ladentür ertönte. Vorsichtig schob sie mit einem Finger die Lamellen vor ihrem Bürofenster auseinander und erschrak. Der Herr, der gerade ihre Galerie betrat, war weder ein potenzieller Kunde noch ein Künstler. Über einem kurzärmeligen Oberhemd hing eine grau gepunktete Krawatte. Viel zu schmal, um neu zu sein. Unter dem Arm klemmte eine verschlissene Collegetasche, die ihr leider nur zu bekannt vorkam. Sie seufzte, schlüpfte in ihre Schuhe, strich den Rock glatt und verließ ihr Büro. Vor einem Gerichtsvollzieher davonzulaufen wäre jetzt eher kontraproduktiv, dachte sie frustriert.
Andrea räusperte sich. »Schade, dass Sie sich nicht angekündigt haben.«
»Der Monat hat gestern begonnen, und ich muss mich keineswegs anmelden. Haben Sie die vereinbarte Summe für mich? Ansonsten muss ich nämlich darauf bestehen, dass wir heute gemeinsam das Formular der eidesstattlichen Versicherung ausfüllen.« Um seine Miene würde ihn jeder Schauspieler beneiden, der einen Blockwart der Dreißigerjahre spielen sollte.
»Zweihundert?«
Er schüttelte den Kopf. »Dreihundert. Wie immer.«
Sie ging zurück ins Büro. Allmählich tat es richtig weh, und noch immer waren mehr als achthundert Euro offen. Wer hatte auch mit einer so immensen Betriebs- und Heizkostennachzahlung rechnen können? Sie war nicht in der Lage gewesen, sie zu zahlen, und der Vermieter hatte nicht lange gefackelt. Mahnbescheid. Vollstreckungsbescheid – und dann kam der Gerichtsvollzieher. Im Gegensatz zu ihrem Vermieter hatte wenigstens der einer Ratenzahlung zugestimmt. Noch vor drei Jahren, als sie diese Räume gefunden hatte, hatte sie sich unbesiegbar gefühlt. Nach jahrelangem Unibesuch, unzähligen Jobs und der monatlichen Unterstützung der Eltern, die sie nur widerwillig angenommen hatte, war sie endlich am Ziel angekommen: eine eigene Galerie.
»Mach eine GmbH aus deiner Firma. Dann haftest du wenigstens nicht persönlich, wenn es schiefgeht«, hatte ihr Vater gesagt. Dass es schiefgehen würde, davon war er in dem Moment überzeugt gewesen, als er diesen Rat ausgesprochen hatte. Andreas italienische Mutter hatte wie immer ihren Widerspruch hinter einem sanften Kopfschütteln versteckt, anstatt gefälligst das Klischee der stolzen und temperamentvollen Südländerin zu erfüllen. Deshalb würde sich Andrea lieber die Zunge abbeißen, als ihre Eltern um Hilfe zu bitten. Sie zählte aus ihrem Portemonnaie das Geld ab und kehrte zu ihrem unliebsamen Gast zurück.
»Wie ich die nächsten Monate überstehen soll, ist mir ein Rätsel«, stöhnte sie, als sie die Ladentür hinter ihm schloss.
Kaum hatte sie sich wieder an den Schreibtisch gesetzt, schlug erneut die Türglocke. Der Briefträger übergab ihr drei Umschläge. Der erste bestand aus Werbung, die sie dankbar in den Papierkorb warf. Der zweite enthielt eine Mahnung, deren Forderung sie Gott sei Dank bereits bezahlt hatte. Sie holte tief Luft. Würde ihr Vater recht behalten? Hatte sie als junge Galeristin unter den vielen anderen dieser großen Stadt keine Chance? Ihr Vater war ein erfahrener Geschäftsmann, und sie vertraute ihm in allen anderen Dingen, nur eben von Kunst hatte er absolut keine Ahnung. Er hätte mit Sicherheit auch Einspruch erhoben gegen die Ausgaben für den teuren Kaffeevollautomaten auf ihrem Wandregal. Ein Wunderwerk der Technik, von der Andrea zwar nichts verstand, das sie aber heiß und innig liebte. Wahlweise spuckte die Maschine Espresso, Latte macchiato, Cappuccino oder Standardkaffee aus. Sie drückte den Knopf für Cappuccino.
Ja, Papa, die Zeiten, in denen du das Sagen hattest, sind vorbei. Mit geschlossenen Augen schlürfte sie den ersten Schluck und öffnete dann gut gelaunt den dritten Umschlag.
Erst traute sie ihren Augen kaum. Der nächste Gedanke war, dass es sich ebenfalls um Werbung handelte, um eine ausgefallene und witzige Werbung. Nein. Nicht witzig. Die aus einer Zeitung ausgeschnittenen und zu Sätzen zusammengeklebten Worte taten erfolgreich, was sie offensichtlich sollten: Sie machten ihr Angst.
Sagen Sie die Ausstellung von Maximilian Ross ab, oder jemand, den Sie sehr lieben, wird sterben.
Einer, der es gut mit Ihnen meint.
PS: Ihre Mutter ist eine schöne und vornehme Frau.
Andreas Herz raste. »Mama«, flüsterte sie und starrte noch immer ungläubig auf das Blatt Papier in ihren zitternden Händen. Was bedeutete das? Maximilian Ross? Was war mit ihm? Was hatte ihre Mama damit zu tun? Sie ließ sich auf den Schreibtischstuhl fallen, und je länger sie überlegte, umso stärker wurde die Überzeugung, dass sich hier jemand einen schlechten Scherz mit ihr erlaubte. Ihr Herzschlag beruhigte sich etwas. Der Umschlag war frankiert und trug einen gewöhnlichen Poststempel aus Berlin. Die Polizei. Ich muss damit zur Polizei gehen. Vielleicht können die ... Sie schüttelte den Kopf. Wahrscheinlich würden die Beamten sie auslachen. Sie war Galeristin, eine neunundzwanzigjährige Unternehmerin, die, wie die meisten der Künstler, die sie bisher ausgestellt hatte, noch ganz am Anfang ihrer Karriere stand. Wer sollte das verhindern wollen? Nein. Es konnte nur ein übler Scherz sein.
Auch für Maximilian Ross würde es die erste Ausstellung sein. Als sie vor einigen Wochen den kleinen Artikel im Berliner Stadtmagazin »tip« gelesen hatte, war für sie klar gewesen, dass sie sich sofort um ihn bemühen musste, um ihrer Konkurrenz zuvorzukommen. Das im Artikel abgebildete Werk zeigte ein auf Glas gemaltes Gesicht. Ein geöffneter Mund und aufgerissene Augen voller Angst. Besonders die Augen verfolgten Andrea noch immer. Unterhalb des Gesichts gab es nur noch Mosaike in leuchtend vollen Farben. »Werke, die den Blick des Betrachters fesseln und ihn bis in seine Träume verfolgen. Viele seiner mannsgroßen Bilder sehen aus wie Kirchenfenster«, hatte die Autorin des Artikels geschrieben. Ja, das war ein passender Vergleich, sowohl von der Farbkomposition als auch von der Form her, denn der obere Rand der Glasplatte war bogenförmig gerundet. Was Maximilian Ross bewog, einen so zerbrechlichen Untergrund zu wählen, hatte Andrea immer noch nicht erfahren, obwohl sie ihn bereits vor zwei Wochen endlich – zum Vertragsschluss hatte überreden können. Der Durchbruch ihrer kleinen Galerie. Und jetzt wollte irgendein Idiot ihr diesen madig machen?
Andrea griff zum Telefon und wählte die Nummer ihrer Eltern. Als sie die warme Stimme ihrer Mutter vernahm, atmete sie erleichtert auf. Es war alles in Ordnung. Ein böser Unsinn, mehr nicht. Lächelnd hörte sie ihrer Mutter zu, die vom neuen und gerade erblühten Rosenstock im Garten berichtete und von ihren Plänen, noch vor dem Wochenende den Vorgarten neu zu bepflanzen. Andrea sah auf die Uhr und erschrak. Himmel. In einer Viertelstunde war sie mit Ross zu einem abschließenden Gespräch verabredet. »Mama, ich muss Schluss machen. Morgen schaffe ich es nicht zu kommen. Aber wir sehen uns auf jeden Fall am nächsten Wochenende«, beendete sie das Gespräch. Schnell nahm sie die Skizze, die sie für die Verteilung der großen Glasplatten im Raum vorbereitet hatte. Je länger sie sich damit beschäftigte, umso mehr verschwand auch der Rest ihrer Sorge. Die Vorstellung, wie die Werke ihre Galerie ausfüllen würden, wirkte wie ein Blasebalg, der aus einer Glut kleine Flammen werden ließ und gleichzeitig die Beunruhigung wegen des merkwürdigen Briefes davonpustete. Bereits am Vortage hatte sie mit einer Firma das Konzept für Lichtwände aus Spannstoffen erörtert, mit denen sie die Galeriewände auskleiden wollte. Das großflächige indirekte Licht würde das i-Tüpfelchen für die Wirkung der Glasbilder sein.
Als Maximilian Ross die Galerie betrat, holte Andrea die Erinnerung an den Brief schlagartig wieder ein. Sah so ein Mann aus, der irgendjemandem so viel Angst oder Ärger machen konnte, dass dieser Jemand Drohbriefe schrieb? Sicher, seine Werke waren ungewöhnlich, und sie hatte bisher nur einige Originale, die anderen lediglich als Hochglanzfotos, gesehen. Aber der junge Mann vor ihr gab eher das Bild eines in sich gekehrten, leicht vergeistigten Künstlers ab. Und das war gerade in ihrer Branche absolut nichts Ungewöhnliches. Sie zwang sich, die Gedanken an den Brief beiseitezuschieben und sich voll und ganz auf den Maler zu konzentrieren. Sie wusste noch viel zu wenig von ihm.
Maximilian schritt langsam die Wände ab und besah sich die verbliebenen Aquarelle der Künstlerin Barbara Krug. Sein Gesicht verfinsterte sich zusehends.
»Diese Art Bilder haben Sie bisher ausgestellt?«
»Nein, keineswegs. Es war ... Diese Ausstellung ist eher die Ausnahme.«
Zu einem Vertrag mit der Aquarellmalerin hatte Martin sie ermuntert. Gegen ihren inneren Widerstand hatte sie sich überzeugen lassen, weil es vernünftig klang, wie er argumentiert hatte. Als ob Kunst etwas mit Vernunft zu tun hatte. »Du klingst wie mein Vater«, hatte sie ihm vorgeworfen, und er hatte sich daraufhin gekränkt zurückgezogen. Ein weiterer kleiner Riss in ihrer Beziehung. Dabei hatten die Zahlen ihm recht gegeben, und sie machte durch die Menge bei diesen relativ niedrigen Preisen mehr Umsatz als mit den Werken ihrer bisherigen anspruchsvolleren Künstler.
»Und wie sehen die Bilder aus, wenn sie keine Ausnahmen sind?«, fragte Maximilian Ross mit einem feindseligen Unterton in der Stimme. Es war verständlich, dass ein Künstler bei der Wahl der ausgestellten Werke sicher nicht Martins Rentabilitätsargumenten folgen würde. Hätte sie schließlich auch nicht getan, wäre sie eine ... Sie verbot sich diesen Gedanken sofort wieder. Es war das bisher schmerzhafteste Eingeständnis ihres Lebens gewesen, nicht gut genug für eine Karriere als Malerin zu sein. Sie beeilte sich, Maximilian den Entwurf des Ausstellungsprospekts für Rüdiger Hauswald zu zeigen.
»Ja«, sagte er nur, während er die Fotos betrachtete. Er ließ sich Zeit, bevor er die Musterung der Werke seines Konkurrenten beendete und die Fotos betont langsam zusammenschob. Er korrigierte ihre Lage so oft, bis die Kanten ordentlich übereinander lagen, und reichte sie Andrea zurück. »Ja«, sagte er wieder und setzte sich auf den ihm angebotenen Stuhl.
»Ich brauche noch etwas mehr Information, Herr Ross. Über Ihre Arbeit, Ihre Intentionen, Ihre Person. Und ich muss für die Befestigungen wissen, wie viele Glasbilder es nun sein sollen. Sind sie alle gleich groß?«
»Ja, der Preis beim Glaser für das Schneiden der Platten war günstiger. Obwohl ich bei den Kindern die Platten gerne kleiner gehabt hätte. Aber zu dem Zeitpunkt war ich wieder einmal etwas knapp bei Kasse.«
»Sie haben die Glasplatten alle auf einmal gekauft?«
»Ja.«
»Sie wussten also schon zu Beginn« – wann entstand überhaupt das erste dieser Bilder? –, »dass Sie mehrere dieser Werke malen wollen?«
»Denken Sie daran, dass ich bei der Ausstellung auch auf der Präsentation meiner übrigen Bilder, meiner eigentlichen Werke, bestehe?«
»Selbstverständlich. Wie wir es besprochen haben. Wir können nachher durch die Räume gehen und die Präsentation im Einzelnen festlegen. Aber jetzt noch einmal zu den ...«
»Glasbildern. Ich weiß«, setzte er seufzend fort. »Es sind derzeit elf fertige und ein angefangenes, das sicher noch vor der Ausstellung fertig sein wird. Das erste entstand bereits vor sieben Jahren.«
»Was passierte vor sieben Jahren? Was passierte in Ihrem Leben vor sieben Jahren? Ich meine, was war der Anlass für ...?«
»Ich habe Sie schon verstanden. Aber warum und wann genau ich begonnen habe, muss der Betrachter meiner Bilder nicht wissen.«
Oje. Wie sollte sie ohne Mithilfe des Künstlers diesen vermarkten? Was, wenn er auch bei Interviews so abweisend sein würde? Andererseits war divenhaftes Verhalten in der Künstlerszene weiß Gott kein Einzelfall.
»Sie wollen unsere Kunden nicht durch solche Informationen beeinflussen, nicht wahr?«, schwenkte sie schnell ein.
»Das haben Sie gut formuliert, aber, wie ich Ihnen schon bei unserem ersten Treffen sagte, muss ein Bild von sich aus zu dem jeweiligen Betrachter sprechen. Tut es das nicht, ist es schlecht, wobei man über die Qualität dieser Sprache natürlich streiten kann.« Dabei sah er provozierend durch die geöffnete Bürotür auf eines der Aquarelle.
Andrea unternahm einen erneuten Versuch: »Offensichtlich haben Sie sich vom Sterben eines Menschen, also vom Tod allgemein inspirieren lassen. Das sieht der Betrachter. Trotzdem ist es für die Kunden durchaus von Interesse, weshalb ein Künstler sich einem Thema besonders annimmt. Zumal, wie in Ihrem Fall, dieser Tod oftmals gewaltsam erlebt wird. Außer bei den Kindern.«
»Das stimmt nicht. Ich habe insgesamt drei Kinder gemalt. Nur eines von ihnen scheint schlafend.«
»Auch ein Mädchen?«
»Ja, zwei Jungen und ein Mädchen.«
»Haben Sie die Fotos von allen Platten dabei, damit ich den Verteilungsplan erstellen kann?«
Maximilian griff in seine Umhängetasche und hielt ihr einen Briefumschlag entgegen. »Sprechen wir jetzt über meine übrigen Bilder.«
Andrea unterdrückte nur mit Mühe den Impuls, den Umschlag zu öffnen, und wandte sich der bereits vorbereiteten Aufstellung seiner Leinwandbilder zu. Die meisten seiner Werke wiesen eine Impasto-Technik auf, entweder mit Pinsel oder Spachtel aufgetragen. Die Farbkompositionen standen im Widerspruch zu den Glasbildern, die dagegen regelrecht bunt wirkten. Kalte und dunkle Farben herrschten vor. Die Motive waren stets ein oder zwei menschliche Körperteile, die sich gegen abstrakte Formen und Linien abhoben.
Den würde ich nicht küssen wollen, dachte sie beim Anblick eines der Bilder. Es zeigte weich geschwungene Linien eines formvollendeten, überdimensional großen Kussmundes. Seine grauschwarzen Lippen waren durch Risse entstellt und erinnerten Andrea an eine ausgetrocknete Wildschwein-Suhle in den Wäldern Berlins. Nur Minuten später hatten sie gemeinsam die Verteilung der Bilder in der Galerie festgelegt.
»Das Glasbild, das Sie im Wohnzimmer bei mir gesehen haben, ist inzwischen fertiggestellt«, unterbrach Maximilian ihre Gedanken. Dass er von sich aus noch einmal auf die Glasbilder zu sprechen kam, überraschte und freute sie.
»Ich suche noch nach dem perfekten Model für ein letztes, und dann wird dieser Malabschnitt der Vergangenheit angehören. Ich hoffe, Sie helfen mir durch eine Präsentation, die Aufmerksamkeit auf diejenigen Bilder zu richten, die mir wichtig sind. Am liebsten wäre es mir, wir würden die Glasbilder ganz sein lassen.«
»Wir waren uns darüber bereits einig. Eine Ausstellung bei mir wird es nur mit diesen Exponaten geben.«
Weshalb erkennt er denn nicht, welch immenser Wert in seinen Todesgesichtern liegt? Seine anderen Bilder waren ja nicht schlecht, aber in ihrer Wirkung auf die Kunden würden sie kein Vergleich sein. Andrea suchte fieberhaft nach den richtigen Worten, um ihn am Reden zu halten. »Gibt es überhaupt ein perfektes Model für diese Art von Bildern?«
Er antwortete nicht, aber das erste Mal während ihrer Besprechung deutete sein Mund ein Lächeln an. Mit Sicherheit galt es allerdings nicht ihr, sondern jemandem oder etwas jenseits dieses Raumes. Er stand auf. »Würden Sie mir bitte den Plan per Mail senden. Ich möchte gerne vorher ...«
»Selbstverständlich. Ich warte nur noch auf die Vorschläge einer Firma hinsichtlich der Befestigungsmöglichkeiten für die schweren Glasplatten.«
Während Andrea ihn an der Tür verabschiedete, überlegte sie, vor welchen Herausforderungen ein perfektes Model bei diesem Maler wohl stehen würde. Eines war sicher: Der Mann oder die Frau, je nachdem, wen sich Maximilian als letztes Motiv vorstellte, war nicht zu beneiden.
Die Erinnerung an den merkwürdigen Brief mischte sich mit einer diffusen Angst, die sich in ihr ausbreitete. Und obwohl ihr durch die geöffnete Tür Hitze entgegenschlug, fröstelte sie.
Kapitel 3
Er zog die Frau, die nicht viel wog, auf die Rückbank und schloss die Tür. Wieder sah er sich um. Nur wenige hundert Meter weiter begann ein Waldweg. Sicherlich benutzten ihn Förster, Jäger oder Waldarbeiter, denn er hatte dort Reifenspuren gesehen. Auf diesem fuhr er in den Wald, bis er die Straße im Rückspiegel nicht mehr sehen konnte. Ein Liebespaar im Auto, falls doch jemand kommen sollte. Er stoppte den Motor und schaltete die Innenbeleuchtung ein. Aus der Flasche zwischen den Sitzen goss er Wasser in einen durchsichtigen Becher. Er drehte sich um und schätzte ihr Gewicht. Höchstens fünfundfünfzig Kilo. Das machte sechseinhalb Tabletten aus der Schachtel im Handschuhfach. Er konnte die Dosierung inzwischen wie im Schlaf umrechnen, wie er überhaupt alles mit der Präzision tat, die er sich in den Jahren angeeignet hatte. Er schwenkte das Plastikglas hin und her, damit die Tabletten sich besser auflösten, und setzte sich neben die Frau auf die Rückbank. Ihren Kopf bettete er auf seine Oberschenkel. Einen kurzen Moment musste er an die perversen Typen denken, die die Situation ausgenutzt hätten. Es wäre ganz leicht, denn sie schlief und trug nur einen mittellangen bunten Rock. Aber so einer war er nicht. Niemals gewesen. Er hatte ganz andere Ziele. Nicht die schnelle Befriedigung. Er schaffte etwas für die Ewigkeit. Geduldig wartete er, bis die Wirkung der Betäubung nachließ. Das dauerte nie lange. Dabei ließ er weder die Frau noch das Messer in der Türablage aus den Augen.
Allmählich beruhigten sich auch seine Sinne. Das war immer so, wenn sie nicht mehr fliehen konnten. Doch er wusste auch: Das Monster ruhte sich nur aus. Sammelte Kraft für später, auf seinem Hof, im Gewölbe, wo ihm alles gelang und er alles bestimmte. Er wünschte wirklich, sein Vater würde einmal dabei sein. Natürlich würde der nicht freiwillig kommen. Aber auf einen Stuhl gefesselt könnte er endlich sehen, zu was sein Sohn fähig war. Etwas, das ein Weichei, wie sein Vater ihn immer genannt hatte, niemals fertigbrächte. Und er könnte ihm endlich beweisen, dass es damals nicht seine Schuld gewesen war.
Die braunen Locken bedeckten den Kopf der Frau wie eine Decke. Sie bewegte sich und schlug einen Augenblick später die Augen auf. Sie richtete sich auf und griff nach dem Hebel, der die Autotür öffnete, die er längst durch die Kindersicherung verriegelt hatte. Die Frau sah an sich herunter, dann starrte sie ihn an, und er konnte in ihren Augen die Verwunderung darüber lesen, dass sie noch heil war und er ruhig neben ihr saß. Sie öffnete den Mund. Da zog er das Messer aus der Sitztasche, und ehe sie reagieren konnte, saß er auf ihr und hielt ihr das Messer an die Kehle.
»Bitte lassen Sie mich doch ... meine kleine Tochter ...« Mehr sagte sie nicht. Nur ihre Augen sprachen weiter mit ihm.
Er griff in den Fußraum nach dem Wasserbecher. »Trink das.« Sie presste die Lippen aufeinander, als er ihr das Glas an den Mund hielt.
»Trink, sonst steche ich zu.«
In ihren Augen sammelten sich Tränen. »Anna«, flüsterte sie.
Er wollte ihren Namen nicht kennen. Namen gehörten zu Individuen, einem Verwandten, der Hauskatze oder von ihm aus auch zu einem Hofköter. Hier ging es um etwas Grundsätzliches, das viel zu erhaben war, als ihm einen beliebigen Namen zu geben.
»Trink, dann tu ich dir nichts«, beruhigte er sie. Der Weg nach Hause dauerte lang, und er hatte keine Lust, ihr jetzt schon mehr als nötig Angst zu machen.
Sie wollte noch immer nicht trinken, und er drückte das Messer in ihre zarte Haut. Nicht zu stark, denn er konnte kein Blut sehen. Davon hatte er als Kind genug beim Schlachten gehabt. Einmal hatte sich eine beim Fallen eine Schramme geholt. Langsam war das Blut ihre Stirn hinuntergelaufen und auf seine Hand getropft. Er war so verstört gewesen, dass er die Frau beinahe hatte laufen lassen.
Er drückte etwas fester zu. Endlich trank sie. Mit langsamen Schlucken, bis der Becher leer war. Er ließ ihren Mund nicht aus den Augen. Manchmal taten sie nur so, als hätten sie getrunken, und spuckten ihm dann das Wasser ins Gesicht, und er musste noch einmal von vorn anfangen. Seither schob er den Kopf nach hinten und drückte mit Daumen und Fingern ihre Münder auf, um nachzusehen, ob sie wirklich geschluckt hatten. Diese war brav und versuchte gar nicht, ihn zu täuschen. Ab jetzt war es einfach. Er musste nur sitzen bleiben und warten, bis sie müde wurde. Das dauerte höchstens eine Viertelstunde. Die meisten wollten nun mit ihm sprechen. Er ließ sie reden, hörte nicht zu, beantwortete keine ihrer Fragen. Dieses Ausblenden einer menschlichen Stimme hatte er bei Beate gelernt, lernen müssen, um ab und zu seine Ruhe zu haben. Außerdem würde die Frau sowieso nicht verstehen, was er vorhatte. Nicht, weil sie zu dumm war, sondern weil sich niemand darauf vorbereiten konnte. Beate hatte es nicht gekonnt und Mutter auch nicht. Deshalb waren ihre Gesichter so fassungslos gewesen. In nur einer Sekunde hatten sie begriffen, dass das Leben zu Ende war, hatten ihn angesehen und gehofft, dass er ihnen helfen konnte. Eine Hoffnung, gestorben in dem Moment, in dem sie entstanden war. Dabei hatte er erst alles versucht, um sie zu retten. Doch dann war er ruhig geworden. Er hatte nur noch zugesehen, und irgendwie hatte es sich richtig angefühlt.
Jetzt schlief sie. Er schlug ihr mit der flachen Hand noch ein paarmal leicht auf die Wangen. Keine Reaktion mehr, kein Augenzucken. Dann löste er sich aus der unbequemen Sitzposition, legte die junge Frau längs auf die Rückbank und deckte sie mit einer Wolldecke zu. Ihren Kopf drehte er zur Seite, falls sie sich würde übergeben müssen. Dann kletterte er nach vorn und stieg durch die Fahrertür aus. Tief atmete er die klare Luft ein. Seine Blase drückte. Noch hundert Kilometer bis nach Berlin. Dort einkaufen und dann weiter auf den Hof. Er pinkelte an einen Baum, presste jeden Tropfen heraus, bis nichts mehr kam. Und mit einem Mal fühlte er wieder das Leben. Frei und leicht.
Die Unterbrechung in Berlin kostete Zeit. Hatte er die? Aber er brauchte dringend Material, besonders neue Farben. Zu dumm, dass er das nicht vorher erledigt hatte. Doch die Gelegenheit war heute viel zu günstig gewesen.
Er parkte in einer Seitenstraße. Vorsichtig zog er die Wolldecke auch über das Gesicht der Schlafenden. Dann hastete er zu dem Fachgeschäft, in dem er immer einkaufte. Trug eilig in dem kleinen Einkaufskorb alles zusammen, was auf dem zerknitterten Zettel stand, den er heute früh in seine Hosentasche gestopft hatte. Die Verkäuferin wollte mit ihm reden. Über seine neuen Bilder, ob endlich eine Ausstellung in Sicht sei und dass sie kürzlich von einer erfolgreichen Vernissage eines völlig unbekannten Malers gehört hätte. Also, es ginge doch. Selbst in der Großstadt Berlin. Er müsse nur am Ball bleiben und die Hoffnung nicht aufgeben. Er nickte mehrmals und bemühte sich um eine freundliche Ausstrahlung, sprach selbst kein Wort.
Mit den Einkäufen rannte er förmlich zurück zum Auto. Die Rückbank zeigte sich unverändert. Vorsorglich legte er für eine bessere Atmung ihren Kopf wieder frei. Dann fuhr er durch die Straßen Charlottenburgs Richtung Stadtautobahn. Nur endlich heraus aus der Stadt, nach Norden, bis die Reifen des Wagens über die Einfahrt seines Hofes holperten und ihn daran erinnerten, wie sehr der letzte Winter dem Pflaster vor dem Haus zugesetzt hatte. Auch die betonierte Fläche des Innenhofes zeigte breite Risse, durch die bereits das Unkraut wucherte. Aber körperliche Arbeit war noch nie seine Sache gewesen. Wie in so vielen anderen Dingen war er auch der Statur nach nicht nach seinem Vater geraten. Der war über einen Meter neunzig groß und an die hundert Kilo schwer. Das passte. Wer würde schon Schweinebauch und Rippchen in einer Fleischerei kaufen, wenn der Metzger ein Hämeken war? Vater und er zusammen im selben Betrieb? Das hätte nur böses Blut gegeben.
Er parkte das Auto und drehte sich zu der Frau auf der Rückbank um. Sie lag noch genauso, wie er sie gebettet hatte. Er schloss das große Tor zur Straße und öffnete die Scheune, stieg die Treppe hinunter und drückte mehrere Lichtschalter. Die helle Deckenbeleuchtung brauchte er wenigstens so lange, bis die Gurte festsaßen.
Er hätte etwas essen sollen. Sein Magen knurrte, und mit einem Mal waren ihre fünfundfünfzig Kilo ziemlich schwer. Er hob ihren Körper und presste ihn zwischen die Wand und seinen Bauch. Mit einer Hand hielt er sie fest und schob ihre Arme mit der anderen Hand in die Schlaufen, bis die passend unter ihren Achseln saßen. Jetzt trug die Mauer das Hauptgewicht, und der Bauchgurt ließ sich blitzschnell anziehen. Zum Schluss noch Beine, Fußgelenke, Kopf und die Ellenbogen, die zu justieren am schwierigsten waren. Sie sollten sich mit den Unterarmen und den Händen bewegen können, aber nur vierzig Zentimeter nach vorn. Mehr nicht. Er ächzte vor Anstrengung, und der Schweiß lief ihm vom Haaransatz auf die Stirn.
Noch immer schlief die Frau tief und fest. Sanft zeichnete er mit den Fingerkuppen ihre Gesichtsform nach, von der Stirn bis nach unten zu ihrem Mund. Er sammelte Spucke in seinem Mund und gab sie mit der Zunge auf seine Finger. Mit vorsichtigen Bewegungen fuhr er ihre gut durchbluteten Lippen entlang, bis sie im weißen Licht der Deckenlampen glänzten. Er griff zur Zerstäuberflasche, die neben ihm auf dem Steinfußboden stand, und sprühte feinen Wassernebel auf Stirn und Haaransatz der Frau. Ihre dunklen Locken wurden noch dunkler, und er zog ihr ein paar nasse Strähnen über die Stirn weiter hinein ins Gesicht. Dann trat er ein paar Schritte zurück und betrachtete seine Arbeit. Sie würde ein gutes Bild werden. Er war zufrieden und kontrollierte die Uhr. Zeit genug, um von oben das Essen und den Wein zu holen, und sogar, um im Internet nachzusehen, ob sein Brief bereits Wirkung gezeigt hatte. Wahrscheinlich eher nicht. Er hätte ihn drängender machen müssen. Doch dann wäre die Galeristin sofort zur Polizei gegangen. Und obwohl die ihm nichts anhaben konnte, beunruhigte der Gedanke daran.
Er beeilte sich, denn er musste auch noch den Raum vorbereiten. Kerzen erneuern, und auf der schmalen Pinselablage der Staffelei fehlte eine frische Rose, von denen es genug auf seinem Grundstück gab, Buschrosen von saftig roten Blüten. Sie dufteten nicht. Aber wen interessierte das? Die Frau würde sie nicht lange riechen können, und ihm waren Gerüche noch nie wichtig gewesen. Die Augen waren seine Werkzeuge und natürlich die Hände.
Mit einem Wurstbrot, einem Ast blühender Rosen und einem Glas Weißwein in den Händen stieg er nach einer Viertelstunde erneut in den Keller. Voller Erwartung galt sein erster Blick der Frau. Sie hatte die Kopfhaltung etwas verändert, aber ihre Augen waren noch immer geschlossen. Ihre Lippen hatten sich leicht geöffnet und entließen einen dünnen Speichelfaden aus dem Mundwinkel. Er stellte Weinglas und Brotteller auf einen runden Gartentisch, den er vorsichtig näher an die Wand schob. Die Eisenfüße hinterließen hässliche braune Flecken auf dem Steinfußboden, den er jede Woche säuberte und blank polierte. Ob noch Zeit war, sie zu entfernen? Nein. Viel wichtiger waren die Kerzen. Aus einem Weidenkorb unter der Treppe zählte er dreißig dunkelrote Kerzen ab und tauschte sie gegen die fast vollständig abgebrannten Stummel in den Kerzenhaltern an den Wänden. Auch wenn er inzwischen Übung darin hatte, dauerte es fast zehn Minuten.
Er rückte seinen Regiestuhl zurecht, bis er die richtige Position frontal vor der Frau fand, und setzte sich. Er hatte diesen Stuhl zufällig in einem Auktionshaus gesehen und sich sofort in ihn verliebt. Angeblich sollte Roland Emmerich darauf gesessen haben, aber der Auktionator hatte mit Sicherheit gelogen, was ihm ganz egal gewesen war. Er hatte nun jedenfalls einen Regiestuhl. Ein Regisseur war der Gott unter den Filmleuten. Ihm gehorchte man, und er war der Einzige, der das große Ganze verstand. Sein Geist verband sich mit allem, was die Nachwelt auf der Leinwand für immer bewundern konnte. Wieder bewegte sich die Frau. Ein leichtes Flackern unter ihren Augenlidern kündigte an, dass sie bald erwachen würde. Sie hing so gerade in den Gurten, als sei sie mit hunderten von Nägeln mit der Wand verbunden, anstatt mit nur elf einfachen Ledergurten. Ja, auch er war ein guter Regisseur.
Es kribbelte überall in seinen Armen und Beinen, und er zwang sich zu extrem langsamen Kau- und Schluckbewegungen. Die Ruhe vor dem Sturm. Eine tiefe Freude erfasste ihn, wie immer, wenn es ihm gelang, die innere Unruhe unter der äußeren Hülle einzuschließen. Wie ein Kater, der eine Ratte entdeckte. Und nur das kaum wahrnehmbare Vibrieren einiger Haarspitzen verriet die Kraft, die in dem bewegungslosen Tier steckte. Völlige Selbstbeherrschung und Konzentration auf das Wesentliche. So saß er da, nahm gelegentlich einen Schluck Wein, aß ein Stück Brot und wartete.
Kapitel 4
Maximilian legte den Pinsel beiseite und ging ins Bad. Er presste das Handtuch an sein Gesicht und sog den Duft des Frotteestoffes tief ein: die Frische einer angeschnittenen Limone und ein Hauch würziges Rosenholz. Wenigstens dieser Geruch seiner Mutter sollte von allen verlorenen Dingen der Kindheit erhalten bleiben. Der Duft tröstete, schob dunkle Gedanken beiseite und ließ die hässliche Parterrewohnung in Berlin-Kreuzberg um ein Vielfaches heller erscheinen. Er sehnte sich nach einer luftigen Atelierwohnung, die das Wort verdiente und von denen es gerade in Berlin sehr viele gab; leider nicht für ihn und seine mäßigen Einkünfte aus dem Verkauf seiner Bilder auf den Straßenfesten. Wenn es ihm eines Tages vergönnt wäre, aus dem Fenster über die Dächer der Stadt zu sehen, würde er vielleicht darauf verzichten, jeden Morgen das Parfum zu versprühen.
Mit dem Handtuch vor seinem Gesicht träumte er vom elterlichen Hof. So wie er es auch tat, wenn die Ein-Euro-Jobber im Volkspark Friedrichshain den Rasen mähten. Dann sah er vor sich die Felder rund um sein Dorf, so weit das Auge reichte, und sah sich selbst seine ersten Bilder in den Sand malen. Bilder von kleinen Brüdern oder Schwestern. Später hatte er einen imaginären besten Freund gemalt.
Er ging zurück ins Wohnzimmer, in dem er notgedrungen auch schlief, denn Malutensilien und seine Werke füllten den zweiten Raum der Wohnung komplett aus, setzte sich an den Tisch und starrte die Farbspritzer auf der Tischplatte an. Andrea Wahrig machte einen ehrlichen Eindruck. Er wollte ja Maler sein. Wollte damit wenigstens so viel verdienen, dass er eines Tages aus diesem Loch hier herauskam. Aber er spürte, dass die Entscheidung falsch gewesen war, ihr, überhaupt irgendjemandem, seine Glasbilder anzuvertrauen. Es war viel zu gefährlich, um damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Ich muss besser aufpassen, wenn ich die Farben mische. Die Kleckse bekam er aus dem Holz nicht mehr heraus. Acrylfarbe, wasserfest, wenn sie erst einmal getrocknet war. Es gab auch wasserlösliche Acrylfarben. Aber er wollte dauerhafte Bilder, keine, die man einfach wieder so vom Glas wischen konnte.
Ein Hungergefühl ließ ihn in die Küche gehen und den Kühlschrank öffnen, um festzustellen, dass der bis auf Margarine und zwei Apfelsinen leer war. Er griff nach den Schlüsseln und lief auf die Straße in Richtung des nahe gelegenen Supermarktes.
»Entschuldigung«, sagte die junge Frau und ließ den Beutel Pommes nicht los.
»Entschuldigung«, sagte er im selben Moment und zog seine Hand zurück. Sein Blick blieb an ihren Augen hängen. Graublau, trotzdem leuchteten sie. Er fand ihr Gesicht hübsch, wenn es auch im Moment trotzig, beinahe kindlich wirkte. Eine braune Locke fiel über ihre Augen, und sie pustete sie zur Seite weg.
»Nehmen Sie ruhig die letzte Tüte.« Er würde eben Nudeln essen.
»Danke.« Der Trotz verschwand aus ihrem Blick.