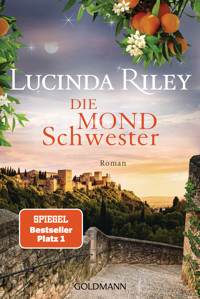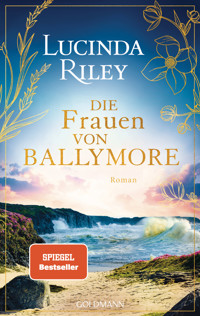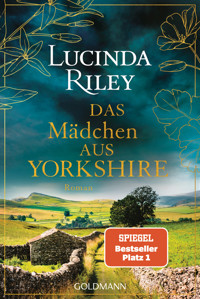11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als der berühmte Schauspieler Sir James Harrison in London stirbt, trauert das ganze Land. Die junge Journalistin Joanna Haslam soll in der Presse von dem großen Ereignis berichten und wohnt der Trauerfeier bei. Wenig später erhält sie von einer alten Dame, die ihr dort begegnet ist, einen Umschlag mit alten Dokumenten – darunter auch einen Liebesbrief voller mysteriöser Andeutungen. Doch wer waren die beiden Liebenden, und in welch dramatischen Umständen waren sie miteinander verstrickt? Joannas Neugier ist geweckt, und sie beginnt zu recherchieren. Noch kann sie nicht ahnen, dass sie sich damit auf eine Mission begibt, die nicht nur äußerst gefährlich ist, sondern auch ihr Herz in Aufruhr versetzt – denn Marcus Harrison, der Enkel von Sir James Harrison, ist ein ebenso charismatischer wie undurchschaubarer Mann ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 725
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Buch
Als der berühmte Schauspieler Sir James Harrison in London stirbt, wird die junge Journalistin Joanna Haslam auf die Trauerfeier geschickt, um in der Presse darüber zu berichten. Wenig später erhält sie von einer alten Dame, die ihr dort begegnet ist, ein Kuvert mit Dokumenten – darunter auch ein Liebesbrief voller mysteriöser Andeutungen. Doch wer waren die beiden Liebenden, und in welch dramatischen Umständen waren sie miteinander verstrickt? Joanna beginnt zu recherchieren und begibt sich damit auf eine Mission, die nicht nur gefährlich ist, sondern auch ihr Herz in Aufruhr versetzt – denn Marcus Harrison, der Enkel von Sir James Harrison, ist ein ebenso charismatischer wie undurchschaubarer Mann ...
Weitere Informationen zu Lucinda Riley sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buches.
Lucinda Riley
Der verbotene Liebesbrief
Roman
Deutsch von Ursula Wulfekamp
Für Jeremy Trevathan
Königsgambit
(Eröffnung, bei der Weiß zur Ablenkung eines schwarzen Bauern ein Bauernopfer bringt.)
Prolog
London
20. November 1995
»James, mein Lieber, was machst du hier?«
Verwirrt sah er sich um, machte ein paar Schritte vorwärts und geriet ins Stolpern.
Sie fing ihn auf, ehe er zu Boden stürzte. »Du hast geschlafwandelt, stimmt’s? Komm, ich bring dich wieder ins Bett.«
Die sanfte Stimme seiner Enkeltochter sagte ihm, dass er noch auf der Erde war. Er wusste, dass er aus einem bestimmten Grund aufgestanden war, dass er etwas Dringendes tun musste, etwas, was er bis zum allerletzten Moment aufgeschoben hatte …
Aber jetzt wollte es ihm nicht mehr einfallen. Unglücklich ließ er sich von seiner Enkeltochter zum Bett zurückführen, fast trug sie ihn. Er verabscheute seinen abgezehrten, gebrechlichen Körper, der ihn hilflos machte wie ein Neugeborenes, und seinen verwirrten Kopf, der ihn wieder einmal im Stich gelassen hatte.
»Alles wieder gut«, sagte sie und legte fürsorglich die Decke um ihn. »Was machen die Schmerzen? Soll ich dir noch ein bisschen Morphium geben?«
»Nein, bitte, ich …«
Es war das Morphium, das Löcher in sein Gehirn fraß. Morgen würde er keins nehmen, und dann würde ihm wieder einfallen, was er noch zu erledigen hatte, ehe er starb.
»Also gut. Und jetzt versuch zu schlafen«, sagte sie besänftigend und streichelte ihm über die Stirn. »Der Arzt wird gleich kommen.«
Er wusste, dass er nicht einschlafen durfte. Er schloss die Augen und dachte angestrengt nach … Erinnerungsfetzen, Gesichter …
Dann sah er sie, so deutlich wie an dem Tag, als er ihr das erste Mal begegnet war. Wunderschön war sie, und so zart …
»Weißt du noch? Mein Liebling, der Brief«, flüsterte sie. »Du hast versprochen, ihn zurückzugeben …«
Natürlich!
Er öffnete die Augen und wollte sich aufsetzen, sah aber nur das besorgte Gesicht seiner Enkeltochter, die sich zu ihm herabbeugte. Im nächsten Moment spürte er einen schmerzhaften Stich in der Ellenbeuge.
»Der Doktor gibt dir was, damit du nicht mehr so unruhig bist, James, Lieber.«
Nein! Nein!
Seine Lippen konnten die Worte nicht formen, und als das Morphium durch seinen Körper floss, wusste er, dass er es zu lange hinausgezögert hatte.
»Es tut mir so leid, so unendlich leid«, keuchte er.
Seine Enkeltochter sah, wie sich seine Lider endlich schlossen und die Anspannung aus seinem Körper wich. Sie schmiegte ihre glatte Wange an sein Gesicht und bemerkte, dass es tränennass war.
Besançon, Frankreich
24. November 1995
Langsam betrat sie das Wohnzimmer und ging zum Feuer. Es war kalt heute, und ihr Husten hatte sich weiter verschlimmert. Vorsichtig ließ sie sich auf einem Stuhl nieder und nahm die neue Ausgabe der Times zur Hand, um zu ihrem gewohnten englischen Frühstückstee die Nachrufe und Todesanzeigen zu lesen. Als ihr Blick auf die Schlagzeile fiel, die ein ganzes Drittel der ersten Seite füllte, landete ihre Tasse klirrend auf der Untertasse.
LEBENDE LEGENDE GESTORBEN
Sir James Harrison, den viele für den größten Schauspieler seiner Generation halten, ist gestern im Kreis der Familie in seinem Haus in London gestorben. Er wurde 95Jahre alt. Die Beisetzung findet kommende Woche im engsten Kreis statt, im Januar wird in London ein Gedenkgottesdienst abgehalten.
Ihr stockte das Herz, die Zeitung in ihrer Hand zitterte derart heftig, dass sie den restlichen Artikel kaum lesen konnte. Unter dem Text war ein Foto von ihm, wie er von der Queen mit dem britischen Verdienstorden ausgezeichnet wurde. Sie betrachtete das Bild, das sie durch den Tränenschleier nur verschwommen sah, und fuhr sein kraftvolles Profil und seine ergraute Haarmähne mit den Fingern nach.
Konnte sie zurückkehren? Konnte sie es wagen? Ein letztes Mal nur, zum Abschied?
Während ihr Morgentee ungetrunken kalt wurde, blätterte sie auf die nächste Seite und las den Artikel weiter, ließ die einzelnen Stationen seines Lebens und seiner Karriere Revue passieren. Dann fiel ihr Blick auf eine kleinere Schlagzeile darunter:
RABEN VON TOWER VERSCHWUNDEN
Gestern Abend wurde bekannt gegeben, dass die berühmten Raben des Londoner Tower verschwunden sind. Der Legende nach leben die Vögel dort seit über fünfhundert Jahren und bewachen, wie von Karl II. verfügt, den Tower und die Königsfamilie. Der Hüter der Raben wurde gestern Abend auf ihr Fehlen aufmerksam, eine landesweite Suche wurde eingeleitet.
»O Gott, steh uns bei«, flüsterte sie, und Angst machte sich in ihrem alten, gebrechlichen Körper breit. Vielleicht war es reiner Zufall, aber sie kannte die Bedeutung der Legende nur allzu gut … Stand wirklich der Untergang des Königreichs bevor?
Kapitel 1
London
5. Januar 1996
Keuchend und mit rasselnder Lunge rannte Joanna Haslam durch Covent Garden. Immer wieder musste sie Touristen und Grüppchen von Schulkindern ausweichen und hätte mit ihrem Rucksack über der Schulter fast einen Straßenmusiker umgerissen. Sie erreichte die Bedford Street, als gerade eine Limousine vor dem schmiedeeisernen Tor zur St. Paul’s Church anhielt. Fotografen drängten sich um den Wagen, als der Chauffeur ausstieg und den Verschlag öffnete.
Verdammt! Verdammt!
Mit letzter Kraft sprintete Joanna die wenigen Meter zum Tor und über den gepflasterten Innenhof; die Uhr an der roten Ziegelfassade der Kirche bestätigte ihr, dass sie zu spät kam. Während sie auf den Eingang zusteuerte, ließ sie den Blick über die Schar der Paparazzi schweifen. Steve, ihr Fotograf, hatte tatsächlich einen Logenplatz hoch oben auf den Stufen ergattert. Sie winkte ihm zu, er wünschte ihr mit dem Daumen nach oben viel Glück, und sie zwängte sich durch das Gedränge der Fotografen, die die berühmte Persönlichkeit aus der Limousine umlagerten. Beim Betreten der Kirche sah sie im Schein der von der hohen Decke hängenden Lüster, dass die Kirchenbänke voll besetzt waren. Im Hintergrund spielte feierliche Orgelmusik.
Nachdem sie dem Kirchendiener ihren Presseausweis gezeigt und einmal tief durchgeatmet hatte, ließ sie sich dankbar auf die hinterste Kirchenbank sinken und durchwühlte ihren Rucksack nach Stift und Notizblock. Mit jedem japsenden Atemzug hoben und senkten sich ihre Schultern.
Trotz der eisigen Kälte, die in der Kirche herrschte, stand ihr der Schweiß auf der Stirn, der Rollkragen des schwarzen Wollpullovers, den sie hastig übergestreift hatte, klebte ihr auf der Haut. Sie putzte sich die laufende Nase, fuhr sich durch die zerzausten langen, dunklen Haare, lehnte sich zurück und versuchte, ruhig durchzuatmen.
Das Jahr hatte so verheißungsvoll begonnen, aber jetzt, nur wenige Tage später, hatte sie das Gefühl, als wäre sie ohne jede Vorwarnung von der Aussichtsplattform des Empire State Building geschleudert worden.
Der Grund dafür war Matthew, ihre große Liebe – oder vielmehr, seit gestern, ihre große Ex-Liebe.
Joanna biss sich auf die Unterlippe, damit sie nicht wieder in Tränen ausbrach, und machte einen langen Hals, um einen Blick auf die Kirchenbänke direkt vor dem Altar zu erhaschen. Mit Erleichterung stellte sie fest, dass die Angehörigen noch nicht eingetroffen waren. Als sie sich zur Kirchentür umdrehte, sah sie die Paparazzi warten, die draußen rauchten und an ihren Objektiven herumfummelten. Vor ihr rutschten die Trauergäste unruhig auf den unbequemen Holzbänken hin und her und tuschelten mit ihren Sitznachbarn. Joanna warf einen prüfenden Blick über die Versammelten, bemüht, die bekanntesten zu entdecken, damit sie deren Namen in ihren Artikel einfließen lassen konnte. Allerdings war es nicht leicht, die Personen von hinten zu erkennen, zumal die meisten grau- oder weißhaarig waren. Während Joanna die Namen in ihren Notizblock kritzelte, kamen ihr wieder Bilder des vergangenen Tags in den Sinn …
Gestern Nachmittag hatte Matthew bei ihr in Crouch End unerwartet vor der Wohnungstür gestanden. Weihnachten und Neujahr hatten sie gemeinsam gefeiert und waren dann übereingekommen, noch ein paar ruhige Tage getrennt zu verbringen, jeder in seiner eigenen Wohnung, bevor es wieder mit der Arbeit losging. Zu ihrem Leidwesen hatte sie sich aber die scheußlichste Erkältung seit Jahren eingefangen und Matthew bei seinem Überraschungsbesuch daher in einem uralten Pyjama empfangen, mit Ringelsocken an den Füßen und ihrer Pu-der-Bär-Wärmflasche im Arm.
Sie hatte sofort gewusst, dass etwas nicht stimmte. Er war gleich hinter der Tür stehen geblieben und hatte es abgelehnt, den Mantel auszuziehen. Sein Blick war hin und her geschossen und hatte sich auf alles Mögliche gerichtet, nur nicht auf sie.
Dann hatte er ihr mitgeteilt, dass er »nachgedacht« habe. Dass er nicht den Eindruck habe, ihre Beziehung hätte eine Zukunft. Und dass es vielleicht an der Zeit sei, sie zu beenden.
»… Wir sind seit sechs Jahren zusammen, seit Ende des Studiums«, hatte er gesagt und mit den Handschuhen gespielt, die sie ihm zu Weihnachten geschenkt hatte. »Ich weiß nicht, ich hatte immer gedacht, dass ich mir irgendwann wünschen würde, dich zu heiraten – du weißt schon, dass wir uns offiziell verbinden. Aber das habe ich nicht …« Er zuckte mit den Schultern. »Und wenn ich es mir jetzt nicht wünsche, kann ich mir nicht vorstellen, dass sich das noch ändert.«
Joanna hielt sich an ihrer Wärmflasche fest, während er sie schuldbewusst ansah. Sie kramte in ihrer Pyjamatasche nach dem feuchten Taschentuch und putzte sich kräftig die Nase. Dann sah sie ihm direkt ins Gesicht.
»Wie heißt sie?«
Er würde über und über rot. »Ich wollte das nie«, murmelte er. »Aber jetzt ist es passiert, und ich kann nicht mehr so tun, als wäre zwischen uns beiden alles in bester Ordnung.«
Joanna dachte an die gemeinsame Silvesternacht vor vier Tagen. Zumindest da war es ihm aber sehr gut gelungen.
Offenbar hieß sie Samantha und arbeitete in derselben Werbeagentur wie er. Immerhin als Account Director. Angefangen hatte es an dem Abend, an dem Joanna wegen einer Korruptionsgeschichte einem Tory-Abgeordneten nachgestellt und es nicht zur Weihnachtsparty in Matthews Agentur geschafft hatte. Sofort war ihr das Wort »Klischee« durch den Kopf geschossen. Aber, fragte sie sich jetzt, was waren Klischees denn anderes als der gemeinsame Nenner menschlichen Verhaltens?
»Bitte glaub mir, ich habe versucht, nicht mehr an Sam zu denken«, sagte Matthew. »Ich habe mich über Weihnachten wirklich bemüht. Es war so schön bei deiner Familie in Yorkshire. Aber dann habe ich sie letzte Woche wieder getroffen, nur auf einen kurzen Drink, und …«
Joanna war passé, jetzt war Samantha angesagt. So einfach war das.
Sie starrte ihn nur sprachlos an, während er einfach weiterredete; ihre Augen brannten vor Schock, Wut und Angst.
»… Zuerst dachte ich, ich hätte mich bloß verknallt. Aber wenn ich für eine andere Frau so viel empfinde, kann ich doch keine Beziehung mit dir haben. Das liegt doch auf der Hand. Ich tue nur das Richtige.« Er sah sie an, als erwarte er Dank für seinen Edelmut.
»Das Richtige …«, wiederholte sie dumpf. Dann brach sie in fiebrige Tränen aus. Wie aus weiter Ferne hörte sie, wie er noch mehr Ausreden anführte. Mühsam riss sie ihre verquollenen Augen auf und starrte ihn an, während er klein und beschämt in ihren abgewetzten Ledersessel sank.
»Raus«, brachte sie schließlich krächzend hervor. »Du mieser, verlogener, schmieriger Betrüger! Raus! Verschwinde!«
Diese eine Aufforderung hatte genügt, was Joanna rückblickend am meisten kränkte. Er war aufgestanden, hatte noch etwas von diversen, bei ihr deponierten Habseligkeiten gemurmelt und dass man sich zusammensetzen müsse, wenn sich alles etwas beruhigt habe, und dann hatte er regelrecht die Flucht ergriffen.
Den Rest des vergangenen Abends hatte sich Joanna erst bei ihrer Mutter am Telefon und anschließend auf der Voicemail ihres besten Freundes Simon ausgejammert und dabei das zunehmend durchweichte Fell ihrer Pu-der-Bär-Wärmflasche vollgeheult.
Dank Unmengen von Hustensaft und Brandy war sie schließlich weggesackt, dankbar, dass sie wegen der vor Weihnachten in der Nachrichtenredaktion angesammelten Überstunden die nächsten Tage frei hatte.
Morgens um neun hatte ihr Handy geklingelt und sie aus ihrem betäubten Schlaf gerissen. Sie betete, es möge ein am Boden zerstörter, reumütiger Matthew sein, dem gerade bewusst geworden war, was er eigentlich getan hatte.
»Ich bin’s«, bellte eine Stimme mit Glasgower Akzent.
Joanna fluchte lautlos. »Hallo, Alec«, schniefte sie. »Was willst du? Ich hab heute frei.«
»Hast du nicht, bedauere. Alice, Richie und Bill haben sich krankgemeldet. Du musst deine Überstunden ein anderes Mal abfeiern.«
»Dann sind wir zu viert.« Joanna hustete übertrieben laut in den Hörer. »Tut mir leid, Alec, aber ich liege halb im Sterben.«
»Sieh’s so: Wenn du heute arbeitest, hast du frei, wenn du wieder gesund bist und etwas Schönes unternehmen kannst.«
»Nein, es geht wirklich nicht. Ich hab Fieber. Ich kann mich kaum auf den Beinen halten.«
»Perfekt. Es ist ein Auftrag im Sitzen, in der Schauspielerkirche in Covent Garden. Um zehn findet dort der Gedenkgottesdienst für Sir James Harrison statt.«
»Alec, das kannst du mir nicht antun, bitte nicht. Eine zugige Kirche ist das Letzte, was ich jetzt brauche. Ich bin todkrank. Als Nächstes besuchst du dann einen Gedenkgottesdienst für mich.«
»Sorry, Jo, du musst dahin. Ich bezahle dir auch ein Taxi hin und zurück. Du darfst hinterher sofort nach Hause und mailst mir deinen Artikel von dort. Versuch ein paar zitierfähige Kommentare von Zoe Harrison zu kriegen, ja? Ich habe Steve zum Fotografieren hingeschickt. Wenn sie sich richtig auftakelt, kommt sie auf die Titelseite. Also, bis später.«
»Verdammt!« Verzweifelt ließ Joanna den Kopf wieder ins Kissen sinken. Dann bestellte sie sich ein Taxi und wankte zum Kleiderschrank, um ein passendes schwarzes Outfit zusammenzustellen.
Sie mochte ihren Job, sie lebte für ihn, wie Matthew oft angemerkt hatte, aber an diesem Morgen fragte sie sich ernsthaft, weshalb. Nach zwei Anstellungen bei Lokalzeitungen war sie vor einem Jahr bei der Morning Mail, einer der auflagenstärksten englischen Tageszeitungen mit Sitz in London, als Junior-Reporterin übernommen worden. Diese hart erarbeitete Position auf der untersten Hierarchiestufe bedeutete, dass sie es sich kaum leisten konnte, einen Auftrag abzulehnen. Wie Alec, der Chefredakteur im Nachrichtenressort, sie nur allzu oft erinnerte, gab es Tausende hungriger junger Journalisten, die ihre Stelle mit Kusshand nähmen. Die sechs Wochen bei ihm in der Redaktion waren ihre bislang anspruchsvollste Aufgabe. Die Arbeitstage waren lang, und Alec – ein Sklaventreiber und leidenschaftlicher Journalist in Personalunion – verlangte von seinen Untergebenen nichts weniger, als er selbst zu leisten bereit war.
»Da wären mir ja sogar die Lifestyle-Seiten noch lieber«, brummelte sie heiser und zog einen nicht allzu sauberen schwarzen Pulli, eine Wollstrumpfhose und dem Anlass entsprechend einen schwarzen Rock an.
Das Taxi war zehn Minuten zu spät gekommen und dann in der Charing Cross Road im Stau stecken geblieben. »Tja, schöne Frau, da geht nichts weiter«, hatte der Fahrer gesagt. Nach einem Blick auf die Uhr hatte Joanna ihm zehn Pfund in die Hand gedrückt und war aus dem Taxi gesprungen. Und während sie mit schmerzender Brust und triefender Nase nach Covent Garden gerannt war, hatte sie sich gefragt, ob das Leben noch schlimmer werden konnte.
Als das Tuscheln plötzlich verstummte, wurde Joanna aus ihren Gedanken gerissen. Sie öffnete die Augen und drehte sich um. Sir James Harrisons Angehörige betraten die Kirche.
Vornweg ging Charles Harrison, Sir James’ einziges Kind und mittlerweile Mitte sechzig. Er lebte in Los Angeles und war ein gefeierter Regisseur von aufwendigen Actionfilmen voller Special Effects. Vage erinnerte Joanna sich, dass er vor einigen Jahren einen Oscar bekommen hatte, aber seine Filme gehörten nicht zu denen, die sie sich gern ansah.
Neben ihm ging Zoe Harrison, seine Tochter. Wie von Alec erhofft, sah sie hinreißend aus in ihrem schwarzen Kostüm mit dem kurzen Rock, der ihre langen Beine zur Geltung brachte. Die Haare hatte sie zu einem schmalen Chignon hochgesteckt, der ihre klassische englische Schönheit unterstrich. Als Schauspielerin galt sie als aufsteigender Stern, Matthew etwa hatte ständig von ihr geschwärmt. Zoe, hatte er gesagt, erinnere ihn an Grace Kelly – offenbar seine Traumfrau –, und Joanna hatte sich gefragt, weshalb er dann mit einer schlaksigen Brünetten wie ihr zusammen war. Sie spürte einen Kloß im Hals und wettete ihre Pu-der-Bär-Wärmflasche darauf, dass diese »Samantha« eine zierliche Blondine war.
An Zoe Harrisons Hand ging ein kleiner Junge von etwa neun oder zehn Jahren, der sich in seinem schwarzen Anzug mit Krawatte sichtlich unwohl fühlte. Das war Zoes Sohn, der nach seinem Urgroßvater benannte Jamie Harrison. Zoe war bei seiner Geburt gerade neunzehn gewesen und weigerte sich nach wie vor standhaft, den Namen des Vaters preiszugeben. Sir James hatte loyal zu seiner Enkeltochter gestanden, ebenso wie zu ihrer Entscheidung, das Kind zu bekommen und Stillschweigen über den Vater zu bewahren.
Joanna fand, dass Jamie seiner Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten war: die gleichen feinen Züge, der gleiche blasse Teint, die gleichen riesigen blauen Augen. Zoe Harrison tat ihr Bestes, ihn dem Blick der Öffentlichkeit zu entziehen. Sollte es Steve gelungen sein, Mutter und Sohn gemeinsam zu fotografieren, würde das Bild morgen zweifellos groß auf der Titelseite stehen.
Hinter ihnen folgte Marcus Harrison, Zoes Bruder. Joanna betrachtete ihn, während er an ihrer Sitzbank vorbeiging. Auch wenn sich ihre Gedanken im Moment eigentlich nur um Matthew drehten, musste sie zugeben, dass Marcus Harrison ein richtig »heißer Typ« war, wie ihre Kollegin Alice sagen würde. Joanna kannte ihn aus den Klatschspalten, in denen er seit Neuestem mit einer blonden Schickimicki-Vertreterin der besseren Gesellschaft abgelichtet wurde. Er war so brünett, wie seine Schwester blond war, hatte aber die gleichen blauen Augen und gab sich eine Aura leicht verruchten Selbstvertrauens. Seine Haare waren fast schulterlang, dazu trug er ein zerknittertes schwarzes Jackett und ein weißes Hemd mit offenem Kragen, was ihm eine charismatische Lässigkeit verlieh. Nur widerwillig konnte Joanna den Blick von ihm losreißen. Beim nächsten Mal, sagte sie sich, suche ich mir einen Vierzigjährigen, der Vögel beobachtet und Briefmarken sammelt. Sie überlegte, was Marcus Harrison beruflich machte – hoffnungsvoller Filmproduzent, wenn sie sich recht erinnerte. Rein optisch erfüllte er die Rolle schon mal bestens.
»Guten Morgen, meine verehrten Damen und Herren.« Der Pfarrer stand auf der Kanzel, vor der ein großes, mit weißen Rosengirlanden geschmücktes Foto von Sir James Harrison aufgebaut war. »Im Namen von Sir James’ Familie begrüße ich Sie sehr herzlich und danke Ihnen, dass Sie gekommen sind, um einem Freund und Kollegen, einem Vater, Großvater und Urgroßvater und dem wohl größten Schauspieler dieses Jahrhunderts die letzte Ehre zu erweisen. Diejenigen unter uns, die wir das Glück hatten, ihn gut zu kennen, wird es nicht überraschen, dass sich Sir James diesen Anlass nicht als einen Trauerakt vorstellte, sondern als Feier. Seine Familie und ich möchten diesem Wunsch entsprechen. Beginnen wir also mit dem Lied, das Sir James von allen am liebsten mochte: ›Treu steh ich zu dir, mein Land.‹ Bitte erheben Sie sich.«
Mühsam hievte sich Joanna mit zittrigen Beinen von der Kirchenbank und war froh, als die Orgel einsetzte, da sie genau in diesem Moment einen Hustenanfall bekam. Sie griff nach dem Programm, das auf der Ablage vor ihr lag, doch eine kleine verknöcherte Hand mit pergamentener Haut, unter der sich die blauen Adern abzeichneten, kam ihr zuvor.
Joanna wandte sich nach links und sah zu der Dame dort: eine vom Alter gebeugte Frau, die ihr gerade bis zur Brust reichte. Sie stützte sich auf die Bank vor ihr, dennoch zitterten die Finger, mit denen sie den Zettel hielt. Die alte Dame war in einen bodenlangen schwarzen Mantel gehüllt, ein schwarzer Schleier verbarg ihr Gesicht.
Die Hand zitterte so stark, dass Joanna dem Liedtext nicht folgen konnte. Sie beugte sich zu ihr hinüber. »Darf ich bei Ihnen mitlesen?«
Sie reichte ihr das Blatt. Joanna hielt es tief genug, damit die alte Dame es ebenfalls sehen konnte. Sie krächzte sich durch das Lied, und als es zu Ende war, nahm ihre Banknachbarin mit Mühe wieder Platz. Schweigend bot Joanna ihr den Arm, doch die alte Dame ignorierte die Geste.
»Unser erster Beitrag ist das Lieblingssonett von Sir James: William Dunbars ›Süße Rose der Tugend‹, vorgetragen von Sir Laurence Sullivan, einem guten Freund.«
Geduldig wartete die Gemeinde, bis der alte Schauspieler wackelig nach vorn gegangen war. Aber dann füllte die berühmte volle Stimme, die früher einmal unzählige Zuschauer in der ganzen Welt in ihren Bann gezogen hatte, den Kirchenraum.
»Süße Rose der Tugend und der Sanftmut, liebliche Lilie …«
Joannas Aufmerksamkeit wurde von einem Knarzen in ihrem Rücken abgelenkt. Sie drehte sich um und sah, dass das Kirchenportal geöffnet wurde, ein Schwall eisiger Luft drang herein. Ein Kirchendiener schob einen Rollstuhl durch den Mittelgang und stellte ihn am Ende der Bankreihe gleich gegenüber der von Joanna ab. Noch während sich der Kirchendiener entfernte, hörte sie ein rasselndes Keuchen, gegenüber dem ihre eigene Kurzatmigkeit völlig harmlos schien. Die alte Dame neben ihr erlitt offensichtlich einen Asthmaanfall, starrte dabei aber unter ihrem Schleier an Joanna vorbei unverwandt auf den Mann im Rollstuhl.
»Alles in Ordnung?«, fragte Joanna im Flüsterton, als die alte Dame sich an die Brust griff, ohne den Blick vom Rollstuhl zu nehmen. In dem Moment kündigte der Pfarrer das nächste Lied an, und die Gemeinde erhob sich erneut. Unvermittelt griff die alte Dame nach Joannas Arm und deutete zur Tür hinter ihnen.
Joanna half ihr aufzustehen, umfasste ihre Taille und schleppte sie förmlich zum Ende der Kirchenbank. Als sie in die Nähe des Mannes im Rollstuhl kamen, schmiegte sich die alte Frau schutzsuchend wie ein Kind an Joannas Mantel. Zwei eisige stahlgraue Augen blickten zu ihnen hoch. Unwillkürlich schauderte Joanna, wandte den Blick ab und half der alten Dame, die paar Schritte zum Portal zurückzulegen. Der Kirchendiener trat zur Seite.
»Diese Frau … ich … sie braucht …«
»Luft!«, stieß die alte Dame hervor.
Der Kirchendiener half Joanna, sie in den grauen Januartag hinaus und die Stufen hinab zu einer der Bänke zu führen, die den Vorhof säumten. Aber ehe Joanna ihn um weitere Hilfe bitten konnte, war er schon wieder in der Kirche verschwunden. Die alte Dame ließ sich schwer keuchend gegen Joanna fallen.
»Soll ich den Krankenwagen rufen? Das klingt gar nicht gut.«
»Nein!«, brachte die alte Dame hervor. Ihre kraftvolle Stimme stand im völligen Gegensatz zu ihrem gebrechlichen Körper. »Rufen Sie ein Taxi. Bringen Sie mich nach Hause. Bitte.«
»Ich glaube wirklich, Sie sollten …«
Die knochigen Finger umklammerten Joannas Handgelenk. »Bitte! Ein Taxi!«
»Also gut, dann warten Sie hier.«
Joanna lief zur Pforte hinaus in die Bedford Street und hielt ein vorbeifahrendes Taxi an. Zuvorkommend stieg der Fahrer aus und half Joanna, die alte Dame zum Wagen zu begleiten.
»Was ist denn mit ihr? Der Atem klingt ja wie ’ne Dampflok«, sagte er zu Joanna, als sie die alte Dame mit vereinten Kräften auf den Rücksitz befördert hatten. »Soll ich sie ins Krankenhaus fahren?«
»Sie sagt, sie möchte nach Hause.« Joanna beugte sich ins Taxi. »Übrigens, wie lautet denn die Adresse?«, fragte sie.
»Ich …«, japste die alte Dame. Die Anstrengung, ins Taxi zu steigen, hatte sie offenbar die letzte Kraft gekostet.
Der Taxifahrer schüttelte den Kopf. »Tut mir leid, Herzchen. In dem Zustand fahre ich sie nirgendwohin, zumindest nicht allein. Dass mir hier jemand im Taxi stirbt, kommt gar nicht in die Tüte. Viel zu lästig. Klar, wenn Sie mitkommen, ist das kein Problem. Dann ist das Ihre Angelegenheit, nicht meine.«
»Ich kenne sie gar nicht, ich meine … Ich bin beruflich hier … Ich muss wieder in die Kirche …«
»Tut mir leid, Ma’am«, sagte er zu der alten Dame. »Dann müssen Sie wieder aussteigen.«
Die alte Dame hob den Schleier, und Joanna erkannte die Panik in ihren wässrigen blauen Augen. »Bitte«, sagte sie kaum hörbar.
»Also gut.« Joanna seufzte resigniert und setzte sich zu der alten Frau auf den Rücksitz. »Wohin?«, fragte sie freundlich.
»… Mary … Mary …«
»Nein, die Adresse«, fragte Joanna nach.
»Mary … le …«
»Ach, Sie meinen sicher Marylebone, stimmt’s?«, sagte der Fahrer.
Die Frau nickte erleichtert.
»Kein Problem.«
Angespannt sah die alte Dame zum Fenster hinaus, als das Taxi anfuhr. Langsam beruhigte sich ihr Atem, sie lehnte den Kopf an das schwarze Lederpolster und schloss die Augen.
Joanna seufzte. Der Tag wurde ja immer besser. Alec würde sie steinigen, schließlich musste er glauben, sie habe sich vorzeitig aus dem Staub gemacht. Die Geschichte einer gebrechlichen alten Dame mit einem Schwächeanfall würde bei ihm nicht verfangen. Alte Damen interessierten ihn nur, wenn sie von einem Skinhead zusammengeschlagen, ausgeraubt und halb tot liegen gelassen wurden.
»Wir sind jetzt fast in Marylebone. Könnten Sie herausfinden, wohin genau wir müssen?«, rief der Taxifahrer nach hinten.
»Marylebone High Street neunzehn.« Die Stimme der alten Dame war klar und deutlich. Überrascht drehte Joanna sich zu ihr.
»Geht es Ihnen besser?«
»Ja, danke. Ich entschuldige mich, Ihnen solche Mühe zu bereiten. Sie sollten wirklich hier aussteigen. Ich komme schon zurecht.« Das Taxi stand gerade wartend an einer Ampel.
»Nein. Jetzt bin ich schon so weit mitgekommen, jetzt bringe ich Sie bis nach Hause.«
Die alte Dame schüttelte den Kopf mit allem Nachdruck, den sie aufzubringen vermochte. »Bitte, um Ihrer selbst willen, ich …«
»Wir sind gleich da. Ich helfe Ihnen nur ins Haus und fahre dann gleich zurück.«
Seufzend zog die alte Dame den Mantel fester um sich und schwieg, bis das Taxi vor der Hausnummer 19 hielt.
»Da sind wir schon.« Der Taxifahrer öffnete die Tür und war sichtlich erleichtert, dass sein Fahrgast noch unter den Lebenden weilte.
»Hier.« Die Frau reichte ihm einen Fünfzig-Pfund-Schein.
»Darauf kann ich leider nicht rausgeben«, sagte er, während er ihr beim Aussteigen behilflich war und sie stützte, bis Joanna an ihrer Seite stand.
»Hier, nehmen Sie den.« Joanna gab ihm einen Zwanzig-Pfund-Schein. »Und warten Sie bitte. Ich bin gleich wieder da.« Die alte Dame steuerte bereits mit unsicheren Schritten eine Tür neben einem Zeitungsladen an.
Joanna folgte ihr. »Soll ich das machen?«, fragte sie, als die alte Dame mit ihren arthritischen Fingern den Schlüssel ins Schloss stecken wollte.
»Danke.«
Joanna drehte den Schlüssel, öffnete die Tür, und die alte Dame schoss regelrecht ins Haus.
»Kommen Sie, schnell!«
»Ich …«
Joanna wollte eigentlich so bald wie möglich zurück in die Kirche, nachdem sie die alte Dame sicher nach Hause begleitet hatte. »Also gut.« Widerstrebend trat sie über die Schwelle, worauf die alte Dame die Haustür ins Schloss warf.
»Kommen Sie mit.« Zielstrebig ging sie zu einer Tür auf der linken Seite eines schmalen Flurs. Wieder fummelte sie herum, bis der Schlüssel schließlich im Schloss steckte. Joanna folgte ihr in die Dunkelheit.
»Der Lichtschalter ist gleich rechts hinter Ihnen.«
Joanna knipste das Licht an. Sie standen in einem kleinen, muffigen Vorraum. Vor ihr lagen drei Türen, zu ihrer Rechten führte eine Treppe nach oben.
Die alte Dame öffnete eine der Türen und schaltete ein weiteres Licht an. Joanna, die ihr dichtauf folgte, sah, dass sich im ganzen Raum Teekisten stapelten. In der Mitte stand ein Einzelbett mit einem angerosteten gusseisernen Gestell, vor einer Wand, eingeklemmt zwischen den Teekisten, ein alter Sessel. Es roch unverkennbar nach Urin. Joanna hob sich der Magen.
Die alte Dame ging auf den Sessel zu und ließ sich erleichtert hineinfallen. »Meine Tabletten. Können Sie sie mir bitte geben?« Sie deutete auf eine umgedrehte Teekiste neben dem Bett.
»Natürlich.« Vorsichtig bahnte sich Joanna einen Weg zwischen den Kisten hindurch. Als sie nach den Tabletten griff, bemerkte sie, dass die Verpackung französisch beschriftet war.
»Danke. Zwei bitte. Und das Wasser.«
Joanna reichte ihr das Glas Wasser, das neben den Tabletten stand, öffnete den Schraubverschluss des Fläschchens, gab zwei Pillen in die zitternde Hand der alten Dame und beobachtete, wie sie sie schluckte. Konnte sie jetzt wieder gehen? Ihr schauderte ein wenig, der unangenehme Geruch und die trübselige Atmosphäre im Raum waren ihr unbehaglich. »Sind Sie sicher, dass ich keinen Arzt rufen soll?«
»Absolut sicher, danke. Ich weiß wirklich nicht, was mit mir ist.« Ihre Lippen verzogen sich zu einem zaghaften Lächeln.
»Dann sollte ich jetzt zum Gottesdienst zurück. Ich muss nämlich für meine Zeitung einen Artikel darüber schreiben.«
»Sie sind Journalistin?« Die alte Dame, die jetzt ihre Stimme wiedergefunden hatte, sprach mit erlesenstem englischem Akzent.
»Ja, bei der Morning Mail, im Moment allerdings noch auf der untersten Stufe.«
»Wie heißen Sie denn?«
»Joanna Haslam.« Sie deutete auf die Kisten. »Ziehen Sie um?«
»Ja, so könnte man es wohl nennen.« Ihr Blick ging in die Ferne, ihre blassblauen Augen wurden noch wässriger. »Ich werde nicht mehr allzu lange Zeit hier sein. Vielleicht ist es nur recht und billig, wenn es ein solches Ende findet …«
»Was meinen Sie damit? Wenn Ihnen etwas fehlt, dann lassen Sie mich bitte einen Arzt rufen oder sich von mir ins Krankenhaus bringen.«
»Nein, nein. Dafür ist es viel zu spät. Gehen Sie jetzt, meine Liebe, kehren Sie in Ihr Leben zurück. Leben Sie wohl.« Die alte Dame schloss die Augen. Joanna beobachtete sie eine Weile, bis sie schließlich leise zu schnarchen begann.
Sie hatte ein fürchterlich schlechtes Gewissen, aber sie hielt es hier nicht mehr aus. Leise verließ sie den Raum und lief hinaus zum Taxi.
Bis sie wieder in Covent Garden ankam, war der Gedenkgottesdienst vorüber. Die Limousine der Familie Harrison war bereits weggefahren, nur wenige Besucher standen noch vor der Kirche. Joanna war elend zumute. Es gelang ihr gerade noch, ein paar Kommentare aufzuschnappen, die sie in ihrem Artikel zitieren konnte, dann hielt sie erneut ein Taxi an und beschloss resignierend, den ganzen Vormittag als Misserfolg zu verbuchen.
Kapitel 2
Es klingelte an der Tür. Immer und immer wieder hallte das Läuten durch Joannas dröhnenden Kopf.
»O mein Gott«, stöhnte sie, als ihr klar wurde, dass der unwillkommene Besucher offenbar nicht bereit war, unverrichteter Dinge wieder zu gehen.
Matthew…?
Den Bruchteil einer Sekunde keimte Hoffnung in ihr auf und schwand ebenso rasch wieder. Sicher stieß der Mistkerl irgendwo in einem Bett mit Samantha und einem Glas Champagner auf seine Freiheit an.
»Verschwinde«, stöhnte sie und putzte sich die Nase mit Matthews altem T-Shirt. Aus irgendeinem Grund ging es ihr dadurch besser.
Wieder läutete es.
»Ach, verdammt!«
Widerstrebend kroch sie aus dem Bett und schwankte zur Haustür.
»Hallo, heißer Feger.« Simon grinste sie von einem Ohr zum anderen an. »Du siehst schrecklich aus.«
»Danke«, brummelte sie und lehnte sich schlapp an den Türrahmen.
»Komm her.«
Zwei tröstlich vertraute Arme schlossen sich um sie. So groß Joanna auch sein mochte, Simon war mit seinen ein Meter neunzig einer der ganz wenigen Männer, die ihr das Gefühl vermittelten, klein und zerbrechlich zu sein.
»Ich habe deine Nachrichten erst abgehört, als ich gestern Abend spät nach Hause gekommen bin. Entschuldige, dass ich nicht Seelentröster spielen konnte.«
»Schon in Ordnung.« Schniefend vergrub sie den Kopf an seiner Schulter.
»Komm, lass uns reingehen, bevor wir hier draußen erfrieren.« Simon schloss die Wohnungstür, ohne den Arm von ihrer Schulter zu nehmen, und führte sie in das kleine Wohnzimmer. »Mein Gott, hier ist es ja eiskalt.«
»Tut mir leid, ich habe den ganzen Nachmittag im Bett gelegen. Ich bin wirklich grauenhaft erkältet.«
»Das glaube ich dir nicht«, zog er sie auf. »Komm, jetzt setz dich erst mal.«
Er fegte alte Zeitungen, zerlesene Bücher und halb vertrocknete Instant-Nudelsuppen-Becher auf den Boden, und Joanna ließ sich auf das unbequeme lindgrüne Sofa sinken. Sie hatte es nur gekauft, weil Matthew die Farbe so gut gefallen hatte, es aber immer bereut. Außerdem hatte er, wenn er da war, immer nur in dem uralten Ledersessel ihrer Großmutter gesessen. Undankbarer Schuft.
»Dir geht’s gar nicht gut, Jo, stimmt’s?«
»Stimmt. Mal davon abgesehen, dass Matthew mir den Laufpass gegeben hat, hat Alec mich heute Vormittag zu einem Gedenkgottesdienst abkommandiert, dabei hätte ich den Tag eigentlich frei gehabt. Und dann bin ich in der Marylebone High Street bei einer merkwürdigen alten Frau gelandet, die in einem Zimmer voller Teekisten lebt.«
»Wow. Und mir ist in Whitehall heute nichts Aufregenderes passiert, als dass ich mir an der Sandwich-Theke einen anderen Belag ausgesucht habe.«
Joanna brachte angesichts seines Versuchs, sie aufzuheitern, nur ein mattes Lächeln zustande.
Simon setzte sich neben sie und nahm ihre Hände in seine. »Es tut mir so leid, Jo, wirklich.«
»Danke.«
»Ist es mit Matthew endgültig vorbei, oder ist das eher eine Untiefe auf dem Weg in den Hafen der Ehe?«
»Es ist aus und vorbei, Simon. Er hat eine andere.«
»Soll ich ihm eine Tracht Prügel verpassen? Würde dir das helfen?«
»Wenn ich ehrlich bin, ja, aber in Wirklichkeit eher nicht.« Joanna seufzte. »Das Schlimmste ist, in solchen Fällen wird von einem erwartet, dass man sich nonchalant gibt. Wenn die Leute einen fragen, wie’s einem geht, soll man darüber hinweglächeln und leichthin sagen: ›Bestens, danke der Nachfrage. Er hat mir sowieso nichts bedeutet, und eigentlich konnte mir nichts Besseres passieren, als dass er mich verlässt. Jetzt habe ich viel mehr Zeit für mich und meine Freunde, ich habe sogar mit dem Korbflechten angefangen!‹ Aber das ist absoluter Schwachsinn! Ich würde auf allen vieren über glühende Kohlen kriechen, wenn Matthew dadurch zu mir zurückkäme und das Leben so weiterginge wie vorher. Ich … ich liebe ihn. Ich brauche ihn. Er ist meiner, er … er gehört mir.«
Simon hielt sie im Arm, streichelte ihr übers Haar und hörte ihr schweigend zu, während sie sich ihren Kummer und ihre Verzweiflung von der Seele weinte. Als sie sich schließlich etwas beruhigt hatte, löste er sie sanft aus seiner Umarmung und stand auf. »Mach die Heizung an, ich setze in der Zwischenzeit Teewasser auf.«
Nachdem Joanna die Gasflamme im offenen Kamin angezündet hatte, folgte sie Simon in die kleine Küche. Dort ließ sie sich an dem Resopaltisch nieder, der in der Ecke stand und an dem Matthew und sie zu unzähligen gemütlichen Sonntagsfrühstücken und Abendessen bei Kerzenlicht zusammengesessen hatten. Während Simon Tee machte, betrachtete sie die ordentlich auf der Arbeitsfläche aufgereihten Glasbehälter.
»Ich kann sonnengetrocknete Tomaten nicht leiden«, sagte sie nachdenklich. »Matthew konnte gar nicht genug davon kriegen.«
»Na dann.« Simon nahm das Glas mit den besagten Tomaten und kippte sie in den Müll. »Ein Gutes zumindest hat das Ganze dann ja doch.«
»Wenn ich es mir recht überlege, gab es eigentlich ziemlich viel, das Matthew mochte und bei dem ich nur so tat, als würde ich es auch mögen.« Nachdenklich stützte Joanna das Kinn auf die Hände.
»Zum Beispiel?«
»Ach, dass wir uns sonntags im Lumière abgedrehte ausländische Art-House-Filme angesehen haben, obwohl ich lieber zu Hause geblieben wäre und mir die neuesten Soaps reingezogen hätte. Und bei Musik war es genauso. Ich meine, Klassik in kleinen Dosen, ja, warum nicht, aber ich durfte nie meine ›ABBA Gold‹-CD oder Take That hören.«
»Ich muss sagen, da stehe ich leider eher auf Matthews Seite.« Grinsend goss Simon kochendes Wasser auf die Teebeutel. »Aber um ehrlich zu sein, ich hatte immer das Gefühl, dass Matthew vor allem versucht hat, so zu sein, wie er glaubte, sein zu müssen.«
»Wahrscheinlich hast du recht.« Joanna seufzte. »Mit mir konnte er eben keinen Eindruck schinden. So bin ich nun mal – ein durchschnittliches, langweiliges Mittelschichtsmädel aus Yorkshire.«
»Wenn es etwas gibt, das du nicht bist, dann durchschnittlich. Oder langweilig. Vernünftig bist du, ja, und ehrlich auch, aber das sind Eigenschaften, die ich bewundernswert finde. Hier.« Er reichte ihr einen Becher Tee. »Jetzt lass uns mal nebenan auftauen.«
Joanna ließ sich im Wohnzimmer vor dem Kamin am Boden nieder, lehnte sich an Simons Beine und trank von ihrem Tee. »Mein Gott, Simon, allein die Vorstellung, diese ganze Dating-Prozedur noch mal durchzumachen, erschreckt mich. Ich bin siebenundzwanzig, viel zu alt, um noch mal von vorn anzufangen.«
»Ja, du bist wirklich steinalt. Man riecht förmlich schon den Tod an dir.«
Joanna versetzte ihm einen Klaps aufs Bein. »Mach dich nicht lustig über mich! Es wird Ewigkeiten dauern, bis ich mich wieder daran gewöhnt habe, Single zu sein.«
»Das Problem mit uns Menschen ist, dass wir Angst vor jeder Veränderung haben und sie deswegen scheuen wie die Pest. Das ist der Grund, weshalb so viele Paare zusammenbleiben, obwohl sie todunglücklich sind und es ihnen viel besser ginge, wenn sie sich trennen würden. Davon bin ich überzeugt.«
»Da hast du wahrscheinlich recht. Schau mich an, jahrelang habe ich sonnengetrocknete Tomaten gegessen! Apropos Paare, hast du mal wieder was von Sarah gehört?«
»Letzte Woche habe ich von ihr eine Postkarte aus Wellington bekommen. Offenbar lernt sie in Neuseeland gerade das Segeln. Ihre einjährige Auszeit ist wirklich lang geworden, aber im Februar kommt sie zurück, es sind also nur noch ein paar Wochen.«
»Ich finde es wirklich toll von dir, so lange auf sie zu warten.« Joanna warf ihm ein Lächeln zu.
»Menschen, die man liebt, soll man doch ihre Freiheit lassen, oder? So heißt es doch immer. Ich sehe es so: Wenn sie nach Hause kommt, und sie will mich noch, dann wissen wir beide, dass es für immer und ewig ist.«
»Darauf würde ich mich nicht verlassen. Ich dachte auch, dass das mit Matthew und mir für immer und ewig ist.«
»Danke, sehr tröstlich!« Simon runzelte in gespielter Empörung die Stirn. »Jetzt komm, du hast deinen Beruf, deine Wohnung und mich. Du bist eine Frau, die immer wieder auf die Beine fällt, Jo. Und das wirst du dieses Mal auch, wart’s nur ab.«
»Aber nur, wenn ich in einer Woche noch einen Job habe. Der Artikel, den ich über den Gedenkgottesdienst für Sir James Harrison abgeliefert habe, ist Mist. Wegen Matthew und wegen meiner schrecklichen Erkältung und dieser verrückten alten Frau …«
»Du hast gesagt, sie lebt in einem Zimmer voller Teekisten? Bist du dir sicher, dass du nicht im Fieberwahn warst?«
»Ja. Sie hat irgendetwas gesagt in der Art, dass sie nicht mehr lange genug da sein würde, um auszupacken.« Joanna biss sich auf die Unterlippe. »Und, igitt, es hat ekelhaft nach Urin gestunken … Ob wir auch mal so werden, wenn wir alt sind? Ich fand die ganze Sache ziemlich bedrückend. Als ich in dem Zimmer stand, dachte ich mir: Wenn das alles ist, was einen am Ende des Lebens erwartet, weshalb rackern wir uns dann die ganzen Jahre so ab?«
»Wahrscheinlich ist sie eine exzentrische Alte, die in der letzten Bruchbude lebt und Millionen auf dem Bankkonto hortet. Oder in Teekisten, wer weiß? Du hättest mal reinschauen sollen!«
»Sie kam mir ganz normal vor, bis ein alter Mann im Rollstuhl reingefahren kam und sich ans Ende der Bankreihe gegenüber gestellt hat. Sobald sie ihn sah, ist sie fast zusammengebrochen.«
»Wahrscheinlich ihr Ex. Vielleicht sind es seine Millionen, die in den Teekisten lagern.« Simon lachte. »Wie auch immer, Jo, ich sollte jetzt gehen. Ich muss noch ein paar Sachen für morgen erledigen.«
Joanna folgte ihm zur Tür, und er nahm sie fest in die Arme. »Danke für alles«, sagte sie und gab ihm einen Kuss auf die Wange.
»Aber immer doch. Wenn du mich brauchst, bin ich da. Ich ruf dich morgen aus der Arbeit mal an. Bis dann, Butch.«
»Gute Nacht, Sundance.«
Joanna schloss die Tür hinter ihm und ging wieder ins Wohnzimmer. Ihre Stimmung hatte sich etwas gebessert. Simon verstand es jedes Mal, sie aufzuheitern. Sie waren fast ihr Leben lang miteinander befreundet. Er war in Yorkshire auf einem Hof ganz in der Nähe des Bauernhofs aufgewachsen, auf dem sie geboren war, und obwohl er zwei Jahre älter war als sie, hatten sie als Kinder in der Abgeschiedenheit, in der sie lebten, viel miteinander unternommen. Als Einzelkind und ausgesprochener Wildfang hatte Joanna sich immer über Simons Gesellschaft gefreut. Von ihm hatte sie gelernt, auf Bäume zu klettern und Fußball und Cricket zu spielen. In den langen Sommerferien waren sie auf ihren Ponys oft auf die Hochebene hinaufgeritten und hatten stundenlang Cowboy und Indianer gespielt. Das waren die einzigen Male, dass sie sich in die Haare bekommen hatten, denn Simon hatte immer darauf bestanden, dass er am Leben blieb und sie starb.
»Das ist mein Spiel, und wir spielen nach meinen Regeln«, hatte er mit seinem riesigen Cowboyhut auf dem Kopf gebieterisch gefordert. Und nachdem sie sich über die buckligen Moor- und Heidewiesen gejagt hatten, hatte er sie früher oder später immer eingeholt und von hinten niedergestreckt.
»Peng peng, du bist tot!«, hatte er gerufen und seine Spielzeugpistole auf sie gerichtet, und sie war getaumelt und hatte sich ins Gras fallen lassen und sich theatralisch hin und her gewälzt, bis sie schließlich nachgegeben hatte und gestorben war.
Mit dreizehn war Simon dann aufs Internat gekommen, und sie hatten sich seltener gesehen. In den Ferien hatte sich die alte Vertrautheit zwar immer wieder eingestellt, aber dann waren sie beide älter geworden und hatten neue Freundschaften geschlossen. Als Simon einen Studienplatz am Trinity College in Cambridge bekam, hatten sie auf der Hochebene mit einer Flasche Champagner darauf angestoßen. Zwei Jahre später war Joanna nach Durham gegangen, um Englisch zu studieren.
Dann hatten sich ihre Wege völlig getrennt. Simon lernte in Cambridge Sarah kennen, und Joanna begann in ihrem letzten Jahr in Durham eine Beziehung mit Matthew. Erst in London, wo sie ganz zufällig keine zehn Minuten voneinander entfernt wohnten, hatten sie wieder an ihre frühere Freundschaft angeknüpft.
Joanna wusste, dass Matthew mit Simon nie richtig warm geworden war, allein schon, weil ihr Jugendfreund ihn körperlich überragte. Außerdem war Simon nach dem Studium ein Überflieger-Job im Staatsdienst angeboten worden, auch wenn er immer ganz bescheiden behauptete, er sei in Whitehall nur ein unbedeutender Bürohengst. Typisch Simon eben. Sehr bald hatte er sich ein kleines Auto und eine wunderschöne große Zwei-Zimmer-Wohnung in Highgate Hill leisten können. Matthew hingegen hatte bei einer Werbeagentur als Mädchen für alles gearbeitet, bis er vor zwei Jahren einen untergeordneten Posten bekam; trotzdem reichte sein Geld gerade für ein möbliertes Zimmer in Stratford.
Vielleicht, überlegte Joanna, hoffte Matthew, dank Samanthas höherer Position in der Agentur selbst eine Stufe auf der Karriereleiter aufzusteigen …
Sie schüttelte den Kopf, sie wollte an diesem Abend nicht mehr an ihn denken. Entschlossen legte sie Alanis Morissette in den CD-Spieler und drehte die Lautstärke auf. Die Nachbarn sollen mir doch den Buckel runterrutschen, dachte sie sich und ließ ein heißes Bad einlaufen. Aus heiserem Hals krächzte sie bei »You Learn« mit, das dampfende Wasser lief plätschernd in die Wanne, und so hörte sie nicht die Schritte auf dem kurzen Weg zur Haustür und sah auch nicht das Gesicht, das durch die Fenster im Erdgeschoss in ihr Wohnzimmer spähte. Frisch gebadet kehrte sie in dem Moment aus dem Bad zurück, als sich die Schritte wieder entfernten.
Sie machte sich ein Käsesandwich, schloss die Vorhänge und setzte sich vor den Kamin, um sich die Füße zu wärmen. Das Baden hatte sie beruhigt, und unvermittelt regte sich eine Ahnung von Optimismus, wenn sie an die Zukunft dachte. Einiges, was sie in der Küche zu Simon gesagt hatte, hatte banal geklungen, aber im Grunde stimmte es. Im Nachhinein betrachtet hatten Matthew und sie tatsächlich wenig Gemeinsamkeiten. Jetzt war sie ein freier Mensch und konnte tun und lassen, was sie wollte. Und ab sofort würde sie ihre Gefühle nicht mehr hintanstellen. Das war ihr Leben, und es kam nicht infrage, dass sie sich von Matthew die Zukunft ruinieren lassen würde.
Bevor ihre gute Laune verfliegen und sich wieder die Niedergeschlagenheit einstellen konnte, nahm Joanna zwei Paracetamol und ging ins Bett.
Kapitel 3
»Tschüs, mein Schatz.« Sie zog ihn an sich und sog seinen vertrauten Geruch ein.
»Tschüs, Mummy.« Ein paar Sekunden schmiegte er sich noch an ihren Mantel, dann löste er sich und musterte sie argwöhnisch.
Zoe Harrison räusperte sich und unterdrückte die Tränen. Sooft sie diese Situation auch schon hatten, es wurde für sie nie leichter. Aber natürlich konnte sie nicht vor Jamie und seinen Freunden zu weinen anfangen, also setzte sie tapfer ein Lächeln auf. »Am Sonntag in zwei Wochen komme ich dich besuchen, dann gehen wir zusammen Mittagessen. Wenn Hugo mitkommen möchte, nimm ihn mit.«
»Mach ich.« Jamie war es erkennbar peinlich, so neben ihrem Wagen zu stehen, und Zoe wusste, dass es Zeit war zu gehen. Trotzdem konnte sie nicht widerstehen, ihm noch eine Strähne seines feinen Haars aus dem Gesicht zu streichen. Er verdrehte die Augen, und einen Moment sah er wieder aus wie der kleine Junge, den sie in Erinnerung hatte, nicht wie der ernsthafte junge Mann, zu dem er heranwuchs. Aber Zoe war unendlich stolz auf ihn, wie er in seiner marineblauen Schuluniform so vor ihr stand, die Krawatte genauso sorgsam geknotet, wie James es ihm gezeigt hatte.
»Also, mein Schatz, dann fahre ich jetzt. Ruf mich an, wenn du was brauchst. Oder wenn du einfach nur mit mir reden möchtest.«
»Mach ich, Mummy.«
Zoe setzte sich hinter das Lenkrad, schloss die Tür und ließ den Motor an. Dann kurbelte sie das Fenster herunter.
»Ich hab dich lieb, mein Schatz. Pass auf dich auf, und vergiss nicht, immer ein Unterhemd anzuziehen. Und lass die nassen Rugby-Socken nicht länger als unbedingt nötig an, ja?«
Eine leichte Röte zog sich über Jamies Gesicht. »Ja, Mummy. Tschüs.«
»Tschüs.«
Zoe fuhr die Auffahrt hinunter und sah Jamie im Rückspiegel fröhlich winken. Nach einer Kurve war er aus ihrem Blickfeld verschwunden. Während sie zum Tor hinaus auf die Hauptstraße bog, wischte sie sich die Tränen weg und kramte in der Manteltasche nach einem Taschentuch. Zum hundertsten Mal sagte sie sich, dass diese Abschiede für sie schlimmer waren als für Jamie. Vor allem jetzt, nach James’ Tod.
Sie folgte den Schildern zur Autobahn, die sie in einer Stunde nach London zurückbringen würde, und fragte sich wieder einmal, ob es nicht eine falsche Entscheidung gewesen war, einen Zehnjährigen in ein Internat zu sperren – zumal jetzt, nachdem er erst wenige Wochen zuvor seinen geliebten Urgroßvater verloren hatte. Andererseits ging Jamie sehr gern in die Schule, er mochte seine Freunde und den geregelten Tagesablauf – Dinge, die sie ihm zu Hause nicht bieten konnte. Und die Schule schien ihm gutzutun, er wurde verantwortungsvoller und zunehmend selbständig.
Das hatte sogar ihr Vater Charles angemerkt, als sie ihn am vergangenen Abend nach Heathrow gebracht hatte. Der Tod seines Vaters hatte ihn sichtlich mitgenommen, zum ersten Mal hatte sie auf seinem attraktiven gebräunten Gesicht Spuren des Alterns entdeckt.
»Du hast das alles wirklich gut gemacht, mein Schatz, du kannst stolz auf dich sein. Und auf deinen Sohn«, hatte er ihr ins Ohr geflüstert, als er sie zum Abschied umarmte. »Und bring Jamie in den Ferien mit nach L. A. Ich sehe euch viel zu selten. Ihr fehlt mir.«
»Du fehlst mir auch, Dad«, hatte Zoe gesagt und war dann, während er die Eingangsschleusen passierte, leicht benommen stehen geblieben. Es kam nur sehr selten vor, dass ihr Vater sie lobte. Oder ihren Sohn.
Sie erinnerte sich an die Zeit, als sie mit achtzehn schwanger geworden war und vor Entsetzen und Verzweiflung fast gestorben wäre. Sie hatte gerade die Internatsschule beendet und sich um einen Studienplatz beworben, es war Irrsinn gewesen, auch nur darüber nachzudenken, ein Kind zu bekommen. Und dennoch, trotz des geballten Zorns und der Ablehnung ihres Vaters und ihrer Freunde, trotz des Drucks von ganz anderer Seite hatte sie in ihrem tiefsten Inneren gewusst, dass das Kind zur Welt kommen musste. Jamie war ein Kind der Liebe, ein ganz besonderes, magisches Geschenk. Einer Liebe, die Zoe nach über zehn Jahren noch immer nicht ganz überwunden hatte.
Sie fädelte sich in die Autobahn ein, und die Worte ihres Vaters vor all den Jahren hallten ihr wieder in den Ohren.
»Und, wird er dich heiraten, dieser Mann, der dich geschwängert hat? Ich sage es dir gleich, Zoe, du bist auf dich allein gestellt. Du hast dir den Schlamassel eingebrockt, jetzt sieh zu, wie du da wieder rauskommst!«
Nicht, dass je die Chance bestanden hätte, ihn zu heiraten, dachte sie wehmütig.
Nur James, ihr geliebter Großvater, war die Ruhe selbst gewesen, eine Stimme der Vernunft, ein Fels in der Brandung, während alle in ihrer Umgebung wüteten und tobten.
Zoe war immer schon James’ Augapfel gewesen. Als Kind hatte sie keine Ahnung gehabt, dass dieser herzensgute ältere Mann mit der tiefen, vollen Stimme, der um keinen Preis »Opa« genannt werden wollte, weil er sich dann alt vorkam, einer der gefeiertsten Theaterschauspieler Englands war. Zoe war mit ihrer Mutter und ihrem älteren Bruder Marcus in einem gutbürgerlichen Haus in Blackheath aufgewachsen. Ihre Eltern hatten sich scheiden lassen, als Zoe noch keine drei Jahre alt war, und ihr Vater war nach L. A. gezogen, sodass sie ihn nur selten zu Gesicht bekam. So war James für sie zur Vaterfigur geworden. An sein verwinkeltes Haus auf dem Land, Haycroft House in Dorset, mit dem Obstgarten und den gemütlichen Mansardenräumen hatte sie die schönsten Kindheitserinnerungen.
Ihr Großvater hatte sich beruflich bereits mehr oder minder zur Ruhe gesetzt, nur bisweilen reiste er in die Staaten, um in einem Film eine Gastrolle zu übernehmen, womit er sich die Butter aufs Brot verdiente, wie er zu sagen pflegte. Und so war er praktisch immer für sie da, vor allem nachdem ihre Mutter bei einem Unfall nur wenige Meter vor dem Haus ums Leben gekommen war. Da war Zoe zehn gewesen, ihr Bruder Marcus vierzehn. Von der Beerdigung wusste sie nur noch, dass sie sich an ihn geklammert hatte und ihm Tränen über sein regloses Gesicht gelaufen waren, während sie den Gebeten des Geistlichen zuhörten. Der Gottesdienst war angespannt und trostlos verlaufen, Zoe hatte ein steifes schwarzes Kleid mit einem Spitzenbesatz tragen müssen, der sie am Hals kratzte.
Ihr Vater war aus Los Angeles angereist, um einen Sohn und eine Tochter zu trösten, die er kaum kannte. James aber hatte ihre Tränen getrocknet, wenn sie spätnachts weinte, er hatte sie in den Arm genommen und auch Marcus zu trösten versucht, aber der hatte sich innerlich verschlossen und nicht über den Tod seiner Mutter gesprochen, sondern die Trauer über ihren Verlust tief in sich vergraben.
Und während ihr Vater sie dann mit nach L. A. nahm, damit sie bei ihm aufwuchs, war Marcus in England in seinem Internat geblieben. Zoe war es vorgekommen, als hätte sie nicht nur ihre Mutter, sondern auch noch ihren Bruder verloren … ihr ganzes Leben.
In der trocknen, brennenden Hitze von Bel Air, im Hazienda-artigen Haus ihres Vaters, durfte Zoe dann feststellen, dass sie eine »Tante Debbie« hatte. Offenbar lebte Tante Debbie bei Daddy und schlief sogar im selben Bett wie er. Tante Debbie war sehr blond, sehr üppig gebaut und gar nicht erfreut, dass die zehnjährige Zoe in ihr Leben trat.
Zoe kam auf eine Schule in Beverly Hills, wo sie sich vom ersten Moment an unwohl fühlte. Ihren Vater, der sich einen Namen als Regisseur zu machen versuchte, sah sie nur selten. Stattdessen musste sie Debbies Vorstellung von Kindererziehung ertragen: Essen vor dem Fernseher und wandgroße Zeichentrickfilme. Zoe sehnte sich nach dem Wechsel der Jahreszeiten in England und verabscheute die brütende Hitze und die Grelle von L. A. In den langen Briefen, die sie ihrem Großvater schrieb, flehte sie ihn an, sie zu holen, damit sie bei ihm in ihrem geliebten Haycroft House leben konnte, und versicherte ihm, sie könne wirklich auf sich selbst aufpassen und würde ganz bestimmt keine Schwierigkeiten machen, wenn er sie nur nach Hause kommen ließe.
Ein halbes Jahr nach Zoes Ankunft in Los Angeles fuhr auf der Auffahrt ein Taxi vor. Und daraus stieg James, einen adretten Panamahut auf dem Kopf und ein breites Lächeln im Gesicht. Zoe erinnerte sich noch gut an das überwältigende Glücksgefühl, als sie die Auffahrt hinuntersauste und ihm um den Hals fiel. Ihr Beschützer war ihrem Ruf gefolgt und zu ihrer Rettung geeilt. Während sich die schmollende Tante Debbie an den Pool verzog, schüttete Zoe ihrem Großvater ihr Herz aus, und der rief daraufhin seinen Sohn an und schilderte ihm Zoes Unglück. Und Charles – der zu der Zeit in Kuba drehte – willigte ein, dass Zoe mit James nach England zurückkehrte.
Den ganzen langen Heimflug über saß sie glücklich neben James und hielt seine große Hand umklammert. An seine kräftige, zuverlässige Schulter gelehnt, wusste sie, dass sie immer nur dort sein wollte, wo auch er war.
Sie verbrachte glückliche Jahre in der kleinen Schule des Wocheninternats in Dorset. Ob in London oder auf dem Land, James empfing ihre Freundinnen und Freunde immer mit offenen Armen. Erst, als Zoe bemerkte, dass die Eltern ihrer Spielgefährten große Augen machten, wenn sie ihre Kinder abholten und dem großen Sir James Harrison die Hand gaben, wurde ihr langsam bewusst, wie berühmt er tatsächlich war. Als sie älter wurde, gab James seine Liebe zu Shakespeare, Ibsen und Wilde an sie weiter, und noch etwas später gingen sie regelmäßig zusammen ins Theater, ins Barbican, ins National Theatre oder ins Old Vic. Bei solchen Gelegenheiten übernachteten sie in London in James’ herrschaftlichem Haus in der Welbeck Street und saßen am Sonntag vor dem Kamin und gingen den Text des Stücks durch.
Mit siebzehn wusste Zoe, dass sie Schauspielerin werden wollte. James forderte von allen Schauspielschulen Prospekte an, und die studierten sie und erörterten eingehend die jeweiligen Vor- und Nachteile, bis sie zu dem Schluss kamen, dass Zoe erst auf einer renommierten Universität Englisch studieren sollte, ehe sie sich mit einundzwanzig an einer Schauspielschule bewarb.
»Abgesehen davon, dass du dich an der Uni mit den Klassikern beschäftigen wirst, was dir auf der Bühne Tiefe verleiht, bist du dann auch älter und kannst das ganze Wissen, das dir an der Schule angeboten wird, besser aufnehmen. Außerdem hast du mit einem Studium immer etwas in der Hinterhand.«
»Du denkst also, ich werde als Schauspielerin keinen Erfolg haben?«, hatte Zoe entsetzt gefragt.
»Nein, mein Liebling, natürlich nicht. Schließlich bist du meine Enkeltochter.« Er hatte leise gelacht. »Aber du bist so verdammt hübsch, dass dich ohne einen richtigen Uniabschluss niemand ernst nimmt.«
Und so hatten sie sich geeinigt, dass sich Zoe – wenn ihre Abschlussnoten so gut waren wie erwartet – für ein Englischstudium in Oxford bewerben sollte.
Und dann hatte sie sich verliebt. Inmitten der Abschlussprüfungen.
Vier Monate später war sie schwanger und am Boden zerstört. Ihre sorgsam geplante Zukunft konnte sie sich aus dem Kopf schlagen.
Ängstlich und auch unsicher, wie ihr Großvater reagieren würde, platzte Zoe eines Abends beim Essen damit heraus. James wurde zwar etwas blass, nickte aber ruhig und fragte sie, was sie jetzt tun wolle. Zoe brach in Tränen aus. Die Situation war so schrecklich und derart verfahren, dass sie nicht einmal ihrem geliebten Großvater die Wahrheit anvertrauen konnte.
Die ganze entsetzliche Woche hindurch, als Charles mit Debbie im Schlepptau nach London kam und sie anbrüllte, sie einen Dummkopf nannte und unbedingt erfahren wollte, wer der Vater war, stand James zu ihr, gab ihr Kraft und den Mut, ihre eigene Entscheidung zu treffen und das Kind zu bekommen. Und er fragte kein einziges Mal nach dem Namen des Vaters. Er wollte auch nichts über ihre Fahrt nach London erfahren, von der sie niedergeschlagen und leichenblass zurückkehrte und weinend in seine Arme sank, als er sie am Bahnhof in Salisbury abholte.
Ohne seine Liebe, seine Unterstützung und sein absolutes Vertrauen in sie hätte Zoe es nie geschafft, das wusste sie.
Nach Jamies Geburt waren ihrem Großvater Tränen in die wässrigen blauen Augen getreten, als er seinen Urenkel das erste Mal sah. Die Wehen hatten früher als erwartet eingesetzt und waren so rasch gekommen, dass gar nicht die Zeit für die halbstündige Fahrt von Haycroft House in die nächste Klinik geblieben war. So war Jamie mit Hilfe der Dorfhebamme in dem alten Himmelbett seines Urgroßvaters zur Welt gekommen. Keuchend vor Erschöpfung und Glück hatte Zoe dagelegen, als ihr ihr winziger, quäkender Sohn James in die Arme gelegt wurde.
»Willkommen auf der Welt, kleiner Mann«, hatte er geflüstert und ihn sanft auf die Stirn geküsst.
In diesem Augenblick hatte Zoe beschlossen, ihren Sohn nach ihm zu benennen.
Ob da das Band zwischen den beiden entstanden war oder in den darauffolgenden Wochen, als Großvater und Enkeltochter nachts abwechselnd aufstanden, um ein von Koliken geplagtes, weinendes Baby zu beruhigen, wusste Zoe nicht. James war ihrem Sohn ein Vater und gleichzeitig ein Freund. Der kleine Junge und der alte Mann verbrachten viele Stunden miteinander, irgendwie fand James die Energie, mit ihm zu spielen. Wenn Zoe nach Hause kam, sah sie die beiden oft im Obstgarten, wo James den Fußball warf, den Jamie zu ihm zurückschoss. Er unternahm mit seinem Urenkel Ausflüge auf den gewundenen Sträßchen des ländlichen Dorset und zeigte ihm die Blumen in den Hecken und den herrlichen Bauerngarten, in dessen breiten Beeten Pfingstrosen, Lavendel und Salbei um die Wette blühten. Und Mitte Juli wehte der Duft von James’ Lieblingsrosen zu den Fenstern herein.
Es war eine wunderschöne Zeit großer Ruhe, und Zoe war glücklich gewesen, wenn sie mit ihrem kleinen Sohn und ihrem Großvater zusammen sein konnte. Mittlerweile stand ihr Vater auf dem Höhepunkt seines Ruhms, er hatte gerade einen Oscar gewonnen, aber sie hörte nur selten von ihm. Sie war bemüht, sich nichts daraus zu machen, trotzdem, als er sie gestern am Flughafen umarmt und gesagt hatte, dass sie ihm fehle, hatte ihr das einen Stich versetzt.
Er wird auch alt, dachte sie, als sie in den Kreisverkehr am Ende der Autobahn einfuhr und die Straße ins Zentrum von London nahm.
Als Jamie drei war, überzeugte James sie mit sanftem Nachdruck, sich an einer Schauspielschule zu bewerben. »Wenn sie dich nehmen, können wir alle in der Welbeck Street wohnen«, sagte er. »Jamie sollte bald ein paar Vormittage die Woche in einen Kindergarten gehen. Ein Kind braucht den Kontakt mit Gleichaltrigen.«
»Sie nehmen mich sowieso nicht«, sagte Zoe darauf, als sie schließlich einwilligte, sich an der mit dem Fahrrad nur wenige Minuten von der Welbeck Street entfernten Royal Academy of Dramatic Art zu bewerben.
Dann wurde sie doch angenommen, und mit der Unterstützung eines jungen französischen Au-pair-Mädchens, das Jamie mittags vom Kindergarten abholte und ihm und James das Mittagessen zubereitete, schloss Zoe die dreijährige Ausbildung ab.
Dann lud ihr Großvater seine Theater- sowie befreundete Castingagenten zu Zoes Abschlussvorstellung ein – »Mein Schatz, Vitamin B regiert die Welt, ob man nun Schauspieler ist oder Fleischer!« Als Zoe die Schule verließ, hatte sie eine Agentin und ihre erste, sehr kleine Rolle in einem Fernsehfilm. Jamie war bereits eingeschult, und Zoes Schauspielkarriere nahm Fahrt auf, obwohl sie ihr Geld zu ihrem Leidwesen eher beim Film verdiente als auf der Bühne, der ihre wahre Liebe galt.
»Liebes Kind, beschwer dich nicht«, tadelte James sie, als sie von einem erfolglosen Tag am Set im Osten Londons nach Hause kam. Es hatte den ganzen Tag geregnet, sie hatten keine einzige Szene gedreht. »Du hast Arbeit, auf mehr kann eine junge Schauspielerin nicht hoffen. Die Royal Shakespeare Company kommt später, das verspreche ich dir.«
Später gestand sich Zoe ein, dass sie den allmählichen Verfall ihres Großvaters in den nächsten drei Jahren einfach nicht hatte wahrhaben wollen. Erst als er sich manchmal vor Schmerzen krümmte, bestand sie darauf, dass er einen Arzt aufsuchte.
Es wurde Darmkrebs im fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert, der bereits auf die Leber und den Dickdarm gestreut hatte. Aufgrund von James’ Alter und seinem gebrechlichen Zustand wurde eine Chemotherapie mit ihren verheerenden Folgen ausgeschlossen. Der Arzt empfahl eine Palliativversorgung, damit James die ihm noch verbleibende Zeit so angenehm wie möglich, ohne Schläuche und Infusionen verbringen konnte. Sollte eine derartige Behandlung zu einem späteren Zeitpunkt nötig werden, um die Schmerzen zu lindern, könnte das zu Hause organisiert werden.