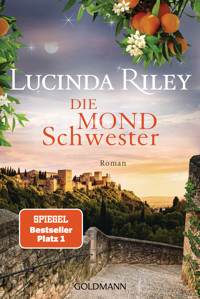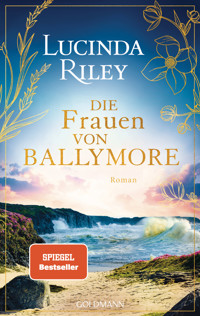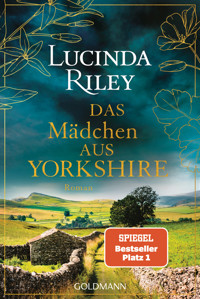11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die sieben Schwestern
- Sprache: Deutsch
Die große Saga von Bestsellerautorin Lucinda Riley.
Reich, berühmt und bildschön: das ist Elektra d’Aplièse, die als Model ein glamouröses Leben in New York führt. Doch der Schein trügt – in Wahrheit ist sie eine verzweifelte junge Frau, die im Begriff ist, ihr Leben zu ruinieren. Da taucht eines Tages ihre Großmutter Stella auf, von deren Existenz Elektra nichts wusste. Sie ist ein Adoptivkind und kennt ihre Wurzeln nicht. Als Stella ihr die berührende Lebensgeschichte der jungen Amerikanerin Cecily Huntley-Morgan erzählt, öffnet sich für Elektra die Tür zu einer neuen Welt. Denn Cecily lebte in den 1940er Jahren auf einer Farm in Afrika – wo einst Elektras Schicksal seinen Anfang nahm …
Der sechste Band aus der Bestseller-Serie um die sieben Schwestern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1087
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Das Buch
Reich, berühmt und bildschön: das ist Elektra d’Aplièse, die als Model ein glamouröses Leben in New York führt. Doch der Schein trügt – in Wahrheit ist sie eine verzweifelte junge Frau, die im Begriff ist, ihr Leben zu ruinieren. Da taucht eines Tages ihre Großmutter Stella auf, von deren Existenz Elektra nichts wusste. Sie ist ein Adoptivkind und kennt ihre Wurzeln nicht. Als Stella ihr die berührende Lebensgeschichte der jungen Amerikanerin Cecily Huntley-Morgan erzählt, öffnet sich für Elektra die Tür zu einer neuen Welt. Denn Cecily lebte in den 1940er Jahren auf einer Farm in Afrika – wo einst Elektras Schicksal seinen Anfang nahm …
Weitere Informationen zu Lucinda Riley sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie unter www.penguin.de/Autor/Lucinda-Riley/p411595.rhd.
LUCINDA RILEY
Die Sonnenschwester
Der sechste Band der »Sieben-Schwestern-Serie«
Roman
Deutsch von Sonja Hauser, Sibylle Schmidt und Ursula Wulfekamp
Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel »The Sun Sister« bei Macmillan, London.
Die Übersetzung von Kapitel 1–31 besorgte Sonja Hauser, von Kapitel 32–41 Sibylle Schmidt und von Kapitel 42–53 Ursula Wulfekamp.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © der Originalausgabe 2019 by Lucinda Riley
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe November 2019 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Uno Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: Landschaft: Getty Images/Roman Lukiw Photography, Flammenbaum: © mauritius images / John Bracegirdle / Alamy, FinePic®, München
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-20190-6V007
www.goldmann-verlag.de
Dem Verlag ist bewusst, dass der Begriff »Neger« aufgrund seiner Historie stark rassistisch konnotiert ist und als abwertend gilt. Er wird daher heutzutage zurecht als diskriminierend abgelehnt und in der deutschen Publizistik nur sehr selten verwendet. Der Verlag hat sich nach sorgsamer Abwägung gleichwohl dazu entschieden, den in der englischen Originalfassung gebrauchten Begriff »negro« für die deutsche Fassung teilweise mit dem Wort »Neger« zu übersetzen, allerdings nur insoweit der Begriff in der historischen Zeitebene des Romans gebraucht wird. Hintergrund dieser Entscheidung ist, dass der Begriff von den handelnden Personen zur damaligen Zeit so verwendet worden wäre und seine Verwendung daher erforderlich scheint, um einen authentischen Sprachgebrauch in diesem speziellen historischen Kontext abbilden zu können. Ebenso verhält es sich mit den Begriffen »native« und »race«, die ebenfalls nur in der historischen Zeitebene des Romans mit »Eingeborene« bzw. »Rasse« übersetzt wurden.
Für Ella Micheler
Manche Frauen fürchten das Feuer,andere werden einfach dazu …
r. h. Sin
Personen
»Atlantis«
Pa Salt
Adoptivvater der Schwestern (verstorben)
Marina (Ma)
Mutterersatz der Schwestern
Claudia
Haushälterin von »Atlantis«
Georg Hoffman
Pa Salts Anwalt
Christian
Skipper
Die Schwestern d’Aplièse
Maia
Ally (Alkyone)
Star (Asterope)
CeCe (Celaeno)
Tiggy (Taygeta)
Elektra
Merope (fehlt)
Elektra
New YorkMärz 2008
I
»Ich weiß nicht mehr, wo ich war und was ich tat, als ich hörte, dass mein Vater gestorben war.«
»Aha. Möchten Sie den Gedanken weiterverfolgen?«
Ich sah Theresa in ihrem ledernen Ohrensessel an. Ein wenig erinnerte sie mich an die verschlafene Haselmaus aus der Teegesellschaft in Alice im Wunderland oder einen ihrer tierischen Freunde. Theresa blinzelte immer wieder hinter ihrer kleinen runden Brille, ihre Lippen formten permanent einen Schmollmund. Unter ihrem knielangen Tweedrock lugten tolle Beine hervor, und sie hatte schöne Haare. Wenn es ihr nicht nur wichtig gewesen wäre, intelligent zu wirken, hätte sie durchaus attraktiv sein können.
»Elektra? Hören Sie mir zu?«
»Ja, tut mir leid, ich war abgelenkt.«
»Haben Sie darüber nachgedacht, was Sie beim Tod Ihres Vaters empfunden haben?«
Da ich ihr meine Überlegungen nicht verraten wollte, nickte ich treuherzig. »Ja.«
»Und?«
»Ich weiß es wirklich nicht mehr. Sorry.«
»Der Gedanke an seinen Tod scheint Sie wütend zu machen. Warum?«
»Nein. Ich kann mich ehrlich nicht erinnern.«
»Sie wissen nicht mehr, was Sie in dem Moment empfunden haben?«
»Nein.«
»Okay.«
Sie kritzelte etwas in ihren Notizblock, vermutlich so etwas wie »möchte sich nicht mit dem Tod ihres Vaters auseinandersetzen«. Genau das hatte der letzte Psychiater mir gesagt, und dabei setzte ich mich sehr wohl damit auseinander. Im Lauf der Jahre war mir klar geworden, dass Seelenklempner unbedingt einen Grund für meinen desolaten Zustand finden wollten. Und wenn sie ihn dann ausgemacht hatten, bissen sie sich daran fest wie eine Maus an einem Stück Käse und nervten mich, bis ich ihnen endlich beipflichtete und irgendeinen Scheiß erzählte, bloß damit sie Ruhe gaben.
»Und welche Gefühle verbinden Sie mit Mitch?«
Was mir zu meinem Ex einfiel, hätte wahrscheinlich ausgereicht, um Theresa nach ihrem Handy greifen zu lassen und der Polizei mitzuteilen, dass eine Verrückte drauf und dran war, einem der berühmtesten Rockstars der Welt die Eier wegzuballern. Also hielt ich lieber freundlich lächelnd den Mund.
»Mir geht’s gut. Mit dem Thema bin ich durch.«
»Bei unserer letzten Sitzung waren Sie sehr wütend auf ihn.«
»Ja, doch die Phase ist vorbei. Wirklich.«
»Das freut mich zu hören. Und wie steht’s mit dem Alkohol? Haben Sie den besser im Griff?«
»Ja«, log ich noch einmal. »Aber jetzt muss ich los. Ich hab gleich einen Termin.«
»Wir sind erst bei der Hälfte der Sitzung.«
»Tja, schade, so ist das Leben nun mal.« Ich stand auf und ging zur Tür.
»Wir sollten uns diese Woche noch einmal zusammensetzen. Vereinbaren Sie bitte gleich mit Marcia einen Termin.«
»Ja, mach ich. Danke.« Mit diesen Worten schloss ich die Tür hinter mir, marschierte schnurstracks an der Rezeption und Marcia vorbei und drückte auf den Rufknopf für den Aufzug, der bald kam. Auf dem Weg nach unten machte ich die Augen zu – ich hasste beengte Räume – und legte meine heiße Stirn an die kühle Marmorverkleidung.
»Herrgott«, fluchte ich leise, »was ist bloß mit mir los? Ich bin so verkorkst, dass ich nicht mal meiner Therapeutin die Wahrheit gestehen kann!«
Du schämst dich, irgendjemandem die Wahrheit zu sagen … Würde sie dich überhaupt verstehen, wenn du es tätest?, fragte ich mich. Wahrscheinlich lebt sie mit ihrem Anwaltsgatten und den beiden Kindern in einem schnuckeligen Backsteinhäuschen, wo am Kühlschrank lauter putzige Magneten mit den künstlerischen Ergüssen der Sprösslinge hängen. Und, fügte ich gedanklich hinzu, während ich mich auf den Rücksitz meiner Limousine setzte, hinter dem Sofa prangt bestimmt eins dieser kotzigen, stark vergrößerten Fotos von Mama und Papa mit den süßen Kleinen, alle in den gleichen Jeanshemden.
»Wohin darf ich Sie bringen, Ma’am?«, erkundigte sich der Fahrer über die Gegensprechanlage.
»Nach Hause«, brummte ich und nahm eine Flasche Wasser aus der Minibar, deren Tür ich hastig wieder schloss, bevor ich in Versuchung geraten konnte, mich dem Alkoholangebot zuzuwenden. Noch um fünf Uhr nachmittags hatte ich höllisches Kopfweh, gegen das alle Schmerztabletten nichts ausrichteten. Die Party am Abend zuvor war, soweit ich mich erinnerte, toll gewesen. Maurice, mein neuer Designerfreund, hatte mit einigen seiner New Yorker Gespielinnen, die später noch andere dazuholten, auf ein paar Drinks vorbeigeschaut … Ich wusste nicht, wie ich ins Bett gekommen, nur, dass ich morgens neben einem Fremden aufgewacht war. Immerhin neben einem attraktiven Fremden. Nach einer weiteren körperlichen Annäherung hatte ich ihn nach seinem Namen gefragt. Bis vor ein paar Monaten war Fernando Ausfahrer für Walmart in Philadelphia gewesen. Dann hatte ein Modeeinkäufer ihn entdeckt und ihm die Nummer eines Freundes bei einer New Yorker Model-Agentur gegeben. Als besagter Fernando erklärte, er würde mich jederzeit über einen roten Teppich führen – ich hatte auf die harte Tour gelernt, dass Fotos von einem neuen Begleiter die Karriere dieses Begleiters rasant beförderten –, hatte ich ihn umgehend vor die Tür gesetzt.
Was wär schon dabei gewesen, wenn du der Haselmaus die Wahrheit gebeichtet hättest, Elektra? Dass du vergangene Nacht mit dem Weihnachtsmann höchstpersönlich hättest schlafen können, ohne es zu merken, so vollgepumpt warst du mit Alkohol und Drogen. Dass du nicht deswegen nicht über deinen Vater nachdenken möchtest, weil er gestorben ist, sondern weil du weißt, wie sehr er sich für dich schämen würde … wie sehr er sich für dich geschämt hat.
Als Pa Salt noch lebte, hatte er immerhin nicht sehen können, was ich trieb, doch nach seinem Tod empfand ich ihn als allgegenwärtig. Er hätte gut und gern in der Nacht in meinem Schlafzimmer sein oder gerade eben neben mir in der Limousine sitzen können …
Bei dem Gedanken wurde ich schwach, griff nach einem Minifläschchen Wodka und leerte es in einem Zug. Dabei versuchte ich den enttäuschten Blick von Pa bei unserem letzten Treffen vor seinem Tod zu vergessen. Er war nach New York gekommen, um mir etwas zu sagen, und ich war ihm bis zum allerletzten Abend seines Aufenthalts, an dem ich mich widerwillig bereit erklärte, mit ihm zu essen, aus dem Weg gegangen. Als ich im Asiate, einem Restaurant am Central Park, eintraf, hatte ich schon jede Menge Wodka und Aufputschmittel intus gehabt. Während des Essens hatte ich benommen ihm gegenübergesessen und mich jedes Mal, wenn er ein mir unangenehmes Thema anschnitt, entschuldigt und mich in die Damentoilette verfügt, um mir ein paar Lines Koks reinzuziehen.
Bei der Nachspeise schließlich hatte Pa die Arme verschränkt und mich mit ruhigem Blick gemustert. »Ich mache mir große Sorgen um dich, Elektra. Du wirkst schrecklich geistesabwesend.«
»Du hast keine Ahnung, unter was für einem Druck ich lebe«, hatte ich ihn angeherrscht. »Was es heißt, ich zu sein!« Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich mich nur vage entsinne, was als Nächstes geschah oder was er darauf erwiderte. Allerdings weiß ich, dass ich aufstand und ihn allein sitzen ließ. Deshalb hatte ich nach wie vor keine Ahnung, was er mir mitteilen wollte …
»Warum zerbrichst du dir darüber den Kopf, Elektra?«, fragte ich mich, wischte mir den Mund ab und steckte das leere Fläschchen in die Tasche – den Fahrer kannte ich nicht, und eine Zeitungsstory darüber, wie ich die Minibar geplündert hatte, konnte ich mir nicht leisten. »Er ist doch nicht mal dein leiblicher Vater.«
Außerdem ließ sich nun sowieso nichts mehr an der Situation ändern. Pa war fort – wie alle anderen Menschen, die ich je geliebt hatte –, und damit musste ich fertigwerden. Ich brauchte ihn nicht, ich brauchte niemanden …
»Wir wären da, Ma’am«, teilte der Fahrer mir über die Gegensprechanlage mit.
»Danke.« Ich stieg aus, bevor er mir die Tür aufhalten konnte, und schloss sie hinter mir. Je unauffälliger ich irgendwo eintraf, desto besser. Andere berühmte Leute trugen Verkleidungen, wenn sie Lust hatten, einfach mal im Lokal um die Ecke zu essen, aber ich war über eins achtzig groß und auch in einer Menschenmenge kaum zu übersehen.
»Hallo, Elektra!«
»Tommy«, erwiderte ich den Gruß lächelnd und lief unter dem Vordach zum Eingang meines Wohnhauses. »Wie geht’s?«
»Immer gut, wenn ich Sie sehe, Ma’am. Hatten Sie einen schönen Tag?«
»Ja, wunderbar, danke.« Ich nickte und blickte meinem treuesten Fan von oben in die Augen. »Bis morgen, Tommy.«
»Gern, Elektra. Gehen Sie heute nicht mehr aus?«
»Nein, wird ein ruhiger Abend. Tschüs dann.« Ich verabschiedete mich mit einem Winken von ihm und betrat das Haus.
Wenigstens er liebt mich, tröstete ich mich, holte die Post vom Concierge ab und machte mich auf den Weg zum Aufzug. Während der Portier mit mir nach oben fuhr, einfach weil das sein Job war, dachte ich über Tommy nach. Seit einigen Monaten hielt er fast täglich vor dem Eingang Wache. Anfangs hatte mich das so beunruhigt, dass ich den Concierge bat, ihn zu verscheuchen, doch Tommy hatte sich nicht abweisen lassen und erklärt, er besitze jedes Recht, auf dem Gehsteig zu stehen, er störe niemanden und wolle mich beschützen. Der Concierge hatte mir geraten, die Polizei zu rufen und ihn als Stalker anzuzeigen, doch eines Morgens hatte ich Tommy nach seinem vollen Namen gefragt und mich über ihn erkundigt. Facebook verriet mir, dass er in der Army gewesen und in Afghanistan seiner Tapferkeit wegen ausgezeichnet worden war und mit Frau und Tochter in Queens wohnte. Nun machte der stets respektvolle und höfliche Tommy mir keine Angst mehr, sondern verlieh mir ein Gefühl der Sicherheit, und der Concierge ließ ihn auf meine Anweisung hin in Ruhe.
Der Portier öffnete die Lifttür für mich. Wir führten ein kurzes Tänzchen auf, bei dem ich einen Schritt zurück machen musste, damit er mir voran zu meiner Penthouse-Wohnung gehen und für mich aufschließen konnte.
»Da wären wir, Miss d’Aplièse. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.«
Er nickte mir zu. In seinen Augen konnte ich kein bisschen Wärme entdecken. Mir war klar, dass die Leute, die im Haus arbeiteten, mir keine Träne nachgeweint hätten, wenn ich ausgezogen wäre. Die meisten Bewohner lebten schon seit Urzeiten hier, als eine Schwarze wie ich es als »Privileg« erachten musste, bei ihnen als Bedienstete beschäftigt zu sein. Allen anderen gehörten die jeweiligen Wohnungen, während ich die meine gemietet hatte. Ich weilte nur in dem Gebäude, weil die ursprüngliche Eigentümerin des Apartments, eine alte Dame, gestorben war, ihr Sohn es renovieren ließ und anschließend versucht hatte, es zu einem exorbitanten Preis zu verkaufen. Was ihm aufgrund der amerikanischen Finanzkrise nicht gelungen war. So hatte er es dem höchsten Bieter – mir – überlassen müssen. Der Preis war genauso irre wie die Wohnung selbst mit ihren modernen Kunstwerken und elektronischen Spielereien (von deren Funktionsweise ich keine Ahnung hatte), und den Blick von der Terrasse auf den Central Park konnte man nur als atemberaubend bezeichnen.
Wenn ich einen Beweis für meinen Erfolg benötigte, lieferte diese Wohnung ihn mir. Was sie mir allerdings am deutlichsten vor Augen führte, dachte ich, als ich auf die Couch sank, auf der bequem mindestens zwei ausgewachsene Kerle schlafen konnten, war meine Einsamkeit. Ihre Größe gab sogar mir das Gefühl, klein und zart zu sein … und so weit oben sehr isoliert.
Irgendwo hörte ich mein Handy klingeln, mit dem Song, der Mitch zum Weltstar gemacht hatte. Ich hatte vergebens versucht, den Klingelton zu ändern. Meine Schwester CeCe litt unter Legasthenie, für mich waren elektronische Geräte ein Buch mit sieben Siegeln. Als ich ins Schlafzimmer ging, um das Handy zu holen, stellte ich erleichtert fest, dass die Zugehfrau das riesige Bett frisch bezogen hatte und alles wieder ordentlich wie im Hotel aussah. Ich mochte das neue Mädchen, eine Empfehlung meiner persönlichen Assistentin. Wie alle meine Angestellten hatte die junge Frau eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnet, die sie daran hinderte, der Presse von meinen absonderlicheren Gewohnheiten zu erzählen. Trotzdem schauderte mich bei dem Gedanken, was sie – hieß sie Lisbet? – sich beim Betreten meiner Wohnung am Morgen wohl gedacht haben mochte.
Ich setzte mich aufs Bett und hörte die Mailbox ab. Fünf Nachrichten stammten von meiner Agentin, die mich dringend bat, wegen des Fotoshootings für Vanity Fair am folgenden Tag so schnell wie möglich zurückzurufen, und die letzte war von Amy, meiner persönlichen Assistentin, die erst seit drei Monaten für mich arbeitete und die ich gut leiden konnte.
»Hallo, Elektra, ich bin’s, Amy. Ich … ich wollte Ihnen nur sagen, dass die Arbeit für Sie mir großen Spaß gemacht hat, dass es aber auf längere Sicht wahrscheinlich nicht funktioniert. Ich habe Ihrer Agentin heute mein Kündigungsschreiben zukommen lassen und wünsche Ihnen viel Glück für die Zukunft …«
»SCHEISSE!«, kreischte ich, löschte die Nachricht und schleuderte das Handy quer durchs Zimmer. »Was zum Teufel hab ich ihr getan?« Wieso regte es mich so auf, dass diese miese kleine Ratte, die mich angebettelt hatte, ihr eine Chance zu geben, mich schon nach drei Monaten im Stich ließ?
»›Seit meiner Kindheit träume ich von der Modebranche. Bitte, Miss d’Aplièse, ich werde Tag und Nacht für Sie da sein. Auf mich können Sie sich hundertprozentig verlassen, das verspreche ich Ihnen‹«, äffte ich Amys leicht näselnden Brooklyn-Akzent nach, während ich die Nummer meiner Agentin wählte. Letztlich gab es nur drei Dinge, ohne die ich nicht leben konnte: Wodka, Koks und eine persönliche Assistentin.
»Hi, Susie. Ich hab gerade von Amys Kündigung erfahren.«
»Ja, schade. Sie hat sich gut gemacht.« Ihr britischer Akzent verlieh ihrer Stimme einen besonders geschäftsmäßigen Klang.
»Fand ich auch. Weißt du, warum sie aufhört?«
Kurzes Schweigen, bevor Susie antwortete: »Nein. Egal, Rebekah soll sich drum kümmern. Bestimmt findet sie bis Ende der Woche eine neue Assistentin für dich. Hast du meine Nachricht erhalten?«
»Ja.«
»Bitte sei morgen pünktlich. Die wollen bei Sonnenaufgang mit dem Shooting anfangen. Du wirst um vier Uhr früh mit dem Wagen abgeholt, okay?«
»Klar.«
»War ’ne tolle Party letzte Nacht, was?«
»Hat Spaß gemacht, ja.«
»Heute bitte keine Party, Elektra. Morgen musst du frisch sein. Die Fotos sind für die Titelseite.«
»Keine Sorge, um neun liege ich artig im Bett.«
»Gut. Tut mir leid, ich muss auflegen, ich hab Lagerfeld in der anderen Leitung. Rebekah meldet sich mit einer Liste geeigneter Assistentinnen bei dir. Ciao.«
»Ciao.« Susie gehörte zu den wenigen Menschen, die es wagten, ein Telefonat mit mir abzubrechen. Sie war die mächtigste Model-Agentin von New York und hatte sämtliche großen Namen der Branche unter Vertrag. Und sie hatte mich entdeckt, als ich sechzehn war. Damals jobbte ich als Kellnerin in Paris, nachdem ich innerhalb von drei Jahren von ebenso vielen Schulen geflogen war. Pa hatte ich erklärt, es sei sinnlos, eine neue Schule für mich zu suchen, weil ich auch von der wieder fliegen würde. Zu meinem Erstaunen hatte er keinen großen Wirbel darum gemacht.
Und war weniger wütend über mein Versagen gewesen als eher enttäuscht, was mir den Wind aus den Segeln nahm.
»Ich denke, ich werde erst mal reisen«, hatte ich verkündet. »Lebenserfahrung sammeln.«
»Das meiste, was man für Erfolg im Leben braucht, lernt man nicht unbedingt in der Schule, da pflichte ich dir bei. Aber bei deiner Intelligenz hatte ich mir wenigstens einen Abschluss von dir erhofft. Du bist noch sehr jung, um auf eigenen Beinen zu stehen. Die Welt ist groß und bedrohlich, Elektra.«
»Ich komme zurecht, Pa«, hatte ich mit fester Stimme erwidert.
»Das glaube ich dir gern, doch wie willst du deine Reisen finanzieren?«
»Ich such mir einen Job. Zuerst möchte ich nach Paris.«
»Ausgezeichnete Wahl.« Pa hatte verträumt, jedoch auch ein wenig traurig genickt. »Eine unglaubliche Stadt. Einigen wir uns auf einen Kompromiss. Du willst nicht mehr zur Schule gehen, was ich verstehen kann, aber ich mache mir Sorgen, weil meine jüngste Tochter in so jungen Jahren allein in die Welt hinaus möchte. Marina kennt Leute in Paris. Bestimmt kann sie dir helfen, eine geeignete Bleibe zu finden. Verbring den Sommer dort, dann sehen wir weiter.«
»Klingt gut«, hatte ich nach wie vor erstaunt darüber gesagt, dass er mich nicht zu einem Schulabschluss zu überreden versuchte. Vermutlich wollte er mich entweder los haben oder mir so viel Freiraum geben, dass ich über kurz oder lang freiwillig zurückkehrte. Am Ende hatte Ma ihre Pariser Bekannten kontaktiert, sodass ich kurz darauf ein hübsches kleines Zimmer mit Blick über die Dächer von Montmartre mein Eigen nannte. Es war winzig, und ich musste mir das Bad mit ausländischen Austauschschülern teilen, die in der Stadt weilten, um ihr Französisch aufzupolieren, aber es war mein Reich.
Ich konnte mich gut an das Gefühl der Unabhängigkeit erinnern, als mir am ersten Abend in meinem Zimmerchen klar wurde, dass es niemanden gab, der mir vorschrieb, was ich zu tun oder zu lassen hatte. Weil auch niemand für mich kochte, war ich zu einem Café in der Straße gegangen, hatte mich an einen der Tische davor gesetzt, mir eine Zigarette angezündet, die Speisekarte studiert und Zwiebelsuppe und ein Glas Wein bestellt. Der Kellner hatte nicht einmal mit der Wimper gezuckt, weil ich rauchte oder Alkohol orderte. Drei Gläser Wein später hatte ich schließlich den Mut aufgebracht, den Geschäftsführer des Lokals zu fragen, ob er eine Kellnerin gebrauchen könne. Und zwanzig Minuten danach war ich die wenigen Meter zu meiner Bleibe mit einer Zusage zurückgeschlendert. Zu den stolzesten Momenten in meinem Leben überhaupt zählte es, wie ich am folgenden Morgen von dem öffentlichen Telefon im Flur aus Pa anrief, der genauso erfreut klang wie damals, als meine Schwester Maia die Zusage für einen Studienplatz an der Sorbonne erhalten hatte.
Vier Wochen später hatte ich Susie, meiner jetzigen Agentin, einen Croque Monsieur serviert, und der Rest war Geschichte …
»Warum beschäftige ich mich permanent mit der Vergangenheit?« Ich hob mein Handy auf, um die weiteren Nachrichten zu checken. »Und warum denke ich die ganze Zeit an Pa …?«
»Mitch … Pa …«, murmelte ich. »Sie sind weg, Elektra, und jetzt auch Amy. Du musst nach vorn blicken.«
»Elektra, mein Schatz! Wie geht’s dir? Ich bin in New York … Hast du heute Abend was vor? Lust auf ein Fläschchen Cristal und Chow mein dans ton lit avec moi? Ich sehne mich nach dir. Ruf mich so schnell wie möglich zurück.«
Trotz meiner schlechten Laune konnte ich mir ein Lächeln über den rätselhaften Zed Eszu nicht verkneifen. Er war fabelhaft reich mit besten Connections und – obwohl nicht sonderlich groß und eigentlich überhaupt nicht mein Typ – unglaublich im Bett. Wir hatten uns drei Jahre lang regelmäßig getroffen, bis das mit Mitch ernst geworden war, und vor ein paar Wochen hatte ich die Sache mit Zed wiederbelebt, weil sie meinem Ego guttat.
Waren wir ineinander verliebt? Ich für meinen Teil konnte diese Frage eindeutig mit Nein beantworten, aber wir verkehrten in denselben New Yorker Kreisen, und das Schönste: Allein redeten wir Französisch. Wie Mitch beeindruckte Zed nicht, wer ich war, was mir inzwischen nur noch selten passierte und was ich als tröstlich empfand.
Ich betrachtete das Telefon und überlegte, ob ich Zeds Nachricht ignorieren und Susies Anweisung, früh ins Bett zu gehen, folgen oder ihn lieber anrufen und zu mir bitten sollte. Die Antwort auf diese Frage war nicht schwierig, also wählte ich Zeds Nummer. Während ich auf ihn wartete, duschte ich und schlüpfte in meinen Lieblingsseidenkimono, den ein aufstrebendes japanisches Modelabel eigens für mich entworfen hatte. Anschließend trank ich vorsorglich Unmengen von Wasser, um dem Alkohol oder anderen schädlichen Substanzen vorzubeugen, die ich mir bei seinem Besuch möglicherweise zuführen würde.
Als der Concierge mir mitteilte, dass mein Gast eingetroffen sei, sagte ich ihm, er solle Zed heraufschicken. Kurz darauf stand er mit einem riesigen Strauß weißer Rosen, meinen Lieblingsblumen, und der versprochenen Flasche Champagner vor meiner Tür.
»Bonsoir, ma belle Elektra«, begrüßte er mich, deponierte Blumen und Champagner auf einem Tischchen und küsste mich auf beide Wangen. »Comment vas-tu?«, erkundigte er sich in seinem merkwürdigen Stakkato-Französisch.
»Gut.« Ich warf einen gierigen Blick auf die Flasche. »Soll ich sie aufmachen?«
»Ich denke, das ist mein Job. Aber darf ich zuerst die Jacke ausziehen?«
»Klar.«
Er griff in seine Tasche und reichte mir ein Samtkästchen. »Als mein Blick darauf fiel, habe ich sofort an dich gedacht.«
»Danke.« Ich setzte mich aufs Sofa und schlug meine elend langen Beine unter, während ich das Kästchen in meiner Hand aufgeregt wie ein Kind beäugte. Zed kaufte mir oft Geschenke, die trotz seines immensen Reichtums nur selten protzig ausfielen. Er wählte lieber etwas Interessantes. Als ich den Deckel anhob, sah ich in dem Kästchen einen Ring mit einem ovalen buttergelben Stein. Ich nahm ihn heraus und drehte ihn im Licht des Kronleuchters.
»Bernstein«, teilte Zed mir mit. »Schau mal, ob er dir passt.«
»An welchem Finger soll ich ihn tragen?«, fragte ich spöttisch.
»Wo du möchtest, ma chère. Bei einem Heiratsantrag würde ich dir allerdings was Besseres schenken. Bestimmt kennst du die Beziehung deiner griechischen Namenspatronin zum Bernstein, oder?«
»Nein.« Ich beobachtete, wie er den Champagner entkorkte. »Wie sieht die aus?«
»Zum Beispiel der Name: Das griechische Wort für Bernstein war ›elektron‹; der Sage nach fängt er die Strahlen der Sonne ein. Die alten Griechen entdeckten, dass man Bernstein durch Reibung elektrisch aufladen und somit Energie erzeugen kann … der Name ist also perfekt für dich.« Er reichte mir lächelnd ein Glas Champagner.
»Willst du etwa behaupten, ich erzeuge Reibung?«, erwiderte ich, ebenfalls schmunzelnd. »Fragt sich nur, ob ich mich an meinen Namen angepasst habe oder ob er sich nach mir richtet. Santé.«
»Santé.« Wir stießen an, und Zed nahm neben mir Platz.
»Ähm …«
»Du überlegst, ob ich dir ein weiteres Geschenk mitgebracht habe, nicht wahr?«
»Ja.«
»Dann schau mal unter das Futter des Kästchens.«
Tatsächlich: Unter dem Samt befand sich ein Plastiktütchen.
»Danke, Zed.« Ich öffnete es begeistert, steckte den Finger hinein wie ein Kind in einen Honigtopf und rieb etwas von dem Pulver in mein Zahnfleisch.
»Gut, was?«, meinte er.
Nun schüttelte ich ein wenig davon auf den Tisch, löste den kurzen Strohhalm, der außen am Tütchen klebte, und zog mir eine Nase von dem Koks rein.
»Mmm, sogar sehr gut. Willst du auch was?«
»Meine Antwort lautet wie immer Nein. Wie geht’s dir?«
»Ach … okay.«
»Klingt nicht sonderlich begeistert, und du wirkst müde, Elektra.«
»Ich hatte ziemlich viel zu tun«, erklärte ich und trank einen großen Schluck Champagner. »Letzte Woche war ich zu einem Shooting auf Fidschi, und nächste Woche fliege ich nach Paris.«
»Du solltest einen Gang zurückschalten, dir eine Pause gönnen.«
»Sagt der Typ, der mehr Nächte in seinem Privatjet verbringt als zu Hause in seinem Bett«, neckte ich ihn.
»Möglicherweise sollten wir beide langsamer machen. Könnte ich dich zu einer Woche auf meiner Jacht überreden? Die liegt die nächsten Monate in St. Lucia, bevor ich sie für den Sommer ins Mittelmeer bringen lasse.«
»Schön wär’s«, seufzte ich. »Mein Terminkalender ist bis Juni voll.«
»Dann eben im Juni. Wir könnten zwischen den griechischen Inseln segeln.«
»Vielleicht«, meinte ich achselzuckend, weil ich seinen Vorschlag nicht wirklich ernst nahm. Er machte oft irgendwelche Pläne, die sich nie realisierten und deren Realisierung ich mir auch gar nicht wünschte. Zed war ein wunderbarer Bettgenosse für eine Nacht, doch im Alltag hätte er mich mit seiner Pingeligkeit und seiner unglaublichen Arroganz vermutlich genervt.
Als sich der Concierge über die Gegensprechanlage meldete, stand Zed auf, um ranzugehen. »Schicken Sie’s rauf, danke.« Dann schenkte er uns Champagner nach. »Das Chow mein ist da. Ein besseres hast du noch nie gegessen, das verspreche ich dir. Wie läuft’s bei deinen Schwestern?«
»So genau weiß ich das nicht. In letzter Zeit war so viel zu tun, da hatte ich keine Zeit, sie anzurufen. Von Ally weiß ich, dass sie ein Baby bekommen hat – einen kleinen Jungen. Er heißt Bär; das finde ich süß. Da fällt mir ein: Wir wollen uns alle im Juni in Atlantis treffen und mit Pas Jacht zu den griechischen Inseln fahren, um an der Stelle einen Kranz ins Meer zu werfen, wo Allys Ansicht nach sein Sarg versenkt wurde. Dein Dad wurde doch ganz in der Nähe am Strand gefunden, oder?«
»Ja, aber wie du denke ich nicht gern über den Tod meines Vaters nach, weil mich das aus der Fassung bringt«, erwiderte Zed barsch. »Ich beschäftige mich lieber mit der Zukunft.«
»Ein merkwürdiger Zufall ist es trotzdem …«
Als die Klingel an der Tür ging, öffnete Zed.
Wenig später brachte er zwei Styroporboxen in die Küche. »Hilf mir mal bitte, Elektra.«
II
Als ich am folgenden Tag vom Fotoshooting nach Hause kam, duschte ich heiß und legte mich mit einem Glas Wodka ins Bett. Ich war völlig kaputt – wer meinte, Models schwebten bloß in hübschen Kleidern über den Laufsteg und verdienten einen Haufen Geld, sollte mal einen Tag lang versuchen, mein Leben zu führen. Um vier Uhr morgens in einer eisig kalten Lagerhalle irgendwo Downtown zu stehen, sechsmal neu frisiert und geschminkt zu werden und sich ebenso oft umzuziehen war definitiv nicht easy. Öffentlich beklagte ich mich nie darüber – schließlich arbeitete ich nicht in einem chinesischen Ausbeuterbetrieb, und für das, was ich tat, wurde ich nun wirklich ordentlich bezahlt –, aber jeder Mensch sieht hauptsächlich sich selbst, und auch Leute, die nur Luxusprobleme plagen, dürfen insgeheim ein bisschen jammern, oder?
Zum ersten Mal an jenem Tag war mir warm. Ich lehnte mich in die Kissen zurück und checkte die Nachrichten auf meiner Mailbox. Rebekah, Susies Assistentin, hatte mir viermal daraufgesprochen. Sie teilte mir mit, sie habe mir per Mail die Lebensläufe geeigneter PAs geschickt, die ich mir so schnell wie möglich vornehmen solle. Ich scrollte sie auf meinem Laptop durch, als mein Handy klingelte. Wieder Rebekah.
»Ich seh sie mir gerade an«, erklärte ich, bevor sie etwas sagen konnte.
»Wunderbar, danke. Ich hätte da eine junge Frau, die meiner Ansicht nach perfekt für dich wäre. Allerdings hat sie noch ein anderes Jobangebot und muss sich bis morgen entscheiden. Könnte sie am frühen Abend bei dir vorbeikommen, damit ihr euch unterhaltet?«
»Ich bin eben erst von dem Fotoshooting für Vanity Fair zurück und …«
»Du solltest sie dir wirklich anschauen, Elektra. Sie kann Superreferenzen vorlegen und hat als persönliche Assistentin für Bardin gearbeitet. Du weißt, wie schwierig der ist. Ich meine …«, fuhr Rebekah hastig fort, »… sie ist gewöhnt, unter Stress für Topleute der Modebranche zu arbeiten. Darf ich sie dir vorbeischicken?«
»Okay«, seufzte ich, um nicht so »schwierig« zu wirken, wie sie mich offenbar einschätzte.
»Prima, dann sag ich ihr Bescheid. Sie wird begeistert sein, ist ein großer Fan von dir.«
»Gut. Ich erwarte sie um sechs.«
Um Punkt sechs informierte mich der Concierge, dass mein Gast eingetroffen sei.
»Schicken Sie sie rauf«, bat ich ihn müde. Ich freute mich nicht sonderlich auf das Gespräch mit der jungen Frau, weil ich, seit Susie meinte, ich brauche Hilfe bei der Organisation meines Lebens, eine ganze Reihe eifriger Mädchen eingestellt hatte, die wenige Wochen später wieder gegangen waren.
»Bin ich schwierig?«, fragte ich mein Spiegelbild und vergewisserte mich, dass keine Speisereste zwischen meinen Zähnen steckten. »Möglich. Aber das ist ja nichts Neues.« Ich leerte das Glas mit Wodka und strich mir über die Haare, die mein Stylist Stefano mir vor Kurzem zu kleinen, eng an der Kopfhaut anliegenden Zöpfen geflochten hatte, um lange Extensions einarbeiten zu können. Eine ziemlich schmerzhafte Prozedur.
Als es an der Tür klopfte, öffnete ich, gespannt, was mich auf der anderen Seite erwartete. Und war erstaunt. Mit dieser kleinen, gepflegten Person im schlichten braunen Kostüm, dessen Rock ziemlich unmodern bis über die Knie reichte, hatte ich nicht gerechnet. Mein Blick wanderte hinunter zu ihren Füßen, die in einem Paar, wie Ma es ausgedrückt hätte, »vernünftiger« brauner Halbschuhe steckten. Am meisten überraschte mich das Kopftuch, das sie um Stirn und Hals gewunden trug. Sie hatte ein hübsches Gesicht, eine winzige Nase, hohe Wangenknochen, volle rosige Lippen und einen reinen milchkaffeefarbenen Teint.
»Hallo.« Die Frau begrüßte mich lächelnd, ihre braunen Augen strahlten. »Ich heiße Mariam Kazemi und freue mich sehr, Sie kennenzulernen, Miss d’Aplièse.«
Eine so tiefe, warme Stimme wie die ihre, die mich an goldenen Honig denken ließ, hätte ich auch gern gehabt.
»Hi, Mariam, kommen Sie rein.«
»Danke.«
Während ich mit großen Schritten zum Sofa ging, ließ Mariam Kazemi sich Zeit und betrachtete die teuren Gemälde voller Kleckse und Kringel. Ihre Miene verriet mir, dass sie ihr genauso wenig gefielen wie mir.
»Die gehören nicht mir, sondern dem Vermieter«, fühlte ich mich bemüßigt zu erklären. »Was darf ich Ihnen anbieten? Wasser, Kaffee, Tee oder etwas Stärkeres?«
»Danke, ich trinke keinen Alkohol. Wasser, wenn Ihnen das keine Umstände macht.«
»Gern.« Ich ging in die Küche und nahm eine Flasche Evian aus dem Kühlschrank. Kurz darauf gesellte sie sich zu mir.
»Haben Sie kein Personal?«
»Doch, eine Zugehfrau, aber die meiste Zeit bin ich allein hier.« Ich reichte ihr das Wasser.
Sie trat damit zum Fenster und blickte hinaus.
»Ganz schön weit oben.«
»Ja.« Diese Frau, die so beruhigend wirkte wie gutes Parfüm und gänzlich unbeeindruckt von mir und der tollen Wohnung zu sein schien, imponierte mir. Andere potenzielle Kandidatinnen waren für gewöhnlich aufgeregt und versprachen mir das Blaue vom Himmel herunter.
»Wollen wir uns setzen?«, schlug ich vor.
»Danke, gern.«
Sobald wir im Wohnzimmer saßen, fragte ich: »Sie haben also für Bardin gearbeitet?«
»Ja.«
»Warum haben Sie dort aufgehört?«
»Weil mir eine Stelle angeboten wurde, die möglicherweise besser für mich passt.«
»Nicht, weil er schwierig war?«
»Nein«, meinte Mariam schmunzelnd. »Er war überhaupt nicht schwierig, ist aber vor Kurzem nach Paris zurückgegangen, während ich hier lebe. Wir sind nach wie vor freundschaftlich verbunden.«
»Wunderbar. Und warum möchten Sie bei mir anfangen?«
»Weil ich Ihre Arbeit sehr bewundere.«
Wow, dachte ich. Es passierte nicht oft, dass jemand das, was ich machte, als »Arbeit« bezeichnete.
»Danke.«
»Ich halte es für eine echte Gabe, den Produkten, für die man wirbt, ein Gesicht zu geben.«
Sie öffnete ihre schlichte braune Tasche, die eher an einen Schulranzen als an ein Designerstück erinnerte, und reichte mir ihren Lebenslauf.
»Vermutlich hatten Sie keine Zeit, ihn sich anzusehen, bevor ich hergekommen bin.«
»Nein«, gestand ich und überflog den ungewöhnlich kurzen sachlichen Text. »Sie waren also nicht auf dem College?«
»Nein, dafür besaß meine Familie nicht die nötigen Mittel. Oder doch …«, sie hob eine ihrer kleinen, zarten Hände ans Gesicht und rieb sich mit einem Finger die Nase, »… aber wir sind sechs Kinder, und es wäre den anderen gegenüber nicht fair gewesen, wenn ich ein College besucht hätte und sie nicht.«
»Wir sind auch zu sechst! Und ich war ebenfalls weder auf dem College noch auf der Uni.«
»Dann haben wir ja etwas gemein.«
»Ich bin die Jüngste.«
»Und ich die Älteste«, sagte Mariam lächelnd.
»Sie sind sechsundzwanzig?«
»Ja.«
»Dann sind wir gleich alt.« Aus einem mir unerfindlichen Grund gefiel es mir, Parallelen zum Leben dieser ungewöhnlichen jungen Frau zu entdecken. »Was haben Sie nach dem Schulabschluss gemacht?«
»Tagsüber habe ich in einem Blumenladen gearbeitet und abends Wirtschaftskurse besucht. Wenn Sie wollen, lege ich Ihnen gern eine Abschrift meines Abschlusszeugnisses vor. Ich kann gut mit dem Computer umgehen und kenne mich mit Tabellenkalkulation aus. Und ich tippe ziemlich schnell … wie schnell genau, weiß ich allerdings nicht.«
»Die Schreibgeschwindigkeit ist mir nicht wichtig. Und um die tabellarische Aufstellung meiner Finanzen kümmert sich mein Steuerberater.«
»Tabellen können auch die Organisation des sonstigen Lebens erleichtern. Sie verschaffen Überblick über den gesamten Monat.«
»Wenn Sie so eine Übersicht aufstellen würden, wären wir geschiedene Leute«, scherzte ich. »Ich lebe von Tag zu Tag. Anders geht es für mich nicht.«
»Das kann ich nachvollziehen, Miss d’Aplièse, doch meine Aufgabe ist es zu strukturieren. Bei Bardin habe ich sogar für die Reinigung und die Kleidung eine Tabelle erstellt. Wir haben besprochen, was er zu welchem Anlass tragen würde, bis hin zur Farbe seiner Socken – die oft absichtlich nicht zusammenpassten.« Als Mariam lachte, fiel ich ein.
»Sie halten ihn also für einen angenehmen Menschen?«
»Ja, er ist ein wunderbarer Mann.«
Egal, ob das stimmte oder nicht: Diese junge Frau besaß Integrität. Im Gegensatz zu anderen potenziellen Kandidatinnen vor ihr sagte sie nichts Schlechtes über ihren früheren Arbeitgeber. Wenn mir jemand haarklein erklärte, warum er gekündigt hatte, wusste ich, dass der Betreffende möglicherweise irgendwann einmal auch über mich so reden würde.
»Bevor Sie fragen: Ich bin absolut diskret.« Mariam schien meine Gedanken erraten zu haben. »Ich habe festgestellt, dass Geschichten, die über berühmte Leute kursieren, häufig nicht der Wahrheit entsprechen. Mich wundert …«
»Was?«
»Nichts.«
»Raus mit der Sprache.«
»Mich wundert, dass so viele Menschen sich nach Ruhm sehnen, denn meiner Erfahrung nach bringt der oft Leid. Die Leute meinen, Ruhm würde ihnen das Recht geben zu tun und zu lassen, was sie wollen, doch in Wirklichkeit raubt er ihnen das wertvollste Gut, das wir besitzen, nämlich die Freiheit.«
Ich sah sie erstaunt an. Offenbar tat ich ihr trotz meines Reichtums leid. Allerdings hatte das bei ihr nichts Herablassendes an sich, sondern zeugte eher von Mitgefühl.
»Ja, ich habe tatsächlich meine Freiheit verloren«, gestand ich dieser wildfremden Person. »Zum Beispiel fürchte ich immerzu, dass mich jemand bei etwas Alltäglichem beobachtet und daraus eine große Story macht, um die Auflage seiner Zeitung zu pushen.«
»Das ist kein schönes Leben, Miss d’Aplièse.« Mariam schüttelte ernst den Kopf. »Leider muss ich mich jetzt verabschieden. Ich habe meiner Mutter versprochen, auf meinen kleinen Bruder aufzupassen, während sie mit Papa ausgeht.«
»Müssen Sie öfter babysitten?«
»Nein. Deswegen ist es so wichtig, dass ich heute Abend da bin. Heute ist nämlich Mamas Geburtstag. Zu Hause scherzen wir, dass Papa sie vor achtundzwanzig Jahren, als er ihr den Heiratsantrag machte, zum letzten Mal ausgeführt hat! Falls ich bei Ihnen anfangen sollte, muss ich rund um die Uhr verfügbar sein, das ist mir klar.«
»Und viel ins Ausland reisen.«
»Kein Problem. Ich lebe nicht in einer festen Beziehung. Wenn Sie mich nun entschuldigen würden …« Sie stand auf. »Es war mir ein Vergnügen, Sie kennenzulernen, Miss d’Aplièse, selbst wenn wir nicht zusammenkommen sollten.«
Ich blickte ihr nach, wie sie zur Tür ging. Trotz ihrer hausbackenen Kleidung besaß sie natürliche Anmut und was Fotografen »Präsenz« nannten. Obwohl unser Gespräch gerade mal eine Viertelstunde gedauert und ich nicht einmal ein Zehntel der Fragen gestellt hatte, die ich als wichtig erachtete, wünschte ich mir Mariam Kazemi und die wundervolle Ruhe, die sie ausstrahlte, in meinem Leben.
»Moment noch. Würden Sie sich vorstellen können, die Stelle bei mir anzutreten?« Ich sprang von der Couch auf. »Soweit ich weiß, haben Sie ein anderes Angebot und müssen sich bis morgen dazu äußern.«
Nach kurzem Zögern drehte sie sich lächelnd zu mir um. »Natürlich könnte ich mir das vorstellen. Ich halte Sie für einen liebenswerten Menschen mit einer guten Seele.«
»Wann könnten Sie anfangen?«
»Nächste Woche, wenn Sie wollen.«
»Abgemacht.« Ich streckte ihr die Hand hin, die sie nach weiterem kurzem Zögern ergriff.
»Abgemacht«, wiederholte sie. »Aber jetzt muss ich wirklich los.«
»Natürlich.«
Sie öffnete die Tür, und ich begleitete sie zum Lift. »Die Bedingungen kennen Sie ja bereits. Ich bitte Rebekah, sie Ihnen am Morgen schriftlich per Fahrradkurier zu schicken.«
»Danke«, sagte sie, als sich die Aufzugtüren öffneten.
»Was ist das übrigens für ein Parfüm, das Sie tragen? Das finde ich sehr angenehm.«
»Das ist Körperöl. Ich stelle es selbst her. Auf Wiedersehen, Miss d’Aplièse.«
Wenig später schlossen sich die Türen des Lifts, und Mariam Kazemi war fort.
* * *
Mariams Referenzen waren nicht nur sehr gut, sondern hymnisch, sodass wir bereits am folgenden Donnerstag am Teterboro Airport in New Jersey einen Privatjet bestiegen und uns auf den Weg nach Paris machten. Auf ihre Kleidung wirkte sich unsere Reise nur insofern aus, als sie den Rock gegen eine beigefarbene Hose eintauschte. Sobald sie ihren Platz im Flugzeug eingenommen hatte, holte sie den Laptop aus ihrer Tasche.
»Sind Sie schon einmal mit einem Privatjet geflogen?«, fragte ich sie.
»Ja, Bardin reiste nur so. Miss d’Aplièse …«
»Sagen Sie doch bitte Elektra zu mir.«
»Elektra. Wollen Sie sich während des Flugs lieber etwas ausruhen oder die Zeit nutzen, um einige Dinge zu besprechen?«
Da ich mich bis vier Uhr morgens mit Zed vergnügt hatte, entschied ich mich für die erste Alternative und betätigte, sobald wir in der Luft waren, den Knopf, der meinen Sitz in ein Bett verwandelte, setzte meine Schlafmaske auf und döste sofort ein.
Drei Stunden später wachte ich erfrischt auf – ich hatte genug Erfahrung mit Flugzeugschlaf – und lugte unter meiner Maske hervor zu meiner neuen persönlichen Assistentin hinüber. Sie war nicht auf ihrem Platz, weswegen ich vermutete, dass sie sich in der Toilette aufhielt. Als ich die Maske abnahm und mich aufrichtete, sah ich Mariam zu meiner Überraschung in dem schmalen Gang zwischen den Sitzen auf dem Boden knien. Vielleicht macht sie Yoga-Übungen, dachte ich. Dann hörte ich sie vor sich hin murmeln. Sobald sie Hände und Kopf leicht hob, begriff ich, was sie tat: Sie betete. Peinlich berührt, dass ich sie bei etwas so Intimem beobachtete, wandte ich den Blick ab und ging selbst zur Toilette. Bei meiner Rückkehr saß Mariam auf ihrem Platz und tippte auf ihrem Laptop herum.
»Haben Sie gut geschlafen?«, erkundigte sie sich.
»Ja, und jetzt hätte ich Hunger.«
»Ich habe dafür gesorgt, dass Sushi an Bord ist. Susie meint, das sei Ihr Lieblingsessen auf Reisen.«
»Danke. Das stimmt.«
Schon stand die Flugbegleiterin neben mir. »Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein, Miss d’Aplièse?«
Ich bestellte frisches Obst, Sushi sowie eine demi-bouteille Champagner und wandte mich wieder Mariam zu. »Wollen Sie auch etwas?«
»Danke, ich habe bereits gegessen.«
»Leiden Sie unter Flugangst?«
Sie schaute mich erstaunt an. »Nein, überhaupt nicht. Warum?«
»Weil ich Sie vorhin beim Beten beobachtet habe.«
»Ach so.« Sie lachte. »Das hat nichts mit Angst zu tun. In New York ist jetzt Mittag, die Zeit, zu der ich immer bete.«
»Ich wusste nicht, dass Sie das müssen.«
»Keine Sorge. Sie werden mich nicht oft beten sehen; für gewöhnlich suche ich mir dafür eine stille Ecke, aber hier oben … In der Toilette ist nicht genug Platz.«
»Müssen Sie jeden Tag beten?«
»Ja, fünfmal.«
»Wow. Ist das nicht lästig?«
»Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Ich kenne es seit Kindertagen nicht anders. Es verschafft mir ein gutes Gefühl und gehört zu meinem Leben.«
»Sie meinen, Ihre Religion verlangt es?«
»Nein, es ist ein Teil von mir. Da kommt das Essen. Sieht köstlich aus.«
»Setzen Sie sich doch zu mir. Ich trinke ungern allein«, forderte ich sie auf, als die Flugbegleiterin mir Champagner einschenkte.
»Möchten Sie auch etwas, Ma’am?«, fragte diese Mariam, die auf dem Sitz neben mir Platz genommen hatte.
»Ein Glas Wasser, bitte.«
»Cheers«, prostete ich ihr zu. »Auf unsere erfolgreiche Zusammenarbeit.«
»Ja. Davon, dass sie erfolgreich wird, gehe ich aus.«
»Entschuldigen Sie, wenn ich mich mit Ihren Gebräuchen nicht auskenne.«
»Dafür müssen Sie sich nicht entschuldigen. Ich an Ihrer Stelle würde auch nichts darüber wissen.«
»Ist Ihre Familie strenggläubig?«
»Nein, eigentlich nicht. Jedenfalls nicht verglichen mit anderen. Ich bin wie meine Geschwister in New York zur Welt gekommen; wir sind Amerikaner. Mein Vater sagt immer, dieses Land habe meinen Eltern Sicherheit in der Not geboten. Deshalb dürfen wir nicht nur an den alten Sitten festhalten, sondern müssen uns auch an die hiesigen neuen anpassen.«
»Wo sind Ihre Eltern geboren?«, erkundigte ich mich.
»Im Iran … oder Persien, wie wir das Land zu Hause nennen. Ein viel schöneres Wort, finden Sie nicht auch?«
»Ja. Ihre Eltern mussten ihre Heimat gegen ihren Willen verlassen?«
»Ja. Sie sind beide nach dem Sturz des Schahs als junge Erwachsene nach Amerika gekommen.«
»Des Schahs?«
»Der damalige iranische Herrscher, eine Art König oder Kaiser. Er war in seiner Einstellung sehr westlich ausgerichtet. Den Fanatikern in unserem Land hat das nicht gepasst. Deshalb mussten alle, die mit ihm verwandt waren, fliehen, wenn sie nicht sterben wollten.«
»Sie sind also adliger Abstammung?«
Mariam schmunzelte. »Man könnte es so ausdrücken, ja, doch bei uns ist das nicht wie in den europäischen Königshäusern. Es gibt zahlreiche Verwandte des Schahs … angeheiratete Cousins und Cousinen zweiten, dritten oder vierten Grades. Im Westen würde man vermutlich sagen, meine Familie sei von hoher Geburt.«
»Na, so was! Dann arbeitet eine Prinzessin für mich!«
»Unter anderen Umständen wäre ich möglicherweise Prinzessin geworden. Allerdings nur wenn ich den richtigen Mann geheiratet hätte.«
Nun begriff ich manches: ihre zurückhaltende Art, ihre Selbstsicherheit und ihre perfekten Manieren …
»Und Sie, Elektra? Woher stammt Ihre Familie?«
»Keine Ahnung«, antwortete ich und leerte mein Glas. »Ich wurde als Baby adoptiert.«
»Sie haben nie mehr über Ihre Vergangenheit erfahren wollen?«
»Nein. Welchen Sinn hat es zurückzublicken, wenn man die Vergangenheit nicht ändern kann? Ich schaue nur nach vorn.«
»Dann sollten Sie meinen Vater lieber nicht kennenlernen.« Mariam wirkte belustigt. »Er erzählt ständig von dem Leben, das er mit meinen Großeltern im Iran führte. Und von unseren Vorfahren. Seine Geschichten sind wunderschön; als Kind habe ich ihnen gern gelauscht.«
»Ich hatte nur die Märchen der Gebrüder Grimm, und in denen kamen viele böse Hexen und Geister vor, die mir Angst machten.«
»Auch in unseren Geschichten gibt es böse Geister. Sie heißen Dschinns und tun Menschen schlimme Dinge an.« Mariam nippte an ihrem Wasser und beäugte mich über den Rand ihres Glases. »Papa sagt immer, unsere Geschichte sei der Teppich, auf dem wir stehen und von dem aus wir fliegen können. Möglicherweise wollen auch Sie eines Tages mehr über Ihre Herkunft herausfinden. Wollen wir nun den Plan für Paris durchgehen?«
Eine Stunde später kehrte Mariam an ihren Platz zurück, um das, was sie während unseres Gesprächs notiert hatte, in ihren Laptop einzugeben. Ich stellte meinen Sitz zurück und beobachtete, wie der Himmel draußen dunkler wurde und die Nacht sich auf Europa herabsenkte. Irgendwo da unten in der Dunkelheit lag mein Zuhause, das Zuhause von uns ungleichen Schwestern, die Pa auf der ganzen Welt zusammengesammelt hatte.
Es hatte mir nie etwas ausgemacht, dass wir nicht blutsverwandt waren, doch wenn ich Mariam über ihre Herkunft reden hörte und beobachtete, wie sie die Sitten ihrer uralten Kultur in einem Privatjet nach Paris befolgte, wurde ich fast ein wenig neidisch.
Der Brief von Pa fiel mir ein, der irgendwo in meiner New Yorker Wohnung liegen musste … Ich wusste nicht einmal, wo. Da ich ihn nicht geöffnet und höchstwahrscheinlich verloren hatte, würde ich vermutlich nie Gelegenheit erhalten, etwas über meine Vergangenheit zu erfahren. Vielleicht konnte mir ja »Hoff« – mein Spitzname für Pas Anwalt – mehr dazu sagen … Außerdem waren da noch die Koordinaten auf der Armillarsphäre, von denen Ally behauptete, sie würden uns verraten, woher wir ursprünglich stammten. Plötzlich erschien es mir sehr wichtig, Pas Brief aufzuspüren, so wichtig, dass ich fast den Piloten gebeten hätte umzukehren, um meine Schubladen durchsuchen zu können. Als ich mich seinerzeit nach der Quasitrauerfeier in Atlantis, die arrangiert worden war, weil Pa sich offenbar für eine Seebestattung entschieden hatte, die vor unser aller Eintreffen stattfand, nach New York zurückbegeben hatte, war ich so wütend gewesen, dass meine Vergangenheit mich nicht mehr interessierte.
Warum so wütend, Elektra?, klangen mir die Worte der Therapeutin in den Ohren. Eine Antwort darauf kannte ich nicht. Die Wut begleitete mich seit frühester Kindheit. Meine Schwestern erzählten gern, wie ich mir als Baby die Lunge aus dem Leib gebrüllt und sich das später nicht wesentlich geändert habe. Wie ich aufwuchs, konnte nicht daran schuld sein, denn meine Jugend war perfekt, wenn auch ungewöhnlich gewesen. Pa hatte uns samt und sonders adoptiert, und unsere Familienfotos ähnelten aufgrund unserer unterschiedlichen ethnischen Herkunft einer Gap-Werbung. Auf meine Fragen danach hatte Pa stets geantwortet, er habe sich uns als seine Töchter ausgesucht. Meine Schwestern schien das, anders als mich, zufriedenzustellen. Ich hingegen wollte den Grund wissen. Jetzt nach seinem Tod würde ich ihn höchstwahrscheinlich nie erfahren.
»Eine Stunde bis zur Landung, Miss d’Aplièse«, teilte die Flugbegleiterin mir mit und schenkte mir nach. »Darf ich Ihnen noch etwas bringen?«
»Nein, danke.« Ich schloss die Augen in der Hoffnung, dass mein Kontakt in Paris Wort gehalten und das, was ich nun dringend brauchte, ins Hotel gebracht hatte. Ohne Drogen und Alkohol begann ich, über Pa nachzudenken, über meine Schwestern, mein Leben … und dabei war mir nicht wohl. Jedenfalls nicht im Moment.
* * *
Zur Abwechslung machte mir das Fotoshooting sogar einmal Spaß. Der Frühling in Paris war – zumindest bei sonnigem Wetter – wunderschön. Falls ich mich überhaupt in einer Stadt zu Hause fühlte, dann in dieser. Wir befanden uns im Jardin des Plantes, in dem Kirschblüten, Iris und Pfingstrosen in voller Pracht standen und alles sehr neu und frisch wirkte. Außerdem mochte ich den Fotografen. So wurden wir frühzeitig fertig und vertieften unsere Bekanntschaft am Nachmittag in meinem Hotelzimmer.
»Wie kommst du bloß dazu, in New York zu leben?«, fragte Maxime mich auf Französisch, während wir im Bett Tee aus zarten Porzellantassen tranken und eine Line vom Tablett snieften. »Du hast eine europäische Seele.«
»Das weiß ich auch nicht so genau«, seufzte ich. »Meine Agentin Susie lebt dort, und ich fand es sinnvoll, in ihrer Nähe zu sein.«
»Deine Model-maman, meinst du?«, neckte er mich. »Du bist doch ein großes Mädchen und in der Lage, selbst über dein Leben zu entscheiden. Zieh nach Paris, dann könnten wir uns öfter miteinander vergnügen.« Er stand vom Bett auf und verschwand ins Bad, um zu duschen.
Als ich durchs Fenster hinaus auf die Place Vendôme blickte, auf der sich Touristen und Kauflustige vor den exklusiven Geschäften drängten, dachte ich über Maximes Worte nach. Er hatte recht: Ich konnte überall leben, weil ich ohnehin so viel auf Achse war.
»Wo ist mein Zuhause?«, flüsterte ich, deprimiert darüber, in meine seelenlose New Yorker Wohnung zurückkehren zu müssen. Einem plötzlichen Impuls folgend, griff ich nach dem Handy und wählte die Nummer von Mariam.
»Habe ich morgen irgendwelche Termine in New York?«
»Ein Essen mit Thomas Allebach, dem Marketingchef der Werbekampagne für den neuen Duft, den Sie bewerben, um sieben Uhr abends«, informierte mich Mariam.
»Aha.« Thomas und ich hatten in den Monaten seit der Trennung von Mitch einige angenehme Stunden miteinander verbracht, aber verliebt war ich nicht in ihn. »Und am Sonntag?«
»Da steht nichts im Kalender.«
»Wunderbar. Sagen Sie das Essen ab, erzählen Sie Thomas, dass das Shooting länger dauert oder sonst irgendwas, verschieben Sie den Rückflug auf den späten Sonntagabend und verlängern Sie meinen Hotelaufenthalt hier. Ich möchte noch ein bisschen in Paris bleiben.«
»Gern. Paris ist eine wunderbare Stadt. Ich gebe Ihnen Bescheid, sobald alles erledigt ist.«
»Danke, Mariam.«
»Keine Ursache.«
»Ich bleibe länger«, teilte ich Maxime mit, als er vom Duschen zurückkam.
»Schade. Leider bin ich übers Wochenende weg. Wenn ich das geahnt hätte …«
»Oh.« Ich versuchte, mir meine Enttäuschung nicht anmerken zu lassen. »Egal, ich bin ja irgendwann wieder hier.«
»Gib mir Bescheid, wann.« Er zog sich an. »Ein Freund von mir heiratet. Da kann ich nicht absagen. Sorry, Elektra.«
»Ich bleibe wegen der Stadt, nicht deinetwegen.« Ich rang mir ein Lächeln ab.
»Diese Stadt liebt dich wie ich.« Er drückte mir einen Kuss auf die Stirn. »Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Melde dich.«
»Mach ich.«
Sobald er weg war, sniefte ich, um mich aufzumuntern, eine weitere Line und überlegte, was ich in Paris unternehmen konnte. Leider würde man mich wie in anderen Großstädten in dem Moment erkennen, in dem ich das Ritz durch den Vordereingang verließ. Irgendjemand würde die Presse informieren, und schon wäre mir ein Rattenschwanz von Reportern auf den Fersen.
Ich griff nach dem Handy, um Mariam anzurufen und ihr mitzuteilen, dass wieder Plan A gelte, als es klingelte.
»Elektra? Ich bin’s, Mariam. Der Rückflug nach New York ist auf Sonntagabend umgebucht, und Sie können weiter in der Hotelsuite bleiben.«
»Danke.«
»Soll ich in einem Restaurant Plätze für Sie reservieren?«
»Nein, ich …« Tränen traten mir in die Augen.
»Alles in Ordnung, Elektra?«
»Ja, alles gut.«
»Sind Sie im Moment … beschäftigt?«
»Nein.«
»Kann ich zu Ihnen kommen? Susie hat Verträge geschickt, die Sie unterschreiben müssten.«
»Kein Problem.«
Wenig später traf Mariam ein, umweht von ihrem angenehmen Duft. Ich unterzeichnete die Verträge und starrte dann düster durchs Fenster hinaus in die hereinbrechende Pariser Dämmerung.
»Wie sehen Ihre Pläne für heute Abend aus?«, erkundigte sich Mariam.
»Ich habe keine. Und die Ihren?«
»Nichts außer Bad, Bett und einem guten Buch«, antwortete sie.
»Ich würde gern in dem Café vorbeischauen, in dem ich früher als Kellnerin gejobbt habe, und einfach nur ganz normal essen gehen wie andere Leute, habe aber keine Lust, erkannt zu werden.«
»Das kann ich verstehen.« Sie musterte mich kurz und stand auf. »Ich habe eine Idee. Warten Sie hier.«
Sie verließ den Raum und kehrte wenige Minuten später mit einem Kopftuch zurück.
»Darf ich Ihnen das umbinden?«
»Sie meinen, um die Schultern?«
»Nein, um den Kopf wie bei mir. Normalerweise halten die Leute Distanz zu Frauen mit Hidschab. Auch deshalb tragen so viele unseres Glaubens ihn. Wollen wir es ausprobieren?«
»Okay. Das dürfte der einzige Look sein, den ich noch nie versucht habe«, meinte ich schmunzelnd.
Ich setzte mich ans Fußende des Bettes, und Mariam wand das Tuch geschickt um meinen Kopf, drapierte die Enden über meine Schultern und steckte sie fest.
»Schauen Sie sich an.« Sie deutete auf den Spiegel.
Kaum zu glauben, wie verändert ich wirkte. Fast hätte ich mich selbst nicht erkannt.
»Das ist gut, richtig gut, doch mit meinem Körper lässt sich nicht viel machen, oder?«
»Haben Sie eine dunkle Strumpfhose oder Leggings dabei?«
»Nur die schwarze Jogginghose, die ich im Flugzeug anhatte.«
»Wunderbar. Ziehen Sie die an, während ich noch etwas anderes hole.«
Ich tat ihr den Gefallen. Kurz darauf kehrte Mariam mit einem Gewand über dem Arm zurück. Als sie es ausschüttelte, sah ich, dass es sich um ein billiges langärmeliges Baumwollkittelkleid mit Blümchenmuster handelte.
»Das habe ich mitgenommen für den Fall, dass wir irgendwo hingehen, wo man etwas Feineres braucht. Es ist für besondere Gelegenheiten, aber ich leihe es Ihnen gern.«
»Ob mir das passt?«
»Soweit ich sehe, ist obenrum bei uns nicht viel Unterschied. Ich trage es als Kleid, Sie könnten es als lange Hemdbluse anziehen. Schlüpfen Sie einfach mal rein.«
Mariam hatte recht. Das Kleid passte am Oberkörper tatsächlich gut und reichte mir bis etwa zur Mitte der Oberschenkel.
»So erkennt Sie niemand. Sie gehen als Muslima durch.«
»Was ist mit meinen Füßen? Ich hab nur meine Louboutins und die Pumps von Chanel dabei.«
»Nehmen Sie die Turnschuhe vom Flug«, schlug sie vor und trat an meinen Koffer. »Darf ich?«
»Klar.« Ich betrachtete mein neues Ich im Spiegel. Mit dem Kopftuch und dem einfachen Baumwollkleid, das ich als Top verwendete, hätte es eines Röntgenblicks bedurft, um mich zu erkennen.
»Perfekt«, meinte Mariam, als ich die Turnschuhe band. »Verwandlung komplett. Nur noch eines: Darf ich einen Blick in Ihre Schminksachen werfen?«
»Ja.«
»Die Augen brauchen noch etwas Kajal. Machen Sie sie bitte zu.«
Ich schloss sie, und meine Gedanken wanderten zu den Zeiten zurück, wenn wir Schwestern während unseres alljährlichen Aufenthalts auf Pas Jacht im Sommer abends zum Essen an Land gehen wollten. Da ich damals selbst zu jung für Make-up war, beobachtete ich vom Bett aus, wie Maia Ally beim Schminken half.
»Sie haben einen wunderbar schimmernden Teint«, bemerkte Mariam seufzend. »Fertig. So erkennt Sie niemand.«
»Glauben Sie?«
»Sie werden es unten im Rezeptionsbereich gleich selbst sehen. Wollen wir?«
»Ja, warum nicht?« Als ich meine Shopper von Louis Vuitton nehmen wollte, hielt Mariam mich davon ab.
»Geben Sie alles, was Sie benötigen, in meine Tasche.« Sie reichte mir ihre billige braune Schultertasche aus Kunstleder. »Bereit?«
»Ja.«
Obwohl drei Leute zu uns in den Aufzug stiegen, würdigte mich keiner eines Blickes. Und im Eingangsbereich schaute der Concierge nur kurz zu uns herüber, bevor er sich wieder seinem Computer zuwandte.
»Wow, Christophe kennt mich seit Jahren«, flüsterte ich draußen, wo Mariam den Portier herbeirief.
»Wir bräuchten ein Taxi nach Montmartre«, erklärte sie in sehr passablem Französisch.
»D’accord, mademoiselle, aber andere Leute wollen auch ein Taxi. Es könnte etwas dauern.«
»Kein Problem, wir warten.«
»Ich habe Jahre nicht mehr auf ein Taxi gewartet«, murmelte ich.
»Willkommen in der realen Welt, Elektra«, meinte Mariam schmunzelnd.
Zwanzig Minuten später nahmen wir an einem Tisch in dem Café Platz, in dem ich früher als Kellnerin gearbeitet hatte. Es war kein sonderlich guter Tisch – wir saßen eingequetscht zwischen zwei anderen, und ich konnte jedes Wort der Leute neben uns verstehen. Immer wieder schaute ich zu George hinter der Bar hinüber, der mir den Job als Kellnerin zehn Jahre zuvor gegeben hatte, doch der wandte sich kein einziges Mal mir zu.
»Und, wie fühlt es sich an, unsichtbar zu sein?«, erkundigte sich Mariam, nachdem ich eine kleine Karaffe des Hausweins bestellt hatte.
»Ich weiß nicht so recht. Irgendwie merkwürdig.«
»Aber befreiend?«
»Ja. Ich habe es genossen, unerkannt die Straße entlangzugehen, doch alles hat seine Licht- und Schattenseiten.«
»Stimmt. Vermutlich wurden Sie schon angestarrt, bevor Sie berühmt waren, nicht wahr?«
»Mag sein, aber mir war nie klar, ob das freundliche Blicke waren oder die Leute mich angafften, weil ich sie an eine schwarze Giraffe erinnerte!«
»Ich glaube eher, es lag an Ihrer Schönheit. Mir hingegen begegnen die Menschen nach den Terroranschlägen auf das World Trade Center mit Argwohn. Jeder Muslim ist automatisch ein Terrorist, wissen Sie.« Sie trank traurig lächelnd einen Schluck Wasser.
»Bestimmt ist das für Sie nicht leicht.«
»Nein. Egal, in welchem politischen oder religiösen System die Menschen leben: Die meisten wollen einfach nur Frieden. Leider werde ich oft, noch bevor ich den Mund aufmache, aufgrund meiner Kleidung beurteilt.«
»Gehen Sie jemals ohne Kopftuch auf die Straße?«
»Nein, obwohl mein Vater meinte, ich solle den Hidschab bei der Jobsuche lieber nicht tragen. Seiner Ansicht nach würde das meine Chancen verringern.«
»Vielleicht sollten Sie’s tatsächlich mal ausprobieren und wie ich heute Abend ein paar Stunden lang jemand anders werden. Auch für Sie könnte das befreiend wirken.«
»Möglich, aber ich trage ihn gern. Wollen wir bestellen?«
Mariam orderte auf Französisch.
»Sie scheinen viele geheime Fähigkeiten zu besitzen«, neckte ich sie. »Wo haben Sie so gut Französisch gelernt?«
»In der Schule und während meiner Tätigkeit für Bardin – Französischkenntnisse sind in der Modebranche unerlässlich. Außerdem habe ich ein Ohr für Sprachen. Ihr Französisch wirkt ganz anders als Ihr Englisch.«
»Wie meinen Sie das?«
»Nicht negativ«, erklärte sie hastig. »Ihr Englisch ist lässiger – möglicherweise des leichten amerikanischen Akzents wegen. In Französisch klingen Sie irgendwie … ernster.«
»Meine Schwestern würden sich köstlich amüsieren, wenn sie das hören könnten«, sagte ich grinsend.
Bei moules marinières und frischem knusprigem Baguette, wie es nur die Franzosen backen können, ermutigte ich Mariam, mir von ihrer Familie zu erzählen, und bot ihr das Du an. Offensichtlich liebte sie ihre Geschwister abgöttisch, und um diese Liebe beneidete ich sie.
»Kaum zu glauben, dass meine kleine Schwester nächstes Jahr heiratet. Meine Eltern behaupten schon, ich werde eine alte Jungfer«, sagte sie belustigt, während wir uns über die Nachspeise, eine Tarte Tatin, hermachten. Die Kalorien würde ich am folgenden Morgen im Fitnessraum des Hotels abtrainieren.
»Meinst du, du wirst jemals heiraten?«, erkundigte ich mich.
»Ich weiß es nicht. Im Moment will ich mich noch nicht fest binden. Vielleicht habe ich auch ›den Richtigen‹ bisher nicht gefunden. Und du? Warst du je verliebt?«
Bei ihr machte mir diese Frage nichts aus, denn an diesem Abend waren wir einfach nur zwei junge Frauen, die beim Essen plauderten.
»O ja, und ich denke, das will ich nicht noch einmal erleben.«
»Es ist nicht gut ausgegangen?«
»Nein. Er hat mir das Herz gebrochen. Das hat mich ziemlich aus der Bahn geworfen, aber hey, was soll’s, so was passiert eben.«
»Irgendwann wird jemand anders in dein Leben treten, Elektra, da bin ich mir ganz sicher.«
»Du klingst wie meine esoterische Schwester Tiggy. Die sagt die ganze Zeit solche Sachen.«
»Vielleicht hat sie recht. Für jeden Menschen gibt es den passenden Partner, daran glaube ich fest.«
»Die Frage ist bloß, ob wir den finden. Die Welt ist ziemlich groß.«
»Das stimmt«, pflichtete Mariam mir bei und unterdrückte ein Gähnen. »Entschuldigung, ich habe letzte Nacht nicht gut geschlafen. Der Jetlag steckt mir in den Knochen.«
»Gut, ich verlange die Rechnung.« Ich versuchte den Kellner herbeizuwinken, der mir allerdings beharrlich die kalte Schulter zeigte.
»Gott, ist der Typ unhöflich«, murrte ich, als er uns fünf Minuten später nach wie vor keine Beachtung schenkte.
»Er ist beschäftigt und kommt zu uns, sobald er Zeit hat. Geduld ist eine Gottesgabe.«
»Die ich leider nicht besitze«, murmelte ich, bemüht, meinen Zorn zu zügeln.
Nachdem der Kellner sich endlich herabgelassen hatte, uns die Rechnung zu bringen, und wir aus dem Café traten, bemerkte Mariam: »Du wirst nicht gern ignoriert, das habe ich heute Abend gesehen.«
»Stimmt. In einer Familie mit sechs Mädchen musste man am lautesten brüllen, um sich Gehör zu verschaffen. Und genau das habe ich getan«, fügte ich lachend hinzu.
»Schauen wir mal, ob wir ein Taxi zurück zum Hotel ergattern können …«
Ich hörte nur mit halbem Ohr, was sie sagte, weil mein Blick auf einen Mann fiel, der allein an einem der Tische vor dem Café saß und Cognac trank.
»O mein Gott …«
»Was ist?«
»Der Mann da drüben. Ich kenne ihn. Er arbeitet für unsere Familie.« Ich hatte seinen Tisch fast erreicht, als er mich endlich wahrnahm.
»Christian?«
»Pardon, mademoiselle, kenne ich Sie?« Er musterte mich verwirrt.
Ich beugte mich zu ihm hinab, um ihm ins Ohr zu flüstern. »Natürlich, du Trottel! Ich bin’s, Elektra!«
»Mon dieu! Elektra! Meine …«
»Sch! Ich bin inkognito hier!«
»Tolle Verkleidung, jetzt erkenne ich Sie natürlich.«
Mariam trat zu uns.
»Mariam, das ist Christian. Er gehört praktisch zur Familie. Stören wir, wenn wir uns auf einen Drink zu dir gesellen? Was für ein Zufall, dich hier zu treffen!«
»Wenn Sie mich entschuldigen würden: Ich gehe zurück zum Hotel«, erklärte Mariam. »Sonst schlafe ich im Stehen ein. Hat mich gefreut, Sie kennenzulernen, Christian. Bonne soirée.« Sie verabschiedete sich mit einem Nicken und verschwand zwischen den Passanten auf der belebten Straße.
»Darf ich mich zu dir setzen?«, fragte ich Christian.
»Natürlich. Gern. Ich bestelle Ihnen einen Cognac.«