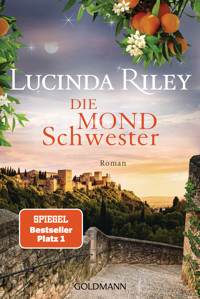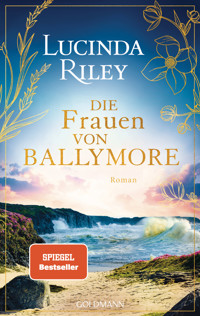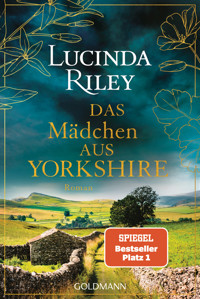
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Von der Bestsellerautorin der »Sieben-Schwestern«-Reihe: ein großer Roman über eine junge Frau und ihr dunkles Geheimnis.
Leah Thompson wächst in einem kleinen Dorf im ländlichen Yorkshire heran. Noch kann niemand ahnen, dass das Mädchen aus einfachen Verhältnissen eines Tages die Laufstege dieser Welt im Sturm erobern wird: Mailand, London, New York sind die Stationen ihrer fulminanten Karriere als Model, die ihr ein Leben in Luxus und Glamour beschert. Aber die schicksalshafte Verbindung mit der Familie Delancey, die weit in ihre Vergangenheit reicht, verfolgt sie wie ein dunkler Schatten und zieht sie in einen Strudel von tragischen Ereignissen, der im zweiten Weltkrieg in Polen seinen Ausgang nahm. Als tief verborgene Geheimnisse drohen ans Licht zu kommen, muss Leah sich einer längst vergessenen Prophezeiung stellen – und einem Schicksal, dem sie scheinbar nicht entkommen kann …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 774
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Buch
Leah Thompson wächst in einem kleinen Dorf im ländlichen Yorkshire heran. Noch kann niemand ahnen, dass das Mädchen aus einfachen Verhältnissen eines Tages die Laufstege dieser Welt im Sturm erobern wird: Mailand, London, New York sind die Stationen ihrer fulminanten Karriere als Model, die ihr ein Leben in Luxus und Glamour beschert. Aber die schicksalhafte Verbindung mit der Familie Delancey, die weit in ihre Vergangenheit reicht, verfolgt sie wie ein dunkler Schatten und zieht sie in einen Strudel von tragischen Ereignissen, der im Zweiten Weltkrieg in Polen seinen Ausgang nahm. Als tief verborgene Geheimnisse drohen ans Licht zu kommen, muss Leah sich einer längst vergessenen Prophezeiung stellen – und einem Schicksal, dem sie scheinbar nicht entkommen kann …
Weitere Informationen zu Lucinda Riley finden Sie am Ende des Buches.
Lucinda Riley
als Lucinda Edmonds
Das Mädchen aus Yorkshire
Roman
Aus dem Englischen von Karin Dufner, Sonja Hauser, Sibylle Schmidt und Ursula Wulfekamp
Die Originalausgabe erschien 1993 unter dem Titel »Hidden Beauty« bei Simon & Schuster, London.
Die überarbeitete Neuausgabe erschien 2024 unter dem Titel »The Hidden Girl« bei Macmillan, einem Imprint von Pan Macmillan, London.
Die Übersetzung von Seite 5–151 besorgte Sonja Hauser, von Seite 152–299 Karin Dufner, von Seite 300–442 Ursula Wulfekamp und von Seite 443–576 Sibylle Schmidt.
Dies ist ein Roman. Fiktion und Realität stellen hier eine untrennbare künstlerische Einheit dar. Ein Anspruch auf historische Richtigkeit und Vollständigkeit besteht daher nicht, mithin sind einzelne historische Fakten teilweise im Dienste der künstlerischen Gestaltungsfreiheit leicht verändert worden und damit umso mehr Ausdruck der kreativ-schriftstellerischen Fantasie.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Deutsche Erstveröffentlichung November 2024
Copyright © der Originalausgabe 2024
by Lucinda Riley
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2024
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: FinePic®, München
CN · Herstellung: ik
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-32627-2V004
www.goldmann-verlag.de
Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
danke, dass Sie sich diesem Roman von Lucinda Riley zuwenden. Ich bin Lucindas Sohn Harry Whittaker. Wenn Sie meinen Namen kennen, dann bestimmt von Atlas – Die Geschichte von Pa Salt, dem letzten Band von Mums Sieben-Schwestern-Reihe, für den ich nach ihrem Tod 2021 die Verantwortung übernahm.
Ich möchte Ihnen erklären, wie es zur Veröffentlichung von Das Mädchen aus Yorkshire gekommen ist. Dazu gebe ich Ihnen eine kurze Zusammenfassung von Mums Arbeit:
Zwischen 1993 und 2000 schrieb sie acht Romane unter dem Namen Lucinda Edmonds. Durch das Buch mit dem Titel Der verbotene Liebesbrief kam ihre Karriere fürs Erste zum Stillstand, weil in dessen Handlung angedeutet wurde, dass es im britischen Königshaus ein außereheliches Kind gebe. Der Tod von Prinzessin Diana sowie die resultierende Unruhe in der britischen Monarchie ließen Buchhändlerinnen und Buchhändler zu diesem Projekt auf Distanz gehen. Bestellungen von Lucinda-Edmonds-Romanen wurden storniert, und ihr Verlag trat vom Vertrag mit ihr zurück.
Zwischen 2000 und 2008 verfasste Mum weitere drei Romane, die allesamt nicht veröffentlicht wurden. 2010 hatte sie dann ihren Durchbruch mit Das Orchideenhaus, ihrem ersten Buch als Lucinda Riley. Unter diesem neuen Namen wurde sie eine der weltweit erfolgreichsten Autorinnen von Frauenliteratur mit mittlerweile sechzig Millionen verkauften Bänden. Parallel zu ihren neuen Werken überarbeitete Mum drei Edmonds-Romane: Das italienische Mädchen, Der Engelsbaum und Der verbotene Liebesbrief. Diese drei bis dahin unveröffentlichten Bände sind inzwischen mit großem Erfolg erschienen.
Was mich zu Das Mädchen aus Yorkshire führt. Der Roman kam ursprünglich 1993 – Mum war damals sechsundzwanzig – in England unter dem Titel Hidden Beauty heraus. Er war erst der zweite, den sie geschrieben hatte. Sie sagte oft, wie stolz sie auf diese Geschichte sei, die sie gern der Welt in überarbeiteter Form schenken wolle. Leider kam es dazu nicht mehr.
Als ich den Roman das erste Mal las, war ich zutiefst beeindruckt. In ihm werden Sie über fehlgeleiteten Ehrgeiz, verbotene Liebe, Rache und Mord lesen … und die Geschichte kulminiert in einer fatalen, fast vergessenen Prophezeiung aus der Vergangenheit. Ich fand erstaunlich, wie viel von dem, was das spätere Werk Lucindas ausmacht, bereits diesen Text charakterisierte – glamouröse Schauplätze, die Bedeutung der Familie sowie das generationenübergreifende Wirken der Liebe. Wie immer scheute sie sich auch nicht, schwierige Themen wie Depression, Alkoholismus und sexuelle Gewalt gegen Frauen anzusprechen.
Lucinda war zweifelsohne eine der weltbesten Geschichtenerzählerinnen, aber natürlich reifte ihre Stimme im Lauf ihrer dreißigjährigen Karriere. Sie verwendete viel Zeit und Mühe auf die drei Umarbeitungen, änderte Handlungsstränge, fügte Figuren hinzu und verfeinerte ihren Stil. Bei dem vorliegenden Text habe ich diese Aufgabe übernommen. Ich habe ihn sanft modernisiert und geholfen, aus einem Edmonds-Roman einen von Lucinda Riley zu machen.
Diese Arbeit war anspruchsvoll, denn selbstverständlich wollte ich das Original so wenig wie möglich verändern. Trotzdem musste ich Perspektiven und Einschätzungen in die heutige Zeit überführen, ohne dem Roman das Herz herauszureißen. Das Leben hat sich in den letzten dreißig Jahren stark verändert, die Kommentare im Internet scheinen tagtäglich gehässiger zu werden. Ich kann nur hoffen, den Balanceakt erfolgreich bewältigt zu haben und Mum gerecht geworden zu sein. Hinzufügen darf ich noch, dass sie die Welt, in die sie Sie gleich entführen wird, gut kannte, denn in jungen Jahren war sie Schauspielerin und Model. Teile dieses Buches beruhen auf ihren persönlichen Erfahrungen, da bin ich mir sicher.
Wie Lucindas Leserinnen und Leser wissen, arrangierte Mum die Handlung ihrer Romane gern um reale historische Ereignisse und erzählte oft weniger bekannte Geschichten aus den fraglichen Epochen. Die Sieben-Schwestern-Reihe fängt die Spannungen der Weltkriege ein, den Konflikt zwischen Großbritannien und Irland, die amerikanische Bürgerrechtsbewegung sowie die Probleme, mit denen sich australische Aborigines oder Roma in Spanien konfrontiert sahen und immer noch sehen. In Das Mädchen aus Yorkshire beschreibt Lucinda die Schrecken des Vernichtungslagers Treblinka im besetzten Polen während des Zweiten Weltkriegs. Das Thema lag ihr sehr am Herzen. Bestimmt hoffte sie, dass dieser Roman die Leserinnen und Leser dazu veranlassen würde, sich intensiver mit dem Holocaust zu beschäftigen.
Nun also erwartet Mum Sie, die sie bereits kennen und schätzen, in Das Mädchen aus Yorkshire wie eine alte Freundin, bereit, Sie in die Vergangenheit zu entführen und rund um den Erdball mitzunehmen. Und den neuen Leserinnen und Lesern: ein herzliches Willkommen! Ich freue mich sehr, dass Sie Zeit mit Lucinda verbringen möchten.
Harry Whittaker, 2024
Prolog
Die alte Frau sah Leah an und begann zu lächeln. Zahllose Fältchen breiteten sich auf ihrem Gesicht aus. Sie war mindestens hundertfünfzig Jahre alt, dachte Leah. Die Kinder in ihrer Schule munkelten, sie sei eine Hexe, und heulten gespenstisch, wenn sie auf dem Heimweg vom Unterricht an ihrem heruntergekommenen Cottage im Ort vorbeiliefen. Für die Erwachsenen war sie die alte Megan, die verletzte Vögel pflegte und ihre gebrochenen Flügel mit Kräutertinkturen heilte. Manche behaupteten, sie sei verrückt, andere, sie besitze die Gabe des Heilens und merkwürdige übersinnliche Kräfte.
Leahs Mutter tat sie leid.
»Die arme Alte«, sagte sie, »sie lebt ganz allein in dem feuchten, verdreckten Cottage.« Sie bat Leah, ein paar Eier aus dem Hühnerstall zu holen und sie Megan zu bringen.
Leahs Herz schlug vor Angst immer wie wild, wenn sie an der schartigen Tür klopfte. Für gewöhnlich machte Megan sie bedächtig auf, spähte kurz heraus und nahm Leah die Eier mit einem Nicken aus der Hand. Dann schloss sich die Tür wieder, und Leah rannte, so schnell sie konnte, nach Hause.
Doch heute öffnete sie sich sehr viel weiter, sodass Leah an Megan vorbei ins dunkle Innere des Häuschens schauen konnte.
»Ich … Mum meint, Sie mögen vielleicht ein paar Eier.« Leah hielt ihr den Karton hin und beobachtete, wie sich die langen, knochigen Finger darum krallten.
»Danke.«
Megans sanfter Tonfall erstaunte sie. Sie klang so gar nicht wie eine Hexe.
»Komm doch herein.«
»Äh, ich …«
Doch da spürte sie bereits einen Arm um ihre Schulter, der sie hineinzog.
»Ich kann nicht lange bleiben. Sonst fragt Mum sich, wo ich bin.«
»Du kannst ihr sagen, du hättest Tee mit Megan, der Hexe getrunken«, kicherte die Alte. »Setz dich da drüben hin. Ich wollte mir gerade einen kochen.« Megan deutete auf einen der ramponierten Sessel zu beiden Seiten eines kleinen kalten Kamins.
Leah nahm unsicher Platz, schob die Hände unter die Oberschenkel und sah sich in der engen Küche um. An sämtlichen Wänden befanden sich Regale mit alten Kaffeegläsern voll merkwürdig farbenem Inhalt. Megan holte eines davon herunter, öffnete es und gab zwei Teelöffel gelbes Pulver in eine uralte Kanne aus Edelstahl. Dann fügte sie Wasser aus dem Kessel hinzu, stellte die Kanne mit zwei Tassen auf ein Tablett und dieses auf den Tisch vor Leah. Nun ließ Megan sich schwerfällig in dem anderen Sessel nieder.
»Schenkst du uns ein, Kleines?«
Leah goss die dampfende Flüssigkeit in die zwei angeschlagenen Porzellantassen. Und schnupperte. Der Tee roch seltsam beißend.
»Keine Sorge, ich will dich nicht vergiften. Schau, ich nehme zuerst einen Schluck. Dann siehst du ja, ob ich sterbe. Ist bloß Löwenzahntee. Der tut dir gut.« Sie wölbte die Hände um die Tasse und trank. »Probier.«
Leah versuchte, durch den Mund zu atmen, weil ihr der scharfe Geruch zuwider war. Sie nippte an dem Getränk und schluckte, ohne etwas zu schmecken.
»Na, war doch gar nicht so schlimm, oder?«
Leah schüttelte den Kopf und stellte die Tasse zurück auf den Tisch. Während Megan die ihre leerte, rutschte Leah unruhig in dem Sessel hin und her.
»Danke für den Tee. Er war sehr gut. Aber jetzt muss ich wirklich los, sonst macht Mum sich …«
»Ich sehe dich jeden Tag hier vorbeigehen. Wenn du einmal erwachsen bist, wirst du außergewöhnlich schön sein. Das ist jetzt schon zu erkennen.«
Leah errötete, als Megan sie mit einem durchdringenden Blick ihrer grünen Augen musterte.
»Und das ist möglicherweise nicht der Segen, für den die Welt es hält. Sei vorsichtig.« Megan runzelte die Stirn und streckte die Hand über den Tisch aus. Leah schauderte, als ihre knochigen Finger sich wie Klauen um ihre Hand schlossen. Panik stieg in ihr auf.
»Ich muss jetzt … wirklich nach Hause.«
Megan sah durch Leah hindurch, ihr Körper verkrampfte sich. »Da ist etwas Böses, das spüre ich. Du musst aufpassen.« Megans Stimme wurde höher. Leah war wie gelähmt vor Angst. Der Griff um ihre Hand wurde noch fester.
»Unnatürliche Dinge … schlimme Dinge … leg dich nie mit der Natur an, sonst bringst du alles durcheinander. Arme Seele … er ist verloren … verdammt … Er wird zurückkommen, dich oben im Moor finden … und du wirst aus freien Stücken zurückkehren. Du kannst dein Schicksal nicht ändern … Nimm dich vor ihm in Acht.«
Plötzlich lockerte sich der Griff um Leahs Hand, und Megan sank mit geschlossenen Augen in ihren Sessel zurück. Leah sprang auf, rannte zur Haustür und hinaus auf die Straße. Sie hörte nicht auf zu laufen, bis sie den Hühnerstall hinter dem Reihenhäuschen erreichte, in dem sie mit ihren Eltern wohnte, öffnete den Riegel und sank so unvermittelt auf den Boden, dass die Hühner erschreckt aufflatterten.
Leah lehnte den Kopf gegen die Holzwand. Sie wartete, bis ihre Atmung sich beruhigt hatte.
Die Leute im Ort hatten recht. Megan war verrückt. Was meinte sie damit, dass Leah sich in Acht nehmen solle? Das machte ihr Angst. Sie war elf Jahre alt und verstand nicht, was Megan ihr sagen wollte. Am liebsten hätte sie ihrer Mutter erzählt, was passiert war, doch das ging nicht. Mum würde glauben, sie habe sich das ausgedacht, und ihr erklären, es sei nicht nett, hässliche Gerüchte über eine arme, hilflose alte Frau zu verbreiten.
Leah stand auf, trat an die hintere Tür des Häuschens und betrat die warme Küche.
»Hallo, Leah, du kommst gerade rechtzeitig zum Essen. Setz dich.« Doreen Thompson wandte sich ihr lächelnd zu. Doch als sie sie sah, runzelte sie die Stirn. »Was ist los, Liebes? Du bist ja kreidebleich.«
»Nichts, Mum. Es ist alles in Ordnung. Mir tut nur der Bauch weh.«
»Wahrscheinlich Wachstumsbeschwerden. Versuch, ein bisschen was zu essen, dann geht’s dir gleich besser.«
Leah ging zu ihrer Mutter und drückte sich fest an sie.
»Was ist denn?«
»Ich … hab dich lieb, Mum.« Allmählich beruhigte sie sich.
Doch als ihre Mutter sie in der folgenden Woche bat, Megan wie üblich ein paar Eier zu bringen, weigerte sie sich strikt.
Zu Leahs Erleichterung starb Megan sechs Monate später.
Teil Eins
Juni 1976 bis Oktober 1977
1
Yorkshire, Juni 1976
Rose Delancey steckte den feinen Zobelhaarpinsel in das Glas mit Terpentin, legte die Palette auf die farbverschmierte Werkbank und sank in den abgewetzten Sessel, wo sie sich die schweren tizianroten Haare aus dem Gesicht strich. Dann nahm sie das Foto in die Hand, das sie als Vorlage benutzte, um es mit dem Gemälde auf der Staffelei zu vergleichen.
Es war ihr gut gelungen, auch wenn Rose Mühe hatte, die eine schlanke Stute von der anderen zu unterscheiden. Während sie versuchte, genug Werke für die Ausstellung in der Londoner Galerie zusammenzubekommen, zahlten Bilder wie dieses die Rechnungen.
Den Auftrag hatte sie von einem wohlhabenden örtlichen Gutsbesitzer, dem drei Rennpferde gehörten. Ondine, die Fuchsstute, die Rose mit feuchten Augen von dem Gemälde anblickte, war Nummer zwei. Dem Gutsbesitzer war jedes Bild fünfhundert Pfund wert. Das reichte, um das Dach des weitläufigen Farmhauses aus Stein, in dem sie und ihre Kinder wohnten, erneuern zu lassen. Nicht jedoch, um das sich stetig verschlimmernde Problem mit der Feuchtigkeit zu lösen oder den Hausschwamm oder Holzwurm zu beseitigen. Immerhin war es ein Anfang.
Rose zählte auf die Ausstellung. Einige ihrer Werke verkaufen zu können, würde ihr bei der Begleichung ihrer wachsenden Schulden sehr helfen. Allmählich begann der Mann von der Bank die Geduld zu verlieren, und Rose wusste, dass sie sich auf sehr dünnem Eis bewegte.
Aber ihre letzte Ausstellung war fast zwanzig Jahre her. Möglicherweise hatten die Menschen sie seit jenen berauschenden Tagen als Liebling der Kritiker und Kunstliebhaber vergessen. Damals war Rose jung, schön und über die Maßen begabt gewesen … dann hatte sich plötzlich alles verändert, und sie war von den hellen Lichtern Londons in das abgeschiedene Sawood in der sanft hügeligen Hochebene von Yorkshire übergesiedelt.
Die Ausstellung im April des kommenden Jahres war ein Wagnis; sie musste sich einfach auszahlen.
Rose stand auf und manövrierte ihren korpulenten Körper gekonnt durch das Chaos in ihrem kleinen Atelier, um aus dem Panoramafenster auf die Landschaft draußen zu schauen. Der Anblick erfüllte sie jedes Mal mit innerer Ruhe; er war der Hauptgrund, warum sie das Farmhaus erworben hatte. Es stand auf einem Hügel, von dem aus man das gesamte Tal sehen konnte. Der silbrig glitzernde Leeming-Stausee hob sich weit unten deutlich von dem üppigen Grün der Umgebung ab. Es wäre traurig, diesen Ausblick nicht mehr genießen zu können, doch dass sie das Farmhaus verkaufen müsste, wenn die Ausstellung ein Misserfolg würde, war ihr klar.
»Verdammt, verdammt, verdammt!« Rose schlug mit der Faust auf das Fensterbrett aus grauem Stein.
Natürlich gab es eine Alternative. Diese Option hatte immer existiert, aber Rose weigerte sich schon fast zwanzig Jahre lang, sie zu ergreifen.
Sie dachte an ihren Bruder David mit seinem Penthouse in New York, seinem Landsitz in Gloucestershire, seiner Villa auf einer exklusiven Karibikinsel und der Hochseejacht, die irgendwo an der Amalfi-Küste vor Anker lag. Viele Nächte hatte sie gelauscht, wie das Wasser in den Metalltopf rechts neben ihrem Bett tropfte, und mit dem Gedanken gespielt, ihn um Hilfe zu bitten. Doch eher würde sie sich mit einer Zwangsräumung abfinden, als ihn um Geld anzubetteln. Dafür war vieles vor langer Zeit zu schiefgelaufen.
Rose hatte ihren Bruder Jahre nicht gesehen, seinen kometenhaften Aufstieg in den Kreis der Reichen und Mächtigen lediglich mithilfe von Zeitungsartikeln verfolgt. Zuletzt hatte sie vom Tod seiner Frau acht Monate zuvor gelesen. Nun war er mit seinem sechzehnjährigen Sohn allein.
Dann hatte sie vor einer Woche aus heiterem Himmel ein Telegramm erhalten.
Liebe Rose stopp bin in den kommenden zwei Monaten beruflich sehr eingespannt stopp mein Sohn Brett kommt am 20. Juni aus dem Internat stopp will ihn nicht allein lassen stopp er trauert nach wie vor um seine Mutter stopp kann er zu dir kommen stopp Landluft würde ihm guttun stopp würde ihn Ende August abholen stopp David.
Nach dem Erhalt des Telegramms war Rose fünf Tage lang nicht im Atelier gewesen. Sie hatte ausgedehnte Wanderungen übers Hochmoor gemacht und überlegt, warum David mit ihr in Kontakt getreten war.
Letztlich konnte sie sich nicht weigern. David hatte sie vor vollendete Tatsachen gestellt. Der Junge würde kommen, wahrscheinlich ein verwöhnter Bengel voller Allüren, dem das zerfallende Farmhaus bestimmt nicht gefiel, wo es nichts weiter zu tun gab, als dem Gras beim Wachsen zuzuschauen.
Rose fragte sich, wie ihre Kinder auf diesen bisher unbekannten Cousin reagieren würden. Sie musste sich eine Erklärung zurechtlegen für das plötzliche Auftauchen nicht nur von Brett, sondern auch von einem Onkel, der vermutlich zu den reichsten Menschen der Welt gehörte.
Ihr groß gewachsener, attraktiver zwanzigjähriger Sohn Miles würde lediglich nicken und die Situation ohne Nachfragen akzeptieren, wogegen die fünfzehn Jahre alte Miranda … Wie immer plagte Rose das schlechte Gewissen, wenn sie an ihre schwierige Adoptivtochter dachte.
Rose fürchtete, für Mirandas kompliziertes Wesen verantwortlich zu sein. Miranda war verzogen und unhöflich und stritt sich mit Rose über praktisch alles. Rose hatte sich stets bemüht, ihr genauso viel Liebe entgegenzubringen wie Miles, aber Miranda schien zu meinen, dass sie nicht mit der engen Verbindung zwischen Mutter und leiblichem Sohn konkurrieren konnte.
Miranda zu lieben, war Rose stets ein Anliegen gewesen. Doch statt zu einer harmonischen Atmosphäre im Haus beizutragen, sorgte Miranda nur für Spannungen. Die Mischung aus Schuldgefühlen und mangelnder Kommunikation zwischen Mutter und Tochter hatte zur Folge, dass die beiden einander bestenfalls tolerierten.
Rose ahnte, dass Miranda von Brett und dem fantastischen Reichtum seines Vaters beeindruckt sein würde. Bestimmt würde sie mit ihm flirten. Sie war sehr hübsch, und schon jetzt säumte eine lange Reihe gebrochener Herzen ihren Weg. Rose hätte sich ein zurückhaltenderes Auftreten von ihr gewünscht, denn sie machte keinerlei Anstalten, ihren gut entwickelten Körper zu verbergen. Besonders intensiv beschäftigte sie sich mit ihren atemberaubend schönen blonden Haaren. Mittlerweile hatte Rose es aufgegeben, ihr den leuchtend roten Lippenstift und die kurzen Röcke zu verbieten, weil Miranda dann tagelang schmollte und die Stimmung im Haus vergiftete.
Rose sah auf die Uhr. Miranda würde bald von der Schule nach Hause kommen, und Miles war auf dem Heimweg von Leeds, weil die Semesterferien begannen. Mrs Thompson würde für sie ein Festmahl aufdecken, darum hatte Rose sie gebeten.
Dabei würde Rose das bevorstehende Eintreffen ihres Neffen verkünden, als wäre es das Normalste der Welt, dass das Kind ihres Bruders die schulfreie Zeit bei ihnen verbrachte.
Sie musste eine Rolle spielen, keiner von ihnen durfte je erfahren …
2
»Leah, hilfst du mir heute oben im großen Haus? Mrs Delancey erwartet für morgen einen Gast, und ich soll eines der Zimmer im ersten Stock gründlich putzen und herrichten. Gott sei Dank ist Sommer. Wenn wir die Fenster aufmachen, kriegen wir vielleicht diesen schrecklichen Muffelgeruch heraus.« Doreen Thompson rümpfte die Nase.
»Natürlich komme ich mit«, antwortete Leah.
Ihre Mutter Doreen hatte praktisch kurz geschnittene, dichte braune Haare. Die Minipli, die sie sich kürzlich hatte machen lassen, war schuld daran, dass ihre Locken an Stirn und Nacken ziepten. Jahrelange harte Arbeit und Sorge hatten ihre stattliche Figur schlank gehalten, aber auch zahlreiche Falten in ihr siebenunddreißigjähriges Gesicht gegraben.
»Wunderbar. Zieh deine älteste Jeans an. In dem Zimmer ist es ziemlich schmutzig. Und beeil dich. Ich bereite nur noch schnell das Mittagessen für deinen Dad vor.«
Leah brauchte keine weitere Ermutigung. Sie eilte die Treppe hinauf, öffnete die Tür zu ihrem winzigen Zimmer, wühlte unten in ihrem Schrank nach einer uralten zerschlissenen Jeans, holte ein abgetragenes Sweatshirt heraus und schlüpfte hinein. Dann setzte sie sich ans Fußende ihres Bettes, um im Spiegel zu überprüfen, wie sie ihre taillenlangen, mahagonibraunen Locken flocht. Mit dem schweren Zopf wirkte Leah jünger als fünfzehn. Doch als sie aufstand, waren in dem Spiegel bereits die Rundungen einer bedeutend reiferen jungen Frau zu sehen. Wie Doreen war sie immer schon groß für ihr Alter gewesen, aber im vergangenen Jahr schien sie geradewegs in die Höhe geschossen zu sein und überragte nun die anderen Mädchen in ihrer Klasse um einen guten Kopf. Ihre Mutter sagte gern, sie wachse zu schnell und solle mehr essen, um nicht so schlaksig zu werden. Leah kam sich ein wenig wie eine Sonnenblume mit einem langen wackeligen Stiel vor.
Sie zog ihre Turnschuhe unter dem Bett heraus und schnürte sie hastig. Leah begleitete ihre Mutter gern zum großen Haus. Das Farmhaus erschien ihr, verglichen mit dem engen Vierzimmerreihenhäuschen, in dem sie wohnte, sehr geräumig. Und sie fand Mrs Delancey faszinierend. Sie war so anders als alle anderen Menschen, die Leah kannte, weswegen Miranda sich ihrer Ansicht nach glücklich schätzen konnte, sie als Mutter zu haben. Nicht, dass sie ihre eigene nicht geliebt hätte, aber da Mum Dad pflegen und den ganzen Tag arbeiten musste, hatte sie manchmal schlechte Laune und schrie herum. Leah wusste, dass das nur an ihrer Müdigkeit lag, und versuchte, ihr bei der Arbeit zu helfen, so gut es ging.
Sie erinnerte sich nur vage an die Zeit, als ihr Vater noch laufen konnte. Er hatte Rheuma bekommen, als sie vier war, und die vergangenen elf Jahre im Rollstuhl verbracht. Dad hatte die harte körperliche Arbeit in der Wollspinnerei aufgeben müssen, worauf Mum als Haushälterin bei Mrs Delancey anfing, um Geld zu verdienen. In all der Zeit hatte Leah ihren Vater nie klagen gehört. Ihr war klar, dass er ein schlechtes Gewissen hatte, weil seine Frau sich um ihn und den Lebensunterhalt der Familie kümmern musste.
Leah liebte ihren Vater abgöttisch und leistete ihm so oft wie möglich Gesellschaft.
Sie eilte nach unten und klopfte an der Tür des vorderen Raums. Als ihr Vater krank geworden war, hatten sie das Wohnzimmer in das elterliche Schlafzimmer umgewandelt, und eine Dusche sowie eine Toilette waren von der Gemeinde in der begehbaren Speisekammer neben der Küche eingebaut worden.
»Herein.«
Sie öffnete die Tür. Mr Thompson saß wie immer am Fenster. Seine braunen Augen, die Leah von ihm geerbt hatte, begannen zu leuchten, als er seine Tochter erblickte.
»Hallo, Liebes. Komm und gib deinem Dad einen Kuss.«
Leah lief zu ihm. »Ich begleite Mum zum großen Haus und helfe ihr.«
»Sehr gut, mein Mädchen. Dann sehen wir uns später. Ich wünsche dir viel Vergnügen.«
»Danke. Mum bringt dir deine Sandwiches.«
»Wunderbar. Auf Wiedersehen, Liebes.«
Leah schloss die Tür und ging in die Küche, wo ihre Mutter einen Teller voller Schinkensandwiches mit Butterbrotpapier abdeckte.
»Die gebe ich noch deinem Dad, und dann müssen wir los, Leah.«
Von Oxenhope zu dem winzigen Weiler Sawood, über dem sich Mrs Delanceys Farmhaus befand, waren es etwa drei Kilometer. Normalerweise fuhr Mrs Thompson mit dem Rad hin, doch da Leah heute bei ihr war, gingen sie zu Fuß aus dem Ort heraus und die Anhöhe hinauf.
Die Sonne lachte vom strahlend blauen Himmel, es war ein warmer, milder Tag. Trotzdem hatte Leah ihren Anorak für den Rückweg über die Schulter geschlungen, da sie wusste, dass es hier oben im Hochmoor rasch kühler werden konnte.
»Ich glaube, dieses Jahr wird sehr heiß«, meinte Doreen. »Mrs Delancey sagt, ihr Neffe kommt. Ich wusste gar nicht, dass sie einen hat.«
»Wie alt ist er?«
»Ein Teenager. Also hat Mrs Delancey das Haus voll, denn Miles ist von der Uni daheim, und Miranda hat Schulferien. Und sie selber steckt gerade mitten in den Vorbereitungen für ihre Ausstellung.«
Kurzes Schweigen. »Darf ich dich was fragen, Mum?«, erkundigte sich Leah.
»Natürlich.«
»Was … hältst du von Miles?«
Mrs Thompson blieb stehen. »Ich mag ihn. Schließlich habe ich geholfen, ihn großzuziehen. Warum willst du das wissen?«
»Ach, nur so«, antwortete Leah, als sie den fürsorglichen Blick ihrer Mutter bemerkte.
»Mehr hätte ich da schon zu seiner Schwester, dieser kleinen Madam, zu sagen. Die Sachen, die sie manchmal anhat … Die gehören sich einfach nicht für ein Mädchen ihres Alters.«
Leah hingegen war ziemlich beeindruckt von der gewagten Kleidung Mirandas und beobachtete voller Bewunderung, wie die Jungs der Greenhead Grammar School Miranda umschwärmten, wo die beiden Mädchen dieselbe Jahrgangsstufe besuchten. Manchmal bekam Leah mit, wie Miranda nach dem Unterricht mit Burschen aus der nächsthöheren Klasse in Richtung Cliffe Castle Park verschwand. Leah fragte sich, wie Miranda es schaffte, in der langweiligen Schuluniform so hübsch und erwachsen auszusehen, während die von Leah lediglich ihre Schlaksigkeit betonte. Obwohl nur einen Monat jünger als Miranda, kam Leah sich neben ihr wie ein Kind vor.
»Mrs Delancey hat kein Geld, sagst du immer, doch Miranda trägt ständig neue Kleider. Und sie wohnen in diesem riesigen Haus.«
Mrs Thompson nickte. »Das muss man im Verhältnis sehen, Leah. Unsere Familie hat keinen roten Heller, und Mrs Delancey behauptet das Gleiche von sich. Aber sie war früher mal reich, richtig reich. Verglichen damit hält sie sich nun für arm. Verstehst du, was ich meine?«
»Ich glaube schon.«
»Miranda beklagt sich, wenn sie sich kein neues Kleid für eine Party kaufen kann. Du beklagst dich, wenn wir abends nichts zu essen haben.«
»Warum ist sie jetzt nicht mehr reich?«
Leahs Mutter machte eine vage Geste. »Keine Ahnung, was sie mit dem ganzen Geld gemacht hat. Jedenfalls hat sie vor ein paar Jahren wieder mit dem Malen angefangen, was bedeutet, dass sie wahrscheinlich ziemlich lange nichts verkauft hat. Doch genug davon. Geh schneller, sonst kommen wir zu spät.«
Kurz darauf öffnete Mrs Thompson die hintere Tür des Farmhauses und betrat die Küche. Dieser Raum allein war größer als das gesamte untere Geschoss des Hauses, in dem Leah wohnte.
Miranda frühstückte, bekleidet mit einem pinkfarbenen Morgenmantel und dazu passenden kuscheligen Pantoffeln, an dem langen Kiefernholztisch, an dem die Sonne ihre blonden Haare aufleuchten ließ.
»Hallo, Doreen, Sie kommen gerade recht. Ich bräuchte noch Toast!«
»Tja, junge Dame, darum musst du dich heute selber kümmern. Ich soll das Zimmer für den Gast deiner Mutter herrichten.«
»Aber du machst das doch für mich, Leah, Schätzchen, oder?«, schnurrte Miranda.
Leah sah ihre Mutter an, die etwas erwidern wollte, und antwortete hastig: »Natürlich. Geh schon mal rauf, Mum, ich komme gleich nach.«
Mrs Thompson runzelte die Stirn, zuckte mit den Schultern und verschwand aus der Küche. Leah steckte zwei Scheiben Brot in den Toaster.
»Jedes Mal, wenn ich dich sehe, bist du wieder ein Stück größer«, bemerkte Miranda, nachdem sie Leah begutachtet hatte. »Machst du Diät? Du bist sehr dünn.«
»Nein, nein, Mum nennt mich den Vielfraß. Wenn sie mich ließe, würde ich den Teller noch ablecken.«
»Du Glückliche. Ich muss Sahne bloß anschauen, und schon hab ich ein Pfund mehr auf den Hüften«, meinte Miranda wehmütig.
»Aber du hast doch eine wunderbare Figur. Das sagen alle Jungs in unserem Jahrgang.« Als das Brot hinter Leah aus dem Toaster sprang, zuckte sie erschreckt zusammen.
»Schmier Margarine drauf und nur hauchdünn Marmelade. Was sagen denn die Jungs sonst noch so über mich?«, erkundigte sich Miranda.
Leah wurde rot. »Na ja, sie finden dich … hübsch.«
»Findest du mich hübsch, Leah?«
»Ja, sehr. Mir … gefallen deine Kleider.« Leah stellte Miranda den Teller mit dem Toast hin. »Möchtest du noch eine Tasse Tee?«
Miranda nickte. »Sag meiner lieben Mutter mal, dass dir meine Kleider gefallen. Sie dreht durch, wenn der Rocksaum über den Knöcheln ist! Wie schrecklich prüde! Nimm dir doch auch eine Tasse Tee und leiste mir Gesellschaft.«
Leah zögerte. »Lieber nicht. Ich muss nach oben, Mum helfen.«
»Wie du meinst. Wenn du später Zeit hast, kannst du ja zu mir ins Zimmer kommen. Dann zeig ich dir die neuen Klamotten, die ich letzten Samstag gekauft habe.«
»Gern. Bis später, Miranda.«
»Ja.«
Leah eilte die zwei knarrenden Treppen hinauf zu ihrer Mutter, die im Flur einen durchgelaufenen Vorleger ausschüttelte.
»Gerade wollte ich dich holen. Du musst mir beim Umdrehen der Matratze helfen. Die ist an einer Ecke schimmelig. Ich hab den Kamin angemacht, damit wir die Feuchtigkeit aus dem Raum rauskriegen.«
Leah folgte ihr in das große Zimmer und ergriff ein Ende der schweren Doppelmatratze.
»Stell sie hochkant … so ist’s gut. Hoffentlich gewöhnst du dir nicht an, dich von der kleinen Madam da unten wie ein Dienstmädchen behandeln zu lassen. Wenn du ihr den kleinen Finger gibst, will sie die ganze Hand. Das nächste Mal sagst du Nein, Liebes. Sie zu bedienen, ist nicht deine Aufgabe.«
»Entschuldige, Mum. Sie ist so erwachsen, findest du nicht?«
Doreen Thompson entging die Bewunderung ihrer Tochter nicht.
»Na ja, das stimmt, aber sie sollte kein Vorbild für dich sein.« Doreen stemmte die Hände in die Hüften. »Sieht schon besser aus. Das Bett beziehen wir erst ganz zum Schluss. Dann hat es Zeit zum Trocknen, und mit ein bisschen Glück holt sich die arme Neffenseele heute Nacht hier keine Lungenentzündung.« Ihr Blick wanderte in Richtung Fenster. »In dem Karton da drüben ist Glasreiniger. Putzt du mir bitte die dreckigen Scheiben?«
Leah nickte, ging mit der Flasche zu dem Bleiglasfenster, fuhr mit dem Finger durch den Schmutz auf der Scheibe und riss dabei eine Spinne aus ihrem Netz.
»Ich gehe runter, den Staubsauger holen.« Mit diesen Worten verließ Mrs Thompson den Raum.
Leah machte sich ans Werk, trug Reiniger auf das Glas auf und rieb daran, bis der Lappen schwarz war. Nachdem sie vier kleine Flächen gesäubert hatte, schaute sie hinaus. Die Sonne tauchte die Hochebene in hellen Schein. Von hier oben aus bot sich ein fantastischer Blick hinunter ins Tal, wo Leah die Kamine von Oxenhope auf der anderen Seite des Leeming-Stausees erkennen konnte.
Da bemerkte sie eine Gestalt auf einer Anhöhe, einen knappen Kilometer vom Haus entfernt. Der Junge saß mit den Armen um die Knie geschlungen da und schaute ins Tal hinab. Leah erkannte die dichten schwarzen Haare. Miles.
Miles machte ihr Angst. Er lächelte nie, grüßte nie, starrte sie einfach nur an. Wenn er zu Hause war, verbrachte er viele Stunden allein im Hochmoor. Gelegentlich sah sie ihn als dunkle Silhouette auf einem von Mr Morris’ Pferden über den oberen Rand des Tals traben.
Unvermittelt drehte sich Miles um und richtete die dunklen Augen direkt auf Leah, als wüsste er, dass sie ihn beobachtete. Leah spürte, wie sein Blick sie durchdrang. Sie erstarrte, begann zu zittern, entfernte sich hastig vom Fenster.
Da kehrte ihre Mutter mit dem Staubsauger zurück. »Hopp, Leah, an die Arbeit. Du hast erst ein Viertel der Scheiben geputzt.«
Widerwillig ging Leah zum Fenster zurück.
Miles war verschwunden.
»Doreen, ich wollte Sie fragen, ob Leah sich ein bisschen Taschengeld verdienen möchte.«
Leah gönnte sich mit ihrer Mutter in der Küche eine Tasse Tee, bevor sie sich wieder in Richtung Ort aufmachten.
Die mit einem ölfarbenverschmierten Kittel bekleidete Mrs Delancey lächelte Leah von der Küchentür aus an.
»Das klingt gut, findest du nicht, Leah?«, sagte Mrs Thompson.
»Ja, Mrs Delancey. Was soll ich für Sie tun?«
»Wie du weißt, kommt morgen mein Neffe Brett zu Besuch. Das Problem ist nur, dass ich gerade sehr beschäftigt bin, weil ich Bilder für die Ausstellung malen muss. Schon ohne jeden Tag zu kochen, habe ich kaum Zeit. Ich habe überlegt, ob du deine Mutter begleiten und ihr helfen könntest, das Haus in Ordnung zu halten und das Frühstück und eine Abendmahlzeit für mich und die Kinder zuzubereiten. Die meinen kommen allein zurecht, aber mein Neffe … Er ist einen bedeutend pompöseren Lebensstil als den unseren gewöhnt. Natürlich würde ich Ihnen für die Überstunden zusätzlich etwas zahlen, Doreen, und Leah würde auch etwas erhalten.«
Mrs Thompson sah Leah an. »Solange einer von uns zu Hause das Abendessen für Dad kochen kann, halte ich das für eine gute Idee, meinst du nicht auch, Leah?«
Leah wusste, dass ihre Mutter das Extrageld gut gebrauchen konnte. Also nickte sie. »Ja, Mrs Delancey, sehr gern.«
»Dann wäre das also geregelt. In der Scheune ist ein altes Fahrrad, das kannst du benutzen. Brett trifft morgen Nachmittag ein, und ich hätte gern etwas Besonderes für die Abendmahlzeit. Wir gehen ins Esszimmer. Nehmen Sie das Wedgwood-Service heraus, Doreen, und stellen Sie eine Liste der Lebensmittel zusammen, die Sie für die Woche brauchen. Ich rufe im Dorfladen an. Die sollen uns die Sachen liefern. Aber jetzt muss ich wirklich zurück ins Atelier. Wir sehen uns morgen.«
»Gut, Mrs Delancey«, meinte Mrs Thompson.
Als Rose schon halb aus der Küche heraus war, drehte sie sich um.
»Achten Sie gar nicht darauf, wenn mein Neffe Ihnen ein bisschen … seltsam erscheinen sollte. Seine Mutter ist vor Kurzem gestorben, und wie gesagt: Er ist nur das Beste gewöhnt.« Rose verließ die Küche und schloss die Tür hinter sich.
»Der arme Junge, dass er seine Mutter so früh verloren hat.« Mrs Thompson wusch die Teetassen in der Spüle aus.
Da spazierte Miranda in einem engen roten Minirock und einem Käseleinentop mit tiefem Ausschnitt herein.
»Ich dachte, du wolltest dir meine neuen Klamotten anschauen, Leah.«
»Ja, aber ich …«
»Egal. Ich führ sie dir hier vor. Wie findest du sie? Sind sie nicht toll?« Miranda drehte sich lächelnd um die eigene Achse.
»Ich finde sie …«
»Ich finde, es ist höchste Zeit, dass wir gehen und uns um das Essen für deinen Dad kümmern«, mischte sich Leahs Mutter ein.
Miranda schenkte ihr keine Beachtung. »Ich hab sie von der neuen Boutique in Keighley und werde sie morgen Abend zu dem Begrüßungsessen für meinen Cousin tragen.« Miranda grinste breit. »Du weißt, dass sein Vater einer der reichsten Männer der Welt ist, oder?«
»Nun erzähl mal keine Geschichten, junge Dame«, rügte Mrs Thompson sie.
»Es ist die Wahrheit!« Miranda setzte sich auf einen Stuhl und schwang die Beine auf den Tisch. Dabei kam ziemlich viel blasse Oberschenkelhaut zum Vorschein. »Das hat die gute Mama Ihnen verschwiegen, was? Ihr Bruder ist David Cooper. Der David Cooper.« Sie wartete auf eine Reaktion und runzelte die Stirn, als keine kam. »Haben Sie etwa noch nie was von ihm gehört? Er ist weltberühmt. Ihm gehört Cooper Industries, eines der größten Unternehmen der Erde. Der Himmel allein weiß, warum wir in diesem Loch leben müssen, wenn die gute alte Rosie einen solchen Bruder hat.«
»Nenn deine Mum nicht Rosie, Madam.«
»Tschuldigung, Mrs T«, erwiderte Miranda. »Ich dachte schon, dass in dieser Gegend nie was Aufregendes passiert, und da erfahre ich urplötzlich, dass ich einen superreichen Onkel habe und sein Sohn morgen hier aufkreuzt. Und das Tollste überhaupt: Er ist sechzehn. Ob er wohl eine Freundin hat?«, überlegte sie laut.
»Sei nett zu ihm, Miranda. Der Arme hat vor nicht allzu langer Zeit seine Mutter verloren.«
Miranda lachte. »Darauf können Sie Gift nehmen, Mrs T … Egal, ich probier jetzt meine neue Gesichtsmaske aus. Bis später.« Mit diesen Worten stand sie auf und tänzelte aus der Küche.
Mrs Thompson schüttelte den Kopf. »Komm, Leah, wir gehen lieber. Morgen wird ein harter Tag.« Sie trocknete die Hände an einem Geschirrtuch ab und deutete mit dem Kinn in Richtung Tür. »Und ich rieche Ärger.«
3
Als die lange schwarze Limousine durch die pittoresken Ortschaften Yorkshires glitt, betrachteten die Anwohner sie neugierig und versuchten, die schattenhafte Gestalt hinter den getönten Scheiben zu erkennen.
Brett Cooper schaute traurig hinaus und zog Grimassen, von denen er wusste, dass die Leute draußen sie nicht sehen konnten. Der Himmel hatte sich bezogen, es begann zu regnen. Die Landschaft wirkte so trostlos, wie Brett sich fühlte.
Er nahm eine Dose Cola aus der Minibar. Das Innere des Wagens erinnerte ihn mit den dicken Lederverkleidungen und Blenden auf allen Seiten, die seinem Vater halfen, sich von der Welt abzuschotten, an eine Luxusgruft.
Brett betätigte einen Knopf. »Wie weit ist es noch, Bill?«
»Nur noch eine halbe Stunde, Sir«, antwortete eine metallische Stimme.
Brett nahm den Finger von dem Knopf, streckte die langen Beine aus, die in einer Jeans steckten, und trank einen Schluck Cola.
Sein Vater hatte ihm versprochen, ihn von der Schule abzuholen und nach Yorkshire zu begleiten, wo er ihn persönlich dieser Tante vorstellen wollte. Doch als Brett voller Vorfreude in den Wagen gestiegen war, hatte er ihn leer vorgefunden.
Bill, der Chauffeur seines Vaters, hatte ihm erklärt, Mr Cooper entschuldige sich. Er habe früher nach Amerika fliegen müssen als erwartet.
Während der knapp fünfstündigen Fahrt von Windsor hatte Brett sich über seinen Vater geärgert, der wieder einmal nach dem Muster von Bretts gesamter Kindheit agierte. Brett hatte Angst davor, dieser ihm unbekannten Tante allein gegenüberzutreten, und er empfand überwältigenden Kummer darüber, ohne seine Mutter zu sein, die ihm das Gefühl hätte nehmen können, dass sein Vater sich nicht das Geringste aus ihm machte.
Tränen traten Brett in die Augen, als er an die Zeit vor ziemlich genau einem Jahr dachte. Damals war er nach Nizza geflogen, wo seine Mutter ihn vom Flughafen abholte. Sie waren zu der von ihr auf Cap Ferrat gemieteten Villa gefahren und hatten einen herrlichen Sommer miteinander verbracht, nur sie beide. Sein Vater hatte sie zweimal besucht, die Tage jedoch in seinem Büro oder auf der Jacht verbracht, wo er wichtige Geschäftspartner empfing, die eigens hergekommen waren, um sich mit ihm zu treffen.
Und dann, drei Monate später, war seine Mutter tot gewesen. Er erinnerte sich, wie er ins Arbeitszimmer seines Hausvorstehers gerufen wurde, wo man ihm die traurige Nachricht verkündete.
Danach war Brett in den leeren Schlafsaal gegangen, hatte sich auf die Bettkante gesetzt und mit leerem Blick vor sich hin gestarrt. All das Geld und der Luxus hatten den Tod seiner Mutter nicht verhindern können. Sie hatte ihm nicht anvertraut, dass etwas nicht stimmte. Dafür hasste er sie. War ihr denn nicht klar gewesen, wie er sich fühlen würde, wenn er am Ende nicht bei ihr sein konnte?
Und sein Vater hatte Bescheid gewusst und ebenfalls nichts gesagt.
Vermutlich hatte sein Vater die Entscheidung gefällt, all seine Kraft in das Unternehmen zu stecken. Das schien das Einzige zu sein, was ihm im Leben wichtig war – manchmal fragte Brett sich, warum er sich überhaupt die Mühe gemacht hatte zu heiraten. Trotzdem war seine Mutter überaus loyal gewesen. Sie beklagte sich nie darüber, dass sie ihren Ehemann kaum je zu Gesicht bekam und sie und ihr gemeinsamer Sohn auf der Liste seiner Prioritäten ziemlich weit unten standen. Brett hatte sie nur ein einziges Mal streiten gehört, als er vier Jahre alt war.
»Herrgott, Vivien, bitte denk darüber nach. New York ist eine wundervolle Stadt. Wenn Brett in die Schule kommt, kann er in den Ferien herüberfliegen. Die Wohnung ist fantastisch. Sieh sie dir wenigstens an.«
Seine Mutter hatte mit ihrer ruhigen Stimme geantwortet: »Nein, David, tut mir leid. Ich will in England bleiben, damit ich da bin, wenn Brett mich braucht.«
Als Brett älter wurde, begriff er, dass auch seine Mutter sich an jenem Tag entschieden hatte. Für ihn. Danach war sein Vater immer seltener nach Hause gekommen, hatte seinen Lebensmittelpunkt nach New York verlegt und seine Frau kaum noch gedrängt, sich zu ihm zu gesellen.
In seiner Anfangszeit in Eton hatten die anderen Jungen Brett gefragt, wie sein berühmter Vater sei. Er hatte geantwortet, er sei »großartig« oder »ein richtig guter Typ«, aber in Wahrheit wusste er nichts über ihn.
Als Brett dreizehn war, hatte David ihn beiseitegenommen und ihm die Pläne für einen neuen Wohnblock gezeigt, den er baute. Brett hatte sich bemüht, interessiert zu wirken.
»Sobald du mit Cambridge fertig bist, trittst du ins Unternehmen ein und lernst, wie es funktioniert. Eines Tages wird es dir gehören, Brett.«
Brett nickte und lächelte, obwohl sich ihm die Nackenhaare aufstellten. Er hatte nicht das geringste Interesse am Imperium seines Vaters, kein Gefühl für Zahlen und fand Statistik entsetzlich. Die Aufnahmeprüfung für Eton hatte er nur dank seiner hohen Punktzahl in Englisch gerade so bestanden.
In den vergangenen beiden Jahren war Brett immer wieder schweißgebadet aufgewacht, als ihm allmählich klar wurde, wie sein Vater sich seine Zukunft vorstellte. Letztes Jahr auf Cap Ferrat hatte er seiner Mutter sein Herz ausgeschüttet und ihr einige seiner Bilder gezeigt. Sie hatte sie erstaunt betrachtet.
»Grundgütiger! Ich hatte ja keine Ahnung, dass du so malen kannst, Schatz. Du hast wirklich Talent. Die Bilder sind fantastisch. Die muss ich deinem Vater zeigen.«
David hatte sie nur flüchtig angesehen und die Achseln gezuckt. »Nicht schlecht. Ein Geschäftsmann sollte ein Hobby haben, das ihm hilft zu entspannen.«
Daraufhin hatte Brett Wasserfarben und Staffelei weggelegt. Seine Mutter hatte versucht, ihn zu trösten, und ihn ermutigt, weiter die herrliche Aussicht aus der Villa zu malen.
»Es hat keinen Sinn, Mutter. Er wird mich nicht auf die Kunstakademie lassen. Vater hat alles geplant. Er ist sich sicher, dass ich Cambridge schaffe, und kommt gar nicht auf die Idee, ich könnte durch die Prüfungen rasseln.«
Vivien hatte geseufzt. Ihnen war beiden klar, dass sich, falls das tatsächlich geschah, mithilfe einer großzügigen Spende für das richtige College leicht ein Platz für Brett arrangieren ließe.
»Brett, ich verspreche dir, mit ihm zu reden. Du bist erst fünfzehn. Bestimmt können wir ihn überzeugen, sobald die Zeit reif ist. Mach weiter, Schatz. Du besitzt Potenzial!«
Brett hatte den Kopf geschüttelt. Einen Monat später war er in die Schule zurückgekehrt und hatte seine Mutter gemalt, wie sie auf der Schaukel im Garten ihres Anwesens in Gloucestershire saß. Als Vorlage hatte ihm sein Lieblingsfoto von ihr gedient, auf dem ihre zarte Schönheit am besten zur Geltung kam. Brett hatte vorgehabt, ihr das Bild zu Weihnachten zu überreichen. Doch da war sie bereits tot gewesen, und nun lag es noch immer als Geschenk verpackt unter seinem Bett in der Schule. Seitdem hatte er den Kunstraum nicht mehr betreten.
Nach acht Monaten war es für Brett nach wie vor so, als wäre sie erst tags zuvor gestorben. Seine Mutter war der Dreh- und Angelpunkt seiner Welt gewesen, sein Fels in der Brandung. Nun, da es keine Vermittlerin mehr zwischen ihm und seinem Vater gab, fühlte er sich sehr verletzlich.
Er war davon ausgegangen, dass er die Sommerferien in Gloucestershire, vielleicht auch auf Antigua, verbringen würde. Folglich hatte ihn der von Pat, Davids persönlicher Assistentin, verfasste Brief, der ihm mitteilte, dass sein Vater ihn nach Yorkshire zu einer Tante verfrachtete, von der er noch nie etwas gehört hatte, in noch tiefere Verzweiflung gestürzt. Er hatte vergeblich versucht, seinen Vater in New York zu erreichen, jedoch immer nur mit Pat gesprochen.
»Ihr Vater besteht darauf, dass Sie hinfahren, Brett, weil er in den nächsten beiden Monaten sehr beschäftigt sein wird. Bestimmt gefällt es Ihnen dort. Ich überweise Ihnen fünfhundert Pfund als Taschengeld. Lassen Sie es mich wissen, wenn Sie mehr brauchen, ja?«
Brett wusste, dass es wenig Zweck hatte zu widersprechen. Was David Cooper wollte, bekam er.
Da summte die Gegensprechanlage. »Noch fünf Minuten, Sir, dann sind wir da. Das Haus können Sie von hier aus bereits sehen. Es ist links, oben auf dem Hügel.«
Brett schaute hinaus. Das große graue Steingebäude stand einsam und verlassen im Nieselregen. In dieser Landschaft wirkte es trostlos und schrecklich abweisend, wie aus einem Roman von Dickens.
»Bleak House, düsteres Haus«, murmelte Brett. Sein Herz schlug schneller, als die Limousine die Anhöhe hinauffuhr. Wohl schon zum tausendsten Mal wünschte er sich seine Mutter neben sich, die ihm versichert hätte, dass alles in Ordnung kommen würde.
Als der Wagen vor dem Haus hielt, holte Brett tief Luft. Seine Mutter war nicht da, er würde dem Ganzen allein ins Auge blicken müssen.
Rose hörte ein Motorengeräusch, blickte aus dem Fenster ihres Ateliers und sah die prächtige Limousine mit den getönten Scheiben. Der Chauffeur stieg aus und ging um den Wagen, um die Fondtür zu öffnen. Rose hielt den Atem an. Ein groß gewachsener junger Mann kletterte heraus. Der Chauffeur schloss die Tür hinter ihm. Da merkte Rose, dass Brett allein war.
»Gott sei Dank.« Rose atmete erleichtert aus und musterte den Sohn ihres Bruders, ohne selbst von diesem gesehen zu werden.
Er hatte die gleichen tizianroten Haare wie sie. Als der Junge sich umdrehte, erblickte sie Davids tiefblaue Augen und seine markanten Gesichtszüge. Sie beobachtete, wie er nervös etwas in seiner Jackentasche befingerte, während der Chauffeur das Gepäck aus dem Kofferraum hob und zur Haustür brachte. Irgendwie wirkte der Junge unglücklich. Wahrscheinlich ist er viel nervöser als ich, dachte Rose. Da klingelte es, und Rose überprüfte hastig ihr Aussehen im Spiegel. Sie hörte, wie Mrs Thompson die Tür öffnete. Rose hatte Miles und Miranda am Nachmittag zum Reiten geschickt, weil sie zunächst etwas Zeit mit Brett allein haben wollte.
Als Mrs Thompson Brett ins Wohnzimmer führte, vernahm Rose eine Stimme, die der von David unheimlich ähnlich war. Sie ging langsam den Flur entlang zur Tür. Der Chauffeur trug gerade den letzten Koffer herein.
»Ms Cooper, nehme ich an.«
»Nein, Delancey.«
»Entschuldigung, Ms Delancey. Mr Cooper bedankt sich bei Ihnen. Er hat mich gebeten, Ihnen das für die Unkosten zu geben, die Ihnen durch Brett entstehen.« Der Chauffeur reichte Rose einen Umschlag.
»Danke. Möchten Sie eine Tasse Tee und etwas zu essen? Die Rückfahrt ist lang.«
»Nein, Ms Delancey. Danke für das Angebot, aber ich muss gleich wieder los, um fünf Uhr einige Leute vom Flughafen in Leeds abholen.«
»Klingt, als würde David Sie auf Trab halten.«
»Tut er, doch das gefällt mir. Ich arbeite seit fast dreizehn Jahren für ihn und kenne Brett beinahe sein ganzes Leben lang. Er ist ein guter Junge und wird Ihnen keine Probleme bereiten. Vielleicht wirkt er ein bisschen still, aber er hat auch eine schwere Zeit hinter sich. Er hat seine Mutter abgöttisch geliebt. Was für eine Tragödie.«
»Keine Sorge, ich kümmere mich um ihn. Bestimmt kommen wir gut miteinander zurecht. Fahren Sie vorsichtig.«
»Wird gemacht.« Bill tippte an seine Mütze. »Auf Wiedersehen, Ms Delancey.«
Als Rose die Haustür schloss, hörte sie, wie die Limousine sich entfernte. Sie riss das Kuvert auf und fand darin eine Kurzantwortkarte von »Cooper Industries« sowie eintausend Pfund in bar.
»Gütiger Himmel«, flüsterte sie. »Um das zu verbrauchen, muss ich ihm jeden Abend Kaviar und Champagner auftischen.« Rose schob den Umschlag in eine Tasche ihres weiten Rocks. Dabei überlegte sie, wie schnell sie den Handwerker dazu bringen könnte, ihr einen Kostenvoranschlag für das Dach zu machen, und öffnete die Tür zum Wohnzimmer.
Wie Brett sich die ihm unbekannte Tante auch immer vorgestellt haben mochte: Sie sah jedenfalls überhaupt nicht so aus wie die Frau, die gerade eintrat.
Seine Mutter hatte sich stets gefragt, woher Brett die ungewöhnliche rotgoldene Haarfarbe hatte. Nun wusste er es.
Tante Rose war korpulent und trug eine bunte Bluse sowie einen Bauernrock. Brett erkannte, dass sie früher einmal sehr schön gewesen sein musste. Sein Künstlerblick nahm die feinen Züge mit den markanten hohen Wangenknochen wahr. Riesige grüne Augen beherrschten ihr Gesicht, und sie hatte die gleichen vollen Lippen wie sein Vater. Rose lächelte; dabei glänzten ihre ebenmäßigen weißen Zähne. Sie kam ihm bekannt vor. Bestimmt hatte er sie schon einmal gesehen, aber er wusste nicht, wo.
»Hallo, Brett. Ich bin Rose«, begrüßte sie ihn mit wohlklingender dunkler Stimme.
Brett erhob sich. »Sehr erfreut, dich kennenzulernen, Tante Rose.« Er streckte ihr die Hand hin. Doch statt sie zu ergreifen, umarmte sie ihn fest. Ihm stieg der Duft eines starken Parfüms und von noch etwas anderem in die Nase … ja, der Geruch von Ölfarben. Rose löste sich von ihm, setzte sich aufs Sofa und klopfte auf den Sitz neben sich. Er nahm ebenfalls Platz, und Rose legte ihre Finger auf die seinen.
»Wie schön, dich bei uns zu haben, Brett. Du musst dir merkwürdig vorkommen bei Verwandten, die du nicht kennst. Aber sicher gewöhnst du dich schnell ein. Nach der langen Reise hast du wahrscheinlich Hunger. Möchtest du etwas essen?«
»Nein, danke. Bill hatte einen Picknickkorb für die Fahrt dabei.«
»Vielleicht eine Tasse Tee?«
»Ja, gern.«
»Ich sage Doreen, dass sie welchen machen soll.«
Während Rose in die Küche ging, sah Brett sich in dem Raum um, der vollgestellt war mit alten Möbeln und Nippes. Sein Blick wanderte zu den Gemälden an der Wand …
»Wie lange wart ihr denn unterwegs?«, erkundigte sich Rose, als sie sich wieder neben ihn setzte.
»Ungefähr fünf Stunden. Es war nicht sonderlich viel Verkehr.«
»Vermutlich bist du müde.«
»Ja, schon ein bisschen.«
»Nach dem Tee zeige ich dir dein Zimmer. Momentan ist es im Haus sehr ruhig, weil meine Kinder beim Reiten sind. Vielleicht möchtest du dich vor dem Abendessen hinlegen.«
»Ja, möglich«, meinte Brett.
Kurzes Schweigen.
»Ah, da ist Doreen mit dem Tee. Nimmst du Zucker?«
»Nein, danke, Tante Rose.«
»Nun lass doch das ›Tante‹, ja?« Rose lächelte. »Du bist fast erwachsen, und wenn du das sagst, fühle ich mich uralt. Meine Kinder nennen mich Rose. ›Mutter‹ und ›Mum‹ kann ich nicht leiden.«
Als Rose den Kummer in Bretts Gesicht wahrnahm, biss sie sich auf die Lippe. Dieser schüchterne, nervöse junge Mann, der so offensichtlich nach wie vor um seine Mutter trauerte, hätte sich nicht stärker von dem selbstbewussten, arroganten Jungen unterscheiden können, den sie erwartet hatte.
»Miles und Miranda lernst du heute Abend beim Essen kennen. Sie ist fünfzehn, nur ein paar Monate jünger als du. Ihr solltet eigentlich etwas miteinander anfangen können.«
»Wie alt ist dein Sohn?«
»Miles ist zwanzig und nach seinem zweiten Jahr an der Leeds University gerade zu Hause. Er redet nicht viel, also mach dir keine Gedanken, wenn es eine Weile dauert, bis du ihn besser kennenlernst. Bestimmt kommt ihr gut miteinander aus.« Rose konnte kaum glauben, dass sie dieses Gespräch führte. »Wenn du mit dem Tee fertig bist, führe ich dich nach oben und zeige dir dein Zimmer.«
Brett folgte Rose zwei knarrende Treppen hinauf und einen Flur mit Linoleumboden entlang.
»Da wären wir. Ein schlichtes Zimmer, aber der Blick aus diesem Fenster ist der beste im Haus. Ich lasse dich jetzt auspacken. Wenn du etwas brauchst: Doreen ist für gewöhnlich in der Küche. Wir sehen uns um acht beim Abendessen.« Rose verabschiedete sich mit einem Lächeln und schloss die Tür hinter sich.
Brett sah sich in dem Raum um, der in den folgenden zwei Monaten ihm gehören würde. Darin stand ein Doppelbett mit einem alten Quilt. Das Linoleum auf dem Boden war durchgewetzt, und im Verputz über ihm befanden sich breite Risse. Brett trat ans Fenster und schaute hinaus. Das Nieseln war in Regen übergegangen, graue Wolken umhüllten die Hügel in der Ferne. Er bekam eine Gänsehaut. In dem Zimmer war es kalt, und es roch feucht. Als Brett ein leises Tropfgeräusch hörte, bemerkte er eine kleine Pfütze neben der Tür. Die Zimmerdecke über der Pfütze hing bedrohlich durch.
Brett spürte einen Kloß im Hals. Er fühlte sich verlassen und einsam. Wie hatte sein Vater ihn hierher, an diesen schrecklich trostlosen Ort, schicken können? Er warf sich mit dem Gesicht nach unten aufs Bett und begann zum ersten Mal seit dem Tod seiner Mutter zu weinen.
Er schluchzte eine ganze Weile. Als ihm kalt wurde, schlüpfte er voll bekleidet unter den Quilt und schlief erschöpft ein.
So fand Rose ihn drei Stunden später. Nachdem sie ihn sanft gerüttelt hatte, ohne dass er reagierte, schlich sie auf Zehenspitzen aus dem Zimmer und schloss die Tür.
4
Brett schlug blinzelnd die Augen auf, als die goldenen Strahlen der Sonne durchs Fenster hereindrangen. Kurz wusste er nicht, wo er war. Er setzte sich auf und schaute hinaus ins üppige Grün. War das zu fassen, dass die Sonne eine trostlose Gegend in eine Landschaft so voller Ruhe verwandeln konnte?
Er drehte sich um und streckte sich. Und bemerkte sie.
Sie stand an der Tür, ein Tablett in den Händen. Die junge Frau war groß gewachsen und hatte, schmal wie sie war, etwas von einer Elfe. Die dichten dunkelbraunen Haare reichten ihr bis fast zur Taille. Auch ihre Augen waren tiefbraun und wurden umrahmt von schwarzen Wimpern. Sie hatte ein herzförmiges Gesicht, ungeschminkte rote Lippen und eine kleine Himmelfahrtsnase.
Wie die Sonne Lichter durch ihre Locken tanzen ließ, sah sie so vollkommen aus, dass Brett sich fragte, ob er eine Vision der Madonna vor sich habe. Doch Madonnen hielten für gewöhnlich keine Frühstückstabletts in Händen und trugen auch keine Sweatshirts oder Jeans. Also musste sie real sein. Sie war das hübscheste Mädchen, das er je gesehen hatte.
»Hallo«, begrüßte sie ihn schüchtern. »Mum meint, du könntest Hunger haben.«
Sie sprach mit weichem Yorkshire-Akzent. Aha, Miranda, dachte Brett. Wow, zwei Monate in ihrer Gesellschaft! Vielleicht würden diese Ferien doch nicht ganz so schlimm werden wie befürchtet.
»Das ist sehr nett von ihr. Ja, ich habe tatsächlich einen Bärenhunger. Das Abendessen gestern habe ich wohl verschlafen.«
Sie lächelte. Dabei kamen ihre makellosen perlweißen Zähne zum Vorschein. »Ich stelle das Tablett aufs Fußende des Betts. Unter dem umgedrehten Teller sind Eier und Speck. Dazu gibt’s Toast und Tee.«
Brett beobachtete, wie sie sich ihm anmutig näherte.
»Danke, Miranda. Ich bin übrigens Brett.«
Sie runzelte die hübsche Stirn und schüttelte den Kopf. »Aber ich bin nicht …«
»Habe ich da gerade meinen Namen gehört?« Eine junge Frau mit glänzend blonden Haaren, enger Reithose und tief ausgeschnittenem T-Shirt stürmte zur Tür herein. Sie wäre sehr hübsch gewesen, hätte sie ihr Gesicht nicht mit wenig dezentem Make-up zugekleistert. Sie eilte zu Brett und ließ sich auf die Bettkante fallen, sodass das Tablett herunterrutschte und das Porzellan klirrend zerbarst.
»Verdammter Mist! Wer hat das Ding da hingestellt? Mach das sauber, ja, Leah?« Sie schenkte Brett ein Lächeln, während das andere Mädchen in die Hocke ging. »Ich bin Miranda Delancey, deine Cousine oder eher Stiefcousine. Die gute alte Rosie hat mich nämlich adoptiert, als ich klein war.«
Brett fühlte sich unwohl. Er beobachtete, wie das Mädchen namens Leah sich abmühte, die Scherben mitsamt dem Chaos aus Speck und Eiern aufzusammeln.
»Schön, dich kennenzulernen«, sagte er zu Miranda und stand auf. »Komm, ich helfe dir.« Er kniete neben Leah nieder.
»Lass sie das erledigen. Sie wird dafür bezahlt.« Miranda schwang die Beine aufs Bett.
Brett nahm einen Anflug von Ärger in Leahs Blick wahr, als er ihr die letzte Scherbe reichte.
»Fertig.« Brett richtete sich auf.
»Ich hole Besen und Putzlappen von unten. Willst du dein Frühstück hier oben essen?«
Als Brett in Leahs klare Augen schaute, war Frühstück das Letzte, woran er dachte. »Nein, ich komme runter.«
Leah nickte, nahm das Tablett in die Hand und verließ das Zimmer.
»Wer ist sie?«, fragte Brett Miranda.
»Leah Thompson, die Tochter der Haushälterin. In den Ferien hilft sie hier«, antwortete Miranda abschätzig. »Aber nun zu wichtigeren Dingen, zum Beispiel zu der Frage, was du und ich heute machen. Rosie hat mich zur Leiterin des Brett-Cooper-Unterhaltungskomitees ernannt, und ich werde dafür sorgen, dass du keine Minute allein bist.«
Brett verblüffte ihre zupackende Art. Er war nicht an Mädchen seines Alters gewöhnt, weil er eine Jungenschule besuchte und den größten Teil seiner Ferien in Gesellschaft von Erwachsenen verbrachte. Als Miranda ihn von oben bis unten musterte, spürte er, wie er rot wurde.
»Und? Was willst du heute unternehmen?«
»Ich … na ja …«
»Kannst du reiten?«
Brett schluckte. »Ja.«
»Wunderbar. Wenn du so weit bist, gehen wir rüber zum alten Morris, holen uns zwei Pferde und machen einen schönen langen Ausritt zum Moor. Dabei können wir uns ein bisschen kennenlernen.« Miranda fuhr sich durch die Haare und sah ihn an.
»In Ordnung. Äh, könntest du mir sagen, wo das Bad ist? Ich denke, ich sollte mich waschen und umziehen.«
»Den Flur runter, die zweite Tür links. Was war denn gestern Abend mit dir los? Ich hab mich eigens fürs Essen hübsch gemacht.«
»Ich … ich war müde von der Fahrt, denke ich.«
»Hoffentlich schläfst du nicht immer in deinen Klamotten.« Miranda sprang vom Bett. »Ich warte unten auf dich. Aber brauch nicht zu lang, ja?« Sie verschwand aus dem Zimmer.
Brett trottete den Gang entlang, fand das Bad und drehte die Wasserhähne auf. Das Wasser kam stoßweise und hatte eine merkwürdig gelbe Farbe.
Er zog seine zerknitterten Sachen aus und kletterte in die Wanne. Dabei versuchte er, die sandige braune Schicht am Boden der uralten Metallwanne zu ignorieren. Vor seinem geistigen Auge sah er Leah in der Tür zu seinem Zimmer stehen. Brett war tief enttäuscht darüber, dass sie nicht das Mädchen war, mit dem er die Ferien verbringen würde.
Zwanzig Minuten später aß er in der gemütlichen Küche Speck und Eier von einem großen Teller. Miranda plapperte ohne Unterlass von ihren Plänen für die kommenden zwei Monate, und Leah half ihrer Mutter beim Abtrocknen.
»Machen wir uns auf den Weg«, sagte Miranda. »Bis zur Farm ist es nur ein knapper Kilometer. Wenn du willst, können wir das Fahrrad nehmen.«
»Nein, ein Spaziergang würde mir guttun.«
Miranda ging ihm voran zur Küchentür, wo Brett stehen blieb und sich umdrehte. »Tschüs, Leah. Bis später.«
»Tschüs, Brett.«
»Meinst du nicht, ich sollte Tante … äh … Rose noch einen guten Morgen wünschen?«, fragte Brett Miranda, die schnellen Schrittes den Hügel hinuntermarschierte.
»Himmel, nein. Die hat sich in ihrem Atelier vergraben, da darf man sie nicht stören. Sie kommt bloß zum Essen raus.«
»Was für ein Atelier?«
»Ach, das weißt du nicht? Rosie war vor Urzeiten mal eine berühmte Malerin. Sie hat Ewigkeiten nichts produziert, aber vor zwei Jahren hat sie dann eins der unteren Zimmer ausgeräumt und in ein Atelier umgewandelt. Nächstes Jahr macht sie eine Ausstellung in London. Ihr großes Comeback oder so. Ich persönlich halte das ja für Zeitverschwendung. Wer soll sich nach zwanzig Jahren noch an sie erinnern?« Miranda rümpfte die Nase.
Auf dem Weg die Anhöhe hinunter fügten sich die Puzzleteile für Brett zu einem Bild. Der Geruch nach Ölfarbe, als er Rose umarmt hatte, die Gemälde an den Wänden des Wohnzimmers und Roses Gesicht … natürlich!
»Ist Roses Familienname Delancey?«
Miranda nickte. »Ja, warum?«
»Deine Mutter war vor zwanzig Jahren der Star der Kunstwelt, angeblich die berühmteste Malerin Europas, doch dann ist sie plötzlich von der Bildfläche verschwunden.«
Miranda rümpfte noch einmal die Nase. »Ich kann ihre Bilder nicht ausstehen. Die sind seltsam. Aber du scheinst eine Menge über sie zu wissen. Du interessierst dich für Kunst?«
»Ja.« Brett war aufgeregt, jedoch auch verwirrt. Warum hatte sein Vater nie erwähnt, dass Rose Delancey seine Schwester war? Darauf konnte man doch stolz sein, oder?
»Bestimmt kann Rosie ein paar Sekunden ihrer wertvollen Zeit erübrigen und sich mit dir über ihr Lieblingsthema unterhalten. Wie gut reitest du? Der Wallach ist ein tolles Pferd, nur leider unberechenbar, und die Stute … Wenn dir ein gemütlicher Ausritt vorschwebt, solltest du die nehmen.«
Mittlerweile hatten sie die Ställe erreicht, wo Miranda ihn an den Boxen entlangführte.
»Für mich die Stute, danke, Miranda.«
Kurz darauf waren die Pferde gesattelt und das Picknick, das Mrs Thompson für sie vorbereitet hatte, in der Satteltasche des Wallachs verstaut. Die beiden trabten los in Richtung Hochebene.
»Kaum zu glauben, dass dies derselbe Ort ist, an dem ich abends angekommen bin. Ich glaube, so deprimiert wie gestern war ich noch nie. Alles war so schwarz und düster.«
»So ist das hier oben. Das Wetter kann sich von einer Minute auf die nächste ändern. Es ist erstaunlich, wie anders die Gegend aussieht, wenn die Sonne scheint«, pflichtete Miranda ihm bei.
»Wem gehört denn all der Grund?«, erkundigte sich Brett.
»Hauptsächlich Farmern. Sie lassen ihre Schafe darauf grasen.«
»Er scheint sich endlos zu erstrecken.« Brett ließ den Blick über das Tal schweifen, während sie aufs offene Weideland ritten und einen Hügel erklommen.
»Stimmt. Da drüben auf der anderen Seite vom Stausee liegt das Black Moor. Es reicht bis fast nach Haworth, das ist knapp fünf Kilometer weg. Im Winter wird’s hier oben ziemlich trostlos. Wir waren schon oft eingeschneit.«
Plötzlich begann Brett, sich wohlzufühlen, und er freute sich, hergekommen zu sein. Er konnte es kaum erwarten, zu seiner Tante zurückzukehren und sich mit ihr zu unterhalten.
»Puh.« Miranda wischte sich den Schweiß von der Stirn. »Heute ist es ganz schön heiß. Oben machen wir eine Rast und trinken was.«
»Gut.«
Eine Viertelstunde später waren Wallach und Stute angebunden, und Brett und Miranda lagen auf der Anhöhe im struppigen Gras und tranken Cola.
»Schau mal!« Unvermittelt schoss Miranda hoch. »Da unten auf dem Pferd, das ist Miles.«
Brett setzte sich auf und blickte in die Richtung, in die Miranda zeigte. In der Ferne sah er eine kleine Gestalt auf einem großen schwarzen Pferd.
»Wenn er von der Uni nach Hause kommt, reitet er die meiste Zeit übers Moor«, erklärte Miranda mit Wehmut in der Stimme.
»Was studiert er?«