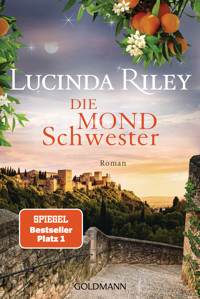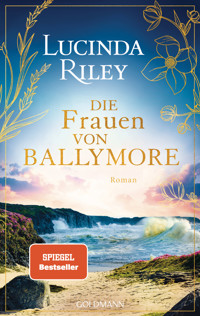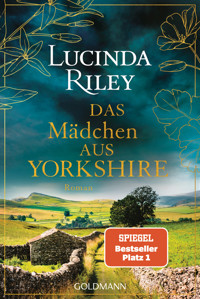11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die sieben Schwestern
- Sprache: Deutsch
Der Anfang der Geschichte um sieben Schwestern und deren einzigartiger Vergangenheit.
„Atlantis“ ist der Name des herrschaftlichen Anwesens am Genfer See, in dem Maia d’Aplièse und ihre Schwestern aufgewachsen sind. Sie alle wurden von ihrem geliebten Vater adoptiert, als sie noch sehr klein waren, und kennen ihre wahren Wurzeln nicht. Als er überraschend stirbt, hinterlässt er jeder seiner Töchter einen Hinweis auf ihre Vergangenheit – und Maia fasst zum ersten Mal den Mut, das Rätsel zu lösen, an dem sie nie zu rühren wagte. Ihre Reise führt sie zu einer alten Villa in Rio de Janeiro, wo sie auf die Spuren von Izabela Bonifacio stößt, einer schönen jungen Frau aus den besten Kreisen der Stadt, die in den 1920er Jahren dort gelebt hat. Maia taucht ein in Izabelas faszinierende Lebensgeschichte – und fängt an zu begreifen, wer sie wirklich ist und was dies für ihr weiteres Leben bedeutet ...
Der Auftakt zur Erfolgsserie von Lucinda Riley.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 754
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Text zum Buch
Maia ist die älteste von sechs Schwestern, die alle von ihrem Vater adoptiert wurden, als sie sehr klein waren. Sie lebt als einzige noch auf dem herrschaftlichen Anwesen ihres Vaters am Genfer See, denn anders als ihre Schwestern, die es drängte, draußen in der Welt ein ganz neues Leben als Erwachsene zu beginnen, fand die eher schüchterne Maia nicht den Mut, ihre vertraute Umgebung zu verlassen. Doch das ändert sich, als ihr Vater überraschend stirbt und ihr einen Umschlag hinterlässt – und sie plötzlich den Schlüssel zu ihrer bisher unbekannten Vorgeschichte in Händen hält: Sie wurde in Rio de Janeiro in einer alten Villa geboren, deren Adresse noch heute existiert. Maia fasst den Entschluss, nach Rio zu fliegen, und an der Seite von Floriano Quintelas, einem befreundeten Schriftsteller, beginnt sie, das Rätsel ihrer Herkunft zu ergründen. Dabei stößt sie auf eine tragische Liebesgeschichte in der Vergangenheit ihrer Familie, und sie taucht ein in das mondäne Paris der Jahrhundertwende, wo einst eine schöne junge Frau aus Rio einem französischen Bildhauer begegnete. Und erst jetzt fängt Maia an zu begreifen, wer sie wirklich ist und was dies für ihr weiteres Leben bedeutet.
Weitere Informationen zu Lucinda Riley sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buches.
Lucinda Riley
Die sieben Schwestern
ROMAN
Deutsch von Sonja Hauser
Die Originalausgabe erscheint 2015 unter dem Titel »The Seven Sisters«
bei Pan Books, a division of Macmillan Publishers Limited, London.
1. Auflage
Copyright © der Originalausgabe 2015 by Lucinda Riley
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2015
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: Uno Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: Getty Images / Philippe Saire-Photography,
Trevillion Images / © Michael Trevillion,
Getty Images / franckreporter, FinePic®, München
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-11700-9
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Für meine Tochter Isabella Rose
»Wir sind alle in der Gosse, aber manche von uns
blicken hinauf zu den Sternen.«
Oscar Wilde
Personen
»Atlantis«
Pa Salt
Adoptivvater der Schwestern (verstorben)
Marina (Ma)
Mutterersatz der Schwestern
Claudia
Haushälterin von »Atlantis«
Georg Hoffman
Pa Salts Anwalt
Christian
Skipper
Die Schwestern d’Aplièse
Maia
Ally (Alkyone)
Star (Asterope)
CeCe (Celaeno)
Tiggy (Taygeta)
Elektra
Merope (fehlt)
MAIA
Juni 2007
Erstes Viertel
13; 16; 21
I
Nie werde ich vergessen, wo ich war und was ich tat, als ich hörte, dass mein Vater gestorben war.
Ich saß im hübschen Garten des Londoner Stadthauses einer alten Schulfreundin, eine Ausgabe von Margaret Atwoods Die Penelopiade aufgeschlagen, jedoch ungelesen auf dem Schoß, und genoss die Junisonne, während Jenny ihren kleinen Sohn vom Kindergarten abholte.
Was für eine gute Idee es doch gewesen war, nach London zu kommen!, dachte ich gerade in dieser angenehm ruhigen Atmosphäre und betrachtete die bunten Blüten der Clematis, denen die Hebamme Sonne auf die Welt half, als das Handy klingelte und ich auf dem Display die Nummer von Marina sah.
»Hallo, Ma, wie geht’s?«, fragte ich und hoffte, dass mir die entspannte Stimmung anzuhören war.
»Maia …«
Marinas Zögern verriet mir, dass sich etwas Schlimmes ereignet hatte.
»Ich weiß leider nicht, wie ich es dir anders sagen soll: Dein Vater hatte gestern Nachmittag hier zu Hause einen Herzinfarkt und ist heute in den frühen Morgenstunden … von uns gegangen.«
Ich schwieg; lächerliche Gedanken schossen mir durch den Kopf, zum Beispiel der, dass Marina sich aus irgendeinem Grund einen geschmacklosen Scherz erlaubte.
»Du als älteste der Schwestern erfährst es zuerst. Und ich wollte dich fragen, ob du es den andern selbst sagen oder das lieber mir überlassen möchtest.«
»Ich …« Als mir klar zu werden begann, dass Marina, meine geliebte Marina, die Frau, die wie eine Mutter für mich war, so etwas nicht behaupten würde, wenn es nicht tatsächlich geschehen wäre, geriet meine Welt aus dem Lot.
»Maia, bitte sprich mit mir. Das ist der schrecklichste Anruf, den ich je erledigen musste, aber was soll ich machen? Der Himmel allein weiß, wie die andern es aufnehmen werden.«
Da erst hörte ich den Schmerz in ihrer Stimme und tat, was ich am besten konnte: trösten.
»Klar sag ich’s den andern, wenn du das möchtest, obwohl ich nicht weiß, wo sie alle sind. Trainiert Ally nicht gerade für eine Segelregatta?«
Als wir darüber diskutierten, wo meine jüngeren Schwestern sich aufhielten, als wollten wir sie zu einer Geburtstagsparty zusammenrufen, nicht zur Trauerfeier für unseren Vater, bekam die Unterhaltung etwas Surreales.
»Wann soll die Beisetzung stattfinden? Elektra ist in Los Angeles und Ally irgendwo auf hoher See, also dürfte nächste Woche der früheste Zeitpunkt sein«, schlug ich vor.
»Tja …« Ich hörte Marinas Zögern. »Das besprechen wir, wenn du zu Hause bist. Es besteht keine Eile. Falls du wie geplant noch ein paar Tage in London bleiben möchtest, geht das in Ordnung. Hier kannst du ohnehin nichts mehr tun …« Sie klang traurig.
»Ma, natürlich setze ich mich in den nächsten Flieger nach Genf, den ich kriegen kann! Ich ruf gleich bei der Fluggesellschaft an und bemühe mich dann, die andern zu erreichen.«
»Es tut mir ja so leid, chérie«, seufzte Marina. »Ich weiß, wie sehr du ihn geliebt hast.«
»Ja«, sagte ich, und plötzlich verließ mich die merkwürdige Ruhe, die ich bis dahin empfunden hatte. »Ich melde mich später noch mal, sobald ich weiß, wann genau ich komme.«
»Pass auf dich auf, Maia. Das war bestimmt ein schrecklicher Schock für dich.«
Ich beendete das Gespräch, und bevor das Gewitter in meinem Herzen losbrechen konnte, ging ich nach oben in mein Zimmer, um die Fluggesellschaft zu kontaktieren. In der Warteschleife betrachtete ich das Bett, in dem ich morgens an einem, wie ich meinte, ganz normalen Tag aufgewacht war. Und dankte Gott dafür, dass Menschen nicht die Fähigkeit besitzen, in die Zukunft zu blicken.
Die Frau von der Airline war alles andere als hilfsbereit; während sie mich über ausgebuchte Flüge und Stornogebühren informierte und mich nach meiner Kreditkartennummer fragte, spürte ich, dass meine emotionalen Dämme bald brechen würden. Als sie mir endlich widerwillig einen Platz im Vier-Uhr-Flug nach Genf reserviert hatte, was bedeutete, dass ich sofort meine Siebensachen packen und ein Taxi nach Heathrow nehmen musste, starrte ich vom Bett aus die Blümchentapete so lange an, bis das Muster vor meinen Augen zu verschwimmen begann.
»Er ist fort«, flüsterte ich, »für immer. Ich werde ihn nie wieder sehen.«
Zu meiner Verwunderung bekam ich keinen Weinkrampf. Ich saß nur benommen da und wälzte praktische Fragen. Mir graute davor, meinen fünf Schwestern Bescheid zu sagen, und ich überlegte, welche ich zuerst anrufen sollte. Natürlich entschied ich mich für Tiggy, die zweitjüngste von uns sechsen, zu der ich immer die engste Beziehung gehabt hatte und die momentan in einem Zentrum für verwaistes und krankes Rotwild in den schottischen Highlands arbeitete.
Mit zitternden Fingern scrollte ich mein Telefonverzeichnis herunter und wählte ihre Nummer. Als sich ihre Mailbox meldete, bat ich sie lediglich, mich so schnell wie möglich zurückzurufen.
Und die anderen? Mir war klar, dass ihre Reaktion unterschiedlich ausfallen würde, von äußerlicher Gleichgültigkeit bis zu dramatischen Gefühlsausbrüchen.
Da ich nicht wusste, wie sehr mir selbst meine Trauer anzuhören wäre, wenn ich mit ihnen redete, entschied ich mich für die feige Lösung und schickte allen eine SMS mit der Bitte, sich baldmöglichst mit mir in Verbindung zu setzen. Dann packte ich hastig meine Tasche und ging die schmale Treppe zur Küche hinunter, um Jenny eine Nachricht zu hinterlassen, in der ich ihr erklärte, warum ich so überstürzt hatte aufbrechen müssen.
Anschließend verließ ich das Haus und folgte mit schnellen Schritten der halbmondförmigen, baumbestandenen Straße in Chelsea, um ein Taxi zu rufen. Wie an einem ganz normalen Tag. Ich glaube, ich sagte sogar lächelnd Hallo zu jemandem, der seinen Hund spazieren führte.
Es konnte ja auch niemand wissen, was ich gerade erfahren hatte, dachte ich, als ich in der belebten King’s Road in ein Taxi stieg und den Fahrer bat, mich nach Heathrow zu bringen.
Fünf Stunden später, die Sonne stand schon tief über dem Genfer See, kam ich an unserer privaten Landestelle an, wo Christian mich in unserem schnittigen Riva-Motorboot erwartete. Seiner Miene nach zu urteilen, wusste er Bescheid.
»Wie geht es Ihnen, Mademoiselle Maia?«, erkundigte er sich voller Mitgefühl, als er mir an Bord half.
»Ich bin froh, dass ich hier bin«, antwortete ich ausweichend und nahm auf der gepolsterten cremefarbenen Lederbank am Heck Platz. Sonst saß ich, wenn wir die zwanzig Minuten nach Hause brausten, vorne bei Christian, doch heute hatte ich das Bedürfnis, hinten allein zu sein. Als Christian den starken Motor anließ, spiegelte sich die Sonne glitzernd in den Fenstern der prächtigen Häuser am Ufer des Genfer Sees. Bei diesen Fahrten hatte ich oft das Gefühl gehabt, in ein Märchenland, in eine surreale Welt, einzutauchen, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun hatte.
In die Welt von Pa Salt.
Als ich an den Kosenamen meines Vaters dachte, den ich als Kind erfunden hatte, spürte ich zum ersten Mal, wie meine Augen feucht wurden. Er war immer gern gesegelt, und wenn er in unser Haus am See zu mir zurückkehrte, hatte er oft nach frischer Meerluft gerochen. Der Name war ihm geblieben, auch meine jüngeren Schwestern hatten ihn verwendet.
Während der warme Wind mir durch die Haare wehte, musste ich an all die Fahrten denken, die ich schon zu »Atlantis«, Pa Salts Märchenschloss, unternommen hatte. Da es auf einer Landzunge vor halbmondförmigem, steil ansteigendem, gebirgigem Terrain lag, war es vom Land nicht zu erreichen; man musste mit dem Boot hinfahren. Die nächsten Nachbarn lebten Kilometer entfernt am Seeufer, sodass »Atlantis« unser eigenes kleines Reich war, losgelöst vom Rest der Welt. Alles dort war magisch … als führten Pa Salt und wir, seine Töchter, ein verzaubertes Leben.
Pa Salt hatte uns samt und sonders als Babys ausgewählt, in unterschiedlichen Winkeln der Erde adoptiert und nach Hause gebracht, wo wir fortan unter seinem Schutz lebten. Wir waren alle, wie Pa gern sagte, besonders und unterschiedlich … eben seine Mädchen. Er hatte uns nach den Plejaden, dem Siebengestirn, seinem Lieblingssternhaufen, benannt. Und ich, Maia, war die Erste und Älteste.
Als Kind hatte ich ihn manchmal in sein mit einer Glaskuppel ausgestattetes Observatorium oben auf dem Haus begleiten dürfen. Dort hatte er mich mit seinen großen, kräftigen Händen hochgehoben, damit ich durch das Teleskop den Nachthimmel betrachten konnte.
»Da sind sie«, hatte er dann gesagt und das Teleskop für mich justiert. »Schau dir den wunderschön leuchtenden Stern an, nach dem du benannt bist, Maia.«
Und ich hatte ihn tatsächlich gesehen. Während er mir die Geschichten erzählte, die meinem eigenen und den Namen meiner Schwestern zugrunde lagen, hatte ich kaum zugehört, sondern einfach nur das Gefühl seiner Arme um meinen Körper genossen, diesen seltenen, ganz besonderen Augenblick, in dem ich ihn ganz für mich hatte.
Marina, die ich in meiner Jugend für meine Mutter gehalten hatte – ich verkürzte ihren Namen sogar auf »Ma« –, entpuppte sich irgendwann als besseres Kindermädchen, das Pa eingestellt hatte, um auf mich aufzupassen, weil er so oft verreisen musste. Doch natürlich war Marina für uns Schwestern sehr viel mehr. Sie wischte uns die Tränen aus dem Gesicht, schalt uns, wenn wir nicht anständig aßen, und steuerte uns umsichtig durch die schwierige Zeit der Pubertät.
Sie war einfach immer da. Bestimmt hätte ich Ma auch nicht mehr geliebt, wenn sie meine leibliche Mutter gewesen wäre.
In den ersten drei Jahren meiner Kindheit hatten Marina und ich allein in unserem Märchenschloss am Genfer See gelebt, während Pa Salt geschäftlich auf den sieben Weltmeeren unterwegs war. Dann waren eine nach der anderen meine Schwestern dazugekommen.
Pa hatte mir von seinen Reisen immer ein Geschenk mitgebracht. Wenn ich das Motorboot herannahen hörte, war ich über die weiten Rasenflächen und zwischen den Bäumen hindurch zur Anlegestelle gerannt, um ihn zu begrüßen. Wie jedes Kind war ich neugierig gewesen, welche Überraschungen sich in seinen Taschen verbargen. Und einmal, nachdem er mir ein fein geschnitztes Rentier aus Holz überreicht hatte, das, wie er mir versicherte, aus der Werkstatt des heiligen Nikolaus am Nordpol stammte, war eine Frau in Schwesterntracht hinter ihm aufgetaucht, in den Armen ein Bündel, das sich bewegte.
»Diesmal habe ich dir ein ganz besonderes Geschenk mitgebracht, Maia. Eine Schwester.« Er hatte mich lächelnd hochgehoben. »Nun wirst du dich nicht mehr einsam fühlen, wenn ich wieder auf Reisen bin.«
Danach hatte das Leben sich verändert. Die Kinderschwester verschwand nach ein paar Wochen, und fortan kümmerte sich Marina um die Kleine. Damals begriff ich nicht, wieso dieses rotgesichtige, kreischende Ding, das oft ziemlich unangenehm roch und die Aufmerksamkeit von mir ablenkte, ein Geschenk sein sollte. Bis Alkyone – benannt nach dem zweiten Stern des Siebengestirns – mich eines Morgens beim Frühstück von ihrem Kinderstuhl aus anlächelte.
»Sie erkennt mich«, sagte ich verwundert zu Marina, die sie fütterte.
»Natürlich, Maia. Du bist ihre große Schwester, zu der sie aufblicken kann. Es wird deine Aufgabe sein, ihr all die Dinge beizubringen, die du bereits kannst.«
Später war sie mir wie ein Schatten überallhin gefolgt, was mir einerseits gefiel, mich andererseits jedoch auch nervte.
»Maia, warte!«, forderte sie lauthals, wenn sie hinter mir hertapste.
Obwohl Ally – wie ich sie nannte – ursprünglich eher ein unwillkommener Eindringling in mein Traumreich »Atlantis« gewesen war, hätte ich mir keine liebenswertere Gefährtin wünschen können. Sie weinte selten und neigte nicht zu Jähzornsausbrüchen wie andere Kinder in ihrem Alter. Mit ihren rotgoldenen Locken und den großen blauen Augen bezauberte Ally alle Menschen, auch unseren Vater. Wenn Pa Salt von seinen langen Reisen nach Hause zurückkehrte, strahlte er bei ihrem Anblick wie bei mir nur selten. Und während ich Fremden gegenüber schüchtern und zurückhaltend war, entzückte Ally sie mit ihrer offenen, vertrauensvollen Art.
Außerdem gehörte sie zu den Kindern, denen alles leichtzufallen schien – besonders Musik und sämtliche Wassersportarten. Ich erinnere mich, wie Pa ihr das Schwimmen in unserem großen Swimmingpool beibrachte. Während ich Mühe hatte, mich über Wasser zu halten, und es hasste unterzutauchen, fühlte meine kleine Schwester sich darin ganz in ihrem Element. Und während ich sogar auf der Titan, Pas riesiger ozeantauglicher Jacht, manchmal schon auf dem Genfer See fast seekrank wurde, bettelte Ally ihn an, mit ihr im Laser von unserer privaten Anlegestelle hinauszufahren. Ich kauerte mich im Heck des Boots zusammen, wenn Pa und Ally es in Höchstgeschwindigkeit über das spiegelglatte Wasser lenkten. Diese Leidenschaft schuf eine innere Verbindung zwischen ihnen, die mir verwehrt blieb.
Obwohl Ally am Conservatoire de Musique de Genève Musik studierte und eine begabte Flötistin war, die gut und gern Berufsmusikerin hätte werden können, hatte sie sich nach dem Abschluss des Konservatoriums für eine Laufbahn als Seglerin entschieden. Sie nahm regelmäßig an Regatten teil und hatte die Schweiz schon mehrfach international vertreten.
Als Ally fast drei war, hatte Pa unsere nächste Schwester gebracht, die er nach einem weiteren Stern des Siebengestirns Asterope nannte.
»Aber wir werden ›Star‹ zu ihr sagen«, hatte Pa Marina, Ally und mir lächelnd erklärt, als wir die Kleine in ihrem Körbchen betrachteten.
Weil ich inzwischen jeden Morgen Unterricht von einem Privatlehrer erhielt, wirkte sich das Eintreffen meiner neuen Schwester weniger stark auf mich aus als das von Ally. Genau wie sechs Monate später, als sich ein zwölf Wochen altes Mädchen namens Celaeno, was Ally sofort zu CeCe abkürzte, zu uns gesellte.
Der Altersunterschied zwischen Star und CeCe betrug lediglich drei Monate, sodass die beiden einander von Anfang an sehr nahestanden. Sie waren wie Zwillinge und kommunizierten in ihrer eigenen Babysprache, von der sie einiges sogar ins Erwachsenenalter retteten. Star und CeCe lebten in ihrer eigenen kleinen Welt, und auch jetzt, da sie beide über zwanzig waren, änderte sich daran nichts. CeCe, die Jüngere der beiden, deren stämmiger Körper und nussbraune Haut in deutlichem Kontrast zu der gertenschlanken, blassen Star standen, übernahm immer die Führung.
Im folgenden Jahr traf ein weiteres kleines Mädchen ein. Taygeta – der ich ihrer kurzen dunklen Haare wegen, die wirr von ihrem winzigen Kopf abstanden wie bei dem Igel in Beatrix Potters Geschichte, den Spitznamen »Tiggy« gab.
Mit meinen sieben Jahren fühlte ich mich sofort zu Tiggy hingezogen. Sie war die Zarteste von uns allen, als Kind ständig krank, jedoch schon damals durch kaum etwas zu erschüttern und anspruchslos. Als Pa wenige Monate später ein kleines Mädchen namens Elektra mit nach Hause brachte, bat die erschöpfte Marina mich gelegentlich, auf Tiggy aufzupassen, die oft an fiebrigen Kehlkopfentzündungen litt. Und als schließlich Asthma diagnostiziert wurde, schob man sie nur noch selten im Kinderwagen nach draußen in die kalte Luft und den dichten Nebel des Genfer Winters.
Elektra war die jüngste der Schwestern, und obwohl ich inzwischen an Babys und ihre Bedürfnisse gewöhnt war, fand ich sie ziemlich anstrengend. Sie machte ihrem Namen alle Ehre, weil sie tatsächlich elektrisch wirkte. Ihre Stimmungen, die von einer Sekunde zur nächsten von fröhlich auf traurig wechselten und umgekehrt, führten dazu, dass unser bis dahin so ruhiges Zuhause nun von spitzen Schreien widerhallte. Ihre Jähzornanfälle bildeten die Hintergrundmusik meiner Kindheit, und auch später schwächte sich ihr feuriges Temperament nicht ab.
Ally, Tiggy und ich nannten sie insgeheim »Tricky«. Wir behandelten sie wie ein rohes Ei, weil wir keine ihrer Launen provozieren wollten. Ich muss zugeben, dass es Momente gab, in denen ich sie für die Unruhe, die sie nach »Atlantis« brachte, hasste.
Doch wenn Elektra erfuhr, dass eine von uns Probleme hatte, half sie als Erste, denn ihre Großzügigkeit war genauso stark ausgeprägt wie ihr Egoismus.
Nach Elektra warteten alle auf die siebte Schwester. Schließlich hatte Pa Salt uns nach dem Siebengestirn benannt, und ohne sie waren wir nicht vollständig. Wir wussten sogar schon ihren Namen – »Merope« – und waren gespannt, wie sie sein würde. Doch die Jahre gingen ins Land, ohne dass Pa weitere Babys nach Hause gebracht hätte.
Ich erinnere mich noch gut an den Tag, an dem ich mit Vater im Observatorium eine Sonnenfinsternis beobachten wollte. Ich war vierzehn Jahre alt und fast schon eine Frau. Pa Salt hatte mir erklärt, dass eine Sonnenfinsternis immer einen wesentlichen Augenblick für die Menschen darstellte und Veränderungen einläutete.
»Pa«, hatte ich gefragt, »bringst du uns noch irgendwann eine siebte Schwester?«
Sein starker, schützender Körper war plötzlich erstarrt, als würde das Gewicht der Welt auf seinen Schultern lasten. Obwohl er sich nicht zu mir umdrehte, weil er damit beschäftigt war, das Teleskop auszurichten, merkte ich, dass ich ihn aus der Fassung gebracht hatte.
»Nein, Maia. Leider konnte ich sie nicht finden.«
Als die dichte Fichtenhecke, die unser Anwesen vor neugierigen Blicken schützte, in Sicht kam und ich Marina auf der Anlegestelle warten sah, wurde mir endgültig bewusst, wie schrecklich der Verlust von Pa war.
Des Weiteren wurde mir klar, dass der Mann, der dieses Reich für uns Prinzessinnen geschaffen hatte, den Zauber nun nicht mehr aufrechterhalten konnte.
II
Marina legte mir tröstend die Arme um die Schultern, als ich vom Boot auf die Anlegestelle kletterte. Dann gingen wir schweigend zwischen den Bäumen hindurch und über die weiten, ansteigenden Rasenflächen zum Haus. Im Juni, wenn in den kunstvoll angelegten Gärten alles blühte und die Bewohner dazu verführte, verborgene Pfade und geheime Grotten zu erkunden, war es hier am schönsten.
Das Gebäude selbst, im ausgehenden achtzehnten Jahrhundert im Louis-quinze-Stil erbaut, vermittelte den Eindruck von Eleganz und Größe. Es hatte vier Stockwerke, deren massige roséfarbene Mauern von hohen Fenstern durchbrochen und von einem steilen roten Dach mit Türmen an jeder Ecke gekrönt wurden. Im Innern war es mit allem modernen Luxus sowie mit hochflorigen Teppichen und behaglichen, dick gepolsterten Sofas ausgestattet. Wir Mädchen und Marina schliefen im obersten Stockwerk, von wo aus man über die Baumwipfel einen atemberaubenden Blick auf den See hatte.
Mir fiel auf, wie erschöpft Marina wirkte. Sie hatte dunkle Ringe unter den freundlichen braunen Augen, und um ihren sonst so oft lächelnden Mund lag ein angespannter Zug. Sie musste mittlerweile Mitte sechzig sein, was man ihr allerdings nicht ansah. Mit ihren markanten Zügen, ihrer Körpergröße und der stets makellosen Kleidung war sie eine attraktive Frau; ihre angeborene Eleganz verriet ihre französische Herkunft. Ich erinnerte mich, dass sie die seidigen dunklen Haare in meiner Kindheit und Jugend offen getragen hatte, nun hingegen schlang sie sie im Nacken zu einem Knoten.
Mir gingen tausend Fragen durch den Kopf, von denen ich eine sofort beantwortet wissen wollte.
»Warum hast du mich nicht gleich informiert, als Pa den Herzinfarkt hatte?«, erkundigte ich mich, als wir das Haus und das Wohnzimmer mit der hohen Decke betraten, von dem aus die große geflieste Terrasse mit Pflanztrögen voll roter und gelber Kapuzinerkresse zu sehen war.
»Maia, glaube mir, ich habe ihn angefleht, es dir und euch allen sagen zu dürfen, aber meine Bitte hat ihm solchen Kummer bereitet, dass ich ihm lieber seinen Willen gelassen habe.«
Mir war klar, dass ihr die Hände gebunden gewesen waren. Er war der König und Marina bestenfalls seine loyale Hofdame, schlimmstenfalls jedoch seine Bedienstete, die seine Anordnungen befolgen musste.
»Ma, wo ist er jetzt?«, fragte ich. »Oben in seinem Zimmer? Soll ich zu ihm raufgehen?«
»Nein, chérie, er ist nicht oben. Möchtest du einen Tee, bevor ich dir mehr erzähle?«
»Offen gestanden wäre mir ein starker Gin Tonic lieber«, antwortete ich und sank auf eines der riesigen Sofas.
»Ich bitte Claudia, ihn dir zu machen. Angesichts der Umstände werde ich mich dir ausnahmsweise anschließen.«
Ich sah Marina nach, wie sie den Raum auf der Suche nach unserer Haushälterin Claudia verließ, die genauso lange wie Marina in »Atlantis« war, aus Deutschland stammte und hinter deren mürrischer Miene sich ein Herz aus Gold verbarg. Wie wir alle hatte sie Pa Salt verehrt. Ich fragte mich, was nun, da Pa nicht mehr da war, aus ihr, Marina und »Atlantis« werden würde.
Was das bedeutete, war noch immer nicht richtig bei mir angekommen, denn Pa war immer »nicht da«, ständig auf Achse, zu irgendwelchen Projekten unterwegs, und Personal und Familie wussten nicht, womit er sich seinen Lebensunterhalt verdiente. Einmal hatte ich ihn danach gefragt, weil meine Freundin Jenny, die die Schulferien bei uns verbrachte, von unserem feudalen Lebensstil beeindruckt gewesen war.
»Dein Vater muss fabelhaft reich sein«, hatte sie voller Ehrfurcht bemerkt, als wir auf dem Flughafen La Môle bei Saint-Tropez aus Pas Privatjet gestiegen waren. Der Chauffeur hatte auf dem Rollfeld gewartet, um uns zum Hafen zu bringen, wo wir an Bord der Titan, unserer prächtigen Jacht, gehen und unsere alljährliche Kreuzfahrt durchs Mittelmeer beginnen sollten.
Da ich kein anderes Leben kannte, war es mir nie ungewöhnlich vorgekommen. Wir Mädchen waren anfangs alle von einem Privatlehrer zu Hause unterrichtet worden, und erst mit dreizehn im Internat wurde mir klar, wie sehr sich unser Leben von dem anderer Jugendlicher unterschied.
Einmal hatte ich Pa gefragt, was genau er tue, um uns all den Luxus ermöglichen zu können.
Er hatte mich mit einem für ihn typischen geheimnisvollen Blick bedacht und gelächelt. »Ich bin so etwas wie ein Zauberer.«
Was mir, wie von ihm beabsichtigt, nichts verriet.
Später hatte ich gemerkt, dass Pa Salt in der Tat ein Meister der Illusion und nichts so war, wie es auf den ersten Blick erschien.
Als Marina mit zwei Gin Tonics ins Wohnzimmer zurückkehrte, wurde mir klar, dass ich mit dreiunddreißig Jahren keine Ahnung hatte, wer mein Vater außerhalb der Welt von »Atlantis« gewesen war. Und ich fragte mich, ob ich es nun endlich herausfinden würde.
»Da wären wir«, sagte Marina und gab mir ein Glas. »Auf deinen Vater.« Sie hob das ihre. »Gott hab ihn selig.«
»Ja, auf Pa Salt. Möge er in Frieden ruhen.«
Marina trank einen großen Schluck, bevor sie das Glas auf den Tisch stellte und meine Hand mit besorgter Miene in die ihre nahm. »Maia, ich muss dir etwas sagen.«
»Was?«
»Du hast mich vorhin gefragt, ob dein Vater noch im Haus ist. Nein, er ist bereits zur letzten Ruhe gebettet. Es war sein Wunsch, dass das sofort geschehen und keines von euch Mädchen anwesend sein sollte.«
Ich sah sie an, als hätte sie den Verstand verloren. »Ma, du hast mir doch erst vor ein paar Stunden gesagt, dass er heute in den frühen Morgenstunden gestorben ist! Wie konnte die Beisetzung so schnell organisiert werden? Und warum?«
»Dein Vater hat darauf bestanden, dass er sofort nach seinem Tod mit dem Jet zur Jacht geflogen wird, wo man ihn in einen Bleisarg legen sollte, der offenbar schon viele Jahre auf der Titan bereitstand. Und mit der Jacht sollte er auf die offene See hinausgebracht werden. Angesichts seiner Liebe zum Wasser wundert es mich nicht, dass er sich eine Seebestattung gewünscht hat. Seinen Töchtern wollte er den Kummer ersparen, sie mit ansehen zu müssen.«
Ich stöhnte entsetzt auf. »Er hätte sich doch denken können, dass wir uns alle von ihm verabschieden wollen. Wie konnte er das tun? Was soll ich nun den andern sagen?«
»Chérie, du und ich, wir leben am längsten in diesem Haus, und wir wissen beide, dass dein Vater immer einsame Entscheidungen getroffen hat. Er wollte wohl genau so beigesetzt werden, wie er gelebt hat, nämlich im Stillen«, seufzte sie.
»Und alles unter Kontrolle haben«, fügte ich ein wenig verärgert hinzu. »Mir kommt es fast so vor, als hätte er den Menschen, die ihn liebten, nicht zugetraut, das Richtige für ihn zu tun.«
»Egal. Ich kann nur hoffen, dass ihr euch immer an den liebevollen Vater erinnern werdet, der er war. Eines weiß ich jedenfalls sicher: Ihr Mädchen wart sein Ein und Alles.«
»Doch wer von uns kannte ihn schon wirklich?«, fragte ich frustriert. »Hat ein Arzt seinen Tod offiziell festgestellt? Hast du eine Todesbescheinigung? Kann ich die sehen?«
»Der Arzt hat sich bei mir nach seinen persönlichen Daten, dem Ort und Jahr seiner Geburt, erkundigt. Ich habe ihm gesagt, dass ich nur seine Angestellte war und über diese Dinge keine klare Auskunft geben kann. Am Ende habe ich ihn an Georg Hoffman, den Anwalt, verwiesen, der alle juristischen Dinge für deinen Vater regelt.«
»Aber warum hat er aus allem ein solches Geheimnis gemacht, Ma? Während des Flugs ist mir bewusst geworden, dass ich mich an keine Freunde erinnern kann, die er nach ›Atlantis‹ mitgebracht hat. Auf der Jacht war er hin und wieder mit einem Geschäftspartner in seinem Arbeitszimmer, doch richtige Einladungen hat er nie gegeben.«
»Er wollte Familien- und Geschäftsleben getrennt halten und sich zu Hause voll und ganz auf seine Töchter konzentrieren.«
»Auf die Töchter, die er adoptiert und aus allen Teilen der Welt hierhergebracht hat. Warum, Ma, warum?«
Marinas Blick verriet mir nichts.
»Als Kind akzeptiert man sein Leben, wie es ist«, fuhr ich fort. »Doch wir wissen beide, dass es äußerst ungewöhnlich, wenn nicht sogar merkwürdig ist, wenn ein alleinstehender Mann mittleren Alters sechs Mädchen im Babyalter adoptiert und in die Schweiz bringt, um sie aufzuziehen.«
»Dein Vater war eben ein ungewöhnlicher Mensch. Dass er bedürftigen Waisenkindern die Chance auf ein besseres Leben gegeben hat, ist doch nichts Schlechtes, oder? Viele Reiche adoptieren Kinder, wenn sie keine eigenen haben.«
»Aber normalerweise sind sie verheiratet. Ma, weißt du, ob Pa jemals eine Freundin hatte? Jemanden, den er liebte? Ich habe ihn in dreiunddreißig Jahren niemals in Gesellschaft einer Frau gesehen.«
»Chérie, ich kann verstehen, dass dir nun, da dein Vater nicht mehr unter uns weilt, viele Fragen durch den Kopf gehen, die du ihm gern gestellt hättest, aber ich kann dir nicht helfen. Außerdem ist jetzt auch nicht der geeignete Moment«, fügte Marina sanft hinzu. »Wir sollten uns lieber an das erinnern, was er für jede Einzelne von uns war, und ihn als den liebevollen Menschen im Gedächtnis behalten, als den wir ihn hier in ›Atlantis‹ kannten. Dein Vater war über achtzig und hatte ein langes und erfülltes Leben hinter sich.«
»Noch vor drei Wochen war er mit dem Laser draußen auf dem See und ist auf dem Boot herumgelaufen wie ein junger Mann. Ich kann nicht glauben, dass er sterbenskrank war.«
»Zum Glück ist er nicht wie viele andere seines Alters einen langsamen, qualvollen Tod gestorben. Ich empfinde es als Segen, dass du und die anderen Mädchen ihn als einen sportlichen, gesunden Mann in Erinnerung behalten werdet. Bestimmt hätte er sich genau das gewünscht.«
»Hat er am Ende leiden müssen?«, fragte ich vorsichtig, obwohl ich wusste, dass Marina mir das niemals verraten würde.
»Nein. Er wusste, was kommen würde, und ich denke, er hatte seinen Frieden mit Gott gemacht. Ich glaube sogar, dass er froh über das Ende war.«
»Wie um Himmels willen soll ich es den andern beibringen, dass Vater nicht mehr ist? Und dass es nicht einmal einen Leichnam gibt, den wir beisetzen können? Sie werden genau wie ich das Gefühl haben, dass er sich einfach in Luft aufgelöst hat.«
»Das hat euer Vater vor seinem Tod bedacht. Sein Anwalt Georg Hoffman hat sich heute mit mir in Verbindung gesetzt. Ich versichere dir, dass jede von euch die Chance bekommen wird, sich von ihm zu verabschieden.«
»Sogar im Tod hat Pa alles unter Kontrolle«, sagte ich seufzend. »Ich hab den fünfen auf die Mailbox gesprochen, aber noch von keiner eine Antwort erhalten.«
»Georg Hoffman wird sich auf den Weg hierher machen, sobald alle da sind. Bitte, Maia, frag mich nicht, was er euch sagen wird, denn ich habe keine Ahnung. Ich habe Claudia gebeten, Suppe zu kochen. Wahrscheinlich hast du seit heute Morgen nichts gegessen. Möchtest du sie zum Pavillon mitnehmen oder die Nacht lieber hier im Haus verbringen?«
»Ich esse die Suppe hier und gehe dann, wenn es dir nichts ausmacht, hinüber. Ich will allein sein.«
»Natürlich.« Marina umarmte mich. »Ich kann mir denken, was für ein furchtbarer Schock das für dich gewesen sein muss. Es tut mir leid, dass du wieder einmal die Last der Verantwortung für euch alle tragen musst, aber er hat mich gebeten, dich als Erste zu benachrichtigen. Vielleicht tröstet dich das. Soll ich Claudia jetzt bitten, die Suppe warm zu machen? Ich glaube, wir könnten beide etwas zu essen vertragen.«
Nach dem Essen sagte ich der erschöpften Marina, dass sie schlafen gehen könne, und gab ihr einen Gutenachtkuss. Bevor ich das Haus verließ, warf ich im obersten Stockwerk einen Blick in die Zimmer meiner Schwestern. Sie sahen alle genau so aus, wie sie sie verlassen hatten, und spiegelten ihre jeweiligen Persönlichkeiten. Wenn sie hierher zurückkehrten wie Vögel ins Nest, schienen sie wie ich nichts verändern zu wollen.
Ich öffnete die Tür zu meinem alten Zimmer, trat an das Regal, in dem ich meine wertvollsten Kindheitsschätze aufbewahrte, und nahm eine alte Porzellanpuppe in die Hand, die Pa mir geschenkt hatte, als ich klein war. Wie immer hatte er eine märchenhafte Geschichte darum gesponnen, nämlich dass die Puppe einmal einer jungen russischen Gräfin gehört und sich in ihrem kalten Moskauer Palast einsam gefühlt habe, als ihre Herrin erwachsen geworden sei und sie vergessen habe. Und er hatte mir gesagt, dass sie Leonora heiße und eine neue liebevolle Besitzerin suche.
Ich setzte die Puppe ins Regal zurück und holte die Schachtel heraus, in der sich Pas Geschenk zu meinem sechzehnten Geburtstag befand, eine Kette.
»Das ist ein Mondstein, Maia«, hatte er mir erklärt, als ich den bläulich schimmernden und mit winzigen Brillanten eingefassten Stein betrachtete. »Er ist älter als ich und hat eine sehr interessante Geschichte. Vielleicht erzähle ich sie dir eines Tages. Momentan erscheint dir die Kette wahrscheinlich noch ein wenig zu erwachsen, aber eines Tages wird sie dir, glaube ich, sehr gut stehen.«
Pa hatte recht gehabt. Seinerzeit hatten mir wie meinen Schulfreundinnen billige Silberreifen und große Kreuze an Lederbändern gefallen. Den Mondstein hatte ich nie getragen.
Doch nun würde ich ihn anlegen.
Ich trat an den Spiegel, schloss den winzigen Verschluss des zarten Goldkettchens und betrachtete es. Vielleicht bildete ich mir das nur ein, aber der Stein schien auf meiner Haut zu leuchten. Als ich zum Fenster ging, um auf die blinkenden Lichter des Genfer Sees hinauszublicken, berührten meine Finger ihn unwillkürlich.
»Ruhe in Frieden, geliebter Pa Salt«, flüsterte ich.
Bevor mich Erinnerungen an die Kindheit überkommen konnten, verließ ich hastig das Zimmer, das ich früher bewohnt hatte, und lief aus dem Haus und über den schmalen Pfad zu meinem jetzigen Domizil in etwa zweihundert Meter Entfernung.
Die vordere Tür zum Pavillon war nie verschlossen; angesichts der Hightechsicherung des gesamten Anwesens war es unwahrscheinlich, dass sich jemand mit meinen wenigen Habseligkeiten davonmachen würde.
Als ich den Pavillon betrat, sah ich, dass Claudia die Lampen im Wohnbereich für mich eingeschaltet hatte. Ich sank niedergeschlagen aufs Sofa.
Als einzige der Schwestern war ich niemals flügge geworden.
III
Als mein Handy um zwei Uhr morgens klingelte, lag ich noch wach und grübelte darüber nach, warum ich nicht in der Lage war, über Pas Tod zu weinen. Beim Anblick von Tiggys Nummer auf dem Display bekam ich ein flaues Gefühl im Magen.
»Hallo?«
»Maia, tut mir leid, dass ich so spät anrufe, aber ich hab deine Nachricht gerade erst gekriegt. Wir haben hier kein zuverlässiges Signal. Du hörst dich nicht gut an. Was ist los?«
Der Klang von Tiggys geliebter Stimme taute die Ränder des Eisbrockens auf, zu dem mein Herz geworden zu sein schien.
»Bei mir ist alles in Ordnung, aber …«
»Pa Salt?«
»Ja«, presste ich hervor. »Woher weißt du das?«
»Heute Morgen hatte ich im Moor bei der Suche nach einem jungen Reh, das wir vor ein paar Wochen markiert haben, plötzlich ein merkwürdiges Gefühl. Als ich es tot gefunden habe, musste ich an Pa denken. Ist er …?«
»Tiggy, er ist heute gestorben. Nein, inzwischen gestern«, korrigierte ich mich.
»Wie bitte? Was ist passiert? War’s ein Segelunfall? Ich hab ihm erst neulich gesagt, dass er mit dem Laser nicht mehr allein rausfahren soll.«
»Nein, er hatte hier im Haus einen Herzinfarkt.«
»Warst du bei ihm? Musste er leiden?« Tiggy brach die Stimme. »Den Gedanken könnte ich nicht ertragen.«
»Nein, Tiggy, ich war ein paar Tage bei meiner Freundin Jenny in London.« Ich holte Luft. »Pa hatte mich dazu überredet. Er meinte, es würde mir guttun, mal ein bisschen von ›Atlantis‹ wegzukommen.«
»Oje, wie schrecklich für dich, Maia. Du bist so selten fort, und wenn du dann tatsächlich mal wegfährst …«
»Ja, genau.«
»Glaubst du, er hat es geahnt und wollte dir den Kummer ersparen?«
Tiggy sprach den Gedanken aus, der mir in den vergangenen Stunden durch den Kopf gegangen war.
»Nein, das war wohl Schicksal. Mach dir mal keine Sorgen um mich, mir ist eher mulmig wegen dir. Alles in Ordnung? Ich wünschte, ich wäre bei dir und könnte dich in den Arm nehmen.«
»Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht so richtig, was ich empfinde, weil alles noch ein bisschen unwirklich ist. Vielleicht ändert sich das, wenn ich nach Hause komme. Ich versuche, für morgen einen Platz in einem Flieger zu ergattern. Hast du es den andern schon gesagt?«
»Ich habe ihnen Nachrichten hinterlassen und sie gebeten, mich sofort zurückzurufen.«
»Ich bin so schnell wie möglich bei dir, Maia, und helfe dir. Vermutlich gibt es viel zu tun wegen der Beerdigung.«
Ich schaffte es nicht, ihr zu sagen, dass unser Vater bereits in seinem feuchten Grab ruhte. »Ich bin froh, wenn du kommst. Aber versuch jetzt zu schlafen, Tiggy. Und falls du jemanden zum Reden brauchst: Ich bin da.«
»Danke.« Sie war den Tränen nahe, das hörte ich. »Maia, du weißt, dass er nicht ganz von uns gegangen ist. Die Seele verschwindet nicht, sie bewegt sich einfach auf eine andere Ebene.«
»Das hoffe ich. Gute Nacht, Tiggy.«
»Halt die Ohren steif, Maia. Wir sehen uns morgen.«
Nachdem ich das Gespräch beendet hatte, sank ich erschöpft aufs Bett zurück. Ich hätte mir gewünscht, Tiggys Glauben an das Weiterleben der Seele zu teilen. Doch leider fiel mir kein einziger karmischer Grund ein, warum Pa Salt die Erde verlassen haben sollte.
Möglicherweise hatte ich früher einmal tatsächlich geglaubt, dass es einen Gott gibt oder zumindest eine Macht, die das Verständnis des Menschen übersteigt. Doch irgendwann war mir dieser Trost abhandengekommen.
Und ich wusste sogar, wann das geschehen war.
Wenn ich nur lernen könnte, wieder etwas zu empfinden, statt nur wie ein Roboter zu funktionieren!, dachte ich. Dann wäre viel gewonnen. Dass ich nicht mit den angemessenen Gefühlen auf Pas Tod reagieren konnte, zeigte mir deutlich meine Probleme.
Immerhin schien ich nach wie vor andere trösten zu können. Alle meine Schwestern betrachteten mich als ihren Fels in der Brandung, denn ich war die pragmatische, vernünftige Maia, »die Starke«, wie Marina es ausdrückte.
Doch tief in meinem Innern wusste ich, dass ich mehr Angst hatte als sie. Während meine Schwestern flügge geworden und hinaus in die Welt gegangen waren, hatte ich mich hinter der Ausrede in »Atlantis« verschanzt, dass Pa mich im Alter brauchen würde. Dabei war mir mein Beruf zupassgekommen, der weder Gesellschaft noch Ortswechsel erforderte.
Und Ironie des Schicksals: Trotz der Leere in meinem Privatleben bewegte ich mich in fiktionalen, oft romantischen Welten, wenn ich Romane vom Russischen oder Portugiesischen in meine Muttersprache, das Französische, übersetzte.
Pa war meine Gabe, wie ein Papagei die Sprachen, in denen er mit mir redete, nachzuahmen, als Erstem aufgefallen. Und er hatte Freude daran gehabt, von der einen in die andere zu wechseln, um herauszufinden, ob ich ihm folgen konnte. Mit zwölf Jahren beherrschte ich bereits Französisch, Deutsch und Englisch und verstand Latein, Griechisch, Russisch, Italienisch und Portugiesisch.
Sprachen waren meine Leidenschaft, eine fortwährende Herausforderung, weil ich mich darin immer weiter verbessern konnte, egal, wie gut ich bereits war. Sie faszinierten mich sowohl in der geschriebenen als auch in der gesprochenen Form. Als dann der Moment gekommen war, meine Studienfächer zu wählen, hatte ich nicht lange überlegen müssen.
Ich hatte Pa nur gefragt, auf welche Sprachen ich mich konzentrieren solle.
»Natürlich ist es deine Entscheidung, Maia, aber vielleicht solltest du die nehmen, die du im Moment am wenigsten gut beherrschst, weil du dann an der Uni drei oder vier Jahre Zeit hast, daran zu arbeiten«, hatte er geantwortet.
»Ich weiß es nicht, Pa«, hatte ich geseufzt. »Sie liegen mir alle am Herzen. Deswegen frage ich dich.«
»Gehen wir das Problem rational an. In den kommenden dreißig Jahren wird sich die globale Ökonomie drastisch verändern. Deshalb würde ich, wenn ich du wäre und bereits drei der großen westlichen Sprachen beherrschte, versuchen, meinen Horizont zu erweitern und mich in der Welt umsehen.«
»Du meinst in Ländern wie China oder Russland?«
»Ja, und Indien und Brasilien. In Gebieten mit riesigen Rohstoffvorräten und faszinierender Kultur.«
»Russisch und Portugiesisch haben mir großen Spaß gemacht. Portugiesisch ist eine sehr …«, ich hatte nach dem passenden Wort gesucht, »… ausdrucksstarke Sprache.«
»Siehst du.« Pa hatte erfreut gelächelt. »Warum studierst du nicht beide Sprachen? Bei deiner Begabung schaffst du das spielend. Maia, ich verspreche dir: Wenn du eine oder sogar alle zwei beherrschst, steht dir vieles offen. Noch erkennen nur wenige Menschen, was sich in der Zukunft tun wird. Die Welt ist dabei, sich zu verändern, und du wirst an vorderster Front stehen.«
Ich tappte mit trockenem Mund in die Küche, um mir ein Glas Wasser zu holen. Dabei musste ich an Pas Hoffnung denken, dass ich mit meiner Sprachbegabung selbstbewusst in die neue Zeit aufbrechen würde. Auch ich hatte das gehofft, weil ich mir nichts sehnlicher wünschte, als ihn stolz auf mich zu machen.
Doch wie so viele Menschen hatte auch mich das Leben von meinem geplanten Weg abgebracht. Statt mich in die weite Welt hinauszukatapultieren, erlaubten meine Fähigkeiten es mir, einfach in meinem Zuhause der Kindheit zu bleiben.
Meine Schwestern neckten mich wegen meines Einsiedlerdaseins, wenn sie von irgendwoher hereinflatterten, und erklärten mir, dass ich aufpassen müsse, keine alte Jungfer zu werden, denn wie sollte ich jemals jemanden kennenlernen, wenn ich mich weigerte, »Atlantis« zu verlassen?
»Du bist so schön, Maia, aber du bleibst hier und nutzt diese Schönheit nicht«, hatte Ally bei unserem letzten Treffen gemeint.
Tatsächlich war mein Äußeres auffällig, das spiegelte sich in den Beinamen, die wir Schwestern seit der Kindheit aufgrund unserer Persönlichkeiten trugen:
Maia, die Schöne; Ally, die Anführerin; Star, die Friedensstifterin; CeCe, die Pragmatikerin; Tiggy, die Fürsorgliche; Elektra, die Temperamentvolle.
Die Frage war nur, ob die Gaben, die wir mitbekommen hatten, uns Erfolg und Zufriedenheit bringen würden.
Einige meiner Schwestern waren noch zu jung und hatten zu wenig Lebenserfahrung, um das beurteilen zu können. Ich selbst wusste jedoch, dass meine Schönheit mir die schmerzlichste Erfahrung meines Lebens beschert hatte, weil ich zu naiv gewesen war, die Macht zu begreifen, die sie mir verlieh. Was dazu geführt hatte, dass ich sie und mich jetzt versteckte.
Pa hatte mich in letzter Zeit, wenn er mich im Pavillon besuchte, oft gefragt, ob ich glücklich sei.
»Natürlich«, hatte ich jedes Mal geantwortet, weil es keinen Grund gab, es nicht zu sein. Ich lebte in unmittelbarer Nähe zweier Menschen, die mich liebten. Und auf den ersten Blick stand mir die Welt tatsächlich offen. Ich hatte keinerlei Verpflichtungen oder Verantwortung …
Obwohl ich mich danach sehnte.
Schmunzelnd erinnerte ich mich, wie Pa mich zwei Wochen zuvor ermutigt hatte, meine Schulfreundin Jenny in London zu besuchen. Weil ich mein ganzes Erwachsenendasein das Gefühl gehabt hatte, ihn zu enttäuschen, war ich auf seinen Vorschlag eingegangen. Denn selbst wenn ich nie wirklich »normal« sein konnte, hoffte ich, dass er mich dafür halten würde, wenn ich seinem Wunsch entsprach.
So war ich also nach London gefahren … und hatte nun feststellen müssen, dass er »Atlantis« ebenfalls den Rücken gekehrt hatte. Für immer.
Inzwischen war es vier Uhr morgens. Ich kehrte in mein Zimmer zurück und legte mich ins Bett, um endlich zu schlafen. Aber als mir klar wurde, dass ich Pa nun nicht mehr als Ausrede für mein Einsiedlerleben vorschieben konnte, begann mein Puls zu rasen. Möglicherweise würde »Atlantis« verkauft werden. Mir – und soweit ich wusste, auch meinen Schwestern – gegenüber hatte Pa niemals erwähnt, was nach seinem Tod geschehen würde.
Noch bis ein paar Stunden zuvor war Pa Salt allmächtig und allgegenwärtig gewesen, eine Naturgewalt, die uns sicher im Griff hatte.
Pa hatte uns gern seine »goldenen Äpfel« genannt, reif und rund, die nur darauf warteten, gepflückt zu werden. Doch nun hatte jemand den Ast geschüttelt, und wir waren alle auf den Boden gefallen, ohne dass jemand uns aufgefangen hätte.
Als es an der Tür zum Pavillon klopfte, fuhr ich, benommen von der Schlaftablette, die ich schließlich im Morgengrauen genommen hatte, hoch. Die Uhr im Flur sagte mir, dass es bereits nach elf war.
Vor der Tür stand mit besorgter Miene Marina. »Guten Morgen, Maia. Ich habe versucht, dich über Festnetz und Handy zu erreichen, aber du bist nicht rangegangen. Deswegen wollte ich nachsehen, ob alles in Ordnung ist.«
»Sorry, ich hab eine Schlaftablette genommen und nichts gehört. Komm doch rein«, sagte ich verlegen.
»Werd erst mal richtig wach. Und könntest du, wenn du geduscht und angezogen bist, rüber ins Haus kommen? Tiggy hat angerufen. Wir können sie heute so gegen fünf erwarten. Sie hat Star, CeCe und Elektra erreicht, die ebenfalls auf dem Weg hierher sind. Hast du schon was von Ally gehört?«
»Ich muss auf meinem Handy nachschauen. Wenn nicht, ruf ich sie noch mal an.«
»Bist du okay? Du siehst nicht gut aus, Maia.«
»Doch, danke, Ma. Ich komm dann später rüber.«
Ich schloss die Haustür, ging ins Bad und wusch mir mit kaltem Wasser das Gesicht, um vollends wach zu werden. Als ich mich im Spiegel betrachtete, wurde mir klar, warum Marina mich gefragt hatte, ob ich okay sei. Über Nacht hatten sich Fältchen um meine Augen eingegraben, und darunter befanden sich tiefe dunkle Ringe. Die sonst glänzenden dunkelbraunen Haare hingen schlaff und fettig herunter. Und meine Haut, die normalerweise makellos honigbraun war und kaum Make-up benötigte, wirkte aufgedunsen und blass.
»Im Moment bin ich nicht gerade die Schönheit der Familie«, murmelte ich meinem Spiegelbild zu, bevor ich in den zerwühlten Laken nach meinem Handy suchte. Als ich es schließlich unter der Bettdecke fand, sah ich, dass acht Anrufe in Abwesenheit eingegangen waren. Ich hörte die Stimmen meiner Schwestern, die alle ungläubig und schockiert klangen. Die einzige, die nach wie vor nicht reagiert hatte, war Ally. Ich sprach ihr noch einmal auf die Mailbox und bat sie, sich so schnell wie möglich mit mir in Verbindung zu setzen.
Im Haus lüfteten Marina und Claudia die Zimmer meiner Schwestern und wechselten das Bettzeug. Marina wirkte trotz ihrer Trauer über den Verlust von Pa glücklich darüber, dass ihre Mädchen zu ihr zurückkehrten, denn inzwischen war es ein seltenes Ereignis, wenn wir alle zusammenkamen. Das letzte Mal war das im Juli geschehen, elf Monate zuvor, auf Pas Jacht, vor der griechischen Küste. An Weihnachten waren nur vier von uns zu Hause gewesen, da Star und CeCe sich im Fernen Osten aufhielten.
»Ich habe Christian mit dem Boot losgeschickt, die bestellten Lebensmittel holen«, erklärte Marina mir, als ich ihr nach unten folgte. »Das Essen hat sich zu einer schwierigen Sache entwickelt. Tiggy ist Veganerin, und der Himmel allein weiß, welche schicke Diät Elektra wieder macht«, brummte sie. Ein Teil von ihr hatte bestimmt Freude an dem Chaos, weil es sie an die Zeit erinnerte, in der wir sie alle noch gebraucht hatten. »Claudia backt schon seit Stunden. Und ich hab mir gedacht, wir machen heute Abend einfach nur Pasta und Salat. Das mögt ihr alle.«
»Weißt du, wann Elektra kommt?«, fragte ich, als wir die Küche erreichten, wo der köstliche Geruch von Claudias Kuchen mich an meine Kindheit erinnerte.
»Wahrscheinlich erst in den frühen Morgenstunden. Sie hat einen Platz in einer Maschine von L. A. nach Paris ergattert, und von dort aus fliegt sie nach Genf.«
»Wie hat sie geklungen?«
»Sie hat geweint«, antwortete Marina. »Hysterisch.«
»Und Star und CeCe?«
»Wie üblich hat CeCe das Heft in die Hand genommen. Mit Star habe ich gar nicht gesprochen. CeCe klang ziemlich durch den Wind, die Arme. Sie sind erst vor zehn Tagen aus Vietnam zurückgekommen. Nimm dir frisches Brot, Maia. Bestimmt hast du heute noch nichts gegessen.« Sie gab mir eine mit Butter und Orangenmarmelade bestrichene Scheibe.
»Danke. Keine Ahnung, wie sie das verarbeiten«, murmelte ich und biss von dem Brot ab.
»Sie werden alle auf ihre jeweilige Art reagieren«, meinte Marina weise.
»Sie glauben, dass sie zu Pas Beisetzung nach Hause kommen«, bemerkte ich seufzend. »Trotz des Kummers wäre sie eine Art Abschluss gewesen, ein Moment, in dem wir sein Leben feiern, ihn zur letzten Ruhe betten und anschließend einen Neuanfang hätten wagen können. Doch jetzt werden sie nur feststellen, dass ihr Vater weg ist.«
»Tja, Maia, so ist es nun mal.«
»Gibt es keine Freunde oder Geschäftspartner, die wir informieren sollten?«
»Das übernimmt Georg Hoffman. Er hat sich heute Morgen noch einmal erkundigt, wann alle hier sein würden. Ich habe ihm versprochen, ihm Bescheid zu geben, sobald es uns gelungen wäre, Kontakt zu Ally aufzunehmen. Vielleicht kann er Licht in die rätselhaften Gedankengänge eures Vaters bringen.«
»Falls das überhaupt jemand kann.«
»Darf ich dich jetzt allein lassen? Ich muss vor der Ankunft deiner Schwestern noch tausend Sachen erledigen.«
»Natürlich. Danke, Ma. Ich wüsste nicht, was wir alle ohne dich tun würden.«
»Und ich nicht, was ich ohne euch machen würde«, entgegnete sie, tätschelte meine Schulter und verließ die Küche.
IV
Kurz nach fünf Uhr nachmittags, nachdem ich ziellos im Garten herumgeschlendert war und dann versucht hatte, mich auf meine Übersetzung zu konzentrieren, um mich von Gedanken an Pas Tod abzulenken, hörte ich, wie das Motorboot anlegte. Erleichtert darüber, dass Tiggy endlich da war und ich nun mit meiner Grübelei wenigstens nicht mehr allein wäre, rannte ich hinunter, um sie zu begrüßen.
Ich beobachtete, wie sie anmutig aus dem Boot stieg. Pa hatte ihr, als sie klein war, geraten, Ballettunterricht zu nehmen, denn Tiggy ging nicht, sie schwebte. Die Bewegungen ihres schlanken, geschmeidigen Körpers wirkten so leicht, als würden ihre Füße den Boden überhaupt nicht berühren, und ihre großen sanften Augen und die dichten Wimpern, die ihr herzförmiges Gesicht beherrschten, verliehen ihr etwas Entrücktes. Plötzlich fiel mir ihre Ähnlichkeit mit den jungen Rehen, um die sie sich so aufopfernd kümmerte, auf.
»Maia, Liebes«, begrüßte sie mich und streckte die Arme nach mir aus.
Wir standen eine Weile stumm da. Als sie sich von mir löste, sah ich, dass sie Tränen in den Augen hatte.
»Wie geht es dir?«, erkundigte sie sich.
»Ich bin erschüttert und irgendwie benommen … und dir?«
»Ähnlich. Ich hab’s noch gar nicht richtig begriffen«, antwortete sie, als wir, die Arme umeinander geschlungen, zum Haus gingen.
Auf der Terrasse blieb Tiggy unvermittelt stehen.
»Ist Pa …?« Sie deutete aufs Haus. »Wenn ja, brauche ich ein paar Minuten, um mich innerlich vorzubereiten.«
»Nein, Tiggy, er ist nicht mehr im Haus.«
»Ach. Sie haben ihn schon …« Sie verstummte.
»Lass uns reingehen und Tee trinken, dann erklär ich dir alles.«
»Ich habe versucht, ihn zu spüren, ich meine, seine Seele«, seufzte Tiggy. »Aber da war nichts, einfach nichts.«
»Vielleicht ist es noch zu früh«, versuchte ich sie zu trösten. »Ich spüre auch nichts«, fügte ich hinzu, als wir die Küche betraten.
Claudia wandte sich von der Spüle aus Tiggy, die wohl immer ihr Liebling gewesen war, mit einem mitfühlenden Blick zu.
»Ist das nicht schrecklich?«, fragte Tiggy, trat zu der Haushälterin und drückte sie. Sie war die Einzige von uns, die sich traute, Claudia körperlich so nahe zu kommen.
»Ja«, antwortete Claudia. »Gehen Sie mal ins Wohnzimmer. Ich bringe Ihnen den Tee.«
»Wo ist Ma?«, erkundigte sich Tiggy, während wir uns auf den Weg machten.
»Oben. Sie richtet eure Zimmer. Wahrscheinlich wollte sie uns die Möglichkeit geben, ein paar Minuten allein miteinander zu verbringen«, erklärte ich, als wir uns setzten.
»Sie war hier? Ich meine, als Pa gestorben ist?«
»Ja.«
»Warum hat sie uns dann nicht eher Bescheid gegeben?«, fragte Tiggy genau wie zuvor ich.
In der folgenden halben Stunde beantwortete ich all jene Fragen, die ich Marina tags zuvor selbst gestellt hatte, und teilte Tiggy mit, dass Pa bereits in einem Bleisarg auf dem Meeresgrund liege. Zu meiner Verwunderung zuckte sie nur mit den Achseln.
»Er wollte, dass sein Körper an dem Ort ruht, den er liebte. Irgendwie bin ich froh, dass ich ihn nicht … leblos gesehen habe, weil ich ihn nun so im Gedächtnis behalten kann, wie er immer war.«
Es überraschte mich, dass Tiggy, die Sensibelste von uns, durch den Tod von Pa nicht so betroffen wirkte, wie ich befürchtet hatte. Im Gegenteil: Ihre dichten kastanienbraunen Haare glänzten, und ihre riesigen braunen Augen mit dem unschuldigen, immer ein wenig erstaunten Ausdruck leuchteten sogar. Tiggys Ruhe gab mir Hoffnung, dass meine anderen Schwestern genauso gelassen reagieren würden wie sie.
»Du siehst toll aus, Tiggy. Die schottische Luft scheint dir zu bekommen.«
»O ja«, bestätigte sie. »Nach all den Jahren, die ich als Kind drinnen bleiben musste, habe ich jetzt das Gefühl, endlich in die Wildnis entlassen worden zu sein. Ich liebe meinen Job, auch wenn die Arbeit hart und das Cottage, in dem ich wohne, spartanisch ist. Dort gibt’s nicht mal ein Klo.«
»Wow.« Ich bewunderte ihre Bereitschaft, für ihre Leidenschaft alle Behaglichkeit aufzugeben. »Dann gefällt’s dir dort besser als in dem Labor des Servion Zoo?«
»Klar.« Tiggy hob eine Augenbraue. »Das war zwar ein toller Job, doch ich konnte nur die genetischen Anlagen der Tiere untersuchen und hatte nichts mit ihnen selbst zu tun. Wahrscheinlich hältst du mich für verrückt, weil ich die Chance auf eine große Karriere aufgegeben habe, um für Peanuts durch die Highlands zu streifen, aber das ist mir nun mal lieber.«
Tiggy bedachte Claudia, als diese ein Tablett auf dem niedrigen Tischchen vor uns abstellte und den Raum wieder verließ, mit einem lächelnden Blick.
»Ich halte dich nicht für verrückt, Tiggy. Nein, ich kann deine Entscheidung sogar sehr gut verstehen.«
»Bis zu dem Anruf gestern Abend war ich sehr glücklich.«
»Weil du deine Berufung gefunden hast.«
»Ja, und noch etwas anderes …« Sie wurde rot. »Aber das erzähle ich dir später. Wann kommen die andern?«
»CeCe und Star müssten heute Abend so gegen sieben hier sein, und Elektra wird in den frühen Morgenstunden eintreffen«, antwortete ich und schenkte uns Tee ein.
»Wie hat sie’s aufgenommen?«, erkundigte sich Tiggy. »Nein, sag nichts. Ich kann’s mir vorstellen.«
»Ma hat mit ihr gesprochen. Sie meint, sie hätte einen Heulkrampf bekommen.«
»Also alles wie erwartet.« Tiggy nahm einen Schluck Tee. Dann seufzte sie plötzlich, und das Leuchten verschwand aus ihren Augen. »Es ist alles so merkwürdig. Ich habe das Gefühl, als könnte Pa jeden Moment reinkommen. Aber das ist natürlich Unsinn.«
»Ja.« Ich nickte traurig.
»Sollten wir nicht irgendwas machen?« Unvermittelt erhob Tiggy sich vom Sofa und trat ans Fenster. »Irgendwas?«
»Wenn alle da sind, will Pas Anwalt herkommen, um uns die wichtigen Dinge zu erklären, doch bis dahin …«, ich zuckte resigniert mit den Achseln, »… können wir nur auf die andern warten.«
Tiggy presste die Stirn gegen die Fensterscheibe. »Keine von uns scheint ihn richtig gekannt zu haben«, stellte sie mit leiser Stimme fest.
»Den Eindruck habe ich auch«, pflichtete ich ihr bei.
»Maia, darf ich dich noch was fragen?«
»Ja, klar.«
»Hast du je überlegt, woher du stammst? Ich meine, wer deine leiblichen Eltern waren?«
»Natürlich, Tiggy, aber Pa war mein Ein und Alles, mein Vater. Deswegen musste – oder wollte – ich mir darüber keine Gedanken machen.«
»Du meinst, du hättest ein schlechtes Gewissen, wenn du versuchen würdest, mehr herauszufinden?«
»Möglich. Pa ist mir immer genug gewesen, und ich könnte mir keinen liebevolleren oder fürsorglicheren Vater vorstellen.«
»Ja, ihr zwei hattet eine besonders enge Bindung. Vielleicht ist das beim ersten Kind so.«
»Jede der Schwestern hatte eine ganz besondere Beziehung zu ihm. Er hat uns alle geliebt.«
»Ich weiß, dass er mich geliebt hat«, erklärte Tiggy ruhig. »Doch das hält mich nicht davon ab zu überlegen, woher ich komme. Ich habe mit dem Gedanken gespielt, ihn danach zu fragen, es dann aber nicht getan, weil ich ihn nicht aus der Fassung bringen wollte. Und jetzt ist es zu spät.« Sie gähnte. »Macht’s dir was aus, wenn ich in mein Zimmer gehe und mich ein bisschen ausruhe? Vielleicht macht sich jetzt verspätet der Schock bemerkbar, und außerdem habe ich seit Wochen keinen freien Tag gehabt. Plötzlich bin ich hundemüde.«
»Nein. Leg dich ruhig hin, Tiggy.« Ich sah ihr nach, wie sie durch den Raum zur Tür schwebte.
»Bis später.«
»Schlaf gut«, rief ich ihr nach, obwohl ich mich irgendwie ärgerte. Vielleicht lag es an mir, aber mein Gefühl, dass Tiggy das, was um sie herum vorging, in ihrer vergeistigten Art nie ganz an sich heranließ, war unvermittelt stärker als sonst. Ich wusste nicht so genau, was ich von ihr erwartete; schließlich hatte ich Angst vor der Reaktion meiner Schwestern gehabt und hätte eigentlich froh sein sollen, dass Tiggy so ruhig geblieben war.
Lag der wahre Grund meiner Unzufriedenheit am Ende darin, dass alle meine Schwestern ein Leben jenseits von Pa Salt und ihrem Elternhaus hatten, während er und »Atlantis« für mich der einzige Lebensinhalt gewesen waren?
Ich begrüßte Star und CeCe, die das Motorboot kurz nach sieben Uhr verließen. CeCe, die Körperkontakt nicht sonderlich mochte, gestattete mir immerhin eine kurze Umarmung.
»Schreckliche Neuigkeiten, Maia«, stellte sie fest. »Star ist ziemlich durch den Wind.«
»Das kann ich mir vorstellen«, sagte ich und sah zu Star hinüber, die, noch blasser als sonst, hinter ihrer Schwester stand.
»Wie geht’s dir, Liebes?«, fragte ich und streckte die Arme nach ihr aus.
»Furchtbar«, flüsterte sie und legte ihren Kopf mit der dichten Mähne, die die Farbe von Mondlicht hatte, ein paar Sekunden an meine Schulter.
»Wenigstens sind wir alle wieder zusammen«, bemerkte ich, als Star zu CeCe zurückkehrte, die schützend den Arm um sie legte.
»Was steht jetzt an?«, erkundigte sich CeCe, während wir zu dritt zum Haus hinaufgingen.
Auch ihnen erläuterte ich im Wohnzimmer die Umstände von Pas Tod und seinen Wunsch, ohne uns begraben zu werden.
»Wer hat Pa eigentlich am Ende ins Meer gestoßen?«, fragte CeCe so rational, wie nur Schwester Nummer vier sein konnte.
ENDE DER LESEPROBE