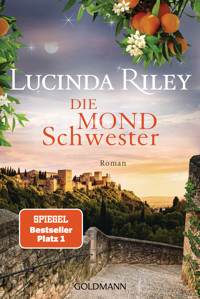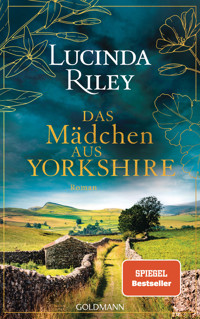11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
St Stephen's, ein kleines Internat im idyllischen Norfolk. Eines Tages kommt der 18-jährige Charlie Cavendish in Fleat House, einem der Wohnheime der traditionsreichen Schule, unter mysteriösen Umständen ums Leben. Der Direktor beeilt sich zu erklären, dass es sich um einen tragischen Unfall handelt, aber die Polizei beginnt unter der Leitung von Detective Inspector Jazz Hunter zu ermitteln. Sie versucht, in den verschlossenen Kosmos des Internats vorzudringen, und findet bald heraus, dass Charlie ein machthungriger junger Mann gewesen ist, der seine Mitschüler gequält hat. War sein Tod ein Racheakt? Jazz taucht tief ein in ein Netz von Beziehungen, emotionalen Abhängigkeiten und offenen Rechnungen – und sie erkennt, dass sie weit in die Vergangenheit zurückgehen muss, wenn sie das Rätsel von Fleat House enthüllen will …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 629
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Buch
St Stephen’s, ein kleines Internat im idyllischen Norfolk. Eines Tages kommt der 18-jährige Charlie Cavendish in Fleat House, einem der Wohnheime der traditionsreichen Schule, unter mysteriösen Umständen ums Leben. Der Direktor beeilt sich zu erklären, dass es sich um einen tragischen Unfall handelt, aber die Polizei beginnt unter der Leitung von Detective Inspector Jazz Hunter zu ermitteln. Sie versucht, in den verschlossenen Kosmos des Internats vorzudringen, und findet bald heraus, dass Charlie ein machthungriger junger Mann gewesen ist, der seine Mitschüler gequält hat. War sein Tod ein Racheakt? Jazz taucht tief ein in ein Netz von Beziehungen, emotionalen Abhängigkeiten und offenen Rechnungen – und sie erkennt, dass sie weit in die Vergangenheit zurückgehen muss, wenn sie das Rätsel von Fleat House enthüllen will …
Weitere Informationen zu Lucinda Riley finden Sie am Ende des Buches.
Lucinda Riley
Die Toten von Fleat House
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Sonja Hauser und Ursula Wulfekamp
Die Originalausgabe erscheint 2022 unter dem Titel »The Murders at Fleat House« bei Macmillan, London.
Die Übersetzung von Vorwort, Prolog und Kapitel 1–17 besorgte Sonja Hauser, von Kapitel 18–33, Epilog und Danksagung Ursula Wulfekamp.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Deutsche Erstveröffentlichung Mai 2022
Copyright © der Originalausgabe 2022 by Lucinda Riley
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2022
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: UNO Werbeagentur, München
Covermotiv: © Nic Skerten / Arcangel; FinePic®, München
CN · Herstellung: Han
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-29349-9V003
www.goldmann-verlag.de
Dieser Roman ist all jenen gewidmet, die träumen. Gebt niemals auf – Lucinda hat es auch nicht getan.
Lucindas Familie
VORWORT
Liebe Leserinnen und Leser,
ich hoffe, Sie freuen sich genauso sehr wie ich, einen nagelneuen Roman von Lucinda Riley in Händen zu halten. Vielleicht sind Sie ein Fan der Sieben Schwestern-Reihe und warten schon gespannt darauf, von Lucinda in ein neues Universum entführt zu werden. Oder aber Sie kennen ihre Werke nicht und erwarten diesen mitreißenden Krimi mit Spannung. In diesem Fall muss ich leider am Ende anfangen, damit Sie den Kontext kennen. Für all diejenigen, die es noch nicht wissen: Lucinda – Mum – ist am 11. Juni 2021 an der Krebserkrankung gestorben, die 2017 diagnostiziert wurde. Ich bin Lucindas ältester Sohn und Koautor (nicht bei dem vorliegenden Projekt, darf ich gleich hinzufügen). Miteinander haben wir die Deine Schutzengel-Bücher für Kinder geschrieben, und nun obliegt mir die Aufgabe, ihr gewaltiges literarisches Vermächtnis weiterzuführen, indem ich mit dem achten und abschließenden Band die Sieben Schwestern-Reihe in ihrem Sinne zu Ende bringe.
Deshalb möchte ich Ihnen erzählen, wie es zu den Toten von Fleat House kam. Mum hat den Roman bereits 2006 verfasst; allerdings wurde er bisher nicht veröffentlicht. Sobald ihre jüngsten Kinder in die Schule gingen, hat Lucinda drei Romane ohne vertragliche Vereinbarung mit einem Verlag verfasst, von denen zwei mittlerweile ausgesprochen erfolgreich herausgekommen sind – Helenas Geheimnis und Das Schmetterlingszimmer. Sie hatte immer vor, auch den dritten dieser Romane zu veröffentlichen, den Sie nun in Händen halten, und zwar nach dem Abschluss der Sieben Schwestern-Reihe.
Bei Helenas Geheimnis und Das Schmetterlingszimmer hat Lucinda ziemlich viel umgeschrieben (wie es wohl jeder Autor tun würde, wenn er sich einem Projekt nach einem Jahrzehnt erneut zuwendet). Im Fall der Toten von Fleat House hatte sie dazu keine Gelegenheit mehr. Deshalb befand ich mich, als ich beschloss, das Buch zur Veröffentlichung freizugeben, in einer Zwickmühle. War ich dafür verantwortlich, den Text zu überarbeiten, anzugleichen und zu aktualisieren, wie sie es gewollt hätte? Nach reiflicher Überlegung gelangte ich zu dem Schluss, dass es wichtiger ist, Mums Stimme zu erhalten. Deshalb wurden nur minimale Veränderungen vorgenommen.
Was bedeutet, dass alles, was Sie lesen, aus Lucindas Feder stammt, aus dem Jahr 2006.
Mum war sehr stolz auf dieses Projekt. Es ist ihr einziger Kriminalroman. Trotzdem werden ihre treuen Leserinnen und Leser sofort ihre unnachahmliche Fähigkeit erkennen, die Atmosphäre eines Ortes einzufangen. Bestimmt interessiert es Sie zu erfahren, dass unsere Familie zu der Zeit, als dieser Roman entstand, in der mystisch-weiten Landschaft lebte, in der er spielt. Darüber hinaus ist die Schule, die wir, ihre Kinder, besuchten, in vielerlei Hinsicht das Vorbild für das Internat in Norfolk, dem in diesem Buch eine so wesentliche Rolle zukommt. Zum Glück kann ich beschwören, dass dort längst keine so dramatischen Dinge vor sich gingen, wie sie in dieser Geschichte beschrieben werden.
Wie zu erwarten, nehmen Geheimnisse der Vergangenheit Einfluss auf die Ereignisse der Gegenwart, und wir dürfen uns auf einige eindringliche Charakterdarstellungen freuen, zum Beispiel von Detective Inspector Jazz Hunter, die, da werden Sie mir sicher zustimmen, das Potenzial für eine eigene Serie besessen hätte.
Vielleicht in einem anderen Leben.
Harry Whittaker, 2021
PROLOG
St Stephen’s School, Norfolk Januar 2005
Als die Gestalt die Treppe zum Flur der Oberstufenschüler hinaufging – ein Labyrinth schuhschachtelgroßer Zimmer, eines pro Junge –, war lediglich das Klopfen und Gluckern der uralten Heizkörper zu hören, gusseiserne Zeugen der Vergangenheit, die sich seit fünfzig Jahren mehr oder weniger vergeblich abmühten, Fleat House und die Schüler darin zu wärmen.
Fleat House, eines der acht Wohnheime, aus denen St Stephen’s bestand, hatte seinen Namen von dem Mann, der die Schule vor hundertfünfzig Jahren geleitet hatte, der Zeit, in der die Anlage erbaut worden war. Das hässliche viktorianische Bauwerk aus rotem Klinker hatte man kurz nach dem Krieg in eine Schülerunterkunft umgewandelt.
Es handelte sich um das letzte Gebäude von St Stephen’s, das in den Genuss der dringend nötigen Sanierung kommen würde. Binnen sechs Monaten würden die Flure, Treppen, Schlafsäle und Gemeinschaftsräume von dem rissigen schwarzen Bodenlinoleum befreit werden; man würde die vergilbten Wände frisch tapezieren und magnolienweiß streichen, die veralteten Duschbereiche mit glänzenden Edelstahlarmaturen und schimmernden weißen Fliesen ausstatten. Das alles, um die Wünsche der anspruchsvollen Eltern zu befriedigen, deren Kinder in hotelähnlichem Komfort leben und arbeiten sollten, nicht in einer Bruchbude.
Vor dem Zimmer mit der Nummer sieben hielt die Gestalt einen Augenblick inne und lauschte. Da es ein Freitag war, hatten die acht Jungen dieses Stockwerks sich vermutlich abgemeldet und waren in den Pub in dem nahe gelegenen Marktflecken Foltesham gegangen, aber sicher war sicher. Als die Gestalt nichts hörte, drückte sie die Klinke herunter und trat ein.
Nachdem sie die Tür leise hinter sich geschlossen und das Licht eingeschaltet hatte, stieg ihr fast sofort der tief in den Poren des Raums eingelagerte muffige Geruch von Teenagern in die Nase: eine Mischung aus ungewaschenen Socken, Schweiß und brodelnden Hormonen, die im Lauf der Jahre noch in den hintersten Winkel von Fleat House gedrungen war.
Der Geruch weckte schmerzliche Gefühle und ließ die Gestalt schaudern, so sehr, dass sie fast über einen Haufen Unterwäsche gestolpert wäre, den jemand achtlos auf dem Boden liegen gelassen hatte. Die Gestalt nahm die beiden weißen Tabletten, die jeden Abend auf das Nachtkästchen des Jungen gelegt wurden, und tauschte sie gegen identisch aussehende aus. Dann schaltete sie das Licht wieder aus und verließ das Zimmer.
Auf der nicht weit von dem Raum entfernten Treppe erstarrte ein Junge im Pyjama, als er sich nähernde Schritte hörte. Voller Panik duckte er sich in die winzige Nische unter den Stufen und verschmolz mit den Schatten. Wenn man ihn um zehn Uhr abends außerhalb des Bettes antraf, würde man ihn bestrafen, und das würde er an diesem Tag nicht auch noch ertragen.
Er lauschte starr, mit wild pochendem Herzen, die Augen fest zugedrückt, in die Dunkelheit hinein, als könnte das helfen, und hielt den Atem an, als die Schritte sich nur wenige Zentimeter über seinem Kopf nach oben bewegten und sich Gott sei Dank entfernten. Vor Erleichterung zitternd kam er aus seinem Versteck hervor und hastete den Flur entlang zu seinem Schlafsaal. Dort schlüpfte er ins Bett und warf einen Blick auf seinen Wecker. Noch eine Stunde würde vergehen müssen, bis er sich in den Schlaf flüchten konnte. Er zog die Decke über den Kopf und ließ endlich den Tränen freien Lauf.
Etwa eine Stunde später betrat Charlie Cavendish Zimmer Nummer sieben und warf sich aufs Bett.
Mit seinen achtzehn Jahren war er an einem Freitagabend um elf wie ein Kind in diesem beschissenen Kaninchenbau eingesperrt, dachte er mürrisch.
Und musste am folgenden Morgen wegen der blöden Kirche um sieben auf sein. Die hatte er in diesem Trimester bereits zweimal verpasst, das konnte er sich kein weiteres Mal erlauben. Wegen dieser dummen Sache mit Millar war er in das Büro von Jones zitiert worden. Jones hatte Andeutungen gemacht, dass er des Internats verwiesen werden könnte, wenn er sich nicht besserte. Es ärgerte Charlie, dass er sich zusammenreißen musste. Denn ohne ordentliche Abschlussnoten und eine gute Beurteilung der Schule würde sein Vater ihm das Gap Year nicht finanzieren, das hatte er klargemacht.
Und das wäre eine verdammte Katastrophe.
Sein Vater konnte einem freien Jahr ohnehin nichts abgewinnen. Hedonismus war ihm ein Gräuel, und mit der Vorstellung, dass sein Sohn sich – vermutlich zugedröhnt – an irgendeinem thailändischen Strand in der Sonne rekelte, konnte er nichts anfangen, schon gar nicht, wenn er dafür zahlte.
Kurz vor Beginn des Trimesters hatten sie sich wegen Charlies Zukunft furchtbar gestritten. Sein Vater William Cavendish war ein Londoner Topanwalt, und man ging allgemein davon aus, dass Charlie in seine Fußstapfen treten würde. Charlie selbst hingegen hatte sich darüber bisher nicht allzu viele Gedanken gemacht.
Jetzt, da er allmählich auf die Zwanzig zuging, dämmerte ihm, was von ihm erwartet wurde – ohne Rücksicht auf seine eigenen Wünsche.
Charlie war ein Macher, ein Adrenalinjunkie. So sah er sich selbst. Er lebte gern auf der Überholspur. Der Gedanke, sein Leben gefangen in der streng hierarchischen, verstaubten Atmosphäre des Inner Temple zu verbringen, verursachte ihm Magengrimmen.
Außerdem war die Vorstellung seines Vaters von »Erfolg« völlig überholt. Heutzutage lief das anders; man konnte tun, was man wollte. Dieser ganze Respektabilitätsblödsinn war Sache seiner Elterngeneration.
Charlie wollte als DJ schönen halbnackten Frauen auf einer Tanzfläche auf Ibiza zuschauen. Ja. Das war’s schon eher! Obendrein konnte man sich als DJ eine goldene Nase verdienen.
Nicht, dass Geld für ihn jemals eine große Rolle spielen würde. Wenn sein unverheirateter siebenundfünfzigjähriger Onkel nicht urplötzlich beschloss, doch noch Kinder in die Welt zu setzen, würde Charlie das Familienanwesen mit Tausenden von Hektar Farmland erben.
Auch dafür hatte er Pläne. Er musste bloß ein paar Hektar als Bauland verkaufen, und schon hatte er verdammt noch mal ein Vermögen!
Nein, das Problem war nicht seine künftige finanzielle Lage, sondern die Tatsache, dass sein knausriger Vater ihn momentan kurzhielt.
Er war jung und wollte Spaß.
Das waren die Gedanken, die Charlie Cavendish durch den Kopf gingen, als er geistesabwesend nach den beiden Tabletten griff, die er seit seinem fünften Lebensjahr jeden Abend schluckte, und das Glas Wasser nahm, das Matron Smith, die für Fleat House zuständige Erzieherin, für ihn vorbereitet hatte.
Er legte die Pillen auf die Zunge und trank einen großen Schluck Wasser, um sie hinunterzuspülen, bevor er das Glas zurück aufs Nachtkästchen stellte.
Eine volle Minute lang geschah nichts, und Charlie grübelte seufzend weiter über die Ungerechtigkeit des Lebens nach. Dann begann sein Körper fast unmerklich zu zittern.
»Was zum Teufel …?«
Das Zittern wurde heftiger, unkontrollierbar, und plötzlich spürte Charlie, wie sich sein Hals zusammenzog. Nach Luft schnappend und ohne zu begreifen, was vor sich ging, gelang es ihm, die wenigen Schritte zur Tür zu wanken. Er streckte die Hand nach der Klinke aus, doch in seiner Panik erwischte er sie nicht richtig, und er schaffte es nicht, sie herunterzudrücken, bevor er halb bewusstlos, eine Hand am Hals, Schaum vor dem Mund, in sich zusammensank. Aufgrund des Sauerstoffmangels und des tödlichen Gifts versagten seine lebenswichtigen Organe eines nach dem anderen. Schließlich entleerte sich sein Darm, und Schritt für Schritt hörte der junge Mann, der einmal Charlie Cavendish gewesen war, auf zu existieren.
1
Robert Jones, der Rektor von St Stephen’s, blickte, die Hände in den Hosentaschen – eine Angewohnheit, derentwegen er seine Schützlinge regelmäßig rügte –, zum Fenster seines Büros hinaus.
Unten sah er Schüler, die die Chapel Lawn, die Rasenfläche vor der Schulkapelle, auf dem Weg zu und von den Unterrichtsstunden überquerten. Seine Hände waren schweißnass, sein Herz klopfte seit dem Unfall noch immer wie wild vom Adrenalin.
Er ging vom Fenster weg und setzte sich hinter seinen Schreibtisch, auf dem ein stetig wachsender Berg unbearbeiteter Papiere sowie eine länger werdende Liste mit unbeantworteten telefonischen Nachrichten lagen.
Robert Jones zog ein Taschentuch hervor, wischte sich damit über den kahlen Kopf und seufzte tief.
Es gab jede Menge potenzieller Albträume für einen Schulleiter, in dessen Obhut sich Hunderte von Jungen und Mädchen im Teenageralter befanden: Drogen, Schüler, die andere schikanierten, und in diesen Zeiten gemischtgeschlechtlicher Internate natürlich das nicht zu bändigende Phantom Sex.
Während seiner vierzehn Jahre als Leiter von St Stephen’s hatte Jones es in unterschiedlichster Form mit allen zu tun gehabt.
Doch jene Krisen waren nichts verglichen mit dem, was sich vergangenen Freitag ereignet hatte. Dies war der schlimmste Albtraum eines jeden Rektors: der Tod eines seiner Schüler.
Wenn es eine sichere Methode gab, den Ruf einer Schule zu ruinieren, dann diese. Wie genau der Junge gestorben war, spielte dabei fast keine Rolle. Robert Jones stellte sich Horden von Eltern vor, die auf der Suche nach einem geeigneten Internat St Stephen’s von ihrer Liste strichen.
Doch Jones schöpfte Trost aus der mehr als vierhundertjährigen Existenz von St Stephen’s. Bei der Sichtung der Schulaufzeichnungen hatte er festgestellt, dass solche Tragödien schon früher passiert waren. Möglicherweise würde die Zahl der Schüler sich vorübergehend reduzieren, aber im Lauf der Zeit würde das, was vergangenen Freitag geschehen war, in Vergessenheit geraten.
Der letzte Tod eines Schuljungen hatte sich 1979 ereignet. Besagter Junge war tot im Keller aufgefunden worden. Er hatte sich mit einem Strick, den er an einem Haken an der Decke befestigte, erhängt. Dieser Vorfall war mittlerweile Schullegende. Die Kinder erzählten sich gern, dass der Geist des Jungen Fleat House heimsuche.
Der kleine Rory Millar hatte selbst wie ein Gespenst ausgesehen, als man ihn nach einer ganzen Nacht aus dem Keller befreite, gegen dessen Tür er gehämmert hatte.
Charlie Cavendish, zweifellos der Übeltäter, hatte wie üblich alles geleugnet und es – schlimmer noch – sogar amüsant gefunden … Robert Jones schauderte. Er hätte sich gewünscht, über den Verlust seines jungen Lebens trauern zu können, musste jedoch feststellen, dass ihm das nicht gelingen wollte.
Dieser Junge hatte von Anfang an nur Ärger gemacht. Und seines Todes wegen war seine eigene Zukunft als Rektor nun ungewiss. Er war sechsundfünfzig und hatte sich darauf gefreut, in vier Jahren bei vollen Altersbezügen in Pension gehen zu können. Wenn er nun dazu gezwungen wäre, seinen Abschied zu nehmen, konnte er kaum auf eine andere Anstellung irgendwo sonst hoffen.
Bei der Krisensitzung des Schulbeirats am vergangenen Abend hatte er seinen Rücktritt angeboten. Doch der Beirat hatte ihm den Rücken gestärkt.
Cavendishs Tod war ein Unfall gewesen … hatte natürliche Ursachen gehabt. Der Junge war an einem epileptischen Anfall gestorben.
Das war Jones’ einziger Hoffnungsschimmer. Solange die amtliche Untersuchung eine natürliche Todesursache ergab und es gelang, die Berichte in den Medien auf das Wesentlichste zu reduzieren, ließ sich der Schaden möglicherweise begrenzen.
Aber solange das nicht der Fall war, hingen sein Ruf und seine Zukunft am seidenen Faden. Man hatte versprochen, ihn am Vormittag anzurufen.
Da schrillte das Telefon auf seinem Schreibtisch. Er schaltete laut. »Ja, Jenny?«
»Die Rechtsmedizin für Sie.«
»Stellen Sie durch.«
»Mr Jones?«
»Am Apparat.«
»Malcolm Glenister von der örtlichen Rechtsmedizin. Ich wollte die Ergebnisse der Obduktion mit Ihnen besprechen, die gestern an Charlie Cavendish durchgeführt wurde.«
Jones schluckte. »Schießen Sie los.«
»Der Pathologe ist zu dem Schluss gekommen, dass die Todesursache kein epileptischer Anfall, sondern ein anaphylaktischer Schock war.«
»Verstehe.« Der Rektor schluckte noch einmal und räusperte sich. »Wodurch herbeigeführt?«
»Wie Ihnen sicher bekannt ist, steht in seiner Krankenakte, dass er hochallergisch auf Aspirin war. In seinem Blut befanden sich sechshundert Milligramm, was zwei rezeptfrei erhältlichen Tabletten entspricht.«
Jones’ Mund war so trocken, dass er kein Wort herausbrachte.
»Abgesehen von Epilim, das Charlie täglich gegen die Epilepsie einnahm, und einem geringen Alkoholspiegel konnte der Pathologe nichts feststellen. Der Junge war kerngesund.«
Robert Jones fand seine Stimme wieder. »Hätte er überleben können, wäre er früher entdeckt worden?«
»Wenn man umgehend eine Behandlung eingeleitet hätte: ja, vermutlich. Dass er in den wenigen Minuten, bevor er das Bewusstsein verlor, noch um Hilfe rufen konnte, ist höchst unwahrscheinlich. Weswegen er erst am nächsten Morgen entdeckt wurde.«
Jones atmete erleichtert auf. »Und was geschieht jetzt?«, erkundigte er sich.
»Uns ist nun klar, wie er starb. Erhebt sich die Frage, warum. Seine Eltern sagen, Charlie wusste um seine starke Aspirin-Allergie. Von Kindesbeinen an.«
»Er muss die Tabletten versehentlich geschluckt haben. Eine andere Erklärung gibt es nicht, oder?«
»Ohne Kenntnis sämtlicher Fakten steht es mir nicht zu, Spekulationen anzustellen, doch da wären in der Tat ein oder zwei ungeklärte Fragen. Ich fürchte, es wird polizeiliche Ermittlungen geben.«
Der Schulleiter spürte, wie das Blut aus seinem Gesicht wich. »Aha. Wie wird sich das auf den Tagesablauf der Schule auswirken?«
»Das müssen Sie mit dem zuständigen Beamten besprechen.«
»Wann kommt die Polizei?«
»Schon bald, denke ich. Sie wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen. Auf Wiederhören.«
»Auf Wiederhören.«
Als Jones den Lautsprecher ausschaltete, war ihm schwindelig. Er atmete drei- oder viermal tief durch.
Polizeiliche Ermittlungen … Er schüttelte den Kopf. Das war die schlimmste denkbare Nachricht.
Dann fiel es ihm wie Schuppen von den Augen: In den vergangenen Tagen hatte er nur an den Ruf der Schule gedacht. Wenn sich die Polizei einschaltete, bezweifelte der Mann von der Rechtsmedizin offenbar, dass Cavendish das Aspirin versehentlich genommen hatte.
»O Gott.« Glaubte er am Ende, es handle sich um Mord?
Wieder schüttelte Jones den Kopf. Nein, wahrscheinlich war es eine reine Formalität. Wenn er es recht überlegte: Charlies Vater besaß mit Sicherheit den nötigen Einfluss, ein solches Vorgehen zu verlangen. Der Rektor ließ die vielen Male vor seinem geistigen Auge Revue passieren, die Charlie Cavendish vor seinem Schreibtisch gestanden und ihn ungerührt angeschaut hatte, wenn er getadelt wurde. Es lief stets nach dem gleichen Muster ab: Jones rief ihm ins Gedächtnis, dass die alte Sitte der Schüler, die Jüngeren wie Bedienstete zu behandeln, schon Jahre nicht mehr praktiziert werde und er sie nicht durch Schikanen gefügig machen dürfe. Charlie nahm seine Strafe hin und machte anschließend einfach weiter wie bisher, als wäre nichts gewesen.
Charlie hatte ursprünglich nach Eton gewollt, war jedoch durch die Aufnahmeprüfung gefallen. Von dem Tag an, als er in St Stephen’s ankam, hatte er allen deutlich gezeigt, dass er die Schule, ihren Leiter und seine Mitschüler als unter seiner Würde erachtete. Seine Arroganz war atemberaubend gewesen.
Auf der Suche nach einer Eingebung betrachtete Robert Jones das Gemälde von Lord Grenville Dudley, dem Mann, der St Stephen’s im sechzehnten Jahrhundert gegründet hatte, warf dann einen Blick auf seine Uhr und merkte, dass es fast Mittag war. Er drückte die Taste der Gegensprechanlage.
»Ja, Mr Jones?«
»Könnten Sie bitte hereinkommen, Jenny?«
Wenige Sekunden später trat Jenny Colman ein, deren Anblick Jones beruhigte. Sie arbeitete seit dreißig Jahren an der Schule, anfangs noch an der Essensausgabe, dann, nach einem Sekretärinnenlehrgang, als Verwaltungsassistentin des Schatzmeisters. Als Jones vierzehn Jahre zuvor die Stelle in St Stephen’s angetreten und festgestellt hatte, dass seine Sekretärin kurz vor der Pensionierung stand, war seine Wahl für ihre Nachfolge auf Jenny gefallen.
Sie war bei Weitem nicht die fähigste Kandidatin gewesen, doch Jones gefielen ihre Ruhe und Unerschütterlichkeit, und ihr Wissen über das Internat war unbezahlbar gewesen in der Zeit, in der er sich als ihr neuer Rektor noch orientieren musste.
Alle liebten Jenny, von den Reinigungskräften bis zu den Leuten vom Beirat. Sie kannte sämtliche Kinder beim Namen, und ihre Loyalität der Schule gegenüber stand außer Frage. Jenny war drei Jahre älter als Robert Jones und somit dem Ruhestand näher als dieser. Er fragte sich oft, wie er ohne sie zurechtkommen würde. Doch nun, realisierte er niedergeschlagen, würde er vermutlich vor ihr gehen.
Jenny hatte einer Hüftoperation wegen das gesamte letzte Trimester nicht gearbeitet. Ihre Vertretung war kompetent gewesen und höchstwahrscheinlich in puncto Bürotechnologie deutlich geschickter, aber Jones hatte Jennys Mütterlichkeit gefehlt, und er war froh, sie wiederzuhaben. Block und Stift gezückt setzte sich die rundliche Jenny mit besorgtem Blick auf den Stuhl vor seinem Schreibtisch.
»Sie haben eine komische Gesichtsfarbe, Mr Jones. Soll ich Ihnen ein Glas Wasser bringen?«, erkundigte sie sich in starkem Norfolk-Tonfall.
Robert Jones hätte gern den Kopf an Jennys üppigen Busen geschmiegt, ihre mütterlichen Arme um sich gespürt und sich von ihr trösten lassen.
Er schob den Gedanken beiseite. »Schlechte Nachrichten aus der Rechtsmedizin. Es wird polizeiliche Ermittlungen geben.«
Jenny hob die buschigen Augenbrauen. »Nein! Das kann nicht sein.«
»Wollen wir hoffen, dass es schnell geht. Wenn die Polizei hier herumschnüffelt, ist das hochgradig störend und enervierend.«
»Stimmt«, pflichtete Jenny ihm bei. »Meinen Sie, Sie werden uns alle befragen?«
»Keine Ahnung, aber natürlich müssen wir alle informieren. Gleich wird mich ein Beamter anrufen. Sobald ich mit ihm gesprochen habe, weiß ich mehr. Es wird das Beste sein, für morgen früh in der Aula eine Schulversammlung mit der gesamten Belegschaft, vom Küchenpersonal aufwärts, einzuberufen. Könnten Sie das für mich organisieren?«
»Selbstverständlich, Mr Jones. Das erledige ich gleich.«
»Danke, Jenny.«
Sie stand auf. »Haben Sie sich mit David Millar in Verbindung gesetzt? Er hat heute Vormittag schon dreimal angerufen.«
Einen labilen Alkoholikervater, der seines Sohnes wegen völlig durchdrehte, konnte er gerade wirklich nicht gebrauchen.
»Nein.«
»Er hat gestern Abend mehrfach Nachrichten hinterlassen, etwas von wegen Rory hätte am Telefon verstört geklungen.«
»Ich weiß, das haben Sie mir bereits mitgeteilt. Er wird warten müssen. Im Moment habe ich Wichtigeres zu tun.«
»Wie wär’s mit einer Tasse Tee? Sie sehen aus, als würde ein bisschen Zucker Ihren Nerven guttun. Hilft gegen Schockzustände.«
»Danke, gern.«
Da klingelte das Telefon auf seinem Schreibtisch. Jenny hob ab.
»Büro des Schulleiters.«
Sie lauschte kurz, legte die Hand über das Mundstück des Hörers und flüsterte: »Ein Commissioner Norton für Sie.«
»Danke.« Jones nahm den Hörer und wartete, bis Jenny aus dem Zimmer war. »Sie sprechen mit dem Schulleiter.«
»Commissioner Norton vom Criminal Investigation Department. Vermutlich kennen Sie den Grund meines Anrufs.«
»Ja.«
»Eine kurze Vorwarnung: Ich schicke Ihnen zwei Beamte vorbei, die zum Tod von Charlie Cavendish ermitteln sollen.«
»Ja, danke.« Etwas Besseres fiel Robert Jones nicht ein.
»Sie kommen morgen früh zu Ihnen.«
»Woher?«
»Aus London.«
»London?«
»Ja. Der Fall ist uns übertragen worden. Wir werden mit der North Norfolk Constabulary zusammenarbeiten.«
»Sie müssen Ihre Arbeit erledigen, Commissioner, das ist mir klar, aber ich habe Sorge, dass der Internatsalltag empfindlich gestört wird, ganz zu schweigen von der Panik, die möglicherweise ausbricht.«
»Meine Kollegen haben Erfahrung mit solchen Fällen. Sie werden sensibel agieren und Sie beraten, wie Sie am besten mit Personal und Schülern umgehen.«
»Ich wollte morgen eine Schulversammlung einberufen.«
»Großartige Idee. Das gibt meinem Team Gelegenheit, die Leute in der Schule zu instruieren und sie im Bedarfsfall hinsichtlich unserer Anwesenheit zu beruhigen.«
»Gut, dann mache ich das.«
»Wunderbar.«
»Würden Sie mir die Namen der Beamten nennen, die Sie zu uns schicken?«
Der Commissioner schwieg kurz, bevor er antwortete: »Da bin ich mir noch nicht sicher. Ich rufe Sie später wieder an. Danke, dass Sie mir Ihre Zeit geopfert haben.«
»Danke Ihnen, Commissioner. Auf Wiederhören.«
Danke wofür?, fragte sich Robert Jones, als er auflegte. Er stützte den Kopf in die Hände. »O Gott«, murmelte er.
Die Leute von der Polizei würden in den Familien sämtlicher Schüler und Angestellten herumstochern … in ihrem Privatleben … Man konnte nicht wissen, worauf sie dabei stießen. Möglicherweise wurde er selbst zum Verdächtigen …
Seit drei Jahren war die Zahl der Neuanmeldungen am Internat rückläufig. Heutzutage herrschte harter Wettbewerb. Die Sache jetzt war das Letzte, was St Stephen’s brauchte. Und, egoistischer, dachte er, als er den Hörer wieder in die Hand nahm, um den Vorsitzenden des Schulbeirats anzurufen, das Letzte was er, Robert Jones, brauchte.
2
Jazmine Hunter-Coughlin – Jazz für ihre Freunde, Detective Inspector Hunter für ihre früheren Arbeitskollegen – zog die Vorhänge zurück und schaute durch das kleine Fenster ihres Schlafzimmers hinaus. Allzu viel konnte sie nicht erkennen, weil die Scheibe angelaufen war und die Landschaft der Salthouse Marshes sowie die trübe Nordsee dahinter verwaschen erscheinen ließ. Ohne nachzudenken, schrieb sie ihre Initialen auf das Glas, wie sie es als Kind getan hatte, betrachtete das »JHC« kurz und wischte das »C« mit einer entschlossenen Bewegung weg.
Nun fiel ihr Blick auf die zahllosen Kisten, die sich im Zimmer stapelten. Sie war erst drei Tage zuvor eingezogen und hatte abgesehen von einigen wesentlichen Dingen wie ihrem Pyjama, dem Wasserkessel und der Seife noch nichts herausgeholt.
Dieses winzige Cottage war das exakte Gegenteil des minimalistischen Docklands-Apartments mit den weißen Wänden, das sie mit ihrem Ex-Mann bewohnt hatte. Genau das gefiel ihr. Obwohl sie eigentlich fast schon krankhaft ordentlich war, packte sie nicht aus, weil das Häuschen gründlich renoviert werden musste. Der Installateur sollte in einer Woche die Zentralheizung einbauen, der Schreiner würde morgen vorbeischauen, um die Küche auszumessen, und sie hatte auf die Mailbox von zwei Malern aus der Gegend gesprochen.
Jazz hoffte, dass Marsh Cottage in einigen Monaten innen genauso gemütlich wirken würde, wie es von außen den Anschein hatte.
Da es heute freundlicher war als die Tage davor, beschloss Jazz, eine morgendliche Wanderung übers Marschland bis zum Meer zu unternehmen. Sie schlüpfte in Stiefel und ihre Barbour-Jacke, öffnete die Haustür und trat hinaus, wo sie die erfrischende Seeluft einatmete.
Ihr Cottage befand sich an der Straße, die den Ort von Marschen und Meer abtrennte. Im Sommer wimmelte es hier von Touristen unterwegs zu den Stränden und den Küstenorten von North Norfolk, doch an diesem Tag im Januar war die Gegend menschenleer.
Während sie den Ausblick genoss, spürte Jazz ein Gefühl der Zufriedenheit in sich aufsteigen. Die flache, baumlose Landschaft wirkte düster und abweisend, aber Jazz liebte ihre Rauheit. Es war nichts Hübsches daran, nichts, was die Monotonie des Horizonts aufgebrochen hätte, der sich zu beiden Seiten kilometerweit erstreckte. Die schlichte Eleganz der gekrümmten Küstenlinie und die atemberaubende Weite sprachen ihr bodenständiges Wesen an.
Beim Überqueren der Straße nahm sie aus den Augenwinkeln einen Mann wahr, der in etwa fünfzig Metern Entfernung aus dem Postamt kam. Sie ging weiter, trat auf grobes Sumpfgras und lauschte dem tröstlichen Quatschen des Wassers unter ihren Stiefeln, als sie zu hören meinte, wie jemand ihren Namen rief.
Jazz tat das Geräusch als das Kreischen der Brachvögel ab, die sich rechts von ihr in einem Kreis versammelten, und stieg weiter die Anhöhe hinauf. Sie war der einzige Schutz, den das Cottage vor Überflutung hatte – ein kritischer Punkt bei den Hypothekenverhandlungen.
»Jazmine! DI Hunter! Bitte warten Sie!«
Diesmal bestand kein Zweifel. Sie blieb stehen und drehte sich zur Straße um.
Himmel! Was macht der denn hier?, dachte Jazz entsetzt und ging einige Schritte zurück. Ein paar Meter von ihm entfernt hielt sie inne und begrüßte ihn mit einem kurzen Lächeln, das ihre Augen nicht erreichte.
»Hallo, DI Hunter.«
»Was führt Sie hierher, Sir?«
»Ich freue mich auch, Sie zu sehen«, erwiderte Norton und streckte ihr die Hand hin.
»Entschuldigung.« Sie trat zu ihm und ergriff sie. »Ich habe Sie nicht erwartet, das ist alles.«
»Schon gut. Und, bitten Sie mich nun hinein, bevor ich in diesem dünnen Anzug erfriere?«
»Ja, natürlich. Kommen Sie.«
Sobald sie drinnen waren, bot Jazz Norton einen Platz auf dem Sofa an und schürte das Feuer. Danach kochte sie Kaffee und setzte sich auf einen Holzstuhl.
»Hübsch haben Sie’s hier«, bemerkte er. »Gemütlich.«
»Danke. Mir gefällt’s auch.«
Eine Weile herrschte peinliches Schweigen.
»Nun, Jazmine, wie geht es Ihnen?«
Es war merkwürdig zu hören, wie Norton sie mit Vornamen ansprach. Das illustrierte, wie sehr sich ihr Leben in den vergangenen Monaten verändert hatte. Aber es fühlte sich auch ein wenig herablassend an.
»Gut, danke«, antwortete sie.
»Sie sehen … besser aus. Haben ein bisschen Farbe gekriegt seit unserer letzten Begegnung.«
»Ja, in Italien ist es warm, sogar im Winter.« Wieder Schweigen. Wann würde er endlich zur Sache kommen? »Woher wussten Sie, dass ich hier bin?«, erkundigte sie sich schließlich, weil sie nicht bereit war, ihm auf die Sprünge zu helfen. »Ich bin erst vor drei Tagen in das Cottage eingezogen.«
Norton schmunzelte. »Es wundert mich, dass Sie mich das fragen müssen. Sie haben doch für Scotland Yard gearbeitet. Aber sogar unser Computer hat lediglich ›Salthouse Road neunundzwanzig‹ ausgespuckt. Als ich in dieser Straße keine Hausnummern an den Türen finden konnte, habe ich mein Glück im Postamt versucht.«
»Aha«, meinte Jazz.
»Warum hier?«
»Vermutlich weil ich als Kind die Ferien in der Gegend verbracht habe. Ich liebe Norfolk. Ist genauso gut oder schlecht wie anderswo. Außerdem leben meine Eltern in der Nähe.«
»Ja, natürlich.«
Erneut Schweigen.
Dann wurde Norton, der ihre Ungeduld zu spüren schien, plötzlich geschäftsmäßig. »Sie wollen also wissen, warum ich an einem frostigen Januarmorgen mehr als hundertfünfzig Kilometer weit gefahren bin, um Sie zu sehen. Ich habe probiert, Sie über Handy zu erreichen, aber das haben Sie anscheinend abgemeldet.«
»Als ich nach Italien aufgebrochen bin, habe ich es hiergelassen. Und als ich wieder da war, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich es eigentlich nicht brauche.«
Norton nickte. »Nützt in North Norfolk ohnehin nicht viel. Mit meinem habe ich seit Norwich keinen Empfang mehr. Egal. Ich bin da, weil ich möchte, dass Sie wieder für uns arbeiten.«
Jazz ließ sich Zeit mit der Antwort. »Ich dachte, ich hätte mich klar genug ausgedrückt«, sagte sie schließlich leise.
»Das haben Sie. Doch das ist sieben Monate her. Sie hatten über ein halbes Jahr frei, haben sich scheiden lassen, eine neue Bleibe gefunden …«
»Die ich auch nicht zu verlassen beabsichtige, um zurück nach London zu gehen«, fiel Jazz ihm ins Wort.
»Das habe ich mir schon gedacht.« Norton wirkte unbeeindruckt.
»Außerdem: Wieso sollte ich? Was bringt Sie auf die Idee, dass ich zurück möchte?«
»Jazmine, wären Sie so gut, mir zuzuhören?« Plötzlich klang seine Stimme hart.
»Sorry, Sir. Aber Sie werden verstehen, dass ich nicht allzu erpicht darauf bin, mich mit der Vergangenheit zu beschäftigen.« Sie klang feindselig, das merkte Jazz, doch sie konnte nicht anders.
»Ja, das tue ich …« Er blickte sie an. »Allerdings würde mich interessieren, warum Sie so wütend auf mich sind. Ich habe Sie nicht betrogen.«
»Das war unter die Gürtellinie, Sir.«
»Tja …« Norton betrachtete seine äußerst gepflegten Fingernägel. »Vielleicht hatten Sie ja das Gefühl, ich hätte es getan.«
»Sir, mir ist klar, dass Sie im Hinblick auf meinen Mann nichts machen konnten. Zu dem Zeitpunkt habe ich mich ohnehin schon keinen Illusionen mehr hingegeben und …«
»Das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte.« Norton nippte an seinem Kaffee. »Jazmine, haben Sie eine Ahnung, wie teuer es ist, DIs anzuwerben und auszubilden?«
»Nein.«
»Wenn ich Ihnen verrate, dass Sie sich für das Geld wahrscheinlich ein weiteres Cottage leisten könnten …«
»Wollen Sie mir ein schlechtes Gewissen machen?«
»Wenn das seinen Zweck erfüllt: ja.« Norton rang sich ein halbherziges Lächeln ab. »Sie haben mir keine Gelegenheit gegeben, mit ihnen noch mal über alles zu sprechen. In der einen Woche saßen Sie noch an Ihrem Schreibtisch, in der nächsten hatten Sie sich schon nach Italien abgesetzt.«
»Mir ist nichts anderes übrig geblieben.«
»Das sagen Sie. Ich dachte, die gute Arbeitsbeziehung, die wir aufgebaut hatten, würde Sie dazu bringen, mit mir zu reden. Wenn wir uns einig gewesen wären, dass Ihre Kündigung die einzige Alternative ist, hätte ich Sie nicht daran zu hindern versucht. Aber Sie sind einfach … abgehauen, ohne ein Wort, ohne Abschlussbericht!«
»Und deswegen sind Sie jetzt hier? Wegen dem Abschlussbericht?«
Norton seufzte frustriert. »Bitte. Ich bemühe mich wirklich. Sie führen sich auf wie ein trotziger Teenager. Juristisch gesehen sind Sie nach wie vor bei uns angestellt.« Er zog einen Umschlag aus seiner inneren Brusttasche und schob ihn ihr hin.
»Was ist das?« Sie runzelte die Stirn. In dem Kuvert befanden sich Gehaltszettel, Mitteilungen ihr gemeinsames Konto mit Patrick betreffend sowie die monatlichen Auszüge, die weiterhin an ihre alte Adresse geschickt worden waren und sie natürlich nicht erreicht hatten. Dazu das Kündigungsschreiben, das sie hastig am Flughafen hingekritzelt und aufgegeben hatte, bevor sie ins Flugzeug nach Pisa gestiegen war.
»Kein sonderlich … professioneller Abgang, nicht wahr?«
»Nein, eher nicht. Aber vermutlich spielt das inzwischen keine Rolle mehr.« Jazz steckte den Brief zurück in den Umschlag und reichte ihn Norton. »Hiermit ist es offiziell. Ich kündige. Ist es so in Ordnung?«
»Wenn Sie es so wollen. Jazmine, ich kann Sie verstehen. Sie kamen sich im Stich gelassen vor, waren demoralisiert, und Ihr Privatleben lag in Trümmern. Wahrscheinlich brauchten Sie Zeit zum Nachdenken …«
»So könnte man es zusammenfassen, Sir.«
»Und weil Sie wütend und verbittert waren, sind Sie Ihrem Instinkt gefolgt, der Ihnen sagte, Sie sollen fliehen. Doch dieser Instinkt hat Sie auch blind gemacht. Begreifen Sie das denn nicht?«
Jazz schwieg.
»Und …«, fuhr Norton fort, »… weil Sie blind waren, haben Sie eine spontane Entscheidung getroffen, die nicht nur eine vielversprechende Karriere ruiniert, sondern mir eine meiner besten Kräfte geraubt hat. Ich bin kein Idiot. Mir war klar, was lief. Das mit Ihrem Mann herauszufinden – es noch dazu praktisch als Letzte zu erfahren – muss schrecklich gewesen sein.«
Wieder Schweigen.
»Es läuft immer aufs Gleiche hinaus: Beziehungen unter Kollegen sind gefährlich, besonders in unserem Metier. Ich habe DCI Coughlin gewarnt, als er mir mitteilte, dass Sie beide heiraten wollen«, erklärte Norton.
Jazz hob den Blick. »Ach. Patrick hat behauptet, wir hätten Ihren Segen.«
»Ich habe vorgeschlagen, dass einer von Ihnen sich in eine andere Abteilung versetzen lässt, damit Sie sich wenigstens nicht in die Quere kommen. Er hat mich angefleht, Sie zu lassen, wo Sie waren. Da ich Sie nicht beide verlieren wollte, habe ich es probiert, wider besseres Wissen, wenn ich das hinzufügen darf.«
»Äh, Sir, haben Sie gerade ›DCI‹ gesagt?«
»Ja. Ihr Ex-Mann ist kürzlich zum Detective Chief Inspector befördert worden.«
»Machen Sie sich nicht die Mühe, ihm meine Glückwünsche zu überbringen.«
»Keine Sorge, das tue ich nicht.«
Wie fehl am Platz Norton doch in seinem Savile-Row-Anzug wirkte, die langen Beine auf dem niedrigen Sofa bis fast zur Brust hochgedrückt, dachte Jazz.
»Wussten Sie Bescheid, Sir? Ich meine über die Sache mit Patrick und … ihr?«
»Ich hatte Gerüchte gehört, konnte aber nichts tun. Falls Sie das tröstet: Sie hat sich ein paar Wochen, nachdem Sie weg waren, ins Polizeirevier von Paddington Green versetzen lassen. Ihr war klar, dass sie Ihnen nicht das Wasser reichen kann. Ihre Kollegen haben ihr die kalte Schulter gezeigt. Sie waren sehr beliebt, wissen Sie? Sie fehlen allen.«
Norton lächelte breit; dabei kamen kräftige weiße Zähne zum Vorschein. Jazz konnte nicht umhin zu denken, dass das dichte schwarze Haar mit den grau melierten Schläfen oder die Lesebrille, die auf seiner Nasenspitze saß, kurzum, das Alter ihn irgendwie würdevoll erscheinen ließ.
»Schön zu wissen. Egal. Was Patrick und seine Lieblings-DC jetzt treiben, ist ihre Sache. Das interessiert mich nicht mehr. Allerdings sollten Sie sie warnen, dass sie beim ersten Anzeichen von beruflicher Rivalität ein Messer in den Rücken bekommt«, erklärte Jazz.
»Ja, das glaube ich auch. Ihr Ex ist ein begabter Ermittler, nur leider hemmungslos ehrgeizig. Das Einzige, womit er nicht fertigwurde, war eine Ehefrau, die mehr Potenzial besitzt als er. Er hat Sie permanent niedergemacht, doch weil Sie nie zu mir gekommen sind, konnte ich nichts dagegen unternehmen.«
»Ich befand mich in einer heiklen Situation. Schließlich war er mein Mann.«
»Tja, solange er es schafft, den Reißverschluss seiner Hose geschlossen zu halten, kriegt er am Ende, was er will, denke ich.«
»Meinetwegen kann er, wenn er möchte, die gesamte Abteilung bumsen. Mir ist das egal.«
»Genau«, meinte Norton. »Soll ich diesen Brief wirklich wieder an mich nehmen? Dadurch wird es offiziell, das ist Ihnen schon klar, oder?« Er wedelte mit dem Umschlag vor ihrer Nase herum.
»Ja.«
»Okay, DI Hunter«, sagte Norton, plötzlich wieder förmlich, »nachdem ich Gelegenheit hatte, die Sache mit Ihnen zu besprechen, weiß ich, dass Sie entschlossen sind, die Polizei zu verlassen. Und ich kehre mit eingezogenem Schwanz nach London zurück, ohne die anderen Optionen zu erwähnen, die ich im Hinterkopf hatte.«
Die Vorstellung von Norton mit eingezogenem Schwanz ließ Jazz schmunzeln. »Na schön, sagen Sie’s mir, wenn Sie schon eigens deswegen hergekommen sind.«
»Ob Sie’s glauben oder nicht: Es gibt noch andere CID-Abteilungen. Ich hätte Ihnen möglicherweise vorgeschlagen, sich in eine von denen versetzen zu lassen.«
»Vielleicht in die von Paddington Green? Dann könnte ich mich über kuschelige Tête-à-têtes mit der Geliebten meines Ex-Mannes freuen.«
»Diese kindische Bemerkung ignoriere ich mal. Aber das ist eine elegante Überleitung zu dem, was ich Sie fragen möchte: Haben Sie wegen der Sache mit Patrick die Kündigung eingereicht? Oder weil Sie nicht länger bei der Polizei sein wollten?«
»Beides«, antwortete Jazz ehrlich.
»Gut, lassen Sie es mich anders ausdrücken: Sie sind vierunddreißig Jahre alt, eine für teures Geld ausgebildete CID-Beamtin und leben wie eine alte Jungfer im Nirgendwo von Norfolk. Was um Himmels willen möchten Sie hier denn machen?«
»Malen.«
Norton hob erstaunt die Augenbrauen. »Malen? Aha. Als Beruf?«
»Wenn ich nicht zur Polizei gegangen wäre, hätte ich nach meinem Abschluss in Cambridge vorgehabt, Kunst am Royal College of Art zu studieren. Einen Platz fürs Grundstudium hatte ich bereits.«
»Tatsächlich? Vielleicht haben Sie deshalb einen so guten Blick fürs Detail.«
»Mag sein. Jedenfalls ist das der Plan. Ich wandle das Nebengebäude in ein Atelier um. Vom Verkauf unserer alten Wohnung habe ich genug Geld übrig, um mich eine Weile über Wasser halten zu können. Außerdem findet ein Kurs an der University of East Anglia statt, für den ich mich möglicherweise nächstes Jahr bewerben werde.«
»Ich muss zugeben: Diese Gegend ist nicht der schlechteste Ort, um Ihre Kreativität wiederzuentdecken«, pflichtete Norton ihr bei.
»Betonung auf wiederentdecken, Sir. Die Polizei hat mich komplett vereinnahmt. Ich habe die Person, die ich mal war, völlig aus dem Blick verloren.«
»Hmm. Aber Sie scheinen sie wiedergefunden zu haben. Soweit ich das beurteilen kann, ist Ihr Kampfgeist von Neuem erwacht.«
»Ja.«
Wieder wurde er ernst. »Wie lange wollen Sie noch weglaufen? Meiner Ansicht nach war es nicht die Polizei, die Sie auslaugte, sondern ein Mann, der Sie und Ihr Selbstvertrauen permanent untergraben hat. Ich habe Sie beobachtet, Jazmine. Sie brauchen das Adrenalin. Sie sind eine ausgezeichnete Ermittlerin. Ich bin übrigens nicht der Einzige, der das findet.«
»Das ist … nett von Ihnen, Sir.«
»Ich befasse mich mit Fakten, nicht mit Nettigkeiten. Es macht mich wütend zu sehen, wie jemand mit Ihren Fähigkeiten das Handtuch wirft, einfach deshalb, weil es mit der Ehe nicht geklappt hat. So viele Jahre haben Sie gegen den Chauvinismus der Männer angekämpft. Wollen Sie wirklich Patrick den Sieg überlassen?«
Jazz musterte schweigend den Teppich.
»Kommen wir zum Punkt«, meinte Norton. »Was, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ich nur ein paar Kilometer von hier entfernt einen Fall für Sie habe?«
»Ein Fall in Norfolk? Wie das?«
»Im örtlichen Internat außerhalb von Foltesham wurde letzten Samstagmorgen ein Schüler tot in seinem Zimmer aufgefunden. Man hat sich an mich gewandt, weil er der Sohn eines Anwalts war, dem es soeben gelungen ist, die Auslieferung zweier bekannter Terroristen ins Vereinigte Königreich durchzusetzen. Ich soll Leute herschicken, um sicherzustellen, dass keine Fremdeinwirkung im Spiel war.«
Norton bemerkte das kurze Aufflackern in Jazmines klaren grünen Augen.
»Die Bitte kam vom Vater?«
»Nein, der Commissioner hat mich angerufen. Wie Sie wissen, beschäftigt sich Scotland Yard normalerweise nicht mit so etwas, aber …«
»… es ist immer gut, Freunde an hoher Stelle zu haben«, beendete Jazz belustigt den Satz für ihn.
»Genau.«
»Wie ist der Junge gestorben?«
»Er war Epileptiker. Die Sanitäter sagen, alles habe auf einen Anfall hingedeutet. Sein Vater jedoch hat zurecht auf einer Obduktion bestanden. Heute Morgen hat sich die Rechtsmedizin mit mir in Verbindung gesetzt. Sieht ganz so aus, als würde mehr dahinterstecken.«
»Und zwar?«
»Das kann ich Ihnen erst sagen, wenn Sie mir verraten, ob Sie an dem Fall interessiert sind.«
Sie wussten beide, dass dem so war.
»Möglich, solange ich rechtzeitig wieder daheim bin, um die nächste Mona Lisa zu malen«, antwortete Jazz nonchalant.
»Ich schicke Ihnen DS Miles. Der soll Ihnen zur Hand gehen.« Nortons Augen blitzten.
»Geben Sie mir einen Tag Bedenkzeit, Sir?«
»Das geht leider nicht. Ich brauche Sie sofort. Sie treffen die Mutter des Jungen heute Nachmittag um zwei. Sie wohnt gut eineinhalb Autostunden von hier weg. Das bedeutet …«, Norton schaute auf seine Uhr, »… Sie haben etwa eine Stunde, um es sich zu überlegen. Sonst muss ich jemand anders hinschicken. Das ist die Akte.«
Norton reichte Jazz einen dicken braunen Umschlag.
Sie sah ihn fassungslos an. »Eine Stunde?«
»Ja. Sie scheinen wieder eine Ihrer berühmten spontanen Entscheidungen treffen zu müssen, DI Hunter. Wenn ich Ihre bisherige Laufbahn so betrachte, waren die wohl immer gut für Sie – abgesehen natürlich von der, uns zu verlassen.« Norton warf einen weiteren Blick auf seine Uhr. »Ich muss los. Habe versprochen, zu einem Treffen um zwei wieder in der Stadt zu sein, und die Landstraßen sind der reinste Albtraum.«
Er stand auf. Mit seinen fast eins neunzig war er größer als Jazz und berührte mit dem Kopf die Zimmerdecke.
»Und was tue ich damit, wenn ich mich dagegen entscheide?« Sie deutete auf die Akte.
»Dann werfen Sie sie einfach in diesen lausigen Kamin und verbrennen sie. Ich mache mich auf den Weg.« Norton schüttelte ihr die Hand. »Danke für den Kaffee.« Er ging zur Tür, wo er sich zu ihr umdrehte. »Ich würde nicht für jeden bis nach Norfolk fahren, DI Hunter. Und das eine sage ich Ihnen: Ich werde Sie nicht auf Knien anbetteln. Rufen Sie mich bis Mittag an. Auf Wiedersehen.«
»Auf Wiedersehen, Sir. Und danke … nehme ich an«, fügte sie leise hinzu.
3
David Millar lief in der kleinen unaufgeräumten Küche hin und her. Plötzlich packte er eine Milchflasche und schleuderte sie voller Wut gegen die Wand. Sie prallte davon ab und landete klappernd auf dem Linoleumboden, ohne zu zerbrechen, was seinen Zorn noch weiter anfachte.
»Herrgott!«, brüllte er und ging schwer atmend, Kopf in den Händen, in die Hocke. Tränen brannten hinter seinen Lidern.
»Was habe ich nur getan?«, jammerte er, rappelte sich hoch, stolperte durch die bogenförmige Nische in den Wohnbereich und warf sich aufs Sofa.
In seiner Verzweiflung bemühte er sich, die Übungen zu machen, die er in der Therapie gelernt hatte. Er konzentrierte sich auf jeden tiefen Atemzug, und allmählich verrauchte seine Wut. Als er die Augen öffnete, fiel sein Blick auf das Foto von ihm mit Angelina und Rory, von der strahlenden Familie, die sie drei Jahre zuvor noch gewesen waren.
Er erinnerte sich gut an den Tag, an dem es aufgenommen worden war. An einem Julinachmittag, an dem die Sonne die Landschaft von Norfolk sanft erwärmte und sie im Garten grillten.
Damals war alles perfekt gewesen, oder? Einfach alles. Wunderschöne Frau, toller Sohn, neues Leben. Wovon er immer geträumt hatte.
David war in dieser Gegend zur Welt gekommen, hatte die ersten fünf Jahre seiner Kindheit in einem kleinen Ort außerhalb von Aylsham verbracht und später die Ferien an der Küste genossen. Weswegen ihm und Angelina, als sie sich ernsthaft darüber unterhielten, London zu verlassen, Norfolk als natürliche Wahl erschienen war.
Sie hatten ein hübsches Farmhaus knapp acht Kilometer von Foltesham entfernt erworben und unendlich viel Zeit, Mühe und Geld in die Renovierung gesteckt. Beim Aussuchen der Tapeten und Vorhänge war Angelina in ihrem Element, einfach glücklich gewesen. Oder ihm jedenfalls so erschienen. Rory hatte sich gut in der St Stephen’s Prep eingewöhnt, die so ganz anders war als die beengte Schule in der Stadt mit dem handtuchgroßen Spielplatz und der stickigen Londoner Luft. David hatte seinen Sohn voller Freude dabei beobachtet, wie er das Landleben für sich entdeckte, seine Wangen sich röteten und sein schmaler Körper kräftiger wurde.
Der einzige Nachteil war natürlich der lange Weg, den David täglich zu seinem Arbeitsplatz in der City auf sich nehmen musste, aber nicht einmal das machte ihm etwas aus. Er hätte alles getan, damit Angelina und Rory glücklich waren.
Auch Angelina war aufgeblüht. Sie hatte sich voller Elan in ihr neues Dasein gestürzt und Freundschaft mit Müttern geschlossen, die sie auf dem Parkplatz der Schule kennenlernte. Viele von ihnen waren wie sie auf der Suche nach einem angenehmeren Alltag auf dem Land dem Londoner Trott entflohen.
Nie zuvor war sie geschäftiger gewesen. Lesezirkel, Elternbeirat, Frühstück mit Nachbarinnen und Tennisstunden füllten die langen Tage, die David im Büro verbrachte. Sie lud zu ihnen passende Paare zum Abendessen ein, die sich später revanchierten, und so entwickelte sich Schritt für Schritt ein ausgesprochen aktives gesellschaftliches Leben.
Bei solchen Einladungen fiel David auf, dass die Häuser ihrer neuen Freunde prächtiger waren als das ihre. Die Frauen unterhielten sich über Designerkleidung und Urlaube auf Mauritius oder in der Karibik; die Männer prahlten mit ihren Weinkellern und den Doppelflinten von Purdey, die sie für die Jagdsaison erstanden.
Er empfand keinen Neid. David, der aus eher einfachen Verhältnissen stammte, hatte das Gefühl, eine Menge erreicht zu haben. Mit seiner Frau und seinem Sohn war er in seinem gemütlichen Haus vollkommen zufrieden. Und glaubte damals, das gelte auch für Angelina.
Im Nachhinein wurde ihm klar, dass er es aufgrund von Angelinas sehnsüchtigen Bemerkungen hätte ahnen müssen: »Schatz, Nicoles Mann hat ihr gerade diesen neuen Wahnsinns-Mercedes mit Vierradantrieb gekauft!« Oder: »Alle haben für den Sommer eine Villa in der Toskana gemietet. Wär das nicht auch für uns toll?«
Immer wieder legte sie ihm den Immobilienteil der örtlichen Zeitung auf den Schoß und wies ihn auf bestimmte Häuser hin. Schon bald verstand David den Wink mit dem Zaunpfahl. Angelina versuchte ihm klarzumachen, dass ihr eigener Lebensstil sich dem ihrer smarten, geldigen Freunde anpassen sollte, indem sie sich ein imposanteres Heim zulegten.
Angesichts der Tatsache, dass Angelina Kosmetikerin gewesen war und in einem Reihenhaus in Penge gelebt hatte, als er sie kennenlernte, meinte David durchaus berechtigt, bereits erheblich zu ihrem gesellschaftlichen Aufstieg beigetragen zu haben.
Angelinas Bedürfnis, mit den anderen mitzuhalten, hatte sich als schier unstillbar erwiesen. Irgendwann hatte David nachgegeben und ihr den Wagen mit Vierradantrieb gekauft, den sie sich so sehr wünschte und den sie abgöttisch liebte wie ein zweites Kind. Die Freude, die es ihr machte, ihn jeden Tag auf den Schulparkplatz zu lenken, entlockte David ein Lächeln. Es bereitete ihm Vergnügen, sie glücklich zu sehen, obwohl es ihn beschäftigte, dass ihr der gesellschaftliche Status so viel bedeutete.
David handelte in der City als erfolgreicher Broker für einen treuen Kundenstamm mit Fremdwährungen und besaß einen guten, soliden Ruf, ohne als Überflieger zu gelten. Er ging keine Risiken für die Sorte Profit ein, derer sich eine kleine Handvoll City Boys rühmte, und vermied so die mit solchen Risiken einhergehenden Verluste, von denen man immer wieder hörte. Privat bestand David darauf, ausschließlich von seinem Gehalt zu leben und eventuelle Boni auf dem Bankkonto zu deponieren. Da er sich im Klaren darüber war, dass die fetten Jahre nicht ewig währen würden, wollte er sicher sein, bei einem erzwungenen frühen Ruhestand ausreichend Mittel auf der hohen Kante zu haben.
Angelina wusste von dem Geld und begriff nicht, warum David sich weigerte, es anzutasten.
»Schatz, wir sind jung«, beklagte sie sich. »Jetzt wäre die Zeit, nach den Sternen zu greifen. Mit deiner Karriere geht es immer weiter aufwärts; ich verstehe nicht, warum wir für schlechte Zeiten sparen müssen, die vielleicht nie kommen. Wir wollen doch nicht mit siebzig auf einem Haufen Geld sitzen! Dann sind wir zu alt, um es noch ausgeben zu können. Denk nur, Schatz, wir könnten uns das Haus unserer Träume leisten!«
David erinnerte sich, gemurmelt zu haben, das Haus ihrer Träume hätten sie doch bereits. Aber so schnell gab Angelina nicht auf.
Schließlich ließ er sich wider besseres Wissen überreden, und Angelina machte sich umgehend mit einer Freundin auf den Weg, um ein Objekt am Ortsrand von Foltesham zu besichtigen. Es handelte sich um ein beeindruckendes, allerdings sanierungsbedürftiges Pfarrhaus aus georgianischer Zeit mit zwei Hektar Grund, viel zu groß für eine dreiköpfige Familie, doch wie Angelina kokett bemerkte, als sie und David später durch die acht Zimmer schlenderten: Möglicherweise würde die Zahl sich ja noch erhöhen.
»Schatz …« Sie schlang die Arme in einem Raum mit durchhängender Decke um seine Schultern. »Wäre das nicht ein wundervolles Kinderzimmer?«
»Angie, ist das dein Ernst?«
Sie nickte mit leuchtenden Augen. »Absolut. Ich finde, ein zweites Kind ist genau das, was wir brauchen, um aus diesem Haus ein richtiges Heim zu machen.«
Das gab den Ausschlag. David hatte sich immer schon ein zweites Kind gewünscht, doch bislang weigerte Angie sich strikt, noch einmal den Schrecken einer Schwangerschaft ins Auge zu blicken.
»Du erinnerst dich daran, was die erste mit meinem Körper angerichtet hat«, erklärte sie eines Morgens und strich den Rock über ihrem straffen Bauch glatt. »Ich hab ein volles Jahr hart gearbeitet, bis ich meine alte Figur wieder hatte. Beim zweiten Mal würde es bestimmt noch länger dauern!«
Rory war damals gerade zwölf; David hatte die Hoffnung mittlerweile aufgegeben. Dennoch vertraute er Angelinas unerwartetem Gesinnungswechsel und machte ein Angebot für das Haus.
Achtzehn Monate später, nachdem er eine gewaltige Hypothek aufgenommen hatte und die Sanierungsarbeiten am Ende dreimal so viel kosteten wie ursprünglich geplant, waren Davids finanzielle Reserven so gut wie aufgebraucht, ohne dass ein Baby in Sicht gewesen wäre.
Dann geriet der wirtschaftliche Aufschwung ins Stocken. In den Bars der City prahlte man nun nicht mehr damit, wie viele Flaschen Krug man in einer Nacht leeren konnte, sondern sprach über die Baisse und darüber, welches Unternehmen als nächstes einen Kahlschlag bei der Belegschaft vornehmen würde.
Angelina wollte immer noch mehr. Die Beträge, die sie für Möbel ausgab, fingen an, dem Haushaltsetat eines kleinen Dritte-Welt-Landes zu ähneln. Außerdem brauchten sie unbedingt einen Pool in dem ummauerten Garten, damit Rory seine Freunde zum Schwimmen einladen konnte.
Nach zunehmend aufwühlenden Tagen im Büro graute David davor, mit dem Zug nach Hause zu fahren, wo ihn ein Gebäude erwartete, das seinen Kontrollverlust symbolisierte, und eine Ehefrau, die unzufrieden wirkte, egal, was er ihr gab.
Deshalb begann er, seine Sorgen nach der Arbeit in Bars zu ertränken, statt sich der Realität zu stellen. Mit fünf oder sechs Pints Bier und einem oder zwei Whisky intus tat es weniger weh, sich Angelinas Forderungen anzuhören und ihnen nachzugeben. Er nahm ein Darlehen bei der Bank auf, um den Swimmingpool zu finanzieren, ein weiteres für einen neuen Tennisplatzbelag und die Gestaltung des riesigen Gartens.
Unter dem erhöhten Druck litt die Qualität seiner Arbeit. David handelte nicht mehr so umsichtig wie früher und machte den einen oder anderen Fehler. Keiner so gravierend, dass ihm sofort gekündigt wurde, aber doch so unübersehbar, dass er in diesen schwierigen Zeiten zu denen gehörte, die das Unternehmen als überflüssig erachtete, als es die Anzahl seiner Beschäftigten reduzierte.
Ein Vorgesetzter rief ihn zu sich und erklärte David, seine Stelle sei mit sofortiger Wirkung gestrichen. Er bekomme ein Jahresgehalt als Abfindung, müsse dafür jedoch umgehend seinen Schreibtisch räumen.
Daraufhin verbrachte David einen sehr langen Abend in seiner Lieblingskneipe und erwischte gerade noch den letzten Zug nach Hause.
Dort lag Angelina bereits im Bett. David wankte in die Küche – der Kopf tat ihm weh –, schenkte sich ein großes Glas Leitungswasser ein und ging zu dem Schrank in der Vorratskammer, in dem Angelina die Medikamente aufbewahrte, um eine Tablette gegen die Kopfschmerzen zu holen.
Beim Herausheben der Box landete der gesamte Inhalt auf dem Boden. Auf den Knien sammelte er Salben, Pflaster und Pillen wieder ein. Eine Packung fiel ihm ins Auge. Darin befand sich das Verhütungsmittel, das Angelina vor ihren Versuchen, ein zweites Kind zu bekommen, genommen hatte.
Mit wild klopfendem Herzen überprüfte er das Datum, an dem es gekauft worden war: zwei Wochen zuvor. David öffnete die Packung und stellte fest, dass die Hälfte der Pillen fehlte.
Voller Wut stürmte er hinauf ins eheliche Schlafzimmer.
Wo Angelina im Bett las.
»Schatz, ich habe mir ja solche Sorgen gemacht. Wo warst du de…«
Bevor sie den Satz zu Ende führen konnte, packte David sie an den Unterarmen, zerrte sie hoch und schüttelte sie wie eine Puppe.
»Was für ein Spiel treibst du da?«, brüllte er sie an. »Wie kannst du es wagen, mich anzulügen!« Er gab ihr eine schallende Ohrfeige, und sie ging zu Boden.
Worauf er auf die Bettkante sank und, den Kopf in den Händen, zu weinen anfing. »Warum hast du mich belogen? Warum? Du hast nie vorgehabt, ein zweites Kind zu kriegen, oder?«
Als er die Augen wieder aufmachte, war Angelina verschwunden. Er fand sie unten; sie hatte sich im Wohnzimmer verschanzt und die Polizei gerufen. Als diese wenige Minuten später eintraf, schlug er noch immer gegen die Tür und verlangte, eingelassen zu werden, damit er alles erklären könne.
Am folgenden Morgen, nach einer Nacht in einer Polizeizelle, wurde wegen seines tätlichen Angriffs Anzeige gegen ihn erstattet. Man hatte Angelina ins Krankenhaus gebracht, wo sie untersucht wurde. Kurz darauf war sie wieder zu Hause. Sie hatte einen Schock erlitten, war aber unverletzt.
Entsetzt über sich selbst versuchte David, den Beamten zu erklären, was ihm widerfahren war, und weil er sich bis dahin niemals häuslicher Gewalt schuldig gemacht hatte, wurde er entlassen.
Reumütig legte er die kurze Strecke nach Hause zu Fuß zurück und fand das Gebäude abgeriegelt wie eine Festung vor. Er rief von einer Telefonzelle aus an, doch Angelina ging nicht ran, weswegen er zurückkehrte, gegen die Tür hämmerte und, als das nichts fruchtete, versuchte, sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen.
Daraufhin kam die Polizei ein zweites Mal, gerade als er mit einem großen Stein aus dem Garten ein Fenster eingeschlagen hatte.
Angelinas Anwalt erwirkte umgehend eine einstweilige Anordnung, die es David fürs Erste untersagte, sich dem Haus, seiner Frau und seinem geliebten Sohn zu nähern.
Die folgenden Wochen waren ein Albtraum voller Alkohol, aus dem David es kaum noch schaffte aufzutauchen.
Dann wachte er irgendwann in dem grässlichen Cottage auf, das er in seiner Verzweiflung gemietet hatte, und schaltete den Fernseher ein.
In einer morgendlichen Talkshow wurde gerade ein trockener Alkoholiker interviewt. Während David lauschte, wie der Mann so tief gefallen war, liefen ihm Tränen über die Wangen, weil dessen Geschichte seiner eigenen so sehr ähnelte.
Noch am selben Abend nahm David an einem Treffen der Anonymen Alkoholiker teil.
So fand er den Weg zurück in die Nüchternheit.
Anfangs war es die Hölle. Bedeutend schwieriger, als David es sich vorgestellt hatte. Doch als die Wochen vergingen und er es nach wie vor schaffte, nüchtern zu bleiben, klärte sich sein Blick allmählich.
Er konsultierte eine Anwältin in Foltesham, eine Frau namens Diana Price, die bemerkte, es sei schon merkwürdig, wie schnell Angelina die einstweilige Anordnung habe erwirken können.
»Ihre Frau wurde nicht stationär im Krankenhaus aufgenommen«, erklärte sie. »Sie hat nur einige Zeit in der Notaufnahme verbracht. Und Sie sollten das Recht haben, Ihren Sohn zu treffen, wenn auch möglicherweise nur unter Aufsicht.«
»Wie sieht die finanzielle Seite aus?«, erkundigte sich David. »Ich habe keine Ahnung, wovon meine Frau lebt. Unser gemeinsames Konto ist praktisch leer.«
»Was ist mit Ihrer Abfindung?«, fragte Diana.
»Die ist auf meinem Konto bei der Bausparkasse; an die kann sie nicht ran.«
»Immerhin etwas.«
»Ja, aber das ist alles, was ich habe. Ich bin arbeitslos, und egal, was passiert: Wir werden das Haus verkaufen müssen. Ich kann weder die Hypothek noch die Darlehen bedienen. Angie redet nach wie vor nicht mit mir, und ich würde wirklich einige meiner Sachen brauchen. Ich besitze buchstäblich nur die Kleidung, die ich am Leib trage.«
»Ich schreibe ihrem Anwalt, dann können wir besser beurteilen, wie die Dinge stehen«, schlug Diana vor. »Sie müssen am sechsten des kommenden Monats vor Gericht erscheinen. Zuvor noch eine Frage meinerseits: Hatten Sie und Ihre Frau schon vor besagtem Abend Eheprobleme?«
David versuchte sich zu erinnern. Seine finanziellen Schwierigkeiten hatten ihn so vereinnahmt, dass er sich nicht mehr klar war über den Zustand seiner Ehe in den vergangenen Monaten. Sonderlich häufig hatten sie nicht miteinander geschlafen, doch er war ja auch oft erst sehr spät nach Hause gekommen …
»Schätze, irgendwann haben wir aufgehört, miteinander zu reden«, antwortete David. »Wir haben uns nicht richtig gestritten, und abgesehen von dem einen Mal hätte ich nie im Traum daran gedacht, ihr wehzutun.«
»Es ist nur …« Diana schüttelte den Kopf. »Normalerweise gibt die Frau dem Mann immerhin Gelegenheit, ihr alles zu erklären. Ich will Ihr Benehmen nicht entschuldigen, aber wenn sie Sie liebt, würde sie doch bestimmt wenigstens versuchen, Ihr Verhalten zu verstehen, oder?«
»Vielleicht hat sie Angst vor mir.«
»Mag sein, aber vergessen Sie nicht: Ihr ist bewusst, dass sie Ihnen vorgemacht hat, sie wolle ein Kind. Vermutlich ist ihr daran gelegen, die Sache zu klären, wenn auch nur Rory zuliebe. Ihr Vorgehen erscheint mir sehr seltsam. Egal: Ich kontaktiere ihren Anwalt, dann sehen wir ja, was passiert.«
Die folgenden Tage brachte David damit zu, in einem Zustand qualvoller Spannung in der kleinen Küche im Cottage auf und ab zu laufen. Eine Woche später bat Diana ihn wieder in ihr Büro.
»Und was sagt sie?«, fragte er.
»Ich fürchte, es gibt gute und schlechte Nachrichten«, antwortete Diana sanft. »Ihre Frau ist bereit, die Anzeige wegen des tätlichen Angriffs fallen zu lassen und die einstweilige Anordnung zurückzunehmen.«
David spürte Hoffnung in sich aufkeimen.
»Allerdings«, fügte sie hinzu, »möchte sie dafür eine schnelle Scheidung. Sie wird ihren Antrag auf ungebührliches Verhalten gründen und dabei belassen, solange Sie ihn nicht anfechten.«
»Wie bitte?« David war verblüfft.
»Außerdem bleibt Rory bei ihr.«
David wurde übel, seine Hände begannen zu zittern.
»Warum will sie die Scheidung? Wir haben uns über rein gar nichts unterhalten. Wahrscheinlich ist ihr nicht mal klar, dass ich meinen Job verloren habe. Wenn, wüsste sie, dass wir das Haus verkaufen müssen.«
»Nach allem, was ihr Anwalt sagt, spielt das keine Rolle«, meinte Diana. »Ihre Frau möchte Sie ausbezahlen.«
»Mich ausbezahlen? Wie zum Teufel will sie das anstellen?«
»Das Haus gehört Ihnen gemeinsam. Ihre Frau würde ihren Anteil erhalten, sobald die Hypothek abbezahlt wäre, und Sie bekämen den Ihren. Ihr Vorschlag sieht folgendermaßen aus: Sie bleibt in dem Haus, übernimmt die Hypothek und zahlt Ihnen Ihren Anteil aus. So wird sie Alleineigentümerin.«
»Das ist Wahnsinn! Angie besitzt keinen roten Heller – sie hat kein Einkommen und keine Ersparnisse. Wo will sie das Geld für die Hypothek hernehmen, ganz zu schweigen von dem, das sie braucht, um mich auszubezahlen?«
Diana zuckte mit den Achseln. »Keine Ahnung, das schlägt sie nun mal vor. David, Sie haben eine ganze Menge zu verdauen. Gehen Sie nach Hause und denken Sie über den Vorschlag nach, ja? Und teilen Sie mir mit, was ich tun soll.«
»Welche Optionen habe ich?«
»Sie können es drauf ankommen und sich wegen des tätlichen Angriffs vor Gericht bringen lassen. Aber vergessen Sie nicht: Das Wort Ihrer Frau steht gegen das Ihre. Sie können um das Sorgerecht für Rory kämpfen, doch die Gerichte entscheiden für gewöhnlich für die Mutter, besonders dann, wenn ein Fall von häuslicher Gewalt vorliegt. Oder Sie können dafür sorgen, dass die Scheidung sich ewig hinzieht, aber auch davon rate ich Ihnen ab.«
»Soll das heißen, sie hat mich im Schwitzkasten?«
»Ich sage lediglich, dass Sie eine Entscheidung treffen müssen. Es wird wehtun, doch so sind Sie immerhin nicht vorbestraft, Ihre Scheidung geht schnell über die Bühne und kostet nicht viel, und vor allen Dingen: Sie dürfen zu Rory.«
»Na wunderbar!«, erwiderte er spöttisch. »Im einen Moment kann ich meinen Sohn noch sehen, wann ich möchte, ihm Frühstück machen und mit ihm Fußball spielen; im nächsten erklärt meine Frau mir dann, ich darf ihn bloß ein paarmal im Jahr treffen!«
»So schlimm wird’s nicht werden. Rory ist die Woche über im Internat; wir verlangen, dass er jedes zweite Wochenende und die Hälfte der Ferien zu Ihnen kommen kann. Bestimmt lässt sie sich darauf ein.«
»Wie großzügig von ihr! Herrgott! Ich habe ihm nie was Böses getan. Auch meiner Frau nicht. Nein, ich habe ihr das Leben ermöglicht, das sie sich von mir wünschte.«
Wieder einmal spürte David, wie glühender Zorn in ihm aufstieg. »Danke, Diana. Ich melde mich bei Ihnen.«