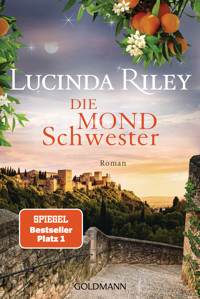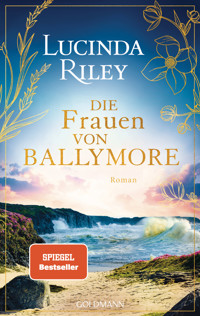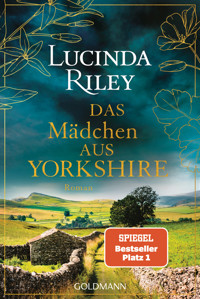11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die sieben Schwestern
- Sprache: Deutsch
Die große Saga von Bestsellerautorin Lucinda Riley.
Star d'Aplièse ist eine sensible junge Frau, der es nie gelang, aus dem Schatten ihrer Schwester CeCe herauszutreten. Als ihr geliebter Vater Pa Salt stirbt, steht Star plötzlich an einem Wendepunkt. Wie alle Mädchen der Familie ist auch sie ein Adoptivkind mit unbekannter Herkunft, doch der Abschiedsbrief ihres Vaters enthält einen Anhaltspunkt: die Adresse einer Londoner Buchhandlung sowie den Hinweis, dort nach einer gewissen Flora MacNichol zu fragen. Star folgt diesen Spuren, die sie auf ein wunderbares Anwesen in Kent und in die Rosengärten des Lake District im vergangenen Jahrhundert führen. Ganz langsam beginnt sie, ihr eigenes Leben zu entdecken – und ihr Herz zu öffnen für das Wagnis, das man Liebe nennt ...
Der dritte Band aus der Bestseller-Serie um die sieben Schwestern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 842
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Buch
Star d’Aplièse ist eine sensible junge Frau und begegnet der Welt eher mit Vorsicht. Seit sie denken kann, ist ihr Leben auf das Engste verflochten mit dem ihrer Schwester CeCe, aus deren Schatten herauszutreten ihr nie gelang. Als ihr geliebter Vater Pa Salt plötzlich stirbt, steht Star jedoch unversehens an einem Wendepunkt. Wie alle Mädchen in der Familie ist auch sie ein Adoptivkind und kennt ihre Wurzeln nicht, doch der Abschiedsbrief ihres Vaters enthält einen Anhaltspunkt – die Adresse einer Londoner Buchhandlung sowie den Hinweis, dort nach einer gewissen Flora MacNichol zu fragen. Während Star diesen Spuren folgt, eröffnen sich ihr völlig ungeahnte Wege, die sie nicht nur auf ein wunderbares Anwesen in Kent führen, sondern auch in die Rosengärten und Parks des Lake District im vergangenen Jahrhundert. Und ganz langsam beginnt Star, ihr eigenes Leben zu entdecken und ihr Herz zu öffnen für das Wagnis, das man Liebe nennt …
Weitere Informationen zu Lucinda Riley sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie unter www.penguin.de/Autor/Lucinda-Riley/p411595.rhd.
LUCINDA RILEY
Die Schattenschwester
ROMAN
Der dritte Band der »Sieben-Schwestern«-Serie
Deutsch von Sonja Hauser
Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel »The Shadow Sister« bei Macmillan, an imprint of Pan Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited, London.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © der Originalausgabe 2016 by Lucinda Riley
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe November 2016 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: Uno Werbeagentur, München
Covermotiv: Landschaft: plainpicture / Benjamin Harte
Cottage: GettyImages / Michael Busselle
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-18375-2V011
www.goldmann-verlag.de
Für Flo
Doch lasst Raum in eurer Zusammengehörigkeit.Und lasst die Winde des Himmels zwischen euch tanzen.
Khalil Gibran
Personen
»Atlantis«
Pa Salt
Adoptivvater der Schwestern (verstorben)
Marina (Ma)
Mutterersatz der Schwestern
Claudia
Haushälterin von »Atlantis«
Georg Hoffman
Pa Salts Anwalt
Christian
Skipper
Die Schwestern d’Aplièse
Maia
Ally (Alkyone)
Star (Asterope)
CeCe (Celaeno)
Tiggy (Taygeta)
Elektra
Merope (fehlt)
Star
Juli 2007
Astrantia major(Große Sterndolde – Apiaceae)vom lateinischen Wort für »Stern« abgeleitet
I
Nie werde ich vergessen, wo ich war und was ich tat, als ich hörte, dass mein Vater gestorben war.
Den Stift über dem Blatt Papier, schaute ich in die Julisonne – oder, besser gesagt, auf den schmalen Strahl, dem es gelungen war, sich zwischen unserem Haus und der roten Ziegelmauer wenige Meter vor mir hindurchzuschmuggeln, auf die alle Fenster unserer winzigen Wohnung gingen und derentwegen es bei uns trotz des schönen Wetters dunkel war. Ganz anders als im Zuhause meiner Kindheit, in »Atlantis« am Genfer See.
Plötzlich wurde mir bewusst, dass ich genau an derselben Stelle wie jetzt gesessen war, als CeCe unser trostloses kleines Wohnzimmer betreten und mir mitgeteilt hatte, dass Pa Salt tot war.
Ich legte den Stift weg und ging an die Spüle, um mir ein Glas Wasser zu holen und in der schwülen Hitze meinen Durst zu stillen. Meine jüngere Schwester Tiggy hatte mir kurz nach Pas Tod in »Atlantis« geraten, mich schriftlich dem Schmerz der Erinnerung zu stellen.
»Liebste Star«, hatte sie gesagt, als einige von uns Schwestern zur Ablenkung auf dem See gesegelt waren, »ich weiß, dass es dir schwerfällt, über deine Gefühle zu sprechen. Doch der Schmerz muss irgendwie heraus. Warum schreibst du deine Gedanken nicht einfach auf?«
Während des Heimflugs von »Atlantis« vor zwei Wochen hatte ich über Tiggys Worte nachgedacht, und nun machte ich mich endlich an die Arbeit.
Als ich die Ziegelmauer betrachtete, ging mir auf, wie sehr sie mein gegenwärtiges Leben symbolisierte, und das ließ mich immerhin schmunzeln. Dieses Schmunzeln führte mich zurück zu dem schartigen Holztisch, den unser Vermieter vermutlich gratis von einem Trödelladen bekommen hatte. Ich setzte mich und nahm den eleganten Füller, ein Geschenk von Pa Salt zu meinem einundzwanzigsten Geburtstag, wieder in die Hand.
»Ich fange nicht mit Pas Tod an«, sagte ich laut, »sondern mit unserer Ankunft hier in London …«
Als ich die Haustür mit einem lauten Knall ins Schloss fallen hörte, wusste ich, dass meine Schwester CeCe da war. CeCe war immer laut. Sie schien nicht einmal eine Tasse Kaffee leise und ohne etwas zu verschütten abstellen zu können. Sie begriff auch nicht, dass man in der Wohnung gedämpfter sprechen konnte als draußen. Ma hatte sich in unserer Kindheit so große Sorgen darüber gemacht, dass sie sogar einmal ihr Gehör überprüfen ließ. Natürlich war es völlig in Ordnung. Genau wie meins, wie ein Logopäde ein Jahr später feststellte, zu dem Ma mich meiner Schweigsamkeit wegen gebracht hatte.
»Sie kennt die Wörter, spricht sie aber nicht aus«, hatte der Therapeut erklärt. »Wenn sie dazu bereit ist, wird sie schon reden.«
Zu Hause hatte Ma mir dann, um sich besser mit mir verständigen zu können, die Grundlagen der französischen Gebärdensprache beigebracht.
»Wenn du etwas möchtest oder brauchst«, hatte sie gesagt, »kannst du es mir so mitteilen. Auch deine Gefühle kannst du damit ausdrücken. Ich zum Beispiel empfinde dir gegenüber das.« Sie hatte auf sich selbst gezeigt, die Handflächen über der Brust gekreuzt und auf mich gedeutet. »Ich … liebe … dich.«
CeCe hatte die Zeichensprache ebenfalls schnell gelernt, und gemeinsam hatten wir das, was als eine Möglichkeit der Kommunikation mit Ma begann, verändert und erweitert zu unserer ganz eigenen Sprache – eine Mischung aus Zeichen und ausgedachten Wörtern –, die wir in Gegenwart anderer verwendeten. Wir genossen die verblüfften Blicke unserer Schwestern, wenn ich beim Frühstück in Zeichensprache eine spöttische Bemerkung machte und CeCe und ich uns vor Lachen bogen.
Heute ist mir klar, dass CeCe und ich uns im Lauf der Zeit zu gegensätzlichen Polen entwickelten: Je weniger ich sprach, desto lauter und mehr redete sie für mich. Und desto weniger musste ich wiederum sagen. Das, was ohnehin in unseren Persönlichkeiten angelegt war, verstärkte sich. In unserer Kindheit spielte das inmitten unserer Schwestern keine große Rolle, denn wir hatten ja einander.
Doch nun wurde es plötzlich wichtig, es wuchs sich zum Problem aus …
»Ich hab sie gefunden!«, rief CeCe, als sie ins Wohnzimmer polterte. »In ein paar Wochen können wir rein. Sie ist noch nicht ganz fertig, der Feinschliff fehlt, aber sie wird unglaublich schön, das ist jetzt schon zu sehen. Gott, ist es heiß hier drin. Ich kann’s gar nicht erwarten, endlich auszuziehen.«
CeCe stapfte in die Küche, und wenig später hörte ich, wie sie den Wasserhahn voll aufdrehte. Mit ziemlicher Sicherheit waren die Arbeitsflächen, die ich zuvor trocken gewischt hatte, nun wieder feucht.
»Willst du auch ein Glas Wasser, Sia?«
»Nein danke.« Obwohl CeCe den Kosenamen, den sie sich in unserer Kindheit für mich ausgedacht hatte, nur benutzte, wenn wir unter uns waren, ärgerte ich mich darüber. Er stammte aus einem Buch, das Pa Salt mir zu Weihnachten geschenkt hatte. Es handelte von einem kleinen Mädchen, das in den Wäldern Russlands lebt und herausfindet, dass es eine Prinzessin ist.
»Sie schaut aus wie du, Star!«, hatte die fünfjährige CeCe gestaunt, als wir gemeinsam die Bilder in dem Buch betrachteten. »Vielleicht bist du auch eine Prinzessin – hübsch genug wärst du mit deinen blonden Haaren und den blauen Augen. Ab jetzt nenne ich dich ›Sia‹. Das passt wunderbar zu ›Cee‹! Cee und Sia, die Zwillinge!« Sie hatte begeistert in die Hände geklatscht.
Erst später, als ich die wahre Geschichte der russischen Zarenfamilie erfahren hatte, war mir klar geworden, was mit Anastasia Romanowa und ihren Geschwistern passiert war. Märchen sahen anders aus.
Inzwischen war ich kein Kind mehr, sondern eine erwachsene Frau von siebenundzwanzig Jahren.
»Die Wohnung wird dir gefallen.« CeCe kehrte ins Wohnzimmer zurück und ließ sich auf das abgewetzte Ledersofa fallen. »Ich hab für morgen Vormittag einen Besichtigungstermin ausgemacht. Sie kostet ein Vermögen, aber jetzt kann ich’s mir leisten. Außerdem sagt der Makler, dass in der City gerade Chaos herrscht. Momentan schlagen sich nicht die üblichen Verdächtigen um die Wohnungen; deshalb konnte ich einen günstigen Preis raushandeln. Wird Zeit, dass wir ein richtiges Zuhause kriegen.«
Wird Zeit, dass ich mir ein richtiges Leben zulege, dachte ich.
»Du willst sie kaufen?«, fragte ich.
»Ja. Vorausgesetzt, sie gefällt dir.«
Ich schwieg verblüfft.
»Alles in Ordnung, Sia? Du wirkst müde. Hast du letzte Nacht nicht gut geschlafen?«
»Nein.« Beim Gedanken an die langen, schlaflosen Stunden vor der Morgendämmerung, in denen ich um meinen geliebten Vater getrauert hatte, dessen Tod ich noch immer nicht fassen konnte, traten mir Tränen in die Augen.
»Du stehst nach wie vor unter Schock. Es ist ja auch erst ein paar Wochen her. Wenn du morgen unsere neue Wohnung siehst, geht’s dir besser, das verspreche ich dir. Diese Scheißbude drückt auf deine Stimmung. Und auf meine auch«, fügte sie hinzu. »Hast du dem Typen mit dem Kochkurs schon ’ne Mail geschickt?«
»Ja.«
»Wann fängt der Kurs an?«
»Nächste Woche.«
»Gut. Dann haben wir Zeit, Möbel für unser neues Zuhause auszusuchen.« CeCe trat zu mir und umarmte mich. »Ich kann’s kaum erwarten, es dir zu zeigen.«
* * *
»Ist es nicht toll?«
CeCe breitete die Arme aus. Ihre Stimme hallte wider von den nackten Wänden des großen Raums, als sie zu der Glasfront marschierte und eines der riesigen Fenster aufschob.
»Schau, dein Balkon«, sagte sie und winkte mich zu sich. »Balkon« war ein viel zu bescheidenes Wort für die geräumige Terrasse, die über der Themse zu schweben schien. »Den kannst du mit deinen Kräutern und Blumen aus ›Atlantis‹ bepflanzen.« CeCe trat ans Geländer und schaute hinab auf die grauen Fluten. »Ist der Blick nicht grandios?« Ich nickte. Als sie wieder hineinging, folgte ich ihr. »Die Küche muss noch eingebaut werden, aber sobald die Formalitäten unter Dach und Fach sind, kannst du dir Herd und Kühlschrank aussuchen. Schließlich wirst du ja jetzt Profi«, fügte sie mit einem Augenzwinkern hinzu.
»Wohl kaum, CeCe. Es ist nur ein kurzer Kurs.«
»Du kannst so gut kochen. Wenn sich rumspricht, was du draufhast, wird dir bestimmt ein Job angeboten. Ich finde die Wohnung ideal für uns, du nicht? Diese Seite kann ich als Atelier nutzen.« Sie deutete auf den Bereich zwischen hinterer Wand und Wendeltreppe. »Das Licht hier ist fantastisch. Und du hast eine große Küche und den Balkon. Etwas ›Atlantis‹ Ähnlicheres konnte ich im Zentrum von London nicht finden.«
»Ja. Es ist wirklich schön, danke.«
Die Wohnung war tatsächlich beeindruckend. Da ich ihr die Freude nicht verderben wollte, verkniff ich es mir, ihr die Wahrheit zu sagen: dass das Leben in diesem riesigen unpersönlichen Glaskasten mit Blick auf den schlammigen Fluss sich meiner Ansicht nach gar nicht stärker von dem in »Atlantis« hätte unterscheiden können.
Als CeCe und der Makler sich über das helle Parkett unterhielten, das in der Wohnung verlegt werden sollte, schüttelte ich den Kopf über meine negativen Gedanken. Ich wusste, dass ich schrecklich verwöhnt war, denn verglichen mit den Straßen von Delhi oder den Slums, die ich am Stadtrand von Phnom Penh gesehen hatte, war eine nagelneue Wohnung in der Londoner City wirklich nicht zu verachten.
Doch letztlich wäre mir eine einfache kleine Hütte mit sicher im Boden verankertem Fundament und kleinem Garten davor lieber gewesen.
Mit halbem Ohr hörte ich CeCe von einer Fernbedienung schwärmen, mit der sich die Jalousien öffnen und schließen ließen, und von einer anderen für die versteckten Surround-Lautsprecher. Hinter dem Rücken des Maklers machte sie das Zeichen für »geldgeiler Kerl« und verdrehte die Augen. Ich rang mir ein Lächeln ab, obwohl mich ein Gefühl der Klaustrophobie überkam, weil ich nicht einfach zur Tür hinaus und wegrennen konnte … Städte raubten mir den Atem; der Lärm, die Gerüche und die Menschenmassen waren mir zu viel. Wenigstens war die Wohnung luftig und geräumig …
»Sia?«
»Entschuldige, Cee, was hast du gerade gesagt?«
»Wollen wir rauf und uns unser Schlafzimmer ansehen?«
Wir gingen die Wendeltreppe hinauf zu dem Zimmer, das CeCe sich mit mir teilen wollte, obwohl es einen weiteren Raum gab. Bei dem spektakulären Ausblick, der sich mir dort bot, bekam ich eine Gänsehaut. Und als wir das riesige Bad begutachteten, wurde mir klar, dass CeCe sich größte Mühe gegeben hatte, etwas zu finden, das uns beiden gefallen würde.
Allerdings waren wir nicht verheiratet, sondern Schwestern.
Wenig später schleppte mich CeCe in einen Möbelladen in der King’s Road, und dann fuhren wir mit dem Bus über die Albert Bridge zurück über den Fluss.
»Diese Brücke ist nach dem Ehemann von Königin Victoria benannt«, erklärte ich CeCe. »In Kensington steht sein Denkmal …«
CeCe machte das Zeichen für »Angeberin«. »Also wirklich, Star, schleppst du immer noch ’nen Reiseführer mit dir rum?«
»Ja«, musste ich zugeben und konterte mit dem Zeichen für »plemplem«. Ich liebte Geschichte.
Als wir ganz in der Nähe unserer Wohnung aus dem Bus stiegen, wandte CeCe sich mir zu. »Lass uns zur Feier des Tages essen gehen.«
»Wir haben kein Geld.« Jedenfalls ich nicht, dachte ich.
»Ich lad dich ein«, meinte CeCe.
Also bestellte CeCe in einem Pub in der Gegend eine Flasche Bier für sich und ein kleines Glas Wein für mich. Wir tranken beide nicht viel – CeCe vertrug Alkohol nicht sonderlich gut, was ihr nach einer besonders ausgelassenen Teenagerparty auf unangenehme Weise bewusst geworden war. Während sie an der Theke wartete, wunderte ich mich über das Geld, das CeCe seit dem Tag, nach dem wir Schwestern von Georg Hoffman, dem Anwalt von Pa Salt, dessen Umschläge ausgehändigt bekommen hatten, zu besitzen schien. CeCe war zu ihm nach Genf gefahren und hatte den Anwalt gebeten, mich zu der Besprechung mitnehmen zu dürfen, doch er hatte Nein gesagt.
»Leider muss ich mich an die Anweisungen meines Mandanten halten. Ihr Vater hat darauf bestanden, dass ich sämtliche Gespräche mit seinen Töchtern einzeln führe.«
Also hatte ich im Vorzimmer gewartet. Als sie wieder herausgekommen war, hatte sie angespannt und aufgeregt gewirkt.
»Tut mir leid, Sia, aber ich musste so eine alberne Verschwiegenheitserklärung unterschreiben. Ist vermutlich wieder eins von Pas Spielchen. Ich darf dir nur sagen, dass alles positiv läuft.«
Meines Wissens war dies das einzige Geheimnis, das CeCe vor mir hatte, und mir war nach wie vor nicht klar, woher all das Geld stammte. Georg Hoffmans Aussage nach hatte Pa in seinem Testament verfügt, dass wir wie bisher nur unsere knapp bemessenen Zuwendungen erhalten würden, uns jedoch an Hoffman wenden konnten, wenn wir darüber hinaus Geld benötigten. Wir mussten also einfach nur fragen, und das hatte CeCe vermutlich getan.
»Prost!« CeCe stieß mit mir an. »Auf unser neues Leben in London.«
»Und auf Pa Salt«, fügte ich hinzu.
»Ja. Du hast ihn sehr geliebt, was?«
»Du etwa nicht?«
»Doch, natürlich. Er war … besonders.«
Als das Essen kam, schlang CeCe es hungrig hinunter. Fast hatte ich das Gefühl, dass nur ich über Pas Tod trauerte, obwohl wir beide seine Töchter waren.
»Sollen wir die Wohnung kaufen?«
»CeCe, die Entscheidung überlasse ich dir. Es ist nicht mein Geld.«
»Unsinn, du weißt, dass meine Sachen auch dir gehören und umgekehrt. Außerdem kann man nicht wissen, was sich herausstellt, wenn du jemals beschließen solltest, den Umschlag aufzumachen, den er dir hinterlassen hat.«
Sie drängte mich schon die ganze Zeit, endlich mein Kuvert zu öffnen. CeCe hatte das ihre sofort aufgerissen und von mir das Gleiche erwartet.
»Willst du ihn nicht aufmachen, Sia?«, hatte sie gefragt.
Doch das konnte ich nicht, weil das, was sich darin befand, Pas Tod besiegelt hätte. Und ich war noch nicht bereit, ihn loszulassen.
Nach dem Essen zahlte CeCe, und wir kehrten in unsere Wohnung zurück, von wo aus sie ihre Bank telefonisch beauftragte, die Anzahlung für das Apartment zu überweisen. Dann setzte sie sich an ihren Laptop und beklagte sich über die wackelige Internetverbindung.
»Hilf mir mal beim Aussuchen der Sofas«, rief sie vom Wohnzimmer aus, als ich unsere gelb patinierte Badewanne mit lauwarmem Wasser füllte.
»Ich hab mir gerade ein Bad eingelassen«, antwortete ich und verschloss die Tür.
Dann legte ich mich ins Wasser und tauchte mit dem Kopf unter. Ich lauschte den gluckernden Geräuschen – Uterusgeräusche, dachte ich – und kam zu dem Schluss, dass ich mich lösen musste, bevor ich den Verstand verlor. Es war nicht CeCes Schuld, und ich wollte meine Unzufriedenheit nicht an ihr auslassen. Bisher war sie immer für mich da gewesen, aber …
Zwanzig Minuten später – ich hatte meinen Beschluss gefasst – betrat ich das Wohnzimmer.
»Na, hast du das Bad genossen?«
»Ja. CeCe …«
»Schau dir mal die Sofas hier an.« Sie winkte mich zu sich. Ich gesellte mich zu ihr und betrachtete nicht sonderlich interessiert die in Cremetönen gehaltenen Sitzgelegenheiten.
»Welches findest du am schönsten?«
»Nimm, was dir gefällt. Inneneinrichtung ist dein Gebiet, nicht meins.«
»Wie wär’s mit dem?« CeCe deutete auf den Bildschirm. »Es soll nicht nur schön, sondern auch bequem sein, schließlich wollen wir drauf sitzen.« Sie notierte Namen und Adresse des Möbelhauses. »Sollen wir das morgen erledigen?«
Ich holte tief Luft. »CeCe, würde es dir was ausmachen, wenn ich ein paar Tage nach ›Atlantis‹ fahre?«
»Kein Problem. Wenn dir der Sinn danach steht, Sia. Ich such uns Flüge raus.«
»Eigentlich möchte ich das allein machen. Ich meine …« Ich schluckte und nahm all meinen Mut zusammen. »Du bist im Moment ziemlich beschäftigt mit der Wohnung und willst mit deinen Kunstprojekten vorankommen.«
»Ja, aber ein paar Tage sind schon drin. Ich kann’s verstehen, wenn du Sehnsucht nach ›Atlantis‹ hast.«
»Mir wär’s lieber, wenn ich allein fahren könnte«, beharrte ich.
»Warum?« CeCe wandte sich mir zu; ihre mandelförmigen Augen nahmen einen erstaunten Ausdruck an.
»Einfach so. Ich würde den Umschlag von Pa Salt gern in dem Garten aufmachen, den ich mit ihm angelegt habe.«
»Verstehe. Klar, warum nicht?«, sagte sie achselzuckend.
Obwohl ich spürte, wie sich ihre Stimmung abkühlte, wollte ich diesmal nicht nachgeben. »Ich leg mich ins Bett. Hab schlimme Kopfschmerzen«, erklärte ich.
»Ich bring dir Tabletten. Soll ich dir einen Flug raussuchen?«
»Ich hab schon eine genommen, aber es wär schön, wenn du dich um den Flug kümmerst, danke. Gute Nacht.« Ich küsste meine Schwester auf die glänzenden dunklen Locken, die wie immer jungenhaft kurz geschnitten waren. Dann zog ich mich in die winzige Besenkammer zurück, die wir uns als Schlafzimmer teilten.
Das Bett war hart und schmal und die Matratze dünn. Nach unserer luxuriösen Kindheit waren wir in den vergangenen sechs Jahren um die Welt gereist und hatten in den übelsten Absteigen genächtigt, weil wir Pa Salt nicht um Unterstützung bitten wollten, auch wenn wir pleite waren. Besonders CeCe war immer zu stolz gewesen, weswegen es mich wunderte, dass sie nun das Geld, das nur von ihm stammen konnte, mit vollen Händen ausgab.
Vielleicht würde ich Ma fragen, ob sie mehr wusste, obwohl sie uns Schwestern gegenüber ausgesprochen diskret war.
»›Atlantis‹«, murmelte ich. Freiheit…
An jenem Abend schlief ich fast sofort ein.
II
Christian erwartete mich mit dem Boot an der Landestelle am Genfer See, als das Taxi mich dort absetzte. Er begrüßte mich mit seinem üblichen freundlichen Lächeln, und zum ersten Mal fragte ich mich, wie alt er war. Obwohl er das Schnellboot schon seit meiner Kindheit lenkte, sah er mit seinen dunklen Haaren, der gebräunten Haut und dem athletischen Körper keinen Tag älter als fünfunddreißig aus.
Im Boot lehnte ich mich auf der bequemen Lederbank im Heck zurück und wunderte mich, während ich im hellen Licht der Sonne die vertraute frische Luft einatmete, darüber, dass die Beschäftigten von »Atlantis« nicht zu altern schienen. Vielleicht war »Atlantis« tatsächlich verzaubert, und wer innerhalb seiner Mauern lebte, besaß das ewige Leben und wäre immer dort.
Alle außer Pa Salt …
Die Erinnerung an meinen letzten Aufenthalt in »Atlantis« schmerzte. Wir sechs Schwestern – samt und sonders von Pa Salt adoptiert, aus fernen Weltgegenden hierher gebracht und nach dem Siebengestirn der Plejaden benannt – hatten uns unmittelbar nach seinem Tod in dem Haus versammelt. Nicht einmal eine richtige Beerdigung hatte stattgefunden, bei der wir über unseren Verlust hätten trauern können; Ma hatte uns mitgeteilt, dass er darauf bestanden habe, ohne Trauerfeier auf See beigesetzt zu werden.
Sein Schweizer Anwalt Georg Hoffman hatte uns etwas präsentiert, das auf den ersten Blick aussah wie eine komplizierte Sonnenuhr und über Nacht in Pa Salts besonderem Garten aufgetaucht war. Georg hatte uns erklärt, dass es sich um eine sogenannte »Armillarsphäre« handle, die die Position der Sterne angebe. Auf den Bändern, die sich um die goldene Kugel in der Mitte wanden, standen alle unsere Namen und daneben Koordinaten, die uns verrieten, wo Pa Salt uns gefunden hatte, dazu ein Spruch auf Griechisch.
Meine älteren Schwestern Maia und Ally hatten uns anderen die zu den Koordinaten gehörigen Orte und die Bedeutungen der griechischen Inschriften aufgeschrieben. Meine hatte ich beide noch nicht gelesen, sondern zusammen mit dem Brief von Pa Salt in eine Plastikmappe gesteckt.
Als das Boot langsamer wurde, erhaschte ich zwischen den Bäumen hindurch kurze Blicke auf das prächtige Gebäude, in dem wir aufgewachsen waren. Mit seinen fahl rosafarbenen Mauern und den vier Türmen, deren Fenster im Sonnenlicht funkelten, wirkte es wie ein Märchenschloss.
Nachdem Georg Hoffman uns die Armillarsphäre gezeigt und die Briefe gegeben hatte, war CeCe sofort verschwunden. Ich hingegen war geblieben, weil ich noch Zeit in dem Haus verbringen wollte, in dem Pa Salt mich mit so viel Liebe aufgezogen hatte. Nun, zwei Wochen später, war ich wieder in »Atlantis«, in dessen Abgeschiedenheit ich nach der Kraft suchte, die ich brauchte, um mich mit seinem Tod abfinden zu können.
Christian lenkte das Boot zur Anlegestelle, machte es fest und half mir heraus. Ich sah Ma über den Rasen auf mich zukommen, wie jedes Mal, wenn ich nach Hause zurückkehrte. Tränen traten mir in die Augen, als sie mich umarmte.
»Star, wie schön, dich wieder bei mir zu haben«, begrüßte sie mich, küsste mich auf beide Wangen und trat einen Schritt zurück, um mich zu betrachten. »Ich sage jetzt nicht, dass du zu dünn bist, denn das ist nichts Neues«, bemerkte sie schmunzelnd und ging mir zum Haus voran. »Claudia hat einen Apfelstrudel gebacken, den magst du doch so gern, und das Teewasser ist aufgesetzt.« Sie deutete auf den Tisch auf der Terrasse. »Setz dich und genieß die letzten Sonnenstrahlen. Ich trage deine Tasche hinein und bitte Claudia, Tee und Strudel herauszubringen.«
Ich blickte ihr nach, wie sie im Haus verschwand, und wandte mich dann den üppigen Gärten und dem frisch gemähten Rasen zu. Christian sah ich auf dem halb verborgenen Weg zu der Wohnung über dem Bootshaus gehen, das in einer kleinen Bucht hinter dem größten Garten des Hauses lag. Die Maschine von »Atlantis« lief weiter wie geschmiert, auch wenn ihr Schöpfer nicht mehr dort weilte.
Da kehrte Ma bereits mit Claudia, die ein Teetablett in den Händen hielt, zu mir zurück. Ich begrüßte Claudia, die noch schweigsamer war als ich und niemals von sich aus ein Gespräch anfing, mit einem Lächeln.
»Hallo, Claudia. Wie geht’s?«
»Gut, danke«, antwortete sie mit starkem deutschem Akzent. Wir Mädchen waren auf Pas Wunsch zweisprachig mit Englisch und Französisch aufgewachsen; mit Claudia unterhielten wir uns ausschließlich auf Englisch. Ma hingegen war durch und durch Französin. Das erkannte man schon an ihrer Kleidung, der gepflegten Seidenbluse und dem Rock, sowie an ihren zu einem eleganten Knoten geschlungenen Haaren. Da wir mit ihnen beiden kommunizieren mussten, waren wir Mädchen in der Lage, mühelos zwischen den Sprachen hin- und herzuwechseln.
»Wie ich sehe, hast du dir die Haare nach wie vor nicht schneiden lassen«, bemerkte Ma und deutete auf meinen langen blonden Pony. »Also: Wie geht es dir,chérie?« Sobald Claudia sich entfernt hatte, goss sie uns den Tee ein.
»So weit gut.«
»Mir ist klar, dass das nicht sein kann. Wir fühlen uns alle nicht gut. So kurz nach diesem schrecklichen Ereignis ist das einfach nicht möglich.«
»Stimmt«, pflichtete ich ihr bei, als sie mir die Tasse mit dem Tee reichte und ich Milch und drei Löffel Zucker hineingab. Obwohl ich so schmal war und meine Schwestern mich deswegen gern neckten, liebte ich Süßigkeiten.
»Wie geht’s CeCe?«
»Sie behauptet, gut, aber ob das stimmt, weiß ich nicht.«
»Menschen trauern unterschiedlich«, meinte Ma. »Und oft führt Trauer zu Veränderungen. Weißt du, dass Maia nach Brasilien geflogen ist?«
»Ja, sie hat CeCe und mir vor ein paar Tagen eine Mail geschickt. Hast du eine Ahnung, warum?«
»Ich vermute, es hat mit ihrem Brief von eurem Vater zu tun. Doch egal, was der Grund ist: Ich freue mich für sie. Es wäre furchtbar gewesen, wenn sie hier allein um ihn getrauert hätte. Sie ist zu jung, um sich zu verkriechen. Du weißt ja selbst, dass Reisen den Horizont erweitert.«
»Stimmt. Aber jetzt reicht es.«
»Tatsächlich?«
Ich nickte. Plötzlich spürte ich, wie sehr mich dieses Gespräch anstrengte. Normalerweise wäre CeCe an meiner Seite gewesen und hätte für uns beide gesprochen. Doch da Ma schwieg, musste ich weiterreden.
»Ich habe genug von der Welt gesehen.«
»Das kann ich mir vorstellen«, sagte Ma schmunzelnd. »Gibt es überhaupt noch einen Winkel der Erde, den ihr in den letzten Jahren nicht bereist habt?«
»Australien und den Amazonas.«
»Warum wart ihr da nicht?«
»Weil CeCe schreckliche Angst vor Spinnen hat.«
»Natürlich!« Ma klatschte in die Hände, als sie sich erinnerte. »Obwohl sie sich als Kind vor nichts gefürchtet hat. Sie ist von den höchsten Felsen ins Meer gesprungen.«
»Oder hinaufgeklettert«, fügte ich hinzu.
»Erinnerst du dich, wie lange sie unter Wasser die Luft anhalten konnte? Manchmal hatte ich fast Angst, dass sie ertrunken ist.«
»Ja«, antwortete ich mit düsterer Miene, weil ich daran denken musste, wie sie auch mich zu extremen sportlichen Aktivitäten zu überreden versucht hatte. Das gehörte zu den wenigen Dingen, bei denen ich mich weigerte, ihr Gesellschaft zu leisten. Während unserer Reisen im Fernen Osten war sie stundenlang getaucht oder die steilen Vulkankegel in Thailand oder Vietnam hinaufgeklettert. Doch egal, ob sie sich im Wasser aufhielt oder hoch oben auf einem Berg: Ich war mit einem Buch am Strand geblieben.
»Sie hat immer so ungern Schuhe getragen … Als sie klein war, musste ich sie dazu zwingen«, erzählte Ma.
»Einmal hat sie sie sogar in den See geworfen.« Ich deutete auf die ruhige Wasseroberfläche. »Ich musste sie beknien, dass sie sie wieder rausholt.«
»Sie hat sich noch nie was sagen lassen«, seufzte Ma. »Und sie ist mutig … Allerdings habe ich eines Tages, sie dürfte etwa sieben gewesen sein, einen lauten Schrei aus eurem Zimmer gehört und gedacht, jemand will ihr ans Leben. Aber nein: Es war bloß eine Spinne, so groß wie eine Zwanzig-Centime-Münze, an der Decke über ihr. Wer hätte das gedacht?« Sie schüttelte verwundert den Kopf.
»Außerdem fürchtet sie sich im Dunkeln.«
»Das wusste ich gar nicht.« Ma sah mich erstaunt an, diese Frau, die von Pa Salt eingestellt worden war, damit sie sich auch in seiner Abwesenheit um uns adoptierte Schwestern kümmerte. Dank ihrer Fürsorge waren wir zu Teenagern und jungen Frauen herangewachsen. Sie war mit keiner von uns blutsverwandt, bedeutete uns allen jedoch sehr viel.
»Sie redet nicht gern über ihre schlimmen Albträume.«
»Bist du deswegen zu ihr ins Zimmer gezogen?«, fragte Ma, die zu begreifen begann. »Und hast du mich deshalb kurz danach um ein Nachtlicht gebeten?«
»Ja.«
»Ich dachte, das ist für dich, Star. Was wieder mal beweist, dass wir die Kinder, die wir großziehen, doch nicht so gut kennen, wie wir glauben. Aber sag: Wie gefällt’s dir in London?«
»Gut, allerdings sind wir noch nicht lange dort. Und …« Ich seufzte, weil ich nicht in der Lage war, meinen Kummer in Worte zu fassen.
»Du bist traurig«, führte Ma den Satz für mich zu Ende. »Vermutlich hast du das Gefühl, dass es momentan letztlich egal ist, wo du bist.«
»Ja, doch ich wollte hierherkommen.«
»Und mir ist es eine große Freude, dich bei mir zu haben, chérie, ganz für mich. Allzu oft passiert das nicht, was?«
»Nein.«
»Würdest du dir das häufiger wünschen, Star?«
»Ich … ja.«
»Das ist eine ganz natürliche Entwicklung. Du und CeCe, ihr seid keine Kinder mehr. Was nicht bedeutet, dass ihr euch nicht weiterhin nahe sein könnt. Aber es ist wichtig für euch, ein eigenes Leben zu haben. Bestimmt empfindet CeCe das auch so.«
»Nein, Ma. Sie braucht mich. Ich kann sie nicht im Stich lassen«, platzte es aus mir heraus, weil die Frustration, Angst und … Wut über mich selbst und die Situation übermächtig wurden. Obwohl ich sonst sehr gut in der Lage war, mich zu beherrschen, konnte ich ein lautes Schluchzen nicht zurückhalten.
»Ach, chérie.« Ma erhob sich, kniete vor mir nieder und ergriff meine Hände. »Kein Grund, sich zu schämen. Es ist gut, Gefühle herauszulassen.«
Und das tat ich. Weinen konnte man das nicht mehr nennen, eher schon heulen, als all die unausgesprochenen Worte und Emotionen sich Bahn brachen.
»Entschuldige …«, murmelte ich, und Ma holte eine Packung Papiertaschentücher hervor, um mir die Tränen abzuwischen. »Das mit Pa geht mir an die Nieren …«
»Dafür musst du dich nicht entschuldigen«, sagte sie sanft. »Mich beschäftigt schon länger, dass du so vieles nicht herauslässt. Weswegen ich jetzt froh bin, auch wenn du das möglicherweise anders siehst. Ich würde vorschlagen, du gehst nach oben und machst dich fürs Abendessen frisch.«
Ich folgte ihr ins Haus, in dem mir immer ein ganz besonderer Geruch in die Nase stieg. Diesen Geruch hatte ich schon oft in seine Bestandteile zu zerlegen versucht, sodass ich ihn in meine eigenen vier Wände mitnehmen könnte – ein Hauch Zitrone, Zedernholz, dazu frisch gebackener Kuchen … Doch natürlich war er mehr als die Summe seiner Einzelteile und fest mit »Atlantis« verbunden.
»Soll ich dich nach oben begleiten?«, fragte Ma, als ich die Treppe betrat.
»Nein, ich komme zurecht.«
»Wir unterhalten uns später weiter, chérie. Du weißt, wo ich bin, wenn du mich brauchst.«
Ich erreichte das Obergeschoss, wo sich die Zimmer von uns Mädchen befanden. Ma hatte dort ebenfalls ihren Bereich mit einem eigenen kleinen Wohnraum und einem Bad. Das Zimmer, das ich mir mit CeCe teilte, lag zwischen dem von Ally und dem von Tiggy. Als ich die Tür öffnete, schmunzelte ich über die Farbe der Wände. Mit fünfzehn hatte CeCe eine »Gothic«-Phase durchgemacht und sie schwarz anmalen wollen, doch damit war ich nicht einverstanden gewesen. Als Kompromiss hatte ich lila vorgeschlagen. Am Ende hatte CeCe darauf bestanden, wenigstens die Wand an ihrem Bett selbst zu gestalten.
Nach einem Tag, an dem CeCe sich in unserem Zimmer eingeschlossen hatte, war sie kurz vor Mitternacht mit rot geränderten Augen herausgekommen.
»Jetzt kannst du’s anschauen«, hatte sie gesagt und mich hineingeschoben.
Drinnen hatten mich die kräftigen Farben überrascht: ein tiefblauer Hintergrund mit helleren himmelblauen Einsprengseln und in der Mitte ein leuchtend goldener Sternenhaufen. Ich wusste sofort, was CeCe gemalt hatte: das Siebengestirn der Plejaden … uns.
Als meine Augen sich an das Licht in dem Raum gewöhnt hatten, war mir klar geworden, dass jeder Stern aus winzigen, präzise angeordneten Punkten bestand, die das Ganze zum Leben erweckten.
Ich hatte gespürt, wie sie hinter mir nervös auf mein Urteil wartete.
»CeCe, das ist unglaublich! Wie bist du auf diese Idee gekommen?«
»Es war einfach …«, sie hatte mit den Achseln gezuckt, »… mir war klar, was ich machen muss.«
Seitdem hatte ich viel Zeit gehabt, diese Wand von meinem Bett aus zu betrachten und immer wieder neue Details zu entdecken.
Doch trotz der Begeisterung von uns Schwestern und Pa hatte CeCe nie wieder in diesem Stil gemalt.
»Ach, das ist mir so eingefallen. Inzwischen hab ich mich weiterentwickelt«, hatte sie erklärt.
Noch jetzt, zwölf Jahre später, hielt ich diese Wandmalerei für das schönste und originellste Kunstwerk, das CeCe je geschaffen hatte.
Da meine Tasche bereits für mich ausgepackt war und meine wenigen Kleidungsstücke ordentlich auf dem Stuhl lagen, setzte ich mich aufs Bett. Plötzlich überkam mich ein unbehagliches Gefühl. In dem Zimmer befand sich fast nichts von mir. Und das war allein meine Schuld.
Ich trat an meine Kommode, zog die unterste Schublade heraus und nahm die alte Keksdose mit meinen wertvollsten Besitztümern in die Hand. Damit kehrte ich zum Bett zurück, stellte sie auf meine Knie und öffnete den Deckel. Weil der Umschlag darin bereits siebzehn Jahre in der Dose war, fühlte er sich unter meinen Fingern trocken und glatt an, als ich die Karte aus dickem Papier herausholte, an der eine getrocknete Blume befestigt war.
Liebste Star, nun ist es uns doch noch gelungen, sie bei uns zum Blühen zu bringen.
Pa X
Meine Finger glitten über die zarten, hauchdünnen Blütenblätter, die nach wie vor das tiefe Weinrot erahnen ließen, in dem unsere Blume in dem Garten, den ich in den Schulferien mit Pa angelegt hatte, erstrahlt war.
Für die Gartenarbeit hatte ich früh aufstehen müssen, bevor CeCe aufwachte. Besonders nach ihren Albträumen, die sie für gewöhnlich zwischen zwei und vier Uhr früh quälten, schlief sie tief und fest, weswegen sie meine frühmorgendlichen Abwesenheiten nie bemerkte. Pa, der wirkte, als wäre er schon seit Stunden wach, erwartete mich bereits im Garten, und ich war trotz meiner Müdigkeit gespannt, was er mir zeigen würde.
Manchmal handelte es sich lediglich um ein paar Samenkörner in seiner Hand, dann wieder um einen empfindlichen Setzling, den er von seinen Reisen mitgebracht hatte. Auf der Bank in der Rosenlaube blätterte er mit seinen kräftigen, gebräunten Fingern so lange in seinem dicken, alten Bestimmungsbuch, bis wir wussten, woher unser Schatz stammte. Wenn wir uns dann darüber informiert hatten, was die Pflanze brauchte und mochte, sahen wir uns im Garten nach dem besten Platz dafür um.
Letztlich, dachte ich jetzt, hatte immer er etwas vorgeschlagen und ich ihm zugestimmt. Aber so hatte es sich nie angefühlt. Ich hatte stets das Gefühl gehabt, dass meine Meinung zählte.
Oft musste ich an eine Stelle aus der Bibel denken, über die er einmal bei der Gartenarbeit mit mir gesprochen hatte: dass jedes Lebewesen von Anfang an sorgfältig gehegt und gepflegt werden müsse. Erhalte es diese Pflege, gedeihe es und könne viele Jahre überdauern.
»Wir Menschen sind wie Samenkörner«, hatte Pa schmunzelnd bemerkt, als er die torfige Erde von seinen Fingern wischte und ich die Pflanze mit meiner Kindergießkanne wässerte. »Sonne und Regen … und Liebe, mehr ist nicht nötig.«
Unser Garten war tatsächlich prächtig gewesen. Während dieser Morgensitzungen mit Pa hatte ich Geduld gelernt. Wenn ich manchmal ein paar Tage später zu der Stelle zurückkehrte, an der wir eine Pflanze eingesetzt hatten, um nachzusehen, wie sie sich entwickelte, musste ich feststellen, dass alles unverändert oder die Pflanze braun und welk war. Dann fragte ich Pa, warum sich nichts tat.
»Star«, sagte er und wölbte seine wettergegerbten Hände um mein Gesicht, »was dauerhaft Wert besitzen soll, braucht Zeit. Und sobald es gedeiht, wirst du dich freuen, dass du nicht aufgegeben hast.«
Weswegen ich morgen früh aufstehen und in unseren Garten gehen werde, dachte ich und schloss die Dose.
* * *
An jenem Abend aßen Ma und ich an dem von Kerzen erhellten Tisch auf der Terrasse. Claudia hatte uns ein wunderbares Lammkarree mit Babykarotten und frischem Brokkoli aus dem Küchengarten zubereitet. Je mehr ich über die Kochkunst lernte, desto klarer wurde mir, was für eine begnadete Köchin sie war.
Nach dem Essen wandte Ma sich mir zu. »Hast du schon entschieden, wo du dich niederlassen wirst?«
»CeCe macht ihren Kunstkurs in London.«
»Das weiß ich, aber ich frage dich, Star.«
»Sie ist gerade dabei, eine Wohnung mit Blick auf die Themse zu kaufen. Nächsten Monat ziehen wir ein.«
»Verstehe. Gefällt sie dir?«
»Sie ist … ziemlich groß.«
»Danach habe ich mich nicht erkundigt.«
»Ich kann dort leben, Ma. Sie ist wirklich toll«, fügte ich aus schlechtem Gewissen über meine mangelnde Begeisterung hinzu.
»Und du willst deinen Kochkurs besuchen, während CeCe sich mit der Kunst beschäftigt?«
»Ja.«
»Als du jünger warst, dachte ich, du würdest vielleicht Schriftstellerin werden«, erklärte Ma. »Schließlich hast du deinen Abschluss in englischer Literatur gemacht.«
»Ja, ich liebe Bücher.«
»Star, du stellst dein Licht unter den Scheffel. Ich erinnere mich gut an die Geschichten, die du dir als Kind ausgedacht hast. Pa hat sie mir manchmal vorgelesen.«
»Ach, tatsächlich?« Das erfüllte mich mit Stolz.
»Ja. Und den Studienplatz in Cambridge hast du nicht angenommen.«
»Stimmt.« Ich merkte, wie abweisend das klang, weil es mich nach neun Jahren immer noch schmerzte …
»Dir macht’s doch nichts aus, wenn ich mich um einen Studienplatz in Cambridge bewerbe, oder, Cee?«, hatte ich meine Schwester gefragt. »Meine Lehrer raten mir dazu.«
»Natürlich nicht, Sia. Du bist so klug, bestimmt nehmen sie dich! Ich informier mich auch über Unis in England, bezweifle aber, dass mich irgendeine will. Du weißt ja, wie dumm ich mich anstelle. Wenn’s nicht klappt, begleite ich dich einfach und such mir einen Job in ’ner Kneipe oder so was«, hatte sie achselzuckend gesagt. »Das Wichtigste ist doch, dass wir zusammen sind, meinst du nicht?«
Damals hatte ich das tatsächlich gedacht. Zu Hause und im Internat, wo die anderen Mädchen unsere enge innere Verbindung spürten und uns in Ruhe ließen, hatten wir uns selbst genügt. Weswegen wir uns auf Universitäten einigten, die geeignete Kurse für uns beide anboten, sodass wir zusammenbleiben konnten. Außerdem bewarb ich mich in Cambridge, wo mir zu meiner Überraschung tatsächlich ein Platz am Selwyn College angeboten wurde, vorausgesetzt, ich schaffte in der Abschlussprüfung die erforderlichen Noten.
An Weihnachten hatte Pa in seinem Arbeitszimmer die Mitteilung des Colleges gelesen, stolz den Blick gehoben und auf die kleine Tanne mit dem alten Christbaumschmuck gedeutet, auf der ganz oben ein leuchtender Stern aus Silber prangte.
»Es hat geklappt«, hatte er lächelnd gesagt. »Wirst du das Angebot annehmen?«
»Ich weiß es nicht. Zuerst muss ich sehen, was mit CeCe wird.«
»Es ist deine Entscheidung. Aber irgendwann solltest du anfangen, das zu tun, was für dich richtig ist.«
Kurz darauf hatten CeCe und ich jeweils zwei Angebote von Universitäten erhalten, an denen wir uns beide beworben hatten, dann absolvierten wir unsere Prüfungen und warteten gespannt auf die Ergebnisse.
Zwei Monate später hatten CeCe und ich auf dem mittleren Deck der Titan, Pas prächtiger Jacht, auf der wir unsere jährliche Fahrt mit unseren Schwestern – diesmal um die französische Südküste – machten, nervös die Umschläge mit unseren Abschlussnoten in Händen gehalten. Sie waren uns gerade von dem Stapel Post gereicht worden, die jeden zweiten Tag per Schnellboot gebracht wurde, egal, wo wir uns mit Pa auf den Weltmeeren aufhielten.
»Und, Mädchen«, hatte Pa über unsere Anspannung schmunzelnd gefragt, »wollt ihr sie hier öffnen oder lieber, wenn ihr allein seid?«
»Bringen wir’s hinter uns«, hatte CeCe geanwortet. »Mach du deinen zuerst auf, Star. Ich bin wahrscheinlich sowieso durchgefallen.«
Ich hatte, aller Augen auf mich gerichtet, mit zitternden Fingern das Kuvert geöffnet.
»Und?«, hatte Maia nach einer Weile gefragt.
»Ich hab einen Schnitt von 1,6 … und eine 1 in Englisch.«
Applaus, dann hatten meine Schwestern mich eine nach der anderen umarmt.
»Jetzt bist du dran, CeCe«, hatte Elektra, unsere jüngste Schwester, sie mit funkelnden Augen aufgefordert. Uns anderen war klar, dass CeCe in der Schule aufgrund ihrer Legasthenie zu kämpfen gehabt hatte, wogegen Elektra jede Prüfung schaffen konnte, wenn sie ihre Faulheit überwand.
»Ist mir egal, was drinsteht«, hatte CeCe gesagt, und ich hatte ihr in Gebärdensprache signalisiert, dass ich ihr Glück wünsche. Während ich den Atem anhielt, hatte sie den Umschlag aufgerissen und ihre Ergebnisse überflogen.
»O mein Gott!«
Wir hatten sie gespannt angesehen.
»Ich hab’s geschafft! Star, ich hab’s geschafft! Ich kann Kunstgeschichte in Sussex studieren.«
»Das ist ja toll!«, hatte ich ausgerufen, weil ich wusste, wie fleißig sie gewesen war, und dann Pas fragenden Blick bemerkt. Ihm war klar, vor was für einer schwierigen Entscheidung ich nun stand.
»Gratuliere, Liebes«, hatte Pa Salt gesagt und CeCe ein Lächeln geschenkt. »Sussex ist ein wunderschönes Fleckchen Erde. Dort befinden sich übrigens auch die Seven-Sisters-Klippen.«
* * *
Später hatten CeCe und ich vom oberen Deck der Jacht aus den herrlichen Sonnenuntergang über dem Mittelmeer betrachtet.
»Ich könnte es verstehen, wenn du das Angebot von Cambridge annimmst, Sia, und nicht mit mir nach Sussex gehst. Ich möchte dir nicht im Weg stehen. Aber …«, ihre Unterlippe hatte zu beben begonnen, »… ich weiß nicht, was ich ohne dich anfangen soll. Keine Ahnung, wie ich die Seminararbeiten ohne deine Hilfe schreiben kann.«
In jener Nacht hatte ich gehört, wie CeCe sich unruhig herumwälzte, weil wieder einer ihrer schrecklichen Albträume sie plagte. Also war ich zu ihr unter die Decke geschlüpft, um sie zu beruhigen. Ihr Stöhnen war lauter geworden, und sie hatte angefangen, unverständliches Zeug zu kreischen.
Wie könnte ich sie im Stich lassen? Sie braucht mich… und ich brauche sie…
Damals hatte das noch gestimmt.
Also hatte ich das Angebot von Cambridge ausgeschlagen und das von Sussex angenommen, um mit meiner Schwester dort zu studieren. Doch im dritten Semester hatte CeCe verkündet, dass sie das Studium hinschmeißen würde.
»Das kannst du doch verstehen, oder, Sia?«, hatte sie mich gefragt. »Ich kann malen und zeichnen, aber nicht für viel Geld eine Seminararbeit über die Maler der Renaissance und ihre endlosen Madonnendarstellungen schreiben. Das schaffe ich nicht. Tut mir leid, es geht einfach nicht.«
Daraufhin hatten CeCe und ich unser gemeinsames Zimmer auf dem Campus aufgegeben und zusammen eine düstere Wohnung gemietet. Während ich Vorlesungen besuchte, war sie mit dem Bus nach Brighton gefahren, um dort als Kellnerin zu jobben.
In dem Jahr hatte ich immerzu verzweifelt an meinen unerfüllten Traum gedacht.
III
Nach dem Essen zog ich mich in mein Zimmer zurück, nahm mein Handy aus dem Rucksack, um die Nachrichten darauf zu überprüfen, und sah, dass sich vier SMS und eine Reihe von Anrufen in Abwesenheit darauf befanden – alle von CeCe. Wie versprochen, hatte ich ihr gleich nach der Landung des Flugzeugs in Genf eine SMS geschickt, und nun sandte ich ihr eine kurze Antwort, in der ich ihr mitteilte, dass es mir gutgehe, ich mich früh schlafen legen wolle und wir am folgenden Tag telefonieren würden. Danach schaltete ich das Telefon aus, kroch unter die Bettdecke und lauschte auf die Stille. Dabei wurde mir bewusst, wie selten ich allein in einem Zimmer schlief, noch dazu in einem leeren Haus, in dem es früher immer laut und lebhaft zugegangen war. In dieser Nacht würde CeCes Gemurmel mich nicht aufwecken; ich konnte so lange schlafen, wie ich wollte.
Doch als ich die Augen zumachte, fehlte sie mir.
* * *
Am folgenden Morgen stand ich früh auf, schlüpfte in Jeans und Kapuzenshirt und schlich mit der Plastikmappe nach unten. Nachdem ich leise die Haustür geöffnet hatte, ging ich, die Plastikmappe mit dem Brief, den Koordinaten und der übersetzten griechischen Inschrift fest in der Hand, zu Pa Salts besonderem Garten.
Ich schlenderte an den Beeten entlang, die wir gemeinsam bepflanzt hatten, um die Fortschritte unserer Schützlinge zu begutachten. Im Juli erstrahlten sie in voller Blüte: bunte Zinnien, lilafarbene Astern, wohlriechende Wicken, die sich wie winzige Schmetterlinge zu Gruppen scharten, sowie die Rosen an der Laube über der Bank.
Da wurde mir klar, dass nun nur noch ich mich darum kümmern würde. Obwohl Hans, unser betagter Gärtner, die Pflanzen betreute, wenn Pa und ich nicht da waren, konnte ich mir nicht sicher sein, dass er sie so liebte wie wir. Eigentlich war es albern, die Pflanzen als Kinder zu betrachten. Doch wie Pa mir oft genug gesagt hatte, unterschied sich ihre Pflege nicht allzu sehr von der bei Menschenkindern.
Ich blieb stehen, um eines meiner Lieblingsgewächse mit zarten purpurroten Blüten zu bewundern, die an dünnen Stielen über dichten grünen Blättern sprießten.
»Sie heißt Astrantia major«, hatte Pa beim Einsetzen der winzigen Samen beinahe zwei Jahrzehnte zuvor gesagt. »Der Name leitet sich vom lateinischen Wort für ›Stern‹ ab. Sie hat prächtige sternförmige Blüten. Leider ist es gar nicht so leicht, sie zu ziehen, weil ich diese Samen aus einem fernen Land mitgebracht habe und sie alt und trocken sind. Aber wenn es uns gelingt, müssen wir uns nicht mehr intensiv darum kümmern, sie braucht nur gute Erde und wenig Wasser.«
Einige Monate später war Pa mit mir in einen schattigen Winkel des Gartens gegangen, um die Sämlinge einzusetzen, die nach liebevoller Pflege einschließlich eines kurzen Aufenthalts im Kühlschrank, der, wie Pa meinte, nötig sei, um die Samen »zum Leben zu erwecken«, tatsächlich aufgingen.
»Jetzt müssen wir uns in Geduld üben und hoffen, dass sie ihr neues Zuhause mag«, hatte er gesagt, als wir die Erde von unseren Händen wischten.
Es hatte zwei Jahre gedauert, bis die Astrantia blühte, doch seit damals hatte sie sich fleißig vermehrt und sich im Garten verbreitet. Ich pflückte eine und ließ die Finger über die zarten Blütenblätter gleiten. Pa fehlte mir so sehr.
Kurz darauf ging ich zu der Bank in der Rosenlaube. Weil das Holz noch mit Morgentau bedeckt war, trocknete ich es mit dem Ärmel ab. Als ich mich setzte, hatte ich das Gefühl, dass die Feuchtigkeit sich schwer auf meine Seele legte.
Ich warf einen Blick auf die Plastikmappe mit den Umschlägen und fragte mich, ob es ein Fehler gewesen war, CeCe den Wunsch abzuschlagen, dass wir unsere Kuverts gemeinsam öffneten.
Mit zitternden Fingern nahm ich Pas Umschlag aus der Mappe und riss ihn, tief Luft holend, auf. Darin befanden sich ein Brief sowie ein kleines, schmales Schmucketui. Ich entfaltete den Brief und begann zu lesen.
»Atlantis«
Genfer See
Schweiz
Meine liebste Star,
am natürlichsten erscheint es mir, Dir zu schreiben, da dies, wie wir beide wissen, Deine bevorzugte Form der Kommunikation ist. Bis zum heutigen Tag bewahre ich all die langen Briefe auf, die Du mir aus dem Internat, während des Studiums und hinterher von Deinen zahlreichen Reisen in ferne Weltgegenden geschickt hast.
Wie Du inzwischen vermutlich weißt, habe ich mich bemüht, Euch ausreichend Informationen über Eure Herkunft zu hinterlassen. Obwohl ich mir gern einreden würde, dass Ihr tatsächlich meine leiblichen Kinder seid und genauso Teil von mir wie solche, könnte eine Zeit kommen, in der meine Hinweise Euch nützen werden, mehr über Eure Geschichte herauszufinden. Doch mir ist klar, dass unter Umständen nicht alle meine Töchter sich auf diese Reise begeben möchten. Besonders Du, meine liebste Star– das vielleicht sensibelste und vielschichtigste meiner Mädchen.
Für diesen Brief habe ich am längsten gebraucht– zum Teil deshalb, weil er auf Englisch verfasst ist, nicht auf Französisch, und ich weiß, dass Du mir in dieser Sprache sowohl in der Grammatik als auch in der Interpunktion weit überlegen bist, also bitte verzeih eventuelle Fehler. Aber auch weil es mir schwerfällt, Dir gerade genug Informationen an die Hand zu geben, um Deine Nachforschungen in die richtige Richtung zu lenken, ohne Dein Leben aus der Bahn zu werfen, falls Du beschließen solltest, keine Recherchen über Deine Herkunft anzustellen.
Interessanterweise handelt es sich bei den Hinweisen, die ich Deinen Schwestern geben konnte, zum größten Teil um greifbare Dinge, während Deine mit verbaler Kommunikation zu tun haben, denn der Pfad zu Deinen Ursprüngen wurde im Lauf der Jahre sorgfältig verwischt. Du wirst die Hilfe anderer benötigen, um ihn beschreiten zu können. Ich habe die Wahrheit selbst erst vor Kurzem herausgefunden. Wenn es irgendjemandem gelingen sollte, sie ebenfalls zu entdecken, dann Dir, meiner klugen Star. Dein scharfer Verstand und Deine Menschenkenntnis– die Du Dir durch jahrelanges Beobachten und Zuhören erworben hast– werden Dir von Nutzen sein, wenn Du Dich entscheiden solltest, dieser Spur zu folgen.
Als Anhaltspunkt gebe ich Dir eine Adresse– sie steht auf der diesem Brief beigefügten Karte. Frag nach einer Frau namens Flora MacNichol, falls Du beschließen solltest, diese Adresse aufzusuchen.
Bevor ich mich von Dir verabschiede, möchte ich Dir noch sagen, dass man im Leben bisweilen schwierige und schmerzliche Entscheidungen treffen muss, mit denen man geliebte Menschen verletzt. Oft jedoch erweisen sich die daraus resultierenden Veränderungen auch für andere als die beste Lösung und helfen ihnen, sich weiterzuentwickeln.
Meine liebste Star, mehr brauche ich nicht zu erklären; wir wissen beide, was ich meine. Im Lauf meines Lebens habe ich gelernt, dass nichts auf ewig so bleiben kann, wie es ist– das zu erwarten ist der größte Fehler, den wir Menschen machen können. Veränderungen ereignen sich, egal, ob wir sie wollen oder nicht. Das muss man akzeptieren, um sich über das Dasein auf unserer wunderbaren Erde freuen zu können.
Kümmere Dich nicht nur um den herrlichen Garten, den wir gemeinsam angelegt haben, sondern vielleicht auch um Deinen eigenen an einem anderen Ort. Und vor allen Dingen: Kümmere Dich um Dich selbst. Und folge Deinem Stern, denn der Zeitpunkt dazu ist gekommen.
Dein Dich liebender Vater,
Pa Salt X
Als ich den Blick zum Horizont hob, lugte die Sonne hinter einer Wolke über dem See hervor und vertrieb die Schatten. Ich fühlte mich benommen und niedergeschlagener als vor dem Öffnen des Briefes. Vielleicht lag das an meinen überzogenen Erwartungen, denn in dem Brief stand nur wenig, worüber Pa und ich nicht schon zu seinen Lebzeiten geredet hätten. Damals, als ich bei der Gartenarbeit noch in seine freundlichen Augen schauen und die sanfte Berührung seiner Hand auf meiner Schulter hatte spüren können.
Ich löste die Büroklammer, mit der die Visitenkarte an dem Brief befestigt war, und las, was darauf stand.
Arthur Morston Books
Kensington Church Street 190
London W8 4DS
Ich erinnerte mich, dass ich einmal mit dem Bus durch Kensington gefahren war. Wenn ich Arthur Morston aufsuchen wollte, würde ich also immerhin nicht um die halbe Welt reisen müssen wie Maia. Ich nahm den Spruch von der Armillarsphäre zur Hand, den Maia für mich übersetzt hatte:
Eiche und Zypresse gedeihen nicht im Schatten des jeweils anderen.
Ich schmunzelte, weil das Bild das Verhältnis von CeCe und mir so treffend beschrieb. Sie war stark und unerschütterlich und stand mit beiden Beinen fest auf dem Boden. Ich hingegen war so hoch aufgeschossen, dass jeder Windstoß mich ins Wanken brachte. Ich kannte das Zitat. Es stammte aus Der Prophet des Philosophen und Schriftstellers Khalil Gibran. Mir war auch klar, wer sich – zumindest auf den ersten Blick – »im Schatten« befand …
Nur wusste ich nicht, wie es mir gelingen sollte, in die Sonne zu treten.
Nachdem ich das Blatt Papier mit dem Zitat gefaltet und in den Umschlag zurückgesteckt hatte, nahm ich den mit den von Ally für uns entschlüsselten Koordinaten. Von allen Hinweisen machte mir dieser am meisten Angst.
Wollte ich wirklich erfahren, wo Pa mich entdeckt hatte?
Im Moment noch nicht, weil ich mir wünschte, weiter zu Pa und »Atlantis« zu gehören.
Ich schob das Kuvert in die Plastikmappe zurück, holte das Schmucketui heraus und öffnete es.
Darin befand sich eine kleine schwarze Tierfigur, vielleicht aus Onyx, auf einem schmalen Silbersockel. Ich nahm sie heraus. Als ich sie umdrehte, entdeckte ich auf der Unterseite eine Punze sowie ein eingraviertes Wort.
Panther
In den Augenhöhlen steckten winzige bernsteinfarbene Steine, die mich in der schwachen Morgensonne anfunkelten.
»Wem hast du gehört? Und in welcher Beziehung standen deine Besitzer zu mir?«, fragte ich mit leiser Stimme.
Nachdem ich den Panther in das Etui zurückgelegt hatte, erhob ich mich und trat zu der Armillarsphäre. Das letzte Mal war ich mit meinen Schwestern davorgestanden. Wir hatten uns gefragt, was sie bedeutete und warum Pa sie uns hinterlassen hatte. Ich betrachtete die goldene Kugel in der Mitte und die silbernen Bänder, die sie elegant umfassten. Sie war fein gearbeitet; die Umrisse der Kontinente ragten stolz aus den sieben Weltmeeren hervor. Ich las die griechischen Namen meiner Schwestern – Maia, Alkyone, Celaeno, Taygeta, Elektra … und natürlich den meinen: Asterope.
Was ist ein Name?, zitierte ich Shakespeares Julia und überlegte wie so oft, ob wir die Persönlichkeiten unserer mythischen Namensgeberinnen angenommen oder ob diese Namen uns adoptiert hatten. Anders als bei meinen Schwestern schien nicht sonderlich viel über den Charakter meiner Namensvetterin bekannt zu sein. Manchmal fragte ich mich, ob ich mich deshalb im Kreis meiner Schwestern so unsichtbar fühlte.
Maia, die Schöne; Ally, die Anführerin; CeCe, die Pragmatikerin; Tiggy, die Fürsorgliche; Elektra, die Temperamentvolle … und ich. Offenbar war mir die Rolle der Friedensstifterin zugedacht.
Wenn Schweigen bedeutet, dass Frieden herrscht, stimmte das wohl. Und wenn man von Geburt an auf diese Rolle festgelegt ist, versucht man, sie auszufüllen. Bei meinen Schwestern bestand jedenfalls keinerlei Zweifel daran, dass sie zu den Persönlichkeiten ihrer mythischen Vorbilder passten.
Merope…
Als mein Blick auf das siebte Band fiel, trat ich näher. Anders als bei den anderen Bändern befanden sich auf diesem keine Koordinaten und kein Zitat. Die fehlende Schwester; die siebte Tochter, auf die wir alle gewartet, die Pa Salt jedoch nie zu uns gebracht hatte. Existierte sie? Oder hatte Pa, der Perfektionist, das Gefühl gehabt, dass die Armillarsphäre ohne ihren Namen nicht komplett wäre? Möglicherweise würden wir, wenn eine von uns Schwestern ein Kind bekäme, dieses, falls es ein Mädchen wäre, der sieben Bänder wegen »Merope« nennen.
Ich setzte mich auf die Bank und versuchte mich zu erinnern, ob Pa mir gegenüber jemals etwas von einer siebten Schwester erwähnt hatte. Meines Wissens hatte er das nicht. Er hatte überhaupt nur selten über sich selbst geredet und sich immer mehr für das interessiert, was sich in meinem Leben abspielte. Obwohl ich ihn so sehr liebte, wie eine Tochter ihren Vater nur lieben konnte, und er für mich – abgesehen von CeCe – der wichtigste Mensch auf Gottes Erdboden war, wurde mir plötzlich klar, dass ich so gut wie nichts über ihn wusste.
Nur, dass er Gärten gemocht hatte und offenbar immens reich gewesen war. Doch wie er sich diesen Reichtum erworben hatte, war mir genauso ein Rätsel wie das siebte Band der Armillarsphäre. Trotzdem hatte ich nie das Gefühl gehabt, dass unser Verhältnis nicht eng war. Oder dass er mir Informationen vorenthielt, wenn ich ihn etwas fragte.
Vielleicht hatte ich einfach nur nie die richtigen Fragen gestellt. Vielleicht hatte keine von uns Schwestern das getan.
Ich erhob mich und schlenderte im Garten herum, um die Pflanzen zu begutachten und mental eine Liste für unseren Gärtner Hans zu erstellen, mit dem ich mich zusammensetzen würde, bevor ich »Atlantis« verließ.
Als ich zum Haus zurückging, merkte ich, dass ich nun, obwohl ich mich so sehr nach »Atlantis« gesehnt hatte, wieder zurück nach London, zu meinem eigenen Leben, wollte.
IV
Ende Juli war es in London heiß und schwül, besonders in der stickigen, fensterlosen Küche in Bayswater, in der ich den ganzen Tag verbrachte. In den knapp drei Wochen dort hatte ich das Gefühl, übers Kochen genug für mein gesamtes Leben zu lernen. Ich würfelte und stiftelte Gemüse nach Art brunoise und julienne, bis ich das Gefühl hatte, dass das Küchenmesser Teil meines Arms geworden war. Ich knetete Teig, bis mir alles wehtat, und freute mich, wenn er tatsächlich ging.
Jeden Abend wurden wir mit der Hausaufgabe heimgeschickt, Speisenfolgen und Zeitabläufe zu planen, und am folgenden Morgen widmeten wir uns der mise en place – das heißt, wir legten Zutaten und Kochutensilien auf unseren Arbeitsflächen bereit, bevor wir mit der eigentlichen Zubereitung begannen. Am Ende des Tages putzten wir sämtliche Oberflächen, bis sie glänzten. Mit Befriedigung dachte ich, dass CeCe wenigstens diese Küche niemals durcheinanderbringen würde.
Die Kursteilnehmer waren ein bunt gemischter Haufen: Männer und Frauen, Achtzehnjährige aus wohlhabenden Familien neben gelangweilten Hausfrauen, die ihre Dinnerpartys in Surrey ein wenig aufpeppen wollten.
»Ich bin seit zwanzig Jahren Lastwagenfahrer«, teilte mir Paul, ein stämmiger, geschiedener Vierzigjähriger, mit, während er gekonnt Brandteig für köstliche Käse-gougères auf ein Backblech spritzte. »Ich wollte immer schon richtig kochen lernen, und jetzt ist es endlich so weit.« Er zwinkerte mir zu. »Das Leben ist kurz, zu kurz, um unsere Zeit zu vergeuden, oder?«
»Ja«, pflichtete ich ihm aus vollem Herzen bei.
Zum Glück traten Gedanken an meine eigene unbefriedigende Situation im Lauf des Kurses in den Hintergrund. Außerdem half es, dass CeCe genauso beschäftigt war wie ich. Wenn sie nicht gerade Möbel für unsere neue Wohnung aussuchte, fuhr sie mit den roten Londoner Bussen in der Stadt herum, um Anregungen für ihre Installationen, eine Kunstform, die sie vor Kurzem für sich entdeckt hatte, zu finden. Zu diesem Zweck sammelte sie überall Dinge ein und brachte sie in unser winziges Wohnzimmer: verdrehte Metallteile von Schrottplätzen, einen Stapel roter Dachziegel, leere, übelriechende Benzinkanister und eine angekokelte, lebensgroße Puppe aus Stoff und Stroh.
»Im November verbrennen die Engländer Guy-Fawkes-Puppen auf Freudenfeuern. Wie die hier es bis Juli geschafft hat, ist mir ein Rätsel«, sagte sie, während sie den Tacker mit Munition füllte. »Scheint was mit dem Typen zu tun zu haben, der vor ein paar hundert Jahren das Parlament in die Luft sprengen wollte. Ganz schön bekloppt, wenn du mich fragst«, meinte sie lachend.
In der letzten Woche des Kochkurses wurden wir in Zweierteams eingeteilt, die ein dreigängiges Menü zubereiten sollten.
»Ihr wisst, dass die Abläufe in einer Küche nur im Teamwork funktionieren«, erklärte Marcus, unser tuntiger Kursleiter. »Man muss unter Druck arbeiten und Anweisungen nicht nur geben, sondern auch ausführen können. Hier sind die Teams.«
Mir sank der Mut, als ich hörte, dass ich mit Piers zusammengespannt war, einem jungen Typen mit wallenden Haaren, der bis dahin, abgesehen von einigen kindischen Kommentaren, wenig zu Gruppendiskussionen beigetragen hatte.
Zum Glück besaß Piers immerhin eine natürliche Begabung fürs Kochen. Zur Verärgerung der anderen heimste er oft das größte Lob von Marcus ein.
»Das macht er bloß, weil er scharf auf ihn ist«, hatte ich Tiffany, eines der englischen Mädchen aus wohlhabendem Hause, einige Tage zuvor in der Toilette meckern gehört.
Ich hatte mir schmunzelnd die Hände gewaschen. Wurden die Menschen jemals erwachsen, oder blieb die Welt auf ewig ein großer Spielplatz?, fragte ich mich.
* * *
»Heute ist also dein letzter Tag, Sia«, bemerkte CeCe, als ich am folgenden Morgen in der Küche hastig eine Tasse Kaffee trank. »Viel Glück bei dem Wettbewerb.«
»Danke. Bis später!«, rief ich zurück und verließ die Wohnung, um die Tooting High Street zum Busstopp entlangzugehen. Die U-Bahn wäre schneller gewesen, doch ich liebte es, während der Fahrt etwas von London zu sehen. An der Haltestelle teilte mir ein Schild mit, dass mein Bus aufgrund von Arbeiten an einer Gasleitung auf die Park Lane umgeleitet werde und nicht die übliche Strecke in Richtung Norden fahre. Stattdessen kamen wir durch Knightsbridge, wo wir mit anderen im Stau standen, bis der Bus sich schließlich lösen konnte und wir den prächtigen Kuppelbau der Royal Albert Hall passierten.
Erleichtert darüber, dass wir uns wieder auf dem richtigen Weg befanden, lauschte ich meinen Lieblingsmusikstücken: Griegs »Morgenstimmung« aus der Peer-Gynt-Suite, die mich so sehr an »Atlantis« erinnerte, und Prokofjews Ballettmusik zu Romeo und Julia … beides hatte mir Pa Salt vorgespielt. Ich dankte Gott für die Erfindung des iPod – CeCe drehte unseren alten CD-Player im Schlafzimmer immer bis zum Anschlag auf, weil sie die kreischenden Gitarren und lauten Stimmen des Hardrock liebte. Als der Bus das nächste Mal hielt, entdeckte ich zu meiner Linken über einem Laden die Aufschrift Arthur Morston …
Ich drehte mich um, weil ich fürchtete, mir Dinge einzubilden, aber wir waren bereits weitergefahren. Wenig später las ich auf einem Straßenschild »Kensington Church Street«. Ein Schauer überlief mich, weil mir Pa Salts Hinweis einfiel.
Die Erinnerung daran beschäftigte mich noch immer, als ich mit den anderen Kursteilnehmern die Küche betrat.
»Morgen, Süße. Heute zeigen wir’s denen, was?« Piers, der sich zu mir gesellt hatte, rieb sich voller Vorfreude die Hände. Ich hasste es, mit »Süße« angeredet zu werden. Egal, ob von einem Mann oder von einer Frau.
»Los geht’s.« Marcus, der gerade hereingekommen war, reichte jedem Paar eine Karte. »Auf der Rückseite steht die Speisenfolge, die ihr miteinander zubereiten sollt. Ich erwarte, dass jeder Gang pünktlich um zwölf Uhr auf eurer jeweiligen Arbeitsfläche steht und von mir verkostet werden kann. Ihr habt zwei Stunden. Viel Glück, meine Lieben. Jetzt könnt ihr die Karten herumdrehen.«
Piers nahm mir die Karte aus der Hand. Ich musste über seine Schulter blicken, um zu erkennen, was wir kochen sollten.
»Foie-gras-Mousse mit Toast Melba, gedünsteter Lachs mit pommes dauphines und sautierte grüne Bohnen. Danach zum Dessert Eton Mess«, las Piers laut vor. »Ich übernehme die Foie-gras-Mousse und den Lachs. Fleisch und Fisch sind mein Ding. Du kannst das Gemüse und die Baiser-Sahne-Nachspeise machen. Fang am besten mit der Meringue an.«