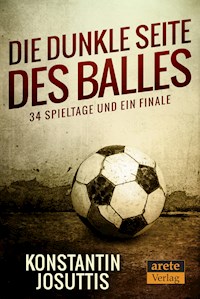Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Arete Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
London, März 1966: Ganz England freut sich auf die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer. Da geschieht das Unfassbare: Das Objekt der Begierde, der WM-Pokal, wird aus einer Ausstellung in der Westminster Central Hall entwendet. Die Hintergründe des Verschwindens wie auch des überraschenden Wiederauftauchens einige Tage später liegen bis heute im Dunkeln. Oder besser gesagt – lagen! In einer nicht komplett wörtlich zu nehmenden Rekonstruktion greift Konstantin Josuttis die Ereignisse in den Swinging Sixties auf, vermischt sie mit ein bisschen Pop-Kultur und komponiert daraus einen mit überraschenden Wendungen gespickten Kriminalfall, dessen Spannungsbogen sich über den halben Erdball zieht. Auch in diesem World-Cup-Rätsel ermittelt wieder Jean Conan Doyle, Tochter des berühmten Autors der Sherlock-Holmes-Romane. Sie bekommt es bei der Aufklärung mit zwielichtigen Gestalten der Londoner Unterwelt, Freundinnen englischer Nationalspieler, der Queen, weltberühmten Musikgrößen, einer Schachweltmeisterin, Heiligen, fremden Königen, einem dubiosen Linienrichter und natürlich auch wieder einem moralisch zweifelhaften Fußballpräsidenten zu tun. So könnte sich alles rund um den World Cup '66 zugetragen haben – das Gegenteil muss erst einmal bewiesen werden!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 341
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für die Geschwister, halbe und ganze:Nicolai, Caroline, Clara und Benjamin
Konstantin Josuttis
Der verschwundenePokal –World Cup ’66
Ein fantastischerKriminalroman
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der DeutschenNationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet überhttp://dnb.ddb.de abrufbar.
© 2024 Arete Verlag Christian Becker, Elisabethgarten 31, 31135 Hildesheimwww.arete-verlag.de
Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Nutzung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages. Dies gilt auch und insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Verfilmungen und die Einspeicherung sowie Datenvorhaltung in elektronischen und digitalen Systemen.
Titelfoto: imago sportfotodienst
Layout, Satz und Umschlaggestaltung: Composizione Katrin Rampp, Kempten
Druck und Verarbeitung: Pressel, Remshalden
ISBN 978-3-96423-117-8
eISBN 978-3-96423-126-0
Inhalt
Dramatis Personae
Prolog
I. Der verschwundene Pokal
Donnerstag – 10.3.1966
Freitag – 11.3.1966
Samstag – 12.3.1966
Sonntag – 13.3.1966
Donnerstag – 17.3.1966
Sonntag – 20.3.1966
Montag – 21.3.1966
II. Fieberhafte Suche
Mittwoch – 23.3.1966
Freitag – 25.3.1966
Samstag, 26.3.1966
Sonntag – 27.3.1966
Montag – 28.3.1966
Dienstag – 29.3.1966
Freitag – 1.4.1966
Montag – 4.4.1966
Dienstag – 5.4.1966
Donnerstag – 7.4.1966
Freitag – 8.4.1966
Samstag – 9.4.1966
Sonntag – 10.4.1966
III. Der Wahnsinn der Welt
Freitag – 15.4.1966
Samstag – 16.4.1966
Mittwoch – 15. Juni 1966
Donnerstag – 23. Juni 1966
Samstag – 30. Juli 1966
Epilog
Endnoten
Faktencheck
Nachwort
Quellen (eine Auswahl)
Dramatis Personae
Helden:
Dame (Jean Conan) Doyle
Pat Lynam
Brian Labone
Air Vice Marshal Sir Geoffrey Rhodes Bromet
Henri Sucroit-Mauroy
Pickles
Schurken:
Der Pole, Andrej Kwiatkowski
Sidney Cugullere
Reg Cugullere
Edward Betchley
Musikanten:
Al Stewart
Paul McCartney
Ringo Starr
Spielleute:
David Corbett
Linda West (Gordon West)
Herrschende:
Sir Stanley (Rous)
Joe Mears
Her Royal Highness The Queen
Chief Inspector Little
U Soe Win, Urenkel des letzten Königs von Burma
Dienende:
Rambahadur Limbu
Suk Bahadur Thapa
Mitläufer:
Rose-Marie Brightenstein, Rous’ Sekretärin
Dennis Follows, Sekretär der FA
Mr. Wesley, Sekretär am FA Hauptquartier
Detective Constable Smears
Prolog
„Was? Sie meinen, ich soll lügen?“
„Was ist daran so schlimm zu lügen? Jeder lügt. Andauernd. Stellen Sie sich nicht so an.“
Der Ältere schaute den Mann, der ihm am Schreibtisch gegenübersaß und der nervös an seiner Schirmmütze nestelte, an. Die Leute waren manchmal auf so unsinnige Art und Weise moralisch.
„Sie müssen ja nicht sagen, dass Sie ihn gefunden haben. Denken Sie sich was aus.“
Der junge, durchaus attraktive Mann blickte zu Boden, verzweifelnd eine Lösung suchend.
„Ja. Dann lasse ich Pickles ihn finden. So können wir es machen. Pickles findet den Pokal.“
„Pickles?“
„Mein Hund. Pickles. Wenn ich sage, dass Pickles den Pokal gefunden hat, dann ist es ja nicht gelogen. Dann stimmt das ja.“
„Was auch immer.“ Ungeduldig verdrehte der Ältere die Augen. „Von mir aus Pickles. Aber sorgen Sie dafür, dass die Geschichte glaubhaft wird. Klar? Keine Pannen. Der Ruf Englands steht auf dem Spiel.“
Der Ruf Englands war schon genug geschädigt geworden. Vielleicht konnte man nun ein paar Reste dieses alten Versprechens aus längst vergangenen Kolonialzeiten wieder aufleben lassen. Dann also Pickles.
I. Der verschwundene Pokal
„Horch! Das Wild ist aufgescheucht!“
William Shakespeare
Donnerstag – 10.3.1966
1.
Die Fensterscheiben vibrierten. Fast unmerklich, sanft und beständig, aber das Rattern war, einmal wahrgenommen, nicht mehr zu ignorieren. Erst waren es die Frauen, die ihr gegenübersaßen, an denen sie Anstoß genommen hatte, aber nun, da diese aufgehört hatten, unerlässlich zu quatschen, musste Jean auf die Fensterscheibe starren, die das beständige Rütteln des Zuges erbarmungslos aufnahm.
Jeans Finger trommelten nervös auf der Ledertasche, die sie auf ihrem Schoß liegen hatte. Draußen rauschte die trübe Spätwinterlandschaft Südenglands an ihr vorbei. Sie hasste den März. Nach der durchaus besinnlichen und gemütlichen Weihnachtszeit, den zwölf Weihnachtstagen und zuletzt mehr oder weniger erholsamen zwei Wochen bei Tante Hattie in Llangollen, kam wie immer dieses lange Warten auf die ersten Boten des Frühjahrs – ein warmer Windhauch aus dem Osten, aufblühende Knospen und gelegentliches Zwitschern der zurückkehrenden Schwalben. Aber so war er, der März: unerbittlich, kalt und trostlos. So wie die gelben Felder, über denen noch nicht einmal eine zärtliche Schneedecke lag. Die großen, nassen Flocken weigerten sich beharrlich, auf den Wiesen und Wegen liegenzubleiben und verzogen sich in die Tiefen des kalten Matsches. Ihre Finger trommelten wieder.
Sie fragte sich, was sie in London erwarten würde. Vielleicht war ja diese Ungewissheit, so wurde ihr auf einmal klar, der Grund, dass sie alles und jeden momentan mit einem überkritischen Auge betrachtete. Als spürte die ihr direkt gegenübersitzende Frau, dass Jean gerade beschlossen hatte, ihre eigene Übellaunigkeit in Frage zu stellen, schaute sie sie an, um sie anzusprechen.
„Fahren Sie auch nach London?“
Jean schluckte die bissige Bemerkung, die sie auf den Lippen hatte, herunter. Sie war in Crewe zugestiegen, wo die beiden Schönheiten schon im Abteil gesessen hatten.
Aber sie nickte lächelnd. Wohin sollte man wohl sonst fahren in einem Zug nach London? Sie schaute die zwei jungen Dinger genauer an. Die erste war gekleidet wie so viele in dieser seltsamen Zeit: Hochfrisierte blonde Haare, einen Trenchcoat über einem Wollpullover, der ihre festen Brüste betonte, und der viel zu kurze Rock, der eine klare Botschaft an alle Männer aussandte. Jean bemerkte, wie sie ihre Lippen spitzte. Die junge Frau schien ihre Abneigung allerdings nicht zu spüren.
Die andere hatte zumindest keine in höhere Stockwerke toupierten Haare, sondern eine lange, dunkle Mähne, die von einem Pony in gerade Bahnen gelenkt wurde. Sie trug ein kariertes Hemd und einen beigefarbenen Rock, der diesen Namen allerdings nicht wirklich verdiente, da ihm die entsprechenden Längenzentimeter fehlten. Jeans Blick auf sich spürend, fühlte sie sich wohl bemüßigt, nochmals nachzuhaken.
„Wir fahren unseren Freunden hinterher, wissen Sie?“
„Ja, wir beide.“
Jean nickte erneut. Sie wollte nicht unhöflich sein, aber auch kein Wort zu viel reden, um das geschwätzige Pärchen nicht zu oberflächlicher Konversation zu ermutigen. Eine Ermutigung war allerdings auch gar nicht notwendig. Die Blonde, schon vorher Initiatorin der unsinnigen Aneinanderreihung von Belanglosigkeiten gewesen, redete munter drauf los.
„Unsere Freunde spielen nämlich Fußball. Falls Sie wissen, was das ist.“
Nun lachte Jean kurz auf. Und nun war es vorbei mit ihrem selbstauferlegten Schweigegelübde.
„Sie werden es mir nicht glauben, Liebste, aber in der Tat weiß ich, was Fußball ist.“ Die Blonde war überrascht. Sie berührte mit der linken Hand kurz ihre Haare, aber ganz vorsichtig, um das mit Spray zusammengehaltene Kunstwerk nicht zu zerstören. Sie schien nur kurzfristig beeindruckt zu sein.
„Ach, was Sie nicht sagen. Also, mein Freund, wissen Sie, der spielt nämlich in der ersten Liga. Ich will ja nicht unbedingt protzen, aber ich glaube, er ist richtig gut.“
„Wie schön.“
„Ja. Gordon ist einfach wunderbar. Samstag ist das Spiel.“
„Sie kommen aus Liverpool?“
„Ja – am Samstag spielen wir gegen Arsenal, wissen Sie?“, warf die Brünette ein, woraufhin die Blonde einen Gesang anstimmte: „Once and for Everton, once and for Everton …“
Diese Zurschaustellung stupider Fußballgeselligkeit ging Jean entschieden zu weit. Schnell warf sie eine Frage ein.
„Sie fahren nicht zusammen mit den beiden?“
Die Dunkelhaarige lächelte versonnen aus dem Fenster hinaus. „Aber nein. Die fahren natürlich mit der Mannschaft. Wobei die uns schon alle gerne dabei hätten.“ Dann fing sie an zu kichern, als ob ihre Andeutung ein gelungener Witz gewesen wäre. Ihre Freundin brach in schallendes Gelächter aus.
„Und nach dem Spiel geht es in den Marquee Club.“
„Oh, Pat, das wird der Knaller.“
Um das Gespräch möglichst schnell wieder zu beenden, zückte Jean den Brief, der sie in erster Linie dazu bewogen hatte, Tante Hattie den Rücken zu kehren und zurück nach London zu kommen. Sie öffnete den Umschlag mit dem königlichen Siegel und las noch einmal die Worte, unterschrieben von der Queen daselbst, die sie zu einem persönlichen Gespräch vorlud. Dies war einer der Gründe dafür, dass sie sich ganz formal in ihre Uniform gekleidet hatte. So bildete sie einen sichtbaren Kontrast zu den jungen Damen, die mit ihr im Abteil saßen. Vielleicht war das einer der Gründe, dass die beiden sie wie die Gattung einer seltsamen Tierspezies anschauten und hinter vorgehaltenen Händen flüsterten und kicherten. Es war Jean egal.
Sie schaute sich die Frauen an, die offensichtlich in vollkommener Zufriedenheit über die Umstände, die ihnen das Leben zugespielt hatte, lebten. Sie musste den Impuls unterdrücken, die beiden jungen Frauen mit Verachtung zu bedenken, denn schon immer war sie misstrauisch gegenüber Menschen, die, ohne nachzudenken, das Leben in vollem Maß genossen und nicht ahnten, dass ihre Jugend irgendeinmal verwelken musste.
Sie dachte an ihre eigene Jugend, die so vollkommen anders gewesen war. Keine aufreizende Kleidung und kein ausschweifendes, zügelloses Leben. Ein Flämmchen Wärme flackerte in ihr auf, als sie an den einen, seltsamen Mann dachte, den sie vor langer Zeit in ihr Herz geschlossen hatte: Moritz Fischer. Sie dachte an die Schiffspassage nach Uruguay, die ihr Leben so nachhaltig und tiefgreifend verändert hatte, und für einen kleinen Moment wurde ihr klar, dass ihre Verachtung eigentlich nur ein billiger Ausdruck ihrer eigenen Enttäuschung war. Bevor sie jedoch diesen Gedanken zulassen konnte, sagte die Frau, die ihr gegenübersaß: „Was?“ Jean schreckte auf.
„Was?“
„Was? Sie schauen mich so an.“
„Oh. Entschuldigung. Sie haben mich an eine Freundin erinnert.“ Jean sah die betörende Gestalt von Smeralda das Schiffsdeck herablaufen.
„Wirklich? Oh, na dann.“
Sollte die Frau für einen kurzen Moment verunsichert gewesen sein, so schien sie sich schnell erholt zu haben. Dann fingen die beiden wieder an zu schwätzen. Es ging, soweit Jean das mitbekam, um Mode, um Tanzen und Musik. Aber sie hörte auch nur noch mit einem halben Ohr zu, denn einmal in Gang gebracht, folgte sie der ratternden Erinnerungsmaschine, die sie 36 Jahre in der Zeit zurückblicken und die Gestalten von Smeralda und Moritz vor ihrem geistigen Auge erscheinen ließ. Schwelgend wunderte sie sich, wie viel Zeit vergangen war, da die Erinnerung noch so frisch und unmittelbar wirkte. Das Schuldgefühl der Älteren, die die Chancen der Jugend ungenutzt haben verstreichen lassen, legte sich wie ein kaltnasser Film auf ihre Haut. Sie blickte hinaus und sah die veränderte Landschaft. Sie hatten Watford bereits hinter sich gelassen. Die ersten Vororte verunstalteten den Blick auf das feuchte Frühjahr.
Immerhin wurden Jeans Gedanken dadurch abgelenkt, dass der Schaffner dem Abteil noch einen Besuch abstattete und, wie zu erwarten war, die beiden Schönheiten mit aufreizenden Blicken bedachte. Während er die braunen Pappkarten mit seinem Stanzer entwertete, starrte er auf das lockende, helle Fleisch, das ihm in Form von langen Beinen und schlanken Armen entgegenblickte. Mit einem schmierigen Grinsen schob er sich seine Schirmmütze ein Stück nach hinten und verabschiedete sich mit „Die Damen“, ohne dabei Jean eines Blickes zu würdigen. Es war offensichtlich, dass die beiden Angesprochenen die zur Schau gestellte Animalität des Mannes auch noch genossen.
Jean hatte diese zweite Welt, in der sich die Gattung Mensch zeitweise aufhielt, nie verstanden. Es war offensichtlich, dass man sich in seinem Alltag gepflegt und gesittet unterhielt, höflich miteinander umging und sich zumindest äußerlich wertschätzte. Wir Engländer beherrschen diese Kunst wie keine Zweiten, dachte Jean. Dies war die erste Welt. Doch dann gab es da eben noch eine andere. Sobald sich der Mensch in der Sicherheit der Dunkelheit zu wähnen glaubte, kam in ihm dieser animalisch dionysische Trieb hervor, der Ratio und Vernunft hinter sich ließ und nur ein Ziel verfolgte: Kopulation. Jean hatte diese seltsame Lust nie verstanden und nie gemocht. Zu groß war der damit einhergehende Kontrollverlust. Sie seufzte. Mittlerweile waren die letzten Felder und Wälder aus dem Sichtwinkel verschwunden und der Zug ratterte an schäbigen Vororthäusern vorbei, an karg befahrenen Straßen und hier und da ein paar Läden: Bäcker, Metzger oder Obsthändler, die Stände mit Kartoffeln und Rüben auf den Bürgersteig gestellt hatten.
Dann aber fuhr Jean auf, sodass die beiden Damen ihr gegenüber sie befremdet ansahen. Vor ihr, während der Zug sich ächzend in eine lange Kurve in Richtung Südosten mühte, tat sich ein riesiges, weißes Gebäude auf. In der Entfernung sah das Gebäude aus wie ein indischer Palast, weiß und majestätisch staken zwei Türme mit runden Kuppeln in den mittlerweile vernebelten Nachmittag. Als sie sich aber dem Gebäude näherten, verschwanden die Türme hinter der Größe des Baus und aus dem Taj Mahal wurde ein römisches Kolosseum: Weite Torbögen, deren Schwärze wie tiefliegende Augen wirkte, spannten sich über eine hunderte von Metern reichende Länge. An den Seitenflügeln des massigen Baus waren die Treppenaufgänge von schützendem Mauerwerk umgeben. Hier hatte jemand geklotzt und nicht gekleckert.
Die jungen Damen schienen Jeans Faszination bemerkt zu haben. „Das ist Wembley.“
„Oh, Pat.“
„Oh, Linda.“
Jeans Neugier war nun doch geweckt. Die Damen schauten sich verträumt an. Wieso nur?
„Was haben Sie?“
„Wembley. Vielleicht spielen sie da.“ Die Brünette schaute die Blonde an. „Ich würde mich so freuen für Gordon.“
Darauf die Blonde zur Brünetten: „Ich bin mir sicher, dass Brian nominiert wird.“
„Nominiert?“, fragte Jean.
„Zur Fußballweltmeisterschaft. Ich dachte, Sie kennen sich aus mit Fußball. Die WM. Hier in England. Im Sommer.“
„Ach so. Ja. Habe davon gehört.“
Jean gestand sich nicht gerne ein, dass sie von dem Turnier nur am Rande mitbekommen hatte. Jedes Mal, wenn Onkel George am reich gedeckten Tisch in der guten Stube ihrer Verwandten angefangen hatte, über mögliche Aufstellungen zu reden und jedes Mal, wenn er über Alf Ramsey, den Trainer der Mannschaft, hergezogen war, hatte Jean abgeschaltet, da ihre Gedanken an ihre bisherigen Begegnungen mit Fußball zurückwanderten. Wie kam es nur, dass sie immer wieder mit der eindrücklichsten Zeit ihres Lebens konfrontiert wurde, auch wenn sie diese Zeit durch einen bewussten Akt des Vergessens hinter sich zu lassen gedachte? Schnell wandte sie sich der Gegenwart zu.
„Und ihre … äh … Freunde spielen bei der Nationalmannschaft?“
Die Gesichter ihrer Gegenüber drückten Verzweiflung aus.
„Nun, das hoffen wir“, sagte die Dunkelhaarige und strich mit beiden Händen über den Rock.
„Brian spielt bestimmt, Pat. Bestimmt.“
„Gordon auch, Linda. Glaub’ mir.“
„Für manche wäre es besser gewesen, wenn sie nicht nominiert worden wären“, sinnierte Jean vor sich hin.
„Was meinen Sie?“ Die Blonde schaute Jean herausfordernd an.
Zu ihrer Rettung ließ die Dampflok einen lauten Pfeifton los und mit quietschenden Rädern rollte der Zug in eine Bahnhofsstation ein, die sich adäquater Weise „Wembley Station“ nannte. Menschen stiegen ein und aus und Jean war dankbar, ihren Erinnerungen entkommen zu können. Es blieb die Verwunderung darüber, dass das Leben ihr schon wieder eine Begegnung mit dem Thema Fußball präsentierte, als wollte es sagen, dass sie noch nicht abgeschlossen hatte mit den Wunden von damals. Sie ahnte noch nicht, wie recht sie mit dem Gefühl hatte.
2.
Draußen vor den hohen schwarzen Metallzäunen, die die streunenden Touristen staunend von der Welt des Adels abhielten, stolzierten die Reiter der Leibgarde fast provokativ gemächlich über das Pflaster, wobei ihre langen goldenen Helmpüschel auf und ab wippten und somit den sorgsam gebürsteten Schweifen der Pferde, auf denen sie saßen, auffallend ähnlich sahen. Der weiße Stein des Palasts war überzogen von schwarzen Flecken, die sich wie Pilze ausgebreitet hatten. Der beständige Regen Londons hatte seine Spuren hinterlassen. Im Gegensatz zu allen anderen, die gaffend vor dem verschlossenen Tor standen und die regungslosen Mienen der Palastwache bewunderten, ging Jean die Spur Road entlang, bis sie in die Erweiterung des Birdcage Walk bog. Sie lief die Buckingham Road entlang und fand ein weitaus kleineres Stück desselben Metallzauns, der sich gegen Eindringlinge erhob, der ihr aber nun von einem ernst aussehenden Mann in schwarzem Anzug geöffnet wurde.
„Danke, Michael“, sagte sie, woraufhin der Mann mit akkuratem Scheitel im schwarzen Frack höflich nickte. Mit dem Geschick eines erfahrenen Torwächters verschloss er die Tür und blickte die Straße hinab, bevor er sich umdrehte und sie mit ein paar schwungvollen Schritten überholte. Nun, da Jean im Inneren des Zirkels angekommen war, überkam sie wieder eine seltsame Mischung aus verschiedensten Gefühlen. Als erstes meldete sich in ihr der Stolz. Sobald sie diesen wahrnahm, ärgerte sie sich schon wieder darüber, denn es war klar, an wen er adressiert war. Es war ein weiterer unsinniger Versuch, die Aufmerksamkeit ihres Vaters zu bekommen, der, seitdem sie aus Uruguay zurückgekommen war, nicht mehr lebte. Dann, verspürte sie das nächste Gefühl, was sich direkt im Schutze des vorigen angeschlichen hatte: Dazugehörigkeit. Sie war im Kreise derer angelangt, die über dem gemeinen Volk standen, der Schönen, der Reichen, der Mächtigen. Und dann, ebenso sicher wie das Auftauchen der anderen zwei, meldete sich Nummer drei: Scham. Zum einen, weil sie eben nicht dazugehörte, nicht wirklich. Sie hatte sich da irgendwie reingeschummelt. Zum anderen, weil sie nicht über dem gemeinen Volk stehen wollte. Sie glaubte an die Gleichheit aller Menschen. Wie konnte es da sein, dass sie das Bessersein genoss? Während sie sich noch mit dem Dilemma ihrer Gefühlswelt beschäftigte, führte Michael sie nach oben. Er war behände eine kalkweiße Stufe hinaufgeeilt und öffnete eine Nebentür, die in den Buckingham Palast führte. Wobei Nebentür eine glatte Untertreibung war. Es handelte sich um ein schwarzes, schweres, doppeltüriges Metallportal, das bedeutungsvoll quietschend nach außen ächzte.
Teils um ihrer eigenen chaotischen Gefühlswelt zu entgehen, schaute sie sich den Mann an, der ihr in so tadelloser Manier die Tür offenhielt, den Kopf dabei in demütiger Geste leicht gebeugt. Sie kannte Michael schon von vorherigen Besuchen, doch bisher war ihr die Geschmeidigkeit seines Verhaltens nicht aufgefallen, die sich nicht nur auf seine glatten Bewegungen bezog, sondern auf sein gesamtes Sein. Das Wesen des Mannes schien vollkommen in dem, was er tat, aufzugehen. Es schien, als wäre er zu keinem anderen Zweck geboren worden, als in einem königlichen Palast zu dienen. Er hatte diese Ausstrahlung von Bediensteten, die offensichtlich keine Schwierigkeiten damit hatten, auf der einen Seite alles im Blick zu haben und über sämtliches notwendiges Wissen zu verfügen und auf der anderen Seite nur Ausführende, niemals Bestimmende zu sein. Wie konnte man da nur hinkommen, fragte sich Jean, während sie die weiten, langen Gänge herabmarschierten. Hatte sie selber sich doch Zeit ihres Lebens den Pflichten des modernen Lebens zu entziehen versucht. Sie hatte versucht, dem Druck, den ihr Vater durch seine Berühmtheit unwissentlich aufgebaut hatte, geschmeidig durch eine Karriere bei der Royal Air Force zu entgehen. Sie hatte es als Kommandantin in der Tat weit gebracht. Die Medaillen, die sie zu diesem offiziellen Anlass auf ihrer Uniform trug und die bei jedem Schritt auf ihrer Brust klimperten, während sie über den weichen Teppich lief, waren ein Zeugnis dafür. Doch im Gegensatz zum scheinbar völlig zufriedenen Michael wusste sie, dass alles, was sie tat, nur ein Ausweichen, ein Verhindern war und keine Erfüllung bot.
Michael blieb stehen, verneigte sich wieder leicht und wies mit seiner linken Hand eine Treppe hinauf. Jean stapfte treppauf. Nun wusste sie wieder, wo sie war. An den hohen Wänden ragten Ölportraits längst verstorbener Adliger. Die Gesichter schienen sie streng anzublicken und zu verurteilen. Jean fragte sich, ob die Architektur von Palästen bewusst darauf angelegt war, dass Menschen, die durch die überdimensionierten Räume liefen, sich klein fühlen sollten. Das wäre unsinnig, so dachte sie, denn mehrheitlich waren es hier die Majestäten, die die Räume bevölkerten, Royals und ihre Verwandten, ihres Zeichens von Gott für eine höhere Aufgabe vorgesehen. Der nächste Gang, durch den sie schritt, verstärkte das Gefühl, ein kümmerliches Leben zu führen. Goldene Spiegel säumten die Wände, eine Palastwache mit buntem Federbusch verschwand in einem Korridor, überall Weite und Größe. Mitten im Korridor stand ein großer Steinlöwe, der etwas Asiatisches an sich hatte. Der Löwe starrte geradeaus. Jean konnte ihr unbekannte Schriftzeichen entdecken, die auf dem Sockel eingeritzt waren. Die Schrift wirkte wie eine Zusammenstellung von verschiedenen Kreisen mit unterschiedlichsten Verzierungen.
Gedämpft durch den Samthandschuh, den er trug, klopfte Michael an eine Tür, die er daraufhin öffnete und, nachdem sie eingetreten war, ebenso sanft hinter ihr wieder verschloss.
Jean blickte in einen Raum, der offensichtlich dem Zweck diente, Gespräche zu führen. In der Mitte des Raumes standen sich zwei blau-gold gepolsterte Sofas gegenüber, daneben zwei Stühle mit derselben Polsterung. Jeans Blick fiel aber als erstes auf die Person, die am Fenster stand und gedankenverloren nach draußen zu blicken schien. Sobald aber die Tür zugeschnappt war, drehte sich die mittelgroße, leicht gebückte Frau, die ihre Hände hinter dem Rücken verschränkt hatte, um. Das helle Blau des Kleides biss sich mit der dunkleren Variante der anderen Möbelstücke.
Als sei sie aus einer Träumerei erwacht, setzte die Queen ein Lächeln auf und empfing Jean herzlich.
„Meine liebe Jean. Wie schön, Sie wieder hier begrüßen zu dürfen.“
Jean machte eilig ein paar Schritte vorwärts und beugte das Knie, um im Knicks den Ringfinger der Königin zu küssen.
„Eure Majestät.“
„Teure Aide-de-Camp. Wie lange ist es her?“
„Drei Jahre, Majestät.“
„Ach, wie die Zeit vergeht. Ich habe Sie sträflich vernachlässigt.“
„Majestät, wenn Ihr keinen Bedarf an meiner Präsenz habt, dann ist das ein gutes Zeichen.“
„In der Tat, in der Tat.“ Mit diesen Worten führte Queen Elizabeth Jean zum Sofa, wo sich die beiden symmetrisch gegenübersetzten. In traulicher Einheit waren die Knie beider Frauen jeweils zur Seite gerichtet.
„Tee?“
Queen Elizabeth goss aus einer beigefarbenen Teekanne mit Goldrändchen in eine breite Tasse ein. Jean musste einen Augenblick überlegen, was zu tun sei. Selbst die einfachste Geste erzeugte bei ihr im Beisein der Queen Nervosität. Sollte sie das Heißgetränk ablehnen, da sie der anderen keine Mühen machen wollte? Oder wäre es generell unhöflich, irgendein Angebot überhaupt abzulehnen? Noch bevor sie diese Gedanken zu Ende denken konnte, reichte ihr die lächelnde Queen auf der Untertasse das dampfende Getränk.
„Danke, Eure Hoheit.“
Elizabeth hatte sich selber eingeschenkt und Jean nahm ein kurzes Lächeln war, als der Kandis in der Tasse knackte.
„Wie ist das Leben zu euch, Dame Jean? Was macht der Nachlass eures Vaters?“
„Vielen Dank, Majestät. Ich kann nicht klagen.“ Jean legte die Hände in Falten auf den Schoß, nachdem sie die Tasse auf dem Beistelltischlein abgestellt hatte. „Der Nachlass wird ja immer noch von meinem Bruder geregelt.“
„Ich erinnere mich. Adrian, nicht wahr?“
„So ist es, Madam. Ich führe eigentlich ein recht beschauliches Leben.“
„Wie schön. Wie schön.“
Wieder befand sich Jean in einer Zwickmühle. Sollte sie nach dem Grund für ihren Besuch selber fragen, oder geduldig warten, bis die Queen ihr Anliegen vor ihr ausbreiten würde?
„Unser Leben ist so voller Unwägbarkeiten, meine Liebe. Für eine Regentin wie mich ist es daher von essentieller Notwendigkeit, Menschen an ihrer Seite zu haben, wie Sie – Menschen, denen ich vertrauen kann.“
„Selbstverständlich könnt Ihr das, Eure Hoheit.“
Die Queen schlürfte etwas Tee.
„Am Nachmittag bevorzuge ich Assam.“
„Ja, köstlich.“ Jean kam sich kindisch vor. Und die Tatsache, dass sie zunehmend unsicher wurde, trug zu weiterem Ärger auf sich selbst bei.
„Ein Freund von mir, ein guter Freund, muss ich sagen, ist auf mich zugekommen. Er hat ein Problem.“
Wieder nahm die Queen einen Schluck. Jean setzte ihre Tasse ab. Sie hatte soeben zum dritten Mal versucht, etwas zu trinken, musste aber im entscheidenden Moment absetzen.
„Wenn ich Ihrer Hoheit weiterhelfen kann.“
„In der Tat. Dieses Problem betrifft England. Es betrifft unsere nationale Identität. Unseren Stolz. Unsere Würde. Leider bin ich selbst nicht genügend informiert, um euch, liebe Jean, ein genaues Bild zeichnen zu können, jedoch …“
Erst in diesem Moment wurde Jean der weiteren Person gewahr, die sich die ganze Zeit im Raum befunden haben musste. Aus dem Hintergrund – er musste hinter dem Vorhang gestanden haben, der die Doppeltür in den nächsten Raum verdeckte – trat ein Mann hervor. Jean konnte zunächst nur einen Schatten erkennen, einen mächtigen Schatten. Der Umriss des Mannes kam ihr bekannt vor. „Moritz“, hauchte sie, als eine Erinnerung wie ein warmer Lufthauch an ihr vorbeizog. Noch bevor sich das Konterfei des Mannes aber zu einer realen Gestalt zusammensetzte, war ihr klar, dass sie einem Wunsch nachgehangen hatte, der sich schnell aus ihrem Unterbewusstsein hervorgetraut hatte. Dennoch ähnelte die Statur des Mannes Moritz Fischer, dem FIFA-Vizepräsidenten, mit dem sie vor vielen Jahren um die halbe Erdkugel gefahren war. Doch schnell merkte sie, dass der Charakter der beiden Männer grundverschieden sein musste.
„Darf ich vorstellen: Sir Stanley.“
Jean stand auf und gab dem Mann, der ihr mit einem schüchternen Lächeln entgegentrat, die Hand. Sein Gesicht schien eingefroren, vielleicht, so dachte Jean, auch einfach mit Sorgen behaftet. Sein Gang hatte etwas Abgehacktes, als müssten sich seine Muskeln jeder einzelnen Bewegung erinnern. Und dennoch hatte er etwas, das in Jean einen mütterlichen Instinkt auslöste. Sie fragte sich kurz, ob der Mann das wusste und mit dieser Eigenschaft spielte.
„Sir Stanley wird Sie mit der Problematik vertraut machen, die uns leider alle betrifft. Sir Stanley.“
Der Mann bedankte sich für die kurze Einführung und setzte sich auf einen der freien Stühle, der sofort zu knarzen begann, jedoch der Belastung standhielt.
„Es ist so, Dame Jean …“ Im Gegensatz zur Queen kam der Mann gleich zur Sache.
Er hob die Hand, um die Worte, die ihm offensichtlich Schwierigkeiten bereiteten, herauszubekommen.
„Im Laufe meiner Tätigkeit als Präsident der Football Association und auch als Präsident des Weltverbandes sind mir einige Gerüchte zu Ohren gekommen.“
Jean spürte einen Knoten in ihrem Magen. Würde sie die Vergangenheit denn nie loslassen?
„Vielleicht haben Sie ja selber davon gehört. Auf den ersten Blick klingt es ja absurd. Aber, … nun ja. Also, als der Siegerpokal …“
„Sie meinen den Jules Rimet Cup?“
Auf ihren Einwurf schien sich das Gesicht des Mannes kurz zusammenzuziehen.
„Ja, der Weltpokal. Als dieser von Jules Rimet nach Uruguay gebracht wurde, da, nun ja …“
Jean wusste, was kommen würde, aber aus einem ihr unbekannten Grund wollte sie es dem Mann, der neben ihr saß, nicht leichter machen. Die Queen lächelte Rous ermutigend an.
„Also, es geht eben dieses Gerücht, dass auf der Schiffspassage einige Menschen zu Tode kamen. Nun heißt es ebenfalls, dass Ihr, Dame Jean, ebenfalls auf dem Schiff wart. Und weiter heißt es, dass die Namen derjenigen, die zu Tode kamen, auf dem Boden der Goldenen Göttin eingraviert wurden, um ihr Andenken am Leben zu halten.“
„Was Sir Stanley sagen möchte, meine Liebe, …“, im Gegensatz zum Fußballpräsidenten war die Stimme der Königin immer noch leicht und fröhlich, „… ist, dass wir uns erhofft hatten, dieses unsinnige Gerücht zu widerlegen und den Vorfall damit ad acta legen zu können. Da Sie ja an Bord waren, können Sie vielleicht etwas zur Aufklärung beitragen.“
Jean starrte die Queen an. Auf einmal war ihre Verlegenheit verflogen. Ihre Expertise war gefragt. Und sie konnte weiterhelfen.
„Es stimmt“, sagte sie und sah die Gesichtszüge der anderen beiden einfrieren.
„Zehn Menschen sind gestorben. Sieben von ihnen ermordet. Fünf Fußballspieler und ein FIFA-Funktionär. Die Namen von neun Menschen sind eingraviert auf dem Coupe Jules Rimet.“
Wieder zuckte Sir Stanley zusammen.
„Aha.“ Und nach einer kurzen Pause und einem Räuspern sagte die Queen erneut: „Aha. Schön. Nun. Wie zutiefst beunruhigend. Aber das werden wir schon hinbekommen, nicht wahr?“
Jean fragte sich, an wen die Frage gerichtet war. Gleichzeitig bewunderte sie die Fähigkeit Ihrer Hoheit, eine positive Attitüde zu bewahren.
„Nun, wie wäre es, wenn wir das weitere Vorgehen in Ruhe besprechen könnten? Dummerweise habe ich nun noch einen offiziellen Termin, den ich nicht verschieben kann. Die Verleihung eines Viktoria-Kreuzes. Ein junger Gurkha wird ausgezeichnet. Wollen Sie beide mich begleiten?“
Rous schien gleichermaßen überrascht zu sein wie Jean. Aber pflichtbewusst folgten sie, als die Queen den Raum verließ und entschlossen rechts den Gang hinab lief. Wieder ging es vorbei an imposanten Gemälden, einer Unmenge von Statuen, fremdländischen Devotionalien, Kunstwerken, Plastiken, Waffen und Möbelstücken.
„Deswegen braucht man also einen Palast …“, redete Jean vor sich hin.
„Was?“ Rous schien ihr zugehört zu haben.
Sie kamen an zwei zusammengebundenen Speeren vorbei, deren Federn schlaff nach unten hingen.
„Um die ganzen Mitbringsel aus den Kolonien auch irgendwo hinstellen zu können.“
Rous schaute sie etwas verstört an. Sie liefen weiter und Jean musste an die vielen Hangars denken, die sie im Laufe ihrer Karriere als Flugkommandantin schon betreten hatte. Nur, dass die Schritte hier in Buckingham weitaus gedämpfter waren, auch wenn die Abstände sich ähnelten.
„Ich werde nun nach links abbiegen, damit ich mir für diesen offiziellen Anlass noch die Krone aufsetzen kann.“
Jean, die stolz war, ein wenig über die britischen Kronjuwelen zu wissen, fragte: „Sicher nehmen Eure Hoheit zu diesem Zwecke die ‚Imperial Crown of India‘1?“
Elizabeth blieb stehen und neigte ihren Kopf ein wenig nach hinten, ohne allerdings Jean dabei anzusehen.
„Nein“, erwiderte sie, „diese Krone ist zu schwer. Mein Großvater hat sie nur ein einziges Mal getragen und danach bekam er wegen des Gewichts Kopfschmerzen. Für solche Zeremonien wie die Ehrung von Soldaten wird die ‚Imperial State Crown‘ verwendet.“
Damit wandte sie sich abrupt ab und lief nach links. Rous schaute Jean ein wenig verärgert an, so als hätte diese irgendetwas falsch gemacht.
Schließlich kamen sie in der Haupteingangshalle an und wurden von Michael nach draußen auf eine Treppe geleitet, wo neben ein paar offiziellen militärischen Würdenträgern noch Kameraleute und eine Rotte Soldaten in ungewöhnlicher Montur standen. Die Männer trugen eine dunkelblaue Uniform, dessen Schnitt Jean an einen Kaftan erinnerte. Auf dem Kopf trugen sie rund geformte Mützen, die von einem Bommel in der Mitte geziert wurden, fast wie die obere Spitze einer Torte.
„Das sind Gurkhas“, erklärte Michael, der neben Jean stehen geblieben war, wofür sie recht dankbar war. Draußen vor den Gittertoren wartete eine ganze Reihe Schaulustiger und Touristen und sah zu, wie die Kompanie der Gurkhas stramm stand, als eine Musikkapelle einen Marsch spielte. Elizabeth stand auf der Treppe und lächelte. Vor sich hielt sie eine kleine Handtasche, die ihr zugleich als Verbindung in die Welt und als Rettungsanker diente – so stellte Jean es sich zumindest vor. Während Rumms auf Rumms folgte und Blasinstrumente im Zusammenspiel mit wirbelnden Trommeln eine Unterhaltung unmöglich machten, erklärte Michael:
„Der junge Obergefreite hier hat sich im Kampf gegen indonesische Truppen in Borneo bewährt.“
„Was sind Gurkhas?“ Jean kam sich etwas ignorant vor, dass sie diese Frage stellte.
„Hauptsächlich nepalesische Kämpfer, die für das Empire ihren Dienst tun.“ Michael schien ihre Gedanken zu lesen. „Und keine Sorge, Madam, ich habe das auch erst nachfragen müssen.“
Die Zeremonie zog sich. Oder vielleicht kam es Jean auch nur so vor, da sie in gespannter Erwartung war, was die Queen genau von ihr wollte. Endlich aber hatte auch die Verleihung des Viktoria-Kreuzes ein Ende. Die Menge löste sich auf, verschiedene Männer mit militärischen Abzeichen gingen zum jungen, sympathisch aussehenden Gefreiten und schüttelten ihm die Hände und die Queen drehte sich nach hinten ab. Michael führte seinerseits Jean und Sir Stanley durch den Haupteingang hinterher, um in einem anderen Seitenausgang nach draußen zu gelangen, wo die Majestät schon wartete.
„Wir gehen durch den Palastgarten. Michael wird Sie beide an der Wellington Arch hinauslassen. Dann haben wir noch etwas Zeit, die Sache zu bereden.“
Gemächlich schritten sie also zu viert an der Nordseite des Palastes entlang. Der feine Kies machte beruhigende Geräusche, sodass Jean den Mut fand, gleich zur Sache zu kommen.
„Ich verstehe nicht genau, weshalb mit dieser Geschichte, die sich vor 36 Jahren zugetragen hat, das Ansehen der gesamten Nation auf dem Spiel stehen soll, Hoheit.“
„Nun, wenn es so ist, wie Ihr angedeutet habt, Dame Jean, dann sind die Namen der Verstorbenen immer noch auf der Statue eingraviert, ist das richtig?“
„Ja, das wurde noch in Montevideo so vorgenommen.“
Nun mischte sich Rous, der sich bisher eher bedeckt gehalten hatte, ein.
„Es gibt ausländische Kräfte, deren einziges Ansinnen es ist, dem Ruf des Empires zu schaden. Kein Mittel wäre diesen Menschen und Organisationen ruchlos genug, um der Welt unsere Schwäche darzulegen.“
„Ein Pokal, an dem Blut klebt, Dame Jean“, warf die Queen ein.
„Das wäre ein gefundenes Fressen für Nationalisten in allen Ecken des Empires. Kommunisten, Maoisten, ehemalige Kolonien – sie alle würden mit dem Finger auf uns zeigen und uns dafür anklagen, dass wir Menschenleben geopfert haben für ein – nun, ich sage es, wie andere es denken – blödes Spiel.“
Langsam begriff Jean die Ausmaße des Problems. „Aber das Blut wurde ja nicht vergossen, um die Weltmeisterschaft zu ermöglichen, sondern um sie zu verhindern“, warf sie dennoch ein.
„Nun, das“, so nahm die Queen ihren Gedanken auf, „wäre in der Tat eine solch moralische Verwerflichkeit, dass die Spiele sofort beendet werden müssten. Sich vorzustellen, dass auch nur ein Menschenleben gegeben wurde, damit 22 Männer einem Ball hinterherlaufen – absurd. Und dennoch, es reicht schon die Verbindung von Blut und Fußball, um unser Ansehen zu besudeln.“
„Das bedeutet, es darf nie herauskommen, dass eine verrückte Einzelperson für den Tod dieser Menschen verantwortlich ist.“ Jean überlegte laut.
„Richtig“, erwiderte Rous. „Die Menschen würden Fußball mit Mord verbinden. Eigentlich absurd, aber Sie wissen ja selbst, was passiert, wenn die Presse ihr Fressen gefunden hat.“
Jean nickte. „Nun, dann wissen Sie ja jetzt Bescheid. Es tut mir leid, dass ich Ihnen keine anderen Nachrichten überbringen konnte. Ich denke, Sie werden nun die richtigen Schritte einleiten.“
Queen Elizabeth und Sir Stanley blieben stehen. Sie waren am hinteren Ende des Buckingham Gardens angekommen. Michael hatte sich schon an der schwarzen Metalltür positioniert.
„Für diese Schritte, meine Liebe“, sagte die Königin, „benötigen wir Sie.“
3.
Es lag schon eine Weile zurück, aber soweit Jean sich erinnern konnte, hatte sie Jules Rimet von Anfang an gemocht, auch wenn er etwas zurückhaltend und fast schüchtern war. Oder vielleicht war diese französische Art des Understatements genau das, was ihr, geplagt vom Ansehen ihres Vaters, so gefallen hatte. Während Sir Stanley neben ihr den feuchten Weg durch den Hyde-Park lief und seine Schuhe bei jedem Schritt ein schmatzendes Geräusch machten, fehlte ihr nun allerdings jegliche Art der Beziehung zu diesem mächtigsten Mann der Fußballwelt. Sie verstand, dass er in einem eigenen Universum mit eigenen Problemen und Herausforderungen leben musste, aber selbst die Queen schien ihr menschlicher zu sein als dieser Mann. Vielleicht war es aber auch nur sein furchteinflößendes Gesicht, das sie bisher noch nicht hatte lächeln sehen. Auch jetzt, da er sie direkt ansprach, hatte Rous eine ausdruckslose Miene.
„Wenn Sie möchten, können wir gemeinsam durch den Hyde Park spazieren. Das Hauptquartier der Football Association ist auf der anderen Seite, an der Lancaster Gate. Das sind zwar mehr als 2 Meilen, aber dann haben wir genügend Zeit und Ruhe.“
Jean schaute den Mann an. Er hatte helle Haare und einen ebenso hellen Schnurrbart. Er war tadellos gekleidet, und vielleicht war dies der Grund, dass er auf Jean auf eine gewisse Art nichtssagend wirkte. Sie schalt sich für ihre vorschnelle Verurteilung. Wahrscheinlich war sie nur immer noch enttäuscht, weil er nicht so war wie Moritz.
„Gerne“, sagte sie. „Obwohl ich immer noch nicht verstehe, wie ich von Nutzen sein könnte.“
„Die ganze Sache ist unglaublich kompliziert“, begann Rous. „Ich will Sie erst einmal mit den Fakten vertraut machen. Der Pokal ist am 6. Januar aus Brasilien hier eingetroffen und befindet sich momentan in einem Safe im Royal Garden Hotel in Kensington. Er wird morgen in unseren eigenen Safe überbracht werden.“
Rous trottete weiter. „Allerdings müssen wir diesen Pokal eben aus dem Verkehr ziehen.“
„Weil die Namen der Toten auf ihm eingraviert sind?“
„Ja.“
„Was wollen Sie dann tun?“
„Ich habe eine Kopie in Auftrag gegeben. Es gibt in Poplar einen Bildhauer. Die von ihm gefertigte goldene Göttin wird praktisch nicht vom Original zu unterscheiden sein.“
„Nun, dann können Sie sie ja einfach austauschen.“
Nun blieb Rous stehen. Er wirkte wie ein Denkmal vor der weiten Rasenfläche, auf der sich im Hintergrund zwei Erlen auftaten, als stünden sie Spalier für den Mann, dessen Kopf leicht nach vorne gebeugt war und dessen Worte nun eine noch größere Gewichtigkeit bekamen. Ein Mann in Uniform spazierte an den beiden vorbei.
„Dies ist leider nicht so leicht, Dame Jean. Der Pokal an und für sich ist eine Staatsangelegenheit. Seine Überwachung liegt in der Verantwortung von Whitehall, also der britischen Regierung. Der MI5 selbst kümmert sich darum, dass das wertvolle Stück sicher ist. Und der Abguss wird leider nicht fertig sein, bevor das gute Stück für die Öffentlichkeit ausgestellt wird. Die sicherste Methode ist also, den Pokal dort offiziell zu stehlen.“
Rous wandte sich wieder zum Gehen. Ein Eichhörnchen rannte über den Fußweg, schnappte sich eine Nuss und jagte in einer Spirale eine Eiche auf der anderen Seite des Wegs hoch.
„Ich verstehe nicht. Was für eine Ausstellung? Und muss der Cup Jules Rimet während dieser Ausstellung verschwinden?“
Rous zuckte kurz zusammen, fasste sich dann aber wieder. „Ja. Sicher. Auf das Hauptquartier der Football Association darf kein schlechtes Licht fallen. Daher haben wir eine Ausstellung organisiert. Er wird ab dem 19. März als Teil der Briefmarkenausstellung der Firma Stanley Gibbons in der Westminster Central Hall präsentiert werden.“ Rous schaute sich um, als befürchtete er, dass das Gespräch der beiden von unliebsamen Ohren mitgehört werden könne.
„Bevor wir das planen, muss ich Sie noch mit den Details vertraut machen.“
„Ich verstehe nicht so ganz – was soll ich denn damit zu tun haben?“
„Sie werden den Pokal stehlen, Dame Doyle.“
Das Gebäude aus weißem Stein ragte imposant aus der Straße heraus, die vom Park abging: Lancaster Gate. Eine Fahne mit den drei Löwen hing als Zeichen der FA, des englischen Fußballverbandes, von einem Balkon oberhalb der Tür herab. Deshalb mochte Jean das Leben in London: Die Trostlosigkeit englischen Landlebens wurde von einer spürbaren Umtriebigkeit und dem anmutigen Glanz viktorianischer Baukunst in den Hintergrund gedrängt. Idylle im Sinne des einfachen Lebens konnte man hier nicht finden, dafür aber die Größe des englischen Selbstverständnisses, welches im Idealfall, so wie hier, zu überbordender Pracht ausarten konnte.
Als sie und Sir Stanley in das Haus gingen, kam es ihr so vor, als sei es drinnen kälter als draußen. Sie stiegen eine knarzende Holztreppe in das erste Stockwerk hinauf und öffneten eine Tür in ein Vorzimmer, in dem ein beschäftigt aussehender Mann mit Brille, hochgekrempelten Hemdsärmeln und einem dunklen Wollpullunder zu ihnen aufsah. Gegenüber saß an einem tadellos ordentlichen Schreibtisch eine adrett gekleidete Blondine mit äußerst roten Lippen.
„Ah, Sir Stanley. Ich habe von den meisten Stadionbetreibern gehört, allerdings noch nicht von allen,“ sage der Mann mit Brille. Die Frau schaute nur etwas pikiert auf.
„Sehr gut, Wesley, bleiben Sie am Ball“, antwortete Rous, offensichtlich wenig an dem interessiert, was der Mann ihm gerade gesagt hatte. „Irgendwelche Post, Ms. Brightenstein?“ Die Dame trommelte mit ihren ebenfalls roten Fingernägeln auf den Schreibtisch und sagte: „Alles erledigt, Sir.“ Es war offensichtlich, dass sie Wesley mit dieser Aussage mit Verachtung strafen wollte. Jean und Rous marschierten weiter in ein dahinterliegendes Zimmer, welches einen Ausblick auf die Straße und den Park bot. Sir Stanley schloss das Zimmer hinter Jean und setzte sich an einen Schreibtisch, wo er seinen Kopf gleich auf die Hände stützte.
„Nicht genug, dass ich mit der Organisation ordentlich zu tun hätte …“ Er nahm einen der zwei Telefonhörer, die auf seinem Schreibtisch standen, wählte eine Nummer und trommelte wartend mit den Fingern seiner rechten Hand auf dem Papier, das wild verteilt auf dem Schreibtisch lag. Dann rief er: „Wesley, rufen Sie Mears an und fragen Sie ihn nach dem Stand der Dinge.“ Von der anderen Seite der Tür kam ein gedämpftes „Jawohl, Sir.“
Eine Tür am anderen Ende des Raumes öffnete sich. Ein älterer Herr mit zurückgekämmten dunkelblonden Haaren und einer modernen, kantigen Brille, deren oberer Steg aus schwarzem Horn war, kam langsam herein.
„Ich bin hier, Stanley. Was gibt’s?“
„Ah. Oh. Joe. Schön. Wollte nur mal fragen, was die Unterkünfte der Italiener angeht. Aber Du bist ja bei der Sache. Darf ich vorstellen – das hier ist Jean Doyle. Eine, ähh, alte Freundin.“
„Angenehm.“ Mears kam schüchtern auf Jean zu, die ihn unsicher anlächelte.
„Sie wollte sich unser Heiligtum einmal von innen ansehen. Nun ja, ich werde sie auch gleich hinausbegleiten.“
„Bei uns ist immer was los, Miss Doyle. So eine Weltmeisterschaft ist ein Haufen Arbeit. Zum Glück haben wir aber noch Wesley da draußen, der Tag und Nacht schuftet.“
„Ich beneide Sie nicht. Aber dafür haben wir die Ehre, dieses großartige Turnier auszurichten.“ Jean fand ihre tröstenden Worte, in dem Moment, als sie sie ausgesprochen hatte, äußerst banal.
„In der Tat. In der Tat.“ Mears schlurfte zurück in das nebenan liegende Zimmer, aus dem er gekommen war. Sir Stanley wartete, bis die Tür sich schloss, und schaute Jean dann eindringlich an.
„Sie sehen, Lady Doyle, wir können hier schlecht reden. Aber Sie sehen auch, dass wir alle auf Ihre Hilfe angewiesen sind. Sie sind eine der wenigen, die das Geheimnis des Pokals kennen. Sie müssen den Pokal stehlen. Danach lassen wir ihn irgendwie finden und haben einen neuen, der keinen Makel trägt.“
Jean blickte Sir Stanley an. „Wie stellen Sie sich das vor? Wie bitteschön soll ich denn ein hochgradig gesichertes Ausstellungstück stehlen? Und warum ich?“
„Wie Sie das machen, davon habe ich keine Ahnung. Und ich will es auch gar nicht wissen. Wichtig ist, dass Sie es tun. Und zu Ihrer Frage, warum ausgerechnet Sie: Außer Ihrer Majestät, Ihnen und mir weiß keiner davon, dass der Pokal mit Blut besudelt ist. Sie haben die notwendige militärische Ausbildung. Sie haben es schon mit dem Pokal zu tun gehabt. Also schnappen Sie ihn sich.“
Mit vor sich gefalteten Händen schaute Rous sie vom Schreibtisch aus an. Er wirkte nicht wie ein Mann, dem man widersprechen wollte oder gar konnte.
„Und wie verfahre ich, wenn ich diesen Pokal habe?“