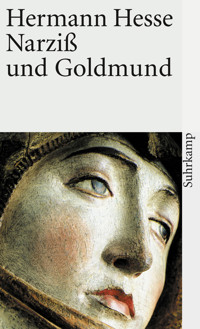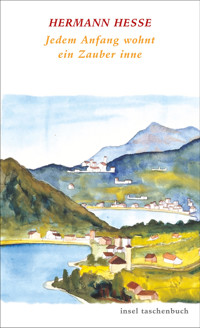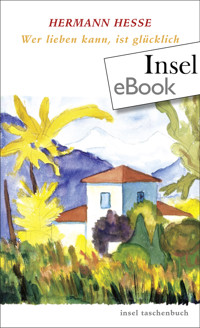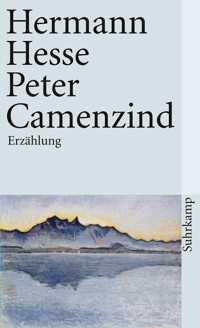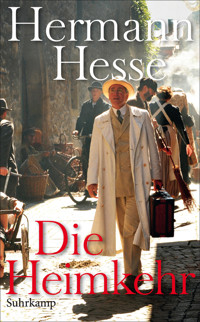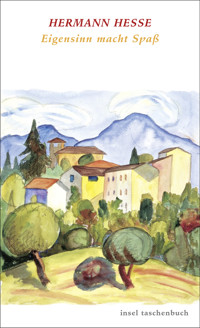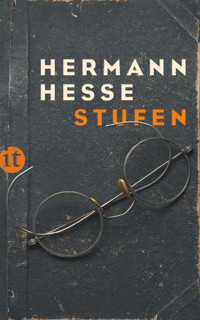13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Diese 1934 entstandene Erzählung, die ursprünglich in Hesses Alterswerk Das Glasperlenspiel aufgenommen werden sollte, ist Fragment geblieben und wurde erst drei Jahre nach seinem Tod veröffentlicht. Sie spielt im 18. Jahrhundert in der Blütezeit der europäischen Musik und des Pietismus und zeigt den Umweg, den der eigentlich für die Musik begabte Josef Knecht auf sich nehmen muß, um der Erwartung seiner frommen Mutter zu entsprechen, die ihren Sohn am liebsten als geistlichen Würdenträger gesehen hätte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 231
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Hermann Hesse
Der vierte Lebenslauf
Josef Knechts
Zwei Fassungen
Mit einem Nachwort von Theodore Ziolkowski
Suhrkamp
Inhalt
Erste Fassung
Zweite Fassung
Anmerkung
Nachwort
Erste Fassung
Unter einem der vielen eigensinnigen, begabten und schließlich trotz allen Unarten beinah liebenswerten Herzöge von Württemberg, die sich mit der »Landschaft« ebenso zäh und siegreich wie launisch und knabenhaft um Geld und Rechte einige Jahrhunderte lang gestritten haben, wurde Knecht in der Stadt Beutelsperg geboren, etwa ein Dutzend Jahre nachdem durch den Frieden von Rijswik das Land für eine Weile von den Teufeln erlöst worden war, die es im Auftrag Ludwigs XIV. lange Zeit wahrhaft viehisch gebrandschatzt, ausgesogen und verwüstet hatten. Zwar dauerte der Friede nicht lang, aber der tüchtige Herzog, mit dem damals berühmtesten Feldherrn Prinz Eugen von Savoyen verbündet, raffte sich auf, schlug die Franzosen mehrmals und trieb sie endlich aus dem Lande, das nun seit bald hundert Jahren mehr Krieg als Frieden und mehr Elend als gute Tage gesehen hatte. Das Land war seinem schneidigen Fürsten dankbar, welcher seinerseits energisch die Gelegenheit ergriff, dem Lande ein stehendes Heer aufzunötigen, womit der gewohnte und normale Zustand einer in ewigem Kleinkrieg warm gehaltenen Haßliebe zwischen Fürst und Volk wiederhergestellt war.
Knechts Vaterhaus stand am Rande der kleinen Stadt, zu oberst in einer steil bergan führenden Gasse, die vom glockentiefen Amboßklang einer Schmiede und vom Geruch versengter Roßhufe beherrscht war und aus zwei Reihen von kleinen Fachwerkhäusern bestand, die ihre spitz hochlaufenden Giebel zur Gasse kehrten und deren jedes vom andern durch einen modrig finstern Zwischenraum getrennt war. Vor den meisten Häusern standen Misthaufen, manche mit schön geflochtenen Strohkanten, denn die meisten Bürger waren nicht bloß Gewerbetreibende, Kaufleute und Beamte, sondern besaßen auch Wiesen, Äcker und Wald und hatten im Erdgeschoß ihrer Giebelhäuser oder in eigenen Ställen Vieh stehen. Noch bestand, selbst in der üppigen Residenz Stuttgart, dies Zusammenleben von Stadt und Land, von Menschen und Vieh in seiner harmlosen und anmutigen Natürlichkeit; im Juni dufteten die Gassen nach Heu, im September nach Obst und süßem Most, zwischen den Häusern und dem Fluß wandelten morgens und abends die klugen, streitsüchtigen Gänse, im Herbst und Winter wurde vor den Häusern das Tannen- und Buchenholz in Klaftern abgeladen und aufgebaut, und am Rand der Gasse von den Hausvätern, Knechten oder Mägden kurzgesägt und auf dem Block in Scheiter gespalten. Es war ein hübsches Städtchen, umfaßt von starken Mauern, in deren Ritzen kleine Farne wuchsen und auf deren Innenseite fast lauter Gärten lagen, meist Grasgärten mit Nuß-, Birn- und Apfelbäumen, dazwischen standen auch schon zwei von den später sehr beliebten Zwetschgenbäumen, gewachsen aus jenen paar Reisern, welche im Jahr 1688 die Übriggebliebenen jenes schwäbischen Regiments aus Belgrad mitgebracht hatten, wofür sie noch lange von den Baumzüchtern gepriesen wurden. Von der gotischen Kirche, deren Turm im 30jährigen Kriege beschädigt worden und bis zur Stunde nur mit einem bretternen Notdach versehen war, liefen um den gepflasterten Marktplatz herum in unregelmäßigen Reihen die vornehmem Häuser der Altstadt, stolz mit doppelter Freitreppe das Rathaus, aus Herzog Ulrichs Zeiten; von da verloren sich die Gassen, minder prächtig, abwärts zum Flusse, mit der oberen und unteren Mühle endend. Jenseits des Wassers, durch eine Brücke mit der Stadt verbunden, zog sich zwischen Fluß und Berghang noch eine einzige lange Häuserzeile hin, die sonnigste der Stadt. Nicht hier stand Knechts bescheidenes Vaterhaus, sondern im höchsten Stadtteil, oberhalb von Markt und Kirche; auf der Rückseite dieser Gasse schoß in enger Schlucht ein kleiner heftiger Bach zu Tal und in den Fluß, eine der Mühlen stand an seiner Mündung.
Das Knechtsche Haus glich allen andern der Gasse, war aber eins der kleinem und bescheidenem. Das Erdgeschoß wurde vom Stall und einer Vorrats- oder Heukammer eingenommen, eine steile hölzerne Treppe führte nach oben, hier wohnte, schlief, aß, ward geboren und starb die Familie in drei Stuben, neben welchen noch die Küche und oben im Dach eine winzige Kammer vorhanden war. Vor diesem Stockwerk hing auf der Rückseite des Hauses, der Bachschlucht zugewandt, eine schmale Laube, zwischen Wohnung und Dach lag der Dachboden, hier wurde das Brennholz aufbewahrt und die Wäsche zum Trocknen gehängt. Im Stall unten gab es kein Rindvieh, nur Ziegen und ein paar Hühner. Unter der Treppe führte eine Falltür zum Keller, er war ein fensterloses, in den weichen Fels gehauenes Loch, hier lagerte ein Faß Most, auch wurden hier über den Winter Kohl und Rüben aufbewahrt.
In diesem Häuschen wurde Knecht geboren. Sein Vater hatte ein nicht sehr einträgliches, aber seltenes und geachtetes Handwerk, er war Brunnenmacher. Er war dem Gemeinderat dafür verantwortlich, daß die öffentlichen Brunnen Wasser führten und rein gehalten wurden. Es gab zwar zwei oder drei Brunnen in der Stadt, welche stets von selber liefen, und manche Hausfrau tat es nicht anders, auch wenn es sie einen weiten Weg kostete, füllte sie die Trinkwasserkrüge jeden Tag aus einem dieser Brunnen, welche ihr eigenes, reines, kaltes Quellwasser führten. Die anderen Brunnen und die Viehtränken aber wurden von entfernten Quellen her gespeist, aus Brunnenstuben draußen im Walde, und von den Brunnenstuben den weiten Weg zur Stadt rann dies Wasser in hölzernen Röhren, welche man Teichel nannte. Diese Teichel, die halbierten Stammholzstücke mit halbrund ausgehöhlter Rinne, deren man das Jahr hindurch Hunderte brauchte, diese Teichel herzustellen, zu Leitungen bald über bald unter der Erde zusammenzulegen und zu befestigen, für Gefälle und Reinhaltung zu sorgen, die Schäden an der Leitung beständig aufzusuchen und auszubessern, war des Brunnenmachers Beruf. In strengen Zeiten, etwa nach Überschwemmungen, arbeitete er mit mehreren Taglöhnern, die ihm von der Stadt gestellt wurden. Mit Knechts Vater war der Gemeinderat zufrieden, er war tüchtig und zuverlässig, ein wenig wortkarg vielleicht und in der Art wunderlich wie Leute es leicht sind, die keine Kollegen haben und ihrem Beruf zum größeren Teil draußen in Wald und Einsamkeit nachgehen. Für die Kinder der Stadt war er ein geheimnisvoller Mann, mit den Wassernixen bekannt und in den entlegenen, finsteren Brunnenstuben zu Hause, in welche man nicht hineinblicken konnte und in denen es so fremd und urweltlich klang und gluckte, und aus welchen auch die kleinen Kinder sollten geholt werden.
Der Knabe Knecht hatte großen Respekt vor seinem Vater, es gab nur einen einzigen Mann, an dem er noch ehrfürchtiger emporblickte, der ihm noch edler, würdiger, höher und furchtgebietender vorkam. Dies war der »Spezial«, der höchste evangelische Geistliche der Stadt und des Bezirkes, ein schöner, stets schwarzgekleideter und mit einem Hut geschmückter Herr von hoher Gestalt und aufrechter Haltung, stillem bärtigem Gesicht und hoher Stirn; und daß ihm dieser Priester so besonders ehrwürdig war, daran hatte auch Knechts Mutter Teil. Sie stammte aus einem Pfarrhause, aus einem ländlichen und sehr armen zwar, aber sie hielt fromm und treu an den kirchlichen und geistlichen Erinnerungen ihres Vaterhauses fest, hatte einen Pfarrer zum Schwager, las die Bibel und erzog ihren Sohn im gläubigen Gehorsam gegen die Landeskirche und die reine Lehre, wie sie seit Brenz und Andreä im Herzogtum treu bewahrt worden war. Die Gläubigen der römischen Kirche nannte sie Papisten und Teufelsdiener, und bis zu hohem Grade verdächtig waren ihr auch die evangelischen Kirchen von etwas anders gefärbtem Bekenntnis, besonders die der Zwinglianer und Calvinisten. Diese Gesinnung bestimmte den Geist und die Erziehung im Haus des Brunnenmachers. Dieser selbst freilich nahm nur schweigend daran teil, ging jeden Sonntag zur Predigt und mehrmals des Jahres zum Sakrament des Abendmahls, womit seine religiösen Bedürfnisse gestillt waren, theologische wie seine Frau hatte er nicht. Dagegen gab es ein anderes Bedürfnis und Interesse, das in der Kirche wie zu Hause Knechts Eltern gemeinsam war, nämlich das für die Musik. Den Gesang der Gemeinde halfen ihre beiden Stimmen fleißig stützen, und wenn sie zu Hause, wie es oft am Feierabend geschah, geistliche oder Volkslieder anstimmten, so sang Vater Knecht kunstvoll die zweite Stimme, und noch waren der kleine Knecht und seine Schwester Benigna nicht schulpflichtig, da sangen sie schon mit, und es wurden auch drei- und vierstimmige Lieder sauber vorgetragen. Dabei neigte Vater Knecht mehr zu den Volksliedern, deren er viele kannte, seine Frau aber mehr zu geistlichen Gesängen. Außerdem trieb der weltlicher gesinnte Brunnenmacher außerhalb des Hauses auf mancherlei Arten Musik, und verschönte damit die Ruhepausen bei seiner meist einsamen Arbeit. Er sang oder pfiff dann seine Volkslieder, Märsche und Tänze, oder blies irgendein von ihm selbst verfertigtes Instrument, am liebsten eine kleine dünne Holzflöte ohne Klappen. Er hatte in seinen Jugendjahren auch als Pfeifer und Zinkenist auf den Tanzplätzen mitgeblasen, bei seiner Verlobung mit der Pfarrerstochter aber, anno 1695, hatte er seiner Braut versprechen müssen, dies niemals mehr zu tun, und hatte sein Wort gehalten, obwohl er nicht so tief und brennend wie seine Frau davon überzeugt war, daß die Wirtshäuser und Tanzböden Brutstätten des Satans seien. In späteren Jahren erinnerte sich Knecht an die seltenen Male, da ihn als ganz kleinen Knaben sein Vater mit auf seine Arbeitsplätze vor der Stadt genommen hatte. Da hatte nach getaner Arbeit der Vater seine kleine helltönende Holzpfeife hervorgezogen, hatte ein Lied ums andre auf ihr gespielt, und der Kleine hatte die zweite Stimme dazu singen müssen. Als sein Vater nicht mehr lebte, gehörte dies Bild des mit ihm im Walde einsam musizierenden Vaters zu den schönsten in seinem Gedächtnis, es hatte jenen überwirklich paradiesischen Glanz und Zauber, den manchmal solche früheste Erinnerungen, und außer ihnen nur manche Träume, haben.
Wie man sieht, lag in geistiger Hinsicht das Hausregiment und die Erziehung mehr in der Mutter als in des Vaters Händen. Der Brunnenmacher hatte durch seine Ehe mit dieser klugen und frommen Frau eine gewisse Vergeistigung, eine Sublimierung seiner Natur erfahren, sein Leben war in eine andere, spirituellere Tonart transponiert worden, er hatte eine fromme und geistig strebsame Frau bekommen, sie konnte sogar ein wenig Latein, er hatte dafür auf einige Gewohnheiten seiner Jugendzeit verzichtet, namentlich auf den Besuch der Wirtshäuser und auf das Mitspielen bei den Tanzbodenmusiken. Indessen war diese Sublimierung seines Wesens doch nur im großen ganzen geglückt. Daß er, wenn er mit sich oder den Kindern allein war, nur seine lieben Volkslieder sang und die Choräle wegließ, deren er sonst genug zu hören bekam, war in Ordnung und natürlich. Dagegen bezahlte er jene Veredlung seines Lebens noch mit manchen kleinen Beschwerden, und eine von ihnen war nicht klein, sondern für ihn und andre recht lästig und peinlich, ja man könnte sie schlechthin ein Laster oder eine Krankheit nennen. Während er nämlich fast das ganze Jahr hindurch als Brunnenmacher, als Gatte, als Hausvater und Kirchenbesucher seinen Pflichten genügte und ein nicht nur ehrbares, sondern mehr als durchschnittlich enthaltsames und gediegenes Bürger- und Christenleben führte, geschah es ihm ein- bis zweimal im Jahr, daß er diese Haltung (welche ihn also offenbar doch irgendwie überanstrengte) verlor und sich gehen ließ, er ergab sich dann einen Tag, oder auch zwei, drei Tage lang dem Trunk, lag in Schenken herum und kehrte nach solchem Exzeß sehr still, scheu und gepeinigt nach Hause zurück, wo seit Jahren über diese betrüblichen Vorkommnisse nur etwa Blicke, doch keine Worte mehr gewechselt wurden. Denn die Zucht, unter der Knechts Leben stand, ließ zwar als Ventil für die undisziplinierbaren Reste seiner Instinkte und Triebe eben jenes Loch der seltenen Anfälle von Trunksucht offen, aber sie war doch stark genug, den Mann bis in dies Laster hinein nicht völlig loszulassen und ihn noch in der scheinbaren Entfesselung einigermaßen zu zügeln: wenn nämlich jener schlimme Hang zur Betäubung ihn überfiel, dann mied der Brunnenmacher nicht nur sein Haus und dessen nächste Umgebung, sondern auch die innere Stadt und die ganze Sphäre seines gewohnten Lebens, und auch in der Gelöstheit und Willenlosigkeit des Rausches passierte es ihm niemals, daß er die gewohnten Schauplätze betreten und sich in solchem Zustand gewissermaßen seinem eigenen Tagesleben gegenübergestellt hätte. Sondern er brachte sein Opfer an die Nachtseite im Verborgenen dar, nahm entweder seine Getränke mit ins Freie, oder genoß sie in der Umgebung der Stadt in geringen Kneipen, wo er keinen Bürger seines Ranges antraf und kehrte niemals betrunken nach Hause zurück, sondern immer erst gereinigt und ernüchtert und schon im Zustand der Reue. So kam es auch, daß die Kinder erst spät von diesen Zuständen erfuhren, und sich auch dann noch jahrelang weigerten an sie zu glauben.
So gehörte zum Erbe des Knaben von beiden Eltern her die Musik, vom Vater her außerdem eine gewisse schwankende Haltung zwischen Geist und Trieb, zwischen Pflicht und Lässigkeit, dazu kam von seiten der Mutter die Devotion vor dem Geistlichen und eine Anlage zur Theologie und Spekulation. Unbewußt fühlte er stark mit seinem Vater, der ihn Waldlaufen und Einsamkeit lieben lehrte, dessen stark gebändigtes Leben etwas im Schatten der Mutter stand und ihn in seinem Hause einigermaßen zum Gast machte, was der Sohn zu Zeiten ahnend und mit einer mitleidähnlichen Zärtlichkeit empfand. Auf der andern Seite aber stand die Mutter und stand eine Welt der Ordnung und Andacht, und hinter ihr die große feierliche Heimat der Kirche. War es auch nur eine kleine Kirche, für ihn war sie vorerst die einzige, und neben jenen holden Erinnerungsbildern, die seinem Leben mit dem Vater entstammten, standen andre, nicht minder schöne, nicht minder geliebte und heilige: die Mutter und ihre geliebte Stimme, der Geist ihrer biblischen Geschichten und Choräle, die priesterliche Gestalt des Spezials und die Atmosphäre der Stadtkirche, in welche er schon früh mitgenommen wurde. Die Sonntagsstunden in dieser Kirche hinterließen namentlich drei Erinnerungsreihen in seiner Kinderseele: an den Herrn Spezialsuperintendenten, wie er im schwarzen Kleide hoch und ehrwürdig zur Kanzel schritt, an die Wogen der Orgelmusik, wie sie mit langem Atem den heiligen Raum durchflutete, und an das hohe Gewölbe des Kirchenschiffs, zu dem er während der langen, feierlich halbverständlichen Predigten lange und träumerisch emporblickte, bezaubert von dem wunderlich lebendigen Netzgeflechte der Gewölberippen, das so still und steinern und hundertjährig oben hing und beim Betrachten so viel Leben, Zauber und Musik ausstrahlte, als wöben in diesen sich spitzwinkelig schneidenden Steinrippen die Gewalten der Orgelmusik sich spielend und kämpfend fort und fort, unterwegs zu einer unendlichen Harmonie.
Darüber, was einmal aus ihm werden sollte, hatte der Knabe während seiner Kinderzeit manche wechselnde Gedanken und Wünsche. Lange Zeit schien es ihm richtig und selbstverständlich, daß er werde was sein Vater war, daß er bei ihm dessen Handwerk erlerne, und später selbst ein Brunnenmacher sei, die Quellen fasse und pflege, die Brunnenstuben reinhalte, die Holzröhren zusammensetze und in den Ruhepausen im Walde Lieder auf selbstgemachten Flöten spiele. Aber etwas später wollte es ihm scheinen, es gebe nichts Erstrebenswerteres, als einmal so in seiner Stadt einherzugehen wie der Herr Spezial, schwarz gekleidet und würdevoll, ein Priester, ein Diener Gottes und Vater der Gemeinde. Nur mochten freilich dazu Kräfte und Gaben gehören, welche sich selber zuzutrauen Vermessenheit wäre. Und andrerseits gab es noch andre Wünsche und Möglichkeiten, vor allem die eine: Musik zu machen, Orgelspielen zu lernen, Chöre zu dirigieren, oder wenigstens als Cembalist, Flötenbläser oder Geiger der Kunst zu dienen. Diese Wunschbilder standen über seiner Kindheit, und mit dem Schwinden und Abwelken der Kindheit schwand und welkte mehr und mehr auch der früheste und unschuldigste dieser Wünsche: zu werden was sein Vater war.
Knechts Schwester Benigna, einige Jahre jünger als er, ein schönes und etwas scheues und eigenwilliges Kind, war im Singen und später auch im Lautenspielen von unbeirrbarer Sicherheit. Sicherer und entschiedener als ihr Brüderchen war sie auch in ihren Gefühlen. Sie neigte schon in ihren ersten Jahren mehr zum Vater als zur Mutter, und stellte sich später immer mehr auf dessen Seite, wurde sein Liebling und Kamerad, lernte alle seine Volkslieder, auch jene, dieman zu Hause vor der Mutter nicht sang, und hing ihm mit leidenschaftliecher Liebe an. Übrigens waren die beiden keineswegs die einzigen Kinder des Brunnenmachers, es wurden sechs oder mehr geboren, und zuzeiten war das kleine Haus überfüllt mit Kindervolk, aber nur die zwei wurden groß, alle andern starben früh, wurden beweint und wurden vergessen, und so sei von ihnen hier nicht die Rede.
Von den großen und kleinen Eindrücken, Ereignissen und Begegnungen in Knechts Kindheit war es ein Erlebnis, das tiefer als alle andern in ihn einging und in ihm nachhallte, das Erlebnis eines Augenblickes nur, aber es hatte symbolische Kraft.
Den Spezial Bilfinger kannte Knecht nicht eigentlich als einen Menschen, sondern mehr wie eine Heldenfigur oder einen Erzengel; in einer unerreichbaren Ferne, Höhe und Würde schien dieser Hohepriester zu atmen und zu schreiten. Knecht kannte ihn von der Kirche her, wo der Spezial entweder am Altare stehend oder erhaben auf der Kanzel ragend mit Gestalt, Gebärde und Stimme die christliche Gemeinde regierte, ermahnte, beriet, tröstete, warnte, strafte oder als Mittler und Herold ihr Flehen, ihren Dank, ihre Sorgen im Gebet vor Gottes Thron brachte. Ehrwürdig, heilig und auch heldisch erschien er da, keine Person sondern nur Gestalt, nur Darstellung und Fleischwerdung des Priesteramtes, Künder des göttlichen Wortes, Verwalter der Sakramente. Auch von der Straße kannte er ihn; dort war er näher, erreichbarer, menschenähnlicher, dort war er mehr Vater als Priester, von jedermann ehrerbietig gegrüßt schritt er hoch und schön einher, blieb bei einem Alten stehen, ließ sich von einer Frau ins Gespräch ziehen, bückte sich zu einem Kind herab, und sein edles geistiges Gesicht war hier nicht amtlich und unnahbar, sondern strahlte Güte und Freundlichkeit, und Liebe und Vertrauen kam ihm aus allen Gesichtern, Häusern und Gassen entgegen. Auch er, der Knabe Knecht, war schon einige Male von diesem Patriarchen angesprochen worden, hatte seine große Hand um seine kleine oder auf seinem blonden Kopf gefühlt, denn Bilfinger anerkannte und schätzte in Frau Knecht sowohl die Pfarrerstochter wie das eifrig-fromme Gemeindeglied, und sprach sie oft auf der Gasse an, hatte bei Krankheiten und beim Sterben der Kinder auch je und je das Knechtsche Haus betreten.
Das Erlebnis eines unvergeßlichen Augenblicks nun gab dem Priester und Patriarchen, dem Prediger und Halbgott für den Knaben plötzlich ganz neue Züge und setzte ihn in ganz neue, bestürzende und auch beglückende Beziehungen zu ihm.
Der Spezial wohnte nahe der Kirche in einem schönen steinernen Amtshause, das von der Gasse etwas zurückstand und mit ihr durch eine breite, schwer gemauerte Treppe mit acht oder zehn Stufen verbunden war. Ein Portal mit massiver Nußbaumtür und schwerem Messingbeschlag führte ins Haus, das man Spezialat nannte, aber im Erdgeschoß dieses Hauses waren keine Wohnräume, nur eine große leere Vorhalle mit Steinfliesen und ein saalartiger, flach gewölbter Raum für Sitzungen; hier konferierten zuweilen die Gemeindeältesten und kamen alle paar Wochen die Geistlichen der Umgegend bei ihrem Vorgesetzen und Visitator zu einer kollegialen Geselligkeit mit Vorträgen und Disputationen zusammen. Die Wohnung des Spezials und seiner Familie lag ein Stockwerk höher. Diese vornehme Abgeschlossenheit und Unsichtbarkeit seines Alltagslebens paßte sehr zum Spezial, obwohl er sie nur einem Zufall verdankte: das Spezialat war in frühern Zeiten das Amtshaus des gräflichen Vogtes gewesen und es gab noch einige alte Leute am Ort, die es »Vogtei« hießen. Nicht selten hatte der Knabe Knecht, wenn er in diese Gegend kam, sich das vornehme und geheimnisvolle Haus des Spezials neugierig angesehen, war die kühle Vortreppe hinan geschlichen, hatte das glänzende Messing an der altersdunklen Tür berührt und die Ornamente darauf betrachtet, hatte auch etwa durch einen Türspalt einen Blick ins Haus getan, in die stille Vorhalle, aus deren stiller, düstrer Leere man weit hinten eine Treppe hinan führen sah. Andere, gewöhnliche Häuser erlaubten irgendeinen Blick in das Leben ihrer Bewohner, man sah durchs Fenster jemand in der Stube sitzen, sah Hausbesitzer, Knecht oder Magd bei einer Arbeit, sah Kinder spielen. Hier aber verbarg sich alles, hoch oben in vollkommener Stille und Unsichtbarkeit verlief das häusliche Leben des Spezials, der Witwer war und dessen Haushalt eine schweigsame alte Verwandte führte. Hinter dem Spezialat erstreckte sich ein Garten mit Obstbäumen und Beerensträuchern, auch er wohlumhegt und verborgen, nur der nächste Nachbar mochte hier etwa den geistlichen Herrn an Sommertagen auf und nieder wandeln sehen.
Nun wohnte am Berghang, gerade über jenem Garten, eine Base von Knechts Mutter in zwei hochgelegenen Kammern, eine alte Jungfer, und es kam vor, daß Frau Knecht zu einem Besuch bei ihr eins der Kinder mitnahm. Dies begab sich einmal wieder, an einem Herbsttag, und der Knabe stand, während die beiden Frauen ihre Fragen und Erzählungen austauschten, am Fenster, anfangs etwas gelangweilt und mürrisch, dann vom Blick auf den tief unten liegenden Garten des Spezials gefesselt, dessen Bäume ihre letzten fahlen Blätter gegen den Oktoberwind verteidigten. Auch auf das Haus des Spezials konnte man hier blicken, doch waren alle Fenster seiner Wohnung geschlossen und hinter den Scheiben und Vorhängen nichts zu erkennen. Ein Stockwerk höher aber blickte man in einen Dachboden, wo etwas Wäsche aufgehängt war und Brennholz gestapelt lag. Und daneben sah man, schräg von oben herab, in eine ziemlich kahle Dachkammer, wo eine große Kiste mit Papieren gefüllt stand und alter, weggeräumter Hausrat an der Wand stand und lag, eine Truhe, eine alte Kinderwiege, ein baufälliger Lehnstuhl mit zerrissenem Bezug. Gedankenlos aber neugierig starrte Knecht in diesen unwohnlichen Raum und auf das dort verkommende Gerümpel. Da plötzlich erschien in der Kammer eine große Gestalt, es war der Spezial selber. Barhaupt im grauen Haar, im schwarzen langen Gehrock, trat er ein, und Knecht wartete mit gespannter Neugierde, was wohl der ehrwürdige Herr in diesem vernachlässigten Winkel zu verrichten habe.
Spezial Bilfinger ging mehrere Male mit starken Schritten durch die Kammer auf und nieder, mit sorgenvollem Gesicht, sichtlich von Kummer und schweren Gedanken gepeinigt. Dann blieb er stehen, mit dem Rücken zum Fenster, langsam das Haupt senkend. So stand er eine Weile, und nun ließ er sich plötzlich auf beide Knie nieder, faltete seine Hände und preßte sie zusammen, hob und senkte die gefalteten Hände betend, verharrte knieend und tief zum Boden gebückt. Knecht verstand sofort, daß er betete, und ein Gefühl von Scham und schlechtem Gewissen zog ihm das Herz zusammen darüber, daß er Zuschauer dieses Betens und Knieens geworden war, aber es war ihm nicht möglich, sich abzuwenden, atemlos und erschrocken starrte er auf den knieenden Mann, sah seine Hände flehen und sein Haupt wieder und wieder sich neigen. Und endlich stand der Mann wieder auf, langsam und mit einiger Mühe, wurde wieder groß und aufrecht, und einen Augenblick konnte Knecht sein Gesicht sehen; es standen Tränen in seinen Augen, aber das ganze Gesicht glänzte sanft, schimmerte von einem stillen andächtigen Glück und sah so schön und unbeschreiblich liebenswert aus, daß der Knabe an seinem Fenster einen Druck und Schauer im Innern empfand und weinen mußte.
Knecht gelang es, seine Tränen, seine Bewegung und sein ganzes Erlebnis zu verbergen, und dies war das erste, im Augenblick stärkste Ergebnis des Erlebten: er hatte ein Geheimnis, er hatte etwas Unaussprechliches, etwas Großes aber Schamhaftes ganz für sich allein erlebt, und hatte sofort gewußt, daß er dies niemandem würde mitteilen können. Aber dies war bloß eine von vielen tiefen und wirksamen Bedeutungen jenes Augenblickes, der für lange Zeit die Quelle von Phantasien und Seelenbewegungen, Grübeleien und Wünschen blieb; ja, wenn Knecht am Ende seines Lebens gefragt worden wäre, welche Begebenheit in seinem Leben die wichtigste und unvergeßlichste gewesen sei, so hätte er vielleicht diese Stunde genannt, da er am Fenster seiner Tante und über den öden Herbstgarten hinweg in seiner Dachkammer den Herrn Spezial hatte niederknieen und beten sehen. O wieviel bedeutete dies, wieviel brachte es in Bewegung; wie viele Gesichter hatte es! Er, der etwa siebenjährige Knabe, hatte einen großen, erwachsenen Mann, einen alten Mann bekümmert und hilfsbedürftig durch die Kammer laufen, hatte ihn niederknieen, beten und weinen, ringen, sich demütigen und flehen sehen. Und dieser Mann war nicht irgendeiner gewesen, sondern der Spezial, der verehrte und etwas gefürchtete Prediger, der Mann Gottes, der Vater aller, der von allen tief Gegrüßte, der Inbegriff aller männlichen und priesterlichen Würde und Hoheit! Ihn hatte er sorgenvoll und verzagt, ihn hatte er kindlich und demütig sich in den Staub niederlassen und vor Einem knieen sehen, vor welchem auch er, der Verehrte und Große, nur ein Kind und nur ein Stäubchen war! Diese beiden Gedanken waren die ersten, die sich aus dem Anblick ergaben: wie aufrichtig und von Herzen fromm dieser Mann sein müsse – und wie groß, wie königlich und gewaltig Gott sein müsse, daß ein solcher Mann solchergestalt sich vor ihm hinwarf und zu ihm flehte! Und weiter: das Flehen war erhört worden, es hatte Frucht getragen; unter Tränen hatte das Gesicht des Beters gelächelt, hatte Erlösung, Stillung, Tröstung und süße Zuversicht ausgedrückt. In Monaten und Jahren dachte Knecht den Inhalt dieser Augenblicke nicht zu Ende, er strömte wie eine Quelle. Er wandte des Knaben Gedanken, der sich oft gewünscht und erträumt hatte, selbst einmal ein Spezial in schwarzem Anzug und Schnallenschuhen zu werden, hinüber zu dem, dessen Diener der Spezial war, von dem er Amt, Bedeutung und Ansehen bekommen hatte. Und wieder war Ihm gegenüber dem Herrgott, der Spezial nicht bloß ein Diener, Beamter und Beauftragter, nein, er war sein Kind, wandte sich an ihn wie ein Kind an den Vater, demütig aber voll Offenheit und Vertrauen. Für Knecht aber, für den kindlichen Zuschauer jenes Gebetes, war der Spezial zugleich weniger und mehr geworden, hatte irgendetwas an stolzer Würde verloren und dafür etwas an Adel und Heiligkeit gewonnen, war aus den natürlichen und gewohnten Ordnungen heraus und unmittelbar in Beziehung zum himmlischen Vater getreten. Wohl hatte auch Knecht selbst schon oft gebetet, ja er betete jeden Tag, und nicht immer nur aus Zwang und Gewohnheit. Aber ein solches Gebet war ihm bisher unbekannt gewesen, unbekannt diese Not und Getriebenheit, diese Hingabe und Werbung, diese Demut und Ergebung und dieses Wiederaufstehen in Freude, Versöhnung und Gnade. Zum erstenmal sah Knecht im Beruf und Leben eines Geistlichen etwas ganz andres als das Würdige und Amtliche, zum erstenmal spürte er hinter Prediger und Predigt, hinter Kirche, Orgelklang und Gemeinde die Macht, zu deren Dienst und Preis dies alles da war, Ihn selbst, der der Gebieter der Könige und zugleich der Vater jedes Menschen ist.
Langsam nur entwickelten alle diese Betrachtungen sich in dem Kinde, und manche wurden nie zu Bewußtsein und Wort, aber alles was Knecht später ein Leben lang an geistlichen Gefühlen und Gedanken hinzu brachte, wurzelte mit in jener Stunde. Und daß das Nachdenken darüber so lange Zeit brauchte und Jahre dauerte, daran war noch etwas anderes schuld, jene andere Seite des Erlebten, jene schamhafte und etwas beklemmende, beunruhigende und vereinsasamende Seite. Das Große, was ihm begegnet war, war nichts dessen er sich rühmen und vor andern froh werden durfte, es war zugleich etwas Beschämendes daran, er war Zeuge einer Sache gewesen welche alle Zeugen scheut und ausschließt, er war Zuschauer von etwas geworden was man nicht schauen soll. Er hatte für den Spezial seit jener Stunde nicht nur eine gesteigerte Ehrfurcht und ganz neue Liebe, sondern schämte und fürchtete sich zugleich vor ihm wie vorher nie. Das Geheimnis und die Scham brachten es dazu, daß seine Gedanken, die doch begierig an dem Gesehenen hafteten, zugleich von diesem Gesehenen fortstrebten, daß er das Unvergeßliche zu vergessen wünschte. Er strebte davon hinweg und ward zu ihm zurückgezogen. Knecht war ein bescheidener, stiller Knabe von geringem Selbstvertrauen; wäre nicht das Biegsame, Musikalische, Harmoniesuchende in seiner Natur gewesen, so hätte sein Geheimnis ihm geschadet. Auch so drückte es schwer.