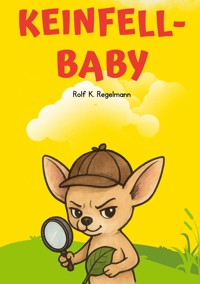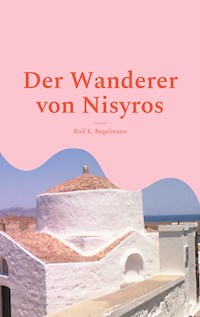
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Reise nach Nisyros. Auf der ursprünglichen, griechischen Vulkaninsel kommt der Protagonist nicht nur zur Ruhe. Er lässt bei einer spontanen Wanderung ins Bergdorf Nikia seine Reisen in die griechische Inselwelt Revue passieren. Es sind anrührende Erlebnisse voller Menschlichkeit und Respekt, die zu Herzen gehen. Geschichten, die den Blick öffnen für ein Lebensgefühl, das völlig anders ist als das unsere. Doch wie lange wird die griechische Inselwelt dem alles einnehmenden Hintergrundrauschen der Welt noch standhalten können? Ergänzt ist das Ganze mit interessanten Reisebeschreibungen bekannter Inseln. Griechenland, oder besser: die griechischen Inseln ... Dort müssen einfach die Götter wohnen!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 124
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über den Autor:
Rolf K. Regelmann, geb. 1966, studierte Verwaltungswissenschaften in Konstanz und war überwiegend in der Industrie tätig. Er hat einen Abschluss als Online-Redakteur.
Im Dezember 2020 erlitt er einen Schlaganfall.
Sein erstes Buch, das er noch vor der Krankheit begonnen hat, konnte er in kleinen Schritten zu Ende bringen. Es diente ihm als Therapie. Es handelt von Griechenland, seiner großen Liebe - und seinen Reisen dorthin.
Der Autor lebt in Überlingen am Bodensee.
„Das Geheimnis der Freiheit ist der Mut.“ (Perikles)
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Nisyros I
Korfu
Kreta
Samos
Lesbos
Rhodos
Kos
Zakynthos
Nisyros II
Epilog
Nachwort
PROLOG
„Ich liebe dies Griechenland überall. Es trägt die Farbe meines Herzens.“ (Friedrich Hölderlin)
„Die sich lieben, begegnen einander häufig.“ (Griechisches Sprichwort)
Kein Blick zurück.
Dieser Gedanke stieg in mir auf, wie ein kalymnischer Schwammtaucher aus der Tiefe an die Oberfläche, als ich die Fähre nach Nisyros betrat.
Nicht, dass ich Zorn auf meine Herkunft verspürt hätte.
Als Kind wurde mir ein fürsorgliches Zuhause geboten. Ich konnte die Schule besuchen und später studieren. Neben der eigenen Familie gab es eine Reihe von Verwandten, Freunden und Nachbarn - sie machten das Leben gelegentlich spannend und kurzweilig, bereicherten manchen Augenblick. Nicht zu vergessen die Versuche sich (wie so viele Menschen) möglichst unauffällig durch ein Erwerbsleben zu schlängeln, um den erreichten Wohlstand zu sichern.
Man konnte unterm Strich durchaus dankbar, vielleicht sogar zufrieden sein.
Doch jede Reise nach Griechenland hat das Band zwischen Deutschland und mir ein wenig mehr zerschnitten.
Meine Heimat zeichnet sich durch eine Menge Ecken und Kanten aus, an denen man sich blaue Flecken holen und blutig stoßen kann.
Sinn stiftet eine heilige Dreifaltigkeit aus Arbeit (möglichst gut), Haben (möglichst viel) und Shopping (möglichst oft). Wer in einem der drei Bereiche nicht in den erwarteten Gleichklang einstimmt läuft Gefahr, als Außenseiter oder gar Versager abgestempelt zu werden.
Der Begriff der Freiheit wiederum scheint sich im Wesentlichen in einem teilweisen Fehlen von Tempolimits auf Autobahnen zu erschöpfen … und in einem Angebot von gefühlt rund siebzig Sorten an Erdbeerjoghurt, zu finden in den Regalen der großen Discounter.
Das antike Griechenland ist ja die Geburtsstätte der abendländischen Philosophie.
In diesem Zusammenhang fällt mir eine Geschichte ein, die ich online gelesen habe.
Sie geht ungefähr so: Ein Professor der Philosophie stand vor seiner Pensionierung.
Ein Jahr davor kündigte er sein Dienstverhältnis mit der Uni und heuerte bei einer Reinigungsfirma an. Er wollte sich am Ende seines Berufslebens einmal aus dem akademischen Elfenbeinturm heraus lehnen und das praktische Leben kennenlernen.
Ein Leben, in dem die Leute auf Niedriglohnniveau schuften müssen.
Der Personalchef der Putzfirma staunte nicht schlecht. Er nahm ihn trotzdem in ein Beschäftigungsverhältnis.
Eine konstruktive Erfahrung für den Professor: Die Tätigkeit entpuppte sich als harte, schmutzige Arbeit bei Mindestlohn - und genau so war es geplant.
Ein praktischer Feldversuch sozusagen. Nur, dass einen solchen sonst kein Gelehrter freiwillig machen würde.
Als Reaktion aus dem akademischen Umfeld könnte ich mir am ehesten Unverständnis ausmalen.
Wie kann man nur auf ein Jahr seiner Pensionsansprüche verzichten? Es nicht gemütlich ausklingen lassen?
Eine Arbeit weit unter der Würde eines Akademikers. Nicht ernst zu nehmen, die ganze Aktion.
Oder gar ein Nestbeschmutzer.
Das sind doch ganz typische Denkmuster, mit denen sich jemand, der aus intellektuellen Kreisen ausschert und womöglich gar Partei für (vermeintlich) einfache Menschen ergreift, konfrontiert sieht.
Was ich sagen will - für den Professor war die Sache in Ordnung gewesen. Er fand sich mit dieser Arbeit in seiner Einschätzung bestätigt, dass der wissenschaftliche, intellektuelle Betrieb völlig überdehnt ist.
Vieles ist überdehnt, es zieht sich gefühlt durch die ganze Gesellschaft.
Die Arroganz, Überheblichkeit und Rechthaberei vieler Menschen, die Tatsache, dass sich sogar Wildfremde in private Angelegenheiten einmischen, hat etwas Beängstigendes an sich.
Ganz zu schweigen von den hasserfüllten Reaktionen zu irgendwelchen Themen in den sozialen Netzwerken - wir sind, wie wir reden.
Es scheint mir wie auf einem Pulverfass. Bescheidenheit, Dankbarkeit und Demut sind in der Gemeinschaft kaum mehr zu finden.
Wir haben dieses System so in uns aufgesogen, dass wir es schon gar nicht mehr merken.
Über den Schwächeren stehen, Ellbogen ausfahren, purer Egoismus. Ein steter Mangel an Empathie in allen Lebensbereichen (was den Deutschen übrigens schon mit den Nürnberger Prozessen von 1946 bescheinigt wurde).
Es sei überall auf der Welt so, wird einem vermittelt - also alles gut, alles im grünen Bereich!
Ist es wirklich so? Oder wird einem das Ganze nur eingeredet, um abzulenken davon, dass es eben doch anders sein kann?
Wieviel von dem Anderen möglich ist, habe ich bereits auf Kos gemerkt.
Die Insel wird regelmäßig von Pauschaltouristen überschwemmt. Trotzdem ist es eine völlig andere Welt, ein (noch) komplett anderes Leben, und das auf europäischem Boden.
Nun also die Überfahrt nach Nisyros.
Wer Ruhe sucht und sich an atemberaubender Landschaft nicht satt sehen kann, der sollte diesen Ort besucht haben. So steht es zumindest in einigen Reiseführern.
Drückt man auf Kos Einheimischen gegenüber seine Absicht aus, dem Massentourismus zu entfliehen und Abgeschiedenheit zu finden, wird einem die Insel schnell als Tipp genannt - nur wenige, kühne Touristen würden den Weg dorthin auf sich nehmen, heißt es.
Möglicherweise liegt es daran, dass der Insel gegenüber ein gewisser Respekt angebracht ist: Nisyros befindet sich auf dem so genannten Kykladenbogen, an dem die anatolische und die afrikanische Kontinentalplatte zusammentreffen.
Es handelt sich um ein Hochrisikogebiet: Der letzte große Vulkanausbruch liegt zwar schon um die 8000 Jahre zurück, trotzdem gibt es in den beiden noch aktiven Kratern der Insel immer wieder Schlammeruptionen.
Erdbeben, zum Glück meist kleinere, sind an der Tagesordnung und lassen die Insel regelmäßig erzittern.
Es heißt, Nisyros sei nicht einfach zu erreichen. Tatsächlich ist die Insel ausschließlich auf dem Seeweg zugänglich. Von Piräus und größeren Inseln wie Rhodos oftmals nur ein- oder zweimal wöchentlich. Um flexibel zu sein empfiehlt es sich, die Fähre von Kardamena zu nehmen.
Der Hafenort liegt im Süden der Insel Kos, und ein Schiff nach Nisyros legt hier wenigstens einmal täglich ab. Im Winter, je nach Wetterlage, sind die Verbindungen oftmals nicht gewährleistet und fallen häufig aus.
So kann es in der kalten Jahreszeit schon einmal zu Versorgungsengpässen kommen. Denn mit der Fährverbindung werden viele Güter des täglichen Bedarfs auf die Insel geliefert.
Heute, wo ich an Bord bin, befinden sich eine Handvoll Touristen und ein paar Einheimische mit ihren Mopeds auf der Fähre. Zwei oder drei Autos, die in Deutschland schon seit ewigen Zeiten keinen TÜV mehr bekommen hätten, sind mit von der Partie.
Ein älterer Kühlwagen, mit dem Logo eines bekannten deutschen Eisherstellers, rostet während der Überfahrt weiter gemütlich vor sich hin.
Etwas über eine Stunde dauert die Fahrt von Kardamena. Nach rund einer dreiviertel Stunde zieht zur rechten Seite Gyali vorbei.
Auf der unbewohnten Insel (die Angaben sind widersprüchlich: manche sagen, es lebten dort rund zwanzig Personen, genauer gesagt Arbeiter mit ihren Familien) werden Obsidian, Basalt und Bimsstein abgebaut. Die großen, weißen Abraumhalden sind von der See aus deutlich zu erkennen.
Bimsstein, ein glasiges Vulkangestein, wird als Baumaterial in viele Länder exportiert. Es stellt eine sehr bedeutende Einnahmequelle der kleinen Gemeinde Nisyros, zu der Gyali gehört, dar.
Die Berge, die die Caldera umschließen, grenzen sich jetzt scharf vom blauen Himmel ab. Es wird damit immer deutlicher, dass es sich bei Nisyros um eine Insel vulkanischen Ursprungs handelt.
Die weiß gekalkten, würfelförmigen Häuser von Mandraki, dem Hauptort der Insel, rücken näher. Das schwarze, vulkanische Gestein, auf dem das Dorf gebaut ist, wird erkennbar. Das Meer schlägt seine Wellen gegen die schwarze Küste, an der sie schäumend brechen.
Für die Entstehung des Felsen, auf denen Mandraki steht, hat die griechische Mythologie übrigens eine schöne Erklärung: Ein Gigant namens Polybotes hatte mit ein paar anderen seinesgleichen den Zeus und die Götter des Olymp - sagen wir es mal so - gereizt. Er wurde übers Wasser gejagt und schließlich von Poseidon, dem Gott des Meeres, gestellt.
Um Polybotes zu töten, brach Poseidon einen Felsen von Kos ab und warf ihn nach dem Giganten. Der Stein fiel ins Meer und begrub den Riesen unter sich.
Der Felsbrocken, der nun im Wasser liegt, das ist Nisyros.
Doch Polybotes ist nicht tot - er bäumt sich unter dem Gestein auf, versucht sich zu befreien. Deshalb wackelt auf Nisyros mal mehr, mal weniger stark die Erde und spuckt Feuer.
Es ist jetzt Ende September. Später Vormittag. Die Sonne brennt zu der Jahreszeit immer noch sehr stark vom Himmel herunter.
Ein strammer Luftstrom vom Meer, verstärkt durch den Fahrtwind, weht mir ins Gesicht. Die Luft riecht angenehm mild und salzig.
Die Fähre legt in Mandraki an.
Gleich werde ich meinen Fuß auf Nisyros setzen, einem der größten aktiven Vulkane des Mittelmeeres.
Der Insel wird nachgesagt, magisch zu sein.
Tatsächlich bezaubert ihre wilde Schönheit auf den ersten Blick, sie zwingt den menschlichen Geist - selbst für griechische Verhältnisse - die Welt aus einer anderen, einfachen und ursprünglichen Perspektive zu betrachten.
NISYROS I
Nisyros gilt als die Vergessene unter den Inseln des Dodekanes, obwohl sie geographisch ziemlich in der Mitte einer Linie von Patmos nach Rhodos liegt.
Sie befindet sich, wie auch Kos oder Symi, nahe der türkischen Küste.
Geprägt ist Nisyros von einer mächtigen Caldera, die vor rund 50.000 Jahren bei zwei gigantischen Eruptionen entstanden ist. Die Insel misst nur rund acht Kilometer im Durchmesser und ist fast rund.
Etwa 1.000 Einwohner leben auf Nisyros, überwiegend in Mandraki, dem Hauptort und Hafen. Die vielen schönen, weiß gekalkten, kubischen Häuser des Ortes sind ein Zeichen dafür, dass die Insel eine „Verlängerung“ der Kykladen darstellt.
Es ist hier, wie es fast immer in der griechischen Inselwelt ist - faszinierend.
Eine Symphonie in Blau und Weiß.
Die strahlende Sonne und weiße Wolken, wie mit einem Pinsel auf den blauen Himmel getupft, und ein azurblaues Meer darunter liegend.
Jede Insel ist, wirkt und bleibt anders.
Die augenfälligen Unterschiede sorgen für Abwechslung: Kleine oder große Inseln, mehr oder weniger besiedelte (die unzähligen kleinen Inseln sind meist gar nicht bewohnt).
Stärker bewachsen, tiefgrün und saftig. Oder einsam, kahl und bergig. Oder beides gleichzeitig.
Die Sonne jedoch, der Himmel und das Meer, sie strahlen, so hat es den Eindruck, überall um die Wette.
Die Fähre legt an. Einmal am Tag geschäftiges Treiben.
Der alte Kühlwagen wird vom Schiff herunter gefahren und parkt wenige Meter weiter.
Dort offenbart er sein Innenleben: Es handelt sich um einen Gemischtwarenhandel auf Rädern.
Frisches Gemüse, Getränke aller Art und verschiedene Waren des täglichen Bedarfs befinden sich in ihm. Nur keine Kälte, wie man vermuten könnte - und keinerlei Eis.
Während der Verkauf von der Ladefläche des Transporters heraus startet, gehe ich auf einen Reisebus zu, der ein paar Meter weiter steht.
Es ist der einzige weit und breit.
Es wird wohl jener sein, der zur Caldera und anschließend nach Nikia fährt … ein überraschend modernes und geräumiges Gefährt. Hinter mir fragt jemand seine Frau, wie so ein Bus auf die Insel kommt. Auf die Fähre würde er jedenfalls nicht passen.
Tatsächlich trommelt nun ein Mann jene Leute zusammen, die diese Fahrt gebucht haben.
Ein paar „wilde Fahrer“, die den Bus mit benutzen, sind ebenfalls dabei. Vermutlich wollen die Einheimischen nach Nikia.
Der Reisebegleiter stellt sich als Yanni vor und bittet die Leute, Platz zu nehmen.
Der Bus fährt los.
Die Straße führt zunächst zur Ortschaft Pali, danach geht es kurvenreich und steil einige Kilometer in die Berge.
Auf einem Bergsattel zweigt die Straße nach rechts ab, in den Kessel der Caldera.
Wiederum kurvig geht es erst einmal bergab, bis der Bus sich in einer kargen Mondlandschaft befindet.
Drei Krater sind es in der Caldera: Der Alexandros, der Polivotis und die Hauptattraktion, der Stefanos-Krater.
Um die Caldera herum türmen sich die Berge, mindestens 250 und bis zu 550 Meter hoch. Die umliegenden Felsen werden übrigens von kleinen Kirchen und einigen Klöstern geschmückt, die teils beschwerlich zu erreichen oder seit langem verlassen sind.
Der Kessel mit seinen drei Kratern hat einen Durchmesser von etwa 3,8 Kilometer. Von oben gesehen würde er Nisyros dominieren.
Wir halten am Parkplatz, der sich beim Krater Stefanos befindet.
Als sich die Tür des Bus öffnet, schnürt es mir beinahe den Atem ab: Es ist elend heiß hier unten und die Luft scheint zu stehen.
Der Krater lässt sich von einem gesicherten Aussichtspunkt aus betrachten, direkt am Rand des Stefanos. Er ist mit seinen fast 300 Metern Durchmesser und 30 Metern Tiefe mächtig und gefährlich anzuschauen. Menschen bewegen sich wie kleine Ameisen darin.
Tatsächlich wagen die meisten Leute den Abstieg, der nicht leicht ist. Man muss die Hitze aushalten können, die beim abwärts gehen immer größer wird.
Es empfiehlt sich sehr gutes, festes Schuhwerk (zum Beispiel gute Stiefel) anzuziehen, denn in der Kratersohle herrschen Temperaturen von fast 100 Grad.
Aus Fumarolen treten Wasser- und Schwefeldämpfe aus, die einen üblen Geruch nach faulen Eiern verbreiten. Kochend heißes Wasser brodelt in kleinen Kratern voller Schlamm vor sich hin.
Zum Glück gibt es direkt beim Parkplatz eine kleine Taverne, oder besser: einen improvisierten Kiosk. Bei der Hitze ist eine Erfrischung notwendig. Man kann gar nicht so viel Nachschub an Flüssigkeit liefern wie verbraucht wurde.
Ich stehe da, schaue auf den Krater und denke an die Reisen, die ich zu den griechischen Inseln bereits unternommen habe. Geschichten, die ich erlebt habe, Eindrücke, die ich gesammelt habe. Die Unterschiede auf den Inseln, Begegnungen mit lieben Menschen.
Vieles werde ich bereits vergessen haben.
Habe ich nun schon Wahnvorstellungen? Ich komme auf eine verwegene Idee.
Ich weihe Yanni in meinen Plan ein, dass ich vorhabe, erst am nächsten Tag mit dem Bus zurückzufahren, und zwar von Nikia aus.
Er ahnt Schlimmes. Selbst für griechische Verhältnisse bringt das seine ganze Reiseplanung ordentlich durcheinander. Nicht zuletzt stellt das Ganze ja eine versicherungsrechtliche Frage dar.
Er versucht mich umzustimmen, aber ihm gefällt meine Abenteuerlust. So läuft sein Widerstand ins Leere.
Nun gut. Allzu weit ist es nicht. Sieben Kilometer schätze ich.
Ich nehme meinen Rucksack und laufe los.
Ich will den Rest der Strecke nach Nikia wandern.
Einsam gehe ich die staubige Piste zurück, weg vom Bus, weg von den Touristen, weg vom Stefanos-Krater.
Dabei erinnere ich mich an Korfu.
KORFU
Korfu. Mein erster Trip nach Griechenland.
Zu der Zeit ging es noch mit einer Turbo-Prop-Maschine auf Reisen - mit zwei Triebwerken und etwas über 30 Plätzen in der Kabine.
Ein wenig holprig war der Hinflug schon. Nicht gerade empfehlenswert für jemanden, der überhaupt erst das zweite Mal fliegt.
Beim Heimflug gerieten wir, nebenbei bemerkt, in ein Gewitter über dem Allgäu.
Die Blitze des Unwetters konnte man regelrecht greifen. Ansonsten nur die Schwärze von Gewitterwolken um das Flugzeug herum.
„Five Miles Out“, der Katastrophenflieger-Song von Mike Oldfield, hätte in diesen Momenten wie die Faust aufs Auge gepasst … das Flugzeug wurde so durchgerüttelt, dass bereits die Sauerstoffmasken ausgeworfen wurden. Einige Leute schrien wie am Spieß und hatten bereits mit ihrem Leben abgeschlossen.