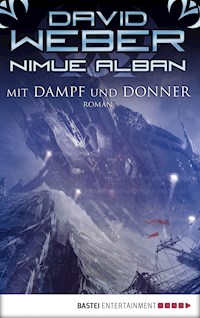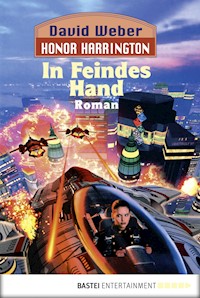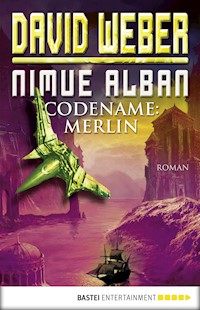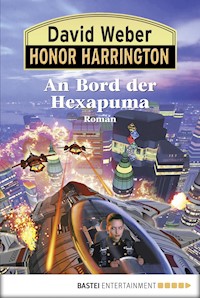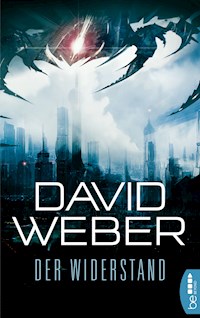
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beBEYOND
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ein brutaler Krieg. Die Feinde sind stark, unerbittlich und nicht von dieser Welt. Hat die Menschheit noch eine Chance?
Mehr als die Hälfte der Erdbevölkerung stirbt in den ersten Minuten. Der Angriff kommt aus dem Nichts. Die Wesen nennen sich Shongari und stürzen die Menschheit von einer Sekunde auf die andere in einen brutalen Krieg.
Schnell liegen die meisten Städte in Trümmern, radioaktiv verseucht. Das Militär ist geschwächt. Eines ist gewiss: Über kurz oder lang werden die Aliens die Menschen vernichten. Doch die Menschen haben Verbündete - im Dunkeln ...
Eine grandiose Mischung von Military-SF mit Horror-Elementen vom Schöpfer von Honor Harrington und Nimue Alban!
"Der Roman wird nicht nur die Honor-Harrington-Fans begeistern! ... Weber gibt Vollgas!" Publishers Weekly
eBooks von beBEYOND - fremde Welten und fantastische Reisen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 757
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über den Autor
Titel
Impressum
Widmung
Prolog
Planet KU-197-20
.I.
.II.
.III.
.IV.
.V.
.VI.
.VII.
.VIII.
.IX.
.X.
.XI.
.XII.
.XIII.
.XIV.
.XV.
.XVI.
.XVII.
.XVIII.
.XIX.
.XX.
.XXI.
.XXII.
.XXIII.
.XXIV.
.XXV.
.XXVI.
.XXVII.
.XXVIII.
.XXIX.
.XXX.
.XXXI.
.XXXII.
.XXXIII.
.XXXIV.
.XXXV.
.XXXVI.
.XXXVII.
.XXXVIII.
.XXXIX.
Epilog
Über dieses Buch
Ein brutaler Krieg. Die Feinde sind stark, unerbittlich und nicht von dieser Welt. Hat die Menschheit noch eine Chance?
Mehr als die Hälfte der Erdbevölkerung stirbt in den ersten Minuten. Der Angriff kommt aus dem Nichts. Die Wesen nennen sich Shongari und stürzen die Menschheit von einer Sekunde auf die andere in einen brutalen Krieg.
Schnell liegen die meisten Städte in Trümmern, radioaktiv verseucht. Das Militär ist geschwächt. Eines ist gewiss: Über kurz oder lang werden die Aliens die Menschen vernichten. Doch die Menschen haben Verbündete – im Dunkeln …
eBooks von beBEYOND – fremde Welten und fantastische Reisen!
Über den Autor
David Weber ist ein Phänomen: Ungeheuer produktiv (er hat zahlreiche Fantasy- und Science-Fiction-Romane geschrieben), erlangte er Popularität mit der Honor-Harrington-Reihe, die inzwischen nicht nur in den USA zu den bestverkauften SF-Serien zählt. David Weber wird gerne mit C. S. Forester verglichen, aber auch mit Autoren wie Heinlein und Asimov. Er lebt heute mit seiner Familie in South Carolina.
David Weber
DERWIDERSTAND
Aus dem amerikanischen Englisch vonRalph Sander
beBEYOND
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2010 by David Weber
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Out of the Dark«
Originalverlag: Tor, New York
This work was negotiated through Literary Agency Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover, on behalf of St. Martin’s Press, L.L.C.
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2012/2014/2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Titelillustration: Arndt Drechsler, Regensburg
Titelgestaltung: Guter Punkt, München
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7517-1675-8
be-ebooks.de
lesejury.de
Für meine Freunde Fred und Joan Saberhagen,die mich in vieler Hinsicht inspirieren.Ich hoffe, dir gefällt Basarab, Fred!
Prolog
Planet KU-197-20Im Jahr 73.764 der Hegemonie
»Garsul, sehen Sie das?«
Garsul, der Leiter des Erkundungsteams, verzog grimmig das Gesicht. Was dachte sich Hartyr eigentlich dabei? Gab es eine dümmere, unnötigere, ärgerlichere …
Der Teamleiter zwang sich, diesen Gedankengang abzubrechen, und atmete einmal tief ein. Dann rang er sich dazu durch, die Tatsache anzuerkennen, dass Hartyr sich nicht viel Mühe geben musste, um seine Geduld zu strapazieren. Das war aber noch lange kein Grund für ihn selbst, sein Temperament so aufbrausen zu lassen. Außerdem wäre es gar nicht dazu gekommen, wenn er selbst nicht hingesehen hätte … und wenn seine beiden Mägen sich nicht am Rand akuter Übelkeit bewegt hätten. Dazu kam sein erhöhter Strokainspiegel, ganz zu schweigen von dem instinktiv über seine Synapsen zuckenden Reflex, entweder zu kämpfen oder die Flucht zu ergreifen (wobei im Falle seiner Spezies meistens das Letztere infrage kam).
»Ja, Hartyr, ich sehe es«, hörte er sich selbst über die Verbindung antworten. Er wusste, dass es seine eigene Stimme war, auch wenn sie angesichts dessen, was sich momentan in ihm abspielte, unmöglich ruhig und gelassen klang. Doch schon seine nächsten Worte zeigten, dass er in Wahrheit alles andere als ruhig und gelassen war. »Und haben Sie auch irgendeine Idee, was wir daran ändern sollen?«, fragte er spitz.
»Nein, aber sicherlich …«
Hartyrs Erwiderung begann kraftvoll, doch gleich wurde er leiser und leiser, bis er kläglich verstummte. Bei Garsul bewirkte das, dass sich seine Gereiztheit größtenteils in Mitgefühl verwandelte. Der angeborene Übereifer und die Prunksucht seines Stellvertreters waren tatsächlich nur schwer zu ertragen, und seine fanatische Begeisterung für Papierkram aller Art machte ihn selbst unter den Barthoni zu einer Ausnahmeerscheinung. Hartyr neigte zudem zu der Überzeugung, dass seine Antwort auf welche Frage auch immer die einzig richtige war. Hinzu kam, dass er ein Drängler war, jemand, der seine eigenen Kameraden in Grund und Boden rannte, nur um das größte Stück vom Kuchen zu ergattern. Doch in diesem Moment war das blanke Entsetzen nur allzu verständlich, das in den Tiefen seiner Stimme mitschwang. Es war nichts, was ihn irgendwie sympathisch gemacht hätte (wahrscheinlich gab es nichts, was ein solches Wunder bewirken konnte), dennoch fühlte Garsul sich auf eine ungewöhnlich eindringliche Weise mit Hartyr verbunden.
»Ich wünschte auch, wir könnten dem irgendwie ein Ende setzen«, sprach er etwas leiser. »Bedauerlicherweise geht das nicht. Jedenfalls nicht, solange wir das Protokoll befolgen.«
Er hörte, wie Hartyr laut einatmete, doch eine weitere Reaktion seines Stellvertreters auf diese letzte Bemerkung blieb aus. Das Ganze bildete einen krassen Gegensatz zu den Optionen, die ihnen zur Verfügung standen – oder besser gesagt: die ihnen nicht zur Verfügung standen, überlegte Garsul. Der Hegemonierat hatte vor langer Zeit seine Erkundungsprotokolle festgelegt, und die Barthoni hatten einen wesentlichen Teil zu ihrem Zustandekommen beigetragen. Für jeden Aspekt der Beschränkungen, die ihnen durch diese Protokolle auferlegt wurden, gab es einen einleuchtenden Grund … unter anderem auch die Notwendigkeit, ein Erkundungsteam davon abzuhalten, sich in Augenblicken wie diesen einzumischen.
»Stellen Sie sicher, das Kurgahr und Joraym das hier aufnehmen«, sagte Garsul. Er hätte die beiden auch unmittelbar darauf ansprechen können, aber es war freundlicher, wenn er Hartyr etwas zu tun gab. »Das wird ein wichtiger Moment in unserem Abschlussbericht werden.«
»Alles klar«, bestätigte Hartyr.
Die eher lässigen, Zentauren ähnlichen Barthoni waren denkbar ungeeignet für die extrem saubere Art, die von vielen anderen Mitgliedsspezies der Hegemonie bevorzugt wurde. Einige dieser Rassen rissen sogar gehässige Witze darüber; aber auch wenn Garsul das durchaus bekannt war, machte es ihm nichts aus. Er und sein Team mussten sich nicht unentwegt mit Dienstgraden oder irgendwelchen Titeln anreden, und es waren auch keine tiefen Verbeugungen und kein Hufescharren nötig, um die Arbeit zu erledigen, die vor ihnen lag. Sie wussten, wer von ihnen das Sagen hatte, und ihnen war auch klar, dass jeder – so sympathisch oder unsympathisch er auch sein mochte – ein bestens ausgebildeter und unschätzbar wertvoller Spezialist war. Und sie alle hatten sich freiwillig gemeldet, weil sie zu jenem Schlag gehörten, der immer herausfinden wollte, was hinter dem nächsten Hügel oder Berg zu finden war. Wichtiger war dabei aber möglicherweise, dass ihre gesamte Spezies sich den Zielen verpflichtet fühlte, die die Erkundungsstreitmacht der Hegemonie verkörperte.
Ganz im Gegensatz zu anderen Spezies, von denen ich auf der Stelle eine ganze Reihe aufzählen könnte, überlegte er missmutig und widmete sich wieder der visuellen Darstellung.
Der Planet, den sie gegenwärtig erkundeten – er trug die Kennung KU-197-20 –, präsentierte sich als eine recht angenehme Welt. Seine Hydrosphäre war etwas ausgedehnter, als es den meisten Barthoni recht gewesen wäre, und die Vegetation bot ihnen einen nur sehr unbefriedigenden Nährwert. Dafür bewegte sich die Temperatur gerade im richtigen Rahmen, und auch wenn die planetare Flora nicht nahrhaft war, konnte man sie zumindest teilweise als schmackhaft bezeichnen. Zudem bot sie einen solchen Variantenreichtum, was den Farbton Grün anging, dass man diese Welt einfach als hübsch anzusehen bezeichnen musste.
Wenn er ganz ehrlich sein sollte, dann lagen die einzigen echten Nachteile bei einigen Aspekten der lokalen Fauna, ganz besonders bei der alles dominierenden Gattung.
Im Augenblick bot die von den Kameras übertragene Szene allerdings deutlich weniger Grün, als sich dort unten hätte befinden können, wofür es verschiedene Gründe gab. Zum einen herrschte in dem beobachteten Gebiet derzeit Herbst, was der Landschaft eine gänzlich andere Färbung verlieh und was zum Teil auch die ersten kahlen Äste mit sich brachte. Zum anderen war sein Blick auf einen schmalen Streifen Land zwischen zwei Waldflächen gerichtet, den man erst vor Kurzem umgepflügt hatte. Durch nachfolgenden Regen hatte sich die umgegrabene Erde in Schlamm verwandelt, der tief genug war, dass sogar ein Liatu daran seine Freude gehabt hätte – was seiner Meinung nach nur den Irrsinn dessen unterstrich, was er dort zu sehen bekam. Ganz sicher hätten die offenbar verrückten Empfindungsfähigen (ein Begriff, den er in diesem Zusammenhang nur sehr allgemein anwandte) für dieses aktuelle Beispiel ihres Irrsinns einen besseren Platz finden können.
»Garsul?«
Die neue Stimme in der Leitung gehörte Joraym, dem Xeno-Anthropologen des Teams, und Garsul musste finster grinsen, als er dessen zögerlichen Tonfall bemerkte. Joraym war derjenige aus ihrer Gruppe, der sie alle am beharrlichsten darauf hingewiesen hatte, dass die lokalen Empfindungsfähigen – »Menschen«, wie sie sich selbst nannten – sich noch immer in der Kindheitsphase ihrer Spezies befanden, weshalb man von ihnen einfach nicht erwarten konnte, dass sie sich wie Erwachsene verhielten. Seiner Ansicht nach wäre es unfair und unangemessen, ihr Verhalten nach den Maßstäben zu bewerten, die man bei zivilisierten Rassen anlegte. Der Teamleiter konnte Jorayms Analyse der dominierenden Spezies auf KU-197-20 nicht widersprechen, aber seit der Ankunft im System tadelte der Xeno-Anthropologe jeden, der Kritik an diesen »Menschen« übte, wegen seiner »barthonzentrischen Hochnäsigkeit« gegenüber der anderen Spezies. Garsul vermutete, dass Joraym auf diese Weise seine eigene aufgeklärte Überlegenheit gegenüber den Teamkollegen demonstrieren wollte.
»Ja, Joraym?«, erwiderte er.
»Kann ich ein paar Audiosonden einsetzen?«, wollte der Xeno-Anthropologe wissen.
»Warum in Clahdrus Namen wollen Sie das denn machen? Die Bildaufzeichnung wird schon schlimm genug sein!« Garsul gab einen kehligen Laut von sich, um sein Missfallen kundzutun. »Ich hoffe, der Rat wird die Aufnahmen mit einem Gelehrtensiegel versehen, sobald wir zurück sind. Aber ich glaube, ein paar von den Gelehrten, die ich kenne, wird das Mittagessen sogar dann wieder hochkommen, wenn das hier nur halb so schlimm ausfällt, wie ich es erwarte.«
»Ich weiß, ich weiß!« Joraym klang unglücklich, gleichzeitig aber auch entschlossen. »Allerdings kommt es nicht oft vor, dass wir so etwas tatsächlich miterleben können«, fuhr er fort. »Wir tun so etwas nicht, und das gilt auch für die meisten anderen Rassen, aber nach allem, was wir über die verschiedenen gesellschaftlichen Einheiten in Erfahrung bringen konnten, glauben diese … Leute, dass es sich um eine vernünftige Methode handelt, um politische Meinungsverschiedenheiten beizulegen. Meine Hoffnung ist, dass ich die Mikrofone nahe genug an die Führer beider Seiten heranbringen kann, um das belegen zu können. Außerdem könnte ich dann ihre Reaktionen und Entscheidungen aufzeichnen, während sie … ihre Anstrengungen fortsetzen.«
»Und warum ist das so wichtig?«, hakte Garsul nach.
»Weil meine Kollegen daheim von meiner Analyse keine Notiz nehmen werden, wenn ich das nicht mit Bergen von Daten und Fakten stütze. Es unterscheidet sich so völlig von der Art, wie wir denken.«
»Entschuldigen Sie, Joraym, aber könnte das etwas damit zu tun haben, dass sie auch so völlig anders sind als wir?« Ihm entging der zynische Unterton in den eigenen Worten nicht, aber das war ihm auch ziemlich egal.
»Ja, natürlich liegt es daran!«, gab der Xeno-Anthropologe aufgebracht zurück. »Aber diese Kreaturen fühlen sich damit viel … wohler als jede andere Spezies, die ich jemals beobachtet habe. Sie erinnern mich in vielen Punkten an die Shongairi, und wir alle wissen, was bei ihnen herauskommt. Ich will damit nur sagen, ich würde gerne so viele Belege wie möglich zusammentragen, bevor der Rat unseren Bericht erhält. Ihre Haltung ist einfach nicht normal, nicht einmal für Omnivoren, und ich glaube, wir werden sie noch lange Zeit im Auge behalten müssen. Clahdru sei Dank, dass sie noch so primitiv sind. So haben sie wenigstens Zeit, um noch ein wenig reifer zu werden, bevor wir uns Sorgen machen müssen, dass sie auf einmal ihren Planeten verlassen und sich im Rest der Galaxis festsetzen könnten.«
Garsuls Nasenflügel blähten sich auf, als die Shongairi erwähnt wurden. Soweit er wusste, waren diese »Menschen« wahrscheinlich nicht schlimmer, als es die Shongairi gewesen waren, als sie sich auf dieser Entwicklungsstufe befunden hatten. Andererseits waren sie aber auch nicht nennenswert besser als die Shongairi, und wie Joraym soeben ganz richtig angemerkt hatte, handelte es sich bei ihnen um Omnivoren, was ihr Verhalten in einem noch bizarreren Licht erscheinen ließ.
Damit war Garsul gezwungen, eine unerfreuliche Entscheidung treffen zu müssen, die sich auf einen Anhang stützte, der nirgends Erwähnung fand und auch nie als Bestandteil offizieller Protokolle verabschiedet worden war – der eine Punkt, der sich ganz stillschweigend durch Befehl und ohne vorherige Diskussion in der Generalversammlung der Rassen ergeben hatte, nachdem den Shongairi die Mitgliedschaft in der Hegemonie gewährt worden war. Es war das erste Mal, dass Garsul sich nun in der unangenehmen Situation befand, die Bestimmungen dieses Anhangs umsetzen zu müssen. Die Geheimhaltungsklausel seines Einsatzbefehls besagte jedoch unzweifelhaft, dass eine der Aufgaben seines Teams darin bestand, dem Rat alle verwertbaren Erkenntnisse vorzulegen, die dazu geeignet sein konnten, sich ein Bild vom Bedrohungspotenzial einer neuen Spezies zu machen. Was der Rat danach mit einer solchen Bewertung machte, das hatte ihm niemand je erklärt, aber er war auch klug genug, gar nicht erst eine entsprechende Frage zu stellen. Durch Jorayms letzten Satz war er nun aber mit eben dieser Geheimhaltungsklausel konfrontiert worden.
Der Teamleiter war nach wie vor nicht davon angetan, alles in Farbe und mit Ton aufzuzeichnen, was sich in Kürze abspielen würde. Dennoch musste er – wenn auch widerstrebend – zugeben, dass Jorayms Ansinnen vermutlich gar nicht so verrückt war, wenn man berücksichtigte, dass der von den Befehlen nichts wusste.
»Was meinen Sie dazu, Kurgahr?«
»Ich würde Joraym zustimmen, Garsul«, äußerte sich der Xeno-Historiker des Teams. Auch ihm waren Garsuls Geheimbefehle nicht bekannt, soweit der Teamleiter wusste. Sein Tonfall war entschieden, wenngleich auch nicht erfreut. »So wie Sie hoffe auch ich, dass sie diese Bilder wegschließen werden, sobald sie sie gesehen haben. Aber es dürfte tatsächlich eine einzigartige Gelegenheit sein, so etwas in voller Länge aufzeichnen zu können. Auf lange Sicht könnten das Daten von unschätzbarem Wert sein.«
»Also gut«, seufzte Garsul. »Ich werde Schiffskommandant Syrahk bitten, das zu erledigen.«
Tief unter dem barthonischen Raumschiff stand ein junger Mann mit langer, spitzer Nase und einem brutal vernarbten Gesicht im Frühnebel. Sein Name war Henry, Duke of Lancaster, Duke of Cornwall, Duke of Chester, Duke of Aquitane, Aspirant auf den Thron von Frankreich und durch Gottes Gnaden König von England. Er war neunundzwanzig Jahre alt und – auch wenn ihm das niemand ansehen konnte – er steckte in Schwierigkeiten.
In großen Schwierigkeiten.
Es war für jedermann erkennbar, dass er es übertrieben hatte, und die Franzosen beabsichtigten, ihn dafür bezahlen zu lassen. Seine Belagerung von Harfleur war erfolgreich gewesen, aber es hatte einen ganzen Monat gedauert, um die Kapitulation zu erzwingen. Und als das endlich geschafft war, hatten in seinen eigenen Reihen zahllose Krankheiten um sich gegriffen. Dieses Problem, die Verluste auf dem Schlachtfeld und die Notwendigkeit, seine Eroberung durch eine Garnison zu sichern, hatten seine über zwölftausend Mann starken Streitkräfte auf unter neuntausend schrumpfen lassen, von denen gerade mal fünfzehnhundert Rüstung tragende Ritter und Waffenknechte waren. Die übrigen rund siebentausend Mann waren Bogenschützen, die mit ihren Langbögen auf größere Distanzen eine todbringende Armee darstellten (sofern die Umstände für den Einsatz dieser Art von Waffen günstig waren), die aber hoffnungslos unterlegen waren, wenn es dem Gegner gelang, bis auf Schwertlänge an sie heranzukommen. Und wenn man ganz ehrlich war, dann stellte Harfleur eigentlich gar kein so beeindruckendes Ergebnis für einen solchen Feldzug dar. Und deshalb schickte Henry zwei Wochen nach der Kapitulation der Hafenstadt seine Leute zurück nach Calais im Norden Frankreichs, da diese Stadt fest in der Hand der Engländer war. Dort sollten sich seine Truppen im Verlauf des Winters neu aufstellen.
Vielleicht wäre ein Rückzug der Armee auf dem Seeweg die klügere Lösung gewesen, aber Henry hatte sich für den Landweg nach Calais entschieden. Mancher mochte es als den Hochmut eines jungen Mannes bezeichnen, aber seinem jugendlichen Alter zum Trotz war Henry V. ein erfahrener Krieger, der mit sechzehn zum ersten Mal auf einem Schlachtfeld gestanden hatte. Andere mochten von Arroganz reden, aber natürlich nicht in seiner Gegenwart. Es war strategisch gesehen vielleicht sogar sinnvoll, um wenigstens etwas Beeindruckenderes als Harfleur von dieser Unternehmung zu retten, sodass er der Curia Regis, dem englischen Parlament, etwas vorlegen konnte, wenn es im anstehenden Winter über weitere Gelder für das Militär entscheiden sollte. Ganz gleich, was ihn auch angetrieben haben mochte, auf jeden Fall beschloss er, nach Calais zu ziehen und dabei Feindesland zu durchqueren, als wollte er beweisen, dass dieser Feind ihn nicht aufhalten konnte.
Dummerweise hatten die Franzosen etwas ganz anderes vor und stellten eine Armee auf, um der englischen Invasion den Weg zu versperren. Auch wenn diese Armee nicht mehr schnell genug ankam, um Harfleur zu retten, und auch wenn sie nur unwesentlich größer war als die Streitmacht, mit der Henry in Richtung Calais aufbrach, blieb ihr noch Zeit, sich zu vergrößern. Zudem gelang es den Franzosen, Henry am Überqueren der Somme zu hindern, und tatsächlich schafften sie es, ihn vom Fluss aus ein Stück nach Süden und damit noch weiter weg von Calais zu treiben, bis er eine Furt finden konnte, wo sich ihm kein Widerstand entgegenstellte.
Zu der Zeit war die französische Streitmacht sehr zum Leidwesen der Engländer auf fast sechsunddreißigtausend Mann angewachsen.
Und genau das war der Grund, weshalb Henry an diesem Morgen so missmutig in den Nebel schaute. Im Angesicht einer vierfachen Übermacht des Gegners hatte er sich für eine Verteidigungsposition entschieden, bei der er davon ausging, dass sie die Franzosen innehalten lassen würde, war ihnen doch immer noch schmerzlich in Erinnerung, was sich an Orten wie Crécy und Poitiers zugetragen hatte. Für den Augenblick hielt sich seine Armee am südlichen Ende eines schmalen, lang gezogenen Feldes zwischen den Wäldern von Agincourt und Tramecourt auf. Die freie Fläche war vor Kurzem umgepflügt worden, und ihre lockere Erde hatte sich nach einem ohnehin verregneten Herbst bei einem Wolkenbruch in der vergangenen Nacht mit Wasser vollgesogen.
Die Franzosen waren den Engländern zahlenmäßig weit überlegen, sowohl was die Ritter zu Pferd und die Ritter zu Fuß als auch die Waffenknechte anging. Deren schwere Rüstungen verschafften ihnen im Nahkampf einen erheblichen Vorteil über die Bogenschützen, die keinerlei Schutz gegen Waffen aller Art vorweisen konnten, die aber mehr als achtzig Prozent von Henrys Streitkräften ausmachten. Also hatte er seine wenigen Ritter und Waffenknechte so platziert, dass sie den mittleren Abschnitt seiner Reihen schützten, während sich die Bogenschützen an den Flanken scharten. Das Ganze ergab eine recht standardmäßige englische Formation, doch er hatte auch etwas Neues zu bieten: lange Holzpfähle, die schräg in den Boden getrieben und an der zum Feind zeigenden Seite angespitzt worden waren. Die Türken hatten neunzehn Jahre zuvor bei der Schlacht von Nikopolis diese Taktik angewandt, um die französische Kavallerie abzuwehren, und vielleicht würde sie ihm ja auch von Nutzen sein.
Der dichte Wald zu beiden Seiten des Feldes hinderte die französischen Waffenknechte daran, um seine Stellung herumzugehen und seine Leute von hinten anzugreifen, und die gesamte Breite seiner Frontlinie betrug weniger als tausend Yards. Damit blieb den Franzosen bei einem Frontalangriff – der einzigen Vorgehensweise, die zur Wahl stand – nur wenig Spielraum, sodass sie ihre zahlenmäßige Überlegenheit nicht ausspielen konnten. Zudem stellte das morastige Terrain ein für den Gegner so ungünstiges Schlachtfeld dar, dass die Franzosen wohl eher von einem Angriff absehen würden. Das wiederum konnten sie sich auch leisten, da die Zeit zu ihren Gunsten arbeitete.
Zwar befand sich Henrys Armee in einer hervorragenden Defensivposition, und die Franzosen hatten schlechte Erfahrungen damit gemacht, gegen gut vorbereitete Engländer vorzurücken. Aber jetzt saß Henry praktisch in der Falle. Es fehlte an Lebensmitteln für seine Leute, die von einem Fußmarsch von gut zweihundertsechzig Meilen in nicht mal zweieinhalb Wochen müde und erschöpft waren. Ganz zu schweigen davon, dass viele seiner Männer an der Ruhr und anderen Krankheiten litten.
Charles d’Albert, der Connétable von Frankreich, der die französische Armee befehligte, versperrte ihm ebenfalls zahlenmäßig weit überlegen den Weg nach Calais, und während die Schlagkraft von Henrys Truppe zwangsläufig nur noch weiter schwinden konnte, würden seine Feinde stärker und stärker werden. So konnte d’Albert in Kürze mit weiterer Verstärkung rechnen, da unter anderem die Ducs de Brebant, Anjou und der Bretagne mit jeweils zwischen eineinhalb- und zweitausend Mann auf dem Weg zu ihm waren, um sich ihm anzuschließen. Sollten die Engländer tatsächlich so dumm sein und ihre Position aufgeben, würde die französische Kavallerie sie in Stücke hauen. Sie wussten, die Engländer steckten in einer Falle, und wenn die Zeit gekommen war, würden die Franzosen sich an ihnen rächen und sie für ihre Arroganz bei vorangegangenen Schlachten bei Crécy und Poitiers bezahlen lassen. Aber noch hatten es die Franzosen nicht eilig, sondern setzten auf Verhandlungen, um auf diese Weise so lange Zeit zu schinden, bis die Verstärkungen eingetroffen waren. Immerhin gab es keinen Grund zur Eile, denn die Engländer konnten ihnen gar nicht entwischen.
Was für Henry Grund genug für die Entscheidung war, zum Angriff überzugehen.
»Hat irgendjemand eine Erklärung dafür, warum diese Menschen – diese ›Engländer‹ – das machen?«, fragte Garsul in einem fast weinerlichen Tonfall.
Obwohl die Übelkeit ihn fest im Griff hatte, musste er feststellen, dass er den Blick nicht von dem riesigen Bildschirm abwenden konnte. Das Ganze hatte etwas so abscheulich … Fesselndes an sich, wie Tausende und Abertausende von mutmaßlich intelligenten Wesen aufeinander zumarschierten, beide Seiten fest entschlossen, einen organisierten Mord am jeweiligen Gegenüber zu begehen. Kein Barthon wäre zu so etwas in der Lage gewesen, das wusste er mit Sicherheit.
»Ich weiß nicht so recht«, antwortete Kurgahr nachdenklich.
Von allen Barthoni, die das Schauspiel mitverfolgten, war der Historiker der Einzige, der irgendeine Art von Wissen zum Thema »Militärgeschichte« besaß, auch wenn dieses Wissen eher als mäßig zu bezeichnen war. Das Problem lag darin begründet, dass die Barthoni keinerlei »Militärgeschichte« vorweisen konnten, mit der man sich hätte befassen können. Andere der Hegemonie angehörende Spezies waren zwar deutlich kampflustiger als die Barthoni, aber die allerwenigsten von ihnen waren annähernd so blutrünstig, wie es diese Menschen zu sein schienen. Tatsächlich hatte niemand in der Hegemonie vor dem Auftauchen der Shongairi jemals den Begriff »blutrünstig« verwendet. Zwar gehörte weder ein Vertreter der Shongairi noch einer anderen Spezies dem Erkundungsteam an, aber zumindest hatte Kurgahr deren Daten zur Hand.
»Ich glaube, die ›Engländer‹ sind zu dem Schluss gekommen, dass sie nichts mehr zu verlieren haben«, erklärte Kurgahr also bedächtig. »Ihnen muss genauso wie den ›Franzosen‹ klar sein, dass sie nicht mehr auf einen Sieg hoffen können, dennoch haben sie sich entschieden, einen Kampf zu provozieren.« Er zuckte mit den oberen Schultern, um seiner Verwunderung Ausdruck zu verleihen. »Ich glaube, diese Rasse ist noch verrückter, als wir es bislang angenommen haben. So wie es aussieht, greifen sie lieber an, obwohl sie wissen, es wird für sie alle den Tod bedeuten, als die Vernunft walten zu lassen und zu kapitulieren.«
»Das ist ein typisches Beispiel für die übelste Sorte von Spezies-Chauvinismus!«, warf Joraym gereizt ein. »Sie übertragen völlig unzutreffend unsere barthozentrischen psychologischen Maßstäbe auf eine kindliche fremde Rasse. Sie als Historiker sollten doch am besten wissen, wie zwangsläufig fehlbar diese Art von Pseudologik ist!«
»Ach ja?« Kurgahr warf dem Xeno-Anthropologen einen wütenden Blick zu. »Haben Sie denn eine bessere Erklärung für das, was die da unten machen?«
Er deutete auf den Bildschirm, auf dem die englische Armee sich durch den Morast vorangekämpft hatte, um sich einem überlegenen Feind zu stellen. Die Bogenschützen kamen dabei wesentlich müheloser voran als die Männer in ihren schweren Rüstungen, obwohl sie die angespitzten Pfähle bei sich trugen, um damit auf den Gegner loszugehen. Andererseits bedeutete dieses Fehlen einer Rüstung natürlich auch ein unausweichliches Schicksal, das sie ereilen würde, sobald sie in die Reichweite der Schwerter der Franzosen gelangten …
Den Bogenschützen war nicht anzusehen, ob sie sich dieser Tatsache überhaupt bewusst waren, was nach Garsuls Ansicht nur Kurgahrs Theorie stützte, dass sie alle verrückt sein mussten. Diese Leute marschierten einfach unverdrossen durch den Schlamm und hielten dabei auf die Franzosen zu.
Die wiederum schien der Ansturm der Engländer zu verblüffen. Offenbar hatten sie nicht mit einem solchen Manöver gerechnet, weshalb es einige Zeit dauerte, bis sie ihre eigenen Reihen geordnet bekamen. Als sie endlich ihre Gefechtsformation eingenommen hatten, waren die Engländer in einer Entfernung von gut dreihundert Yards in Stellung gegangen und die Bogenschützen damit beschäftigt, die Pfähle an diesem Platz in den Boden zu rammen.
Charles d’Albert war kein glücklicher Mann.
Er und seine unmittelbaren Untergebenen (sofern französische Adlige im 15. Jahrhundert überhaupt akzeptieren konnten, irgendjemandem außer Gott untergeordnet zu sein – und Letzteres auch nur mit großen Vorbehalten) hatten einen Schlachtplan vorbereitet. Ihnen allen war klar gewesen, welche strategischen Vorteile die Engländer sich mit ihrer Stellung verschafft hatten, und sie besaßen auch genügend schlechte Erfahrung, wozu englische Bogenschützen in der Lage waren. Diese Hurensöhne aus Wales und England hatten viel zu oft die Gelegenheit erhalten, ein Können unter Beweis zu stellen, mit dem es kein Bogenschütze auf dem Festland aufzunehmen vermochte, was insbesondere für ihre Reichweite und für die Schnelligkeit galt, mit der sie Pfeil auf Pfeil folgen ließen. Schlimmer aber war noch die Tatsache, dass es sich bei dem Langbogen um eine Waffe handelte, die gewöhnliche Bürgerliche in die Lage versetzte, mühelos einen aristokratischen Gegner zu töten. Das war mit ein Grund, warum die Franzosen gefangen genommenen feindlichen Bogenschützen prinzipiell die Finger der rechten Hand abhackten … jedenfalls dann, wenn ihnen ausnahmsweise einmal keine fantasievollere Bestrafung einfallen wollte.
Diesmal jedoch verfügte der Connétable über fast genauso viele Bogenschützen wie Henry, was er nicht zuletzt auch der Tatsache verdankte, dass sich zahlreiche Genueser Bogenschützen hatten anheuern lassen. Ursprünglich hatte sein Plan vorgesehen, diese Männer auf der gesamten Breite der Front einzusetzen, damit die Engländer einmal am eigenen Leib zu spüren bekamen, was sie sonst immer nur den anderen antaten. Es wäre für seine eigenen Leute kein Zuckerschlecken geworden, da die Engländer mit ihrem Langbogen deutlich überlegen waren, aber es wäre dennoch besser gewesen, sie zu opfern und ihre adligen Kameraden zu verschonen. Schließlich hätte ein solcher Vorstoß ohnehin in erster Linie dem Zweck gedient, die Reihen der englischen Bogenschützen zu lichten. Sobald deren Formation durch Gefallene in Unordnung geraten wäre, hätte seine Kavallerie vorrücken können, um die feindliche Linie zu durchbrechen. Von da an wären die Engländer verloren gewesen.
Aber nachdem man sich drei Stunden lang nur gegenseitig belauert hatte, war es d’Alberts Leuten zu viel geworden, und einige seiner Ritter saßen ab, um sich auszuruhen und ihren Pferden und der eigenen Kehle etwas Wasser zu gönnen. Selbst im Oktober wurde es in einer einengenden Rüstung so heiß wie in einem Ofen, also war dieses Verhalten nur zu verständlich. Allerdings bedeutete es auch, dass seine Leute nicht alle auf ihrem Posten waren, um den Vorstoß zu unternehmen, mit dem sie Henrys Armee überrennen konnten, wenn sie sie im richtigen Moment erwischten. Und dann überraschten die Engländer sie alle, indem sie ihrerseits völlig unerwartet vorrückten. Bis es Charles schließlich gelungen war, in seinen Reihen die Ordnung wiederherzustellen, hatten Henrys Leute sich erneut hinter diesen angespitzten Pfählen verschanzt, die jeden Angreifer zurückhalten sollten.
Bei einem Abstand von nunmehr noch knapp dreihundert Yards eröffneten sie das Feuer.
Jeder Barthoni, der diese Aktion mitverfolgte, zuckte unwillkürlich zusammen, als er sah, wie ein erster Pfeilregen auf die französische Formation niederprasselte. Die Audio-Sensoren, um deren Einsatz Joraym und Kurgahr gebeten hatten, übertrugen mit abscheulicher Klarheit die Schreie der verletzten Menschen und jene Laute, die ihre vierbeinigen Reittiere – die sogenannten »Pferde« – von sich gaben. Kein Barthon konnte, ohne körperlichen Schmerz zu empfinden, zusehen, wie Blut aus den verletzten Körpern spritzte. Doch so widerwärtig dieser Anblick auch war, brachte es dennoch keiner von ihnen fertig, sich wegzudrehen. Es war, als würde man eine Naturkatastrophe beobachten, beispielsweise eine Lawine, die einen Berghang herabstürzte und alles mitriss, was ihr im Weg stand. Nur handelte es sich bei dieser »Naturkatastrophe« um das Ergebnis einer vorsätzlich pervertierten Intelligenz, was das Ganze aus einem unerfindlichen Grund umso fesselnder machte.
»Da!«, rief Kurgahr plötzlich und zeigte auf den Schirm. »Ich hatte mich schon gefragt, wann sie das machen würden.« Er zuckte mit dem Kopf, jene typische Geste, mit der ein Barthon Resignation ausdrückte. »Ob sie nun verrückt sind oder nicht, auf jeden Fall erwartet diese Engländer ein unerfreuliches Schicksal.«
Der Historiker besaß ein Talent für Untertreibungen, überlegte Garsul finster, während er zusah, wie der Großteil der zweitausend Reiter sich den Reihen der Engländer näherte. Ihm kam der Gedanke, dass es vermutlich besser gewesen wäre, die Engländer anzugreifen, bevor sie ihre neue Stellung auf dem Feld hatten einnehmen können. Doch die Franzosen hatten ihre Attacke erst begonnen, als sie bereits von den Engländern mit Pfeilen beschossen wurden. Dennoch sollte es keinen nennenswerten Unterschied ausmachen, denn die Bilder ließen deutlich erkennen, dass die Rüstungen der Ritter den Pfeilen ihrer Gegner mühelos standhielten, da die Geschosse wirkungslos von dem Metall abprallten.
Charles d’Albert fluchte lautstark, als er sah, wie seine Kavallerie zum Angriff auf die Engländer ansetzte. Jetzt, wo sie die beste Gelegenheit längst verpasst hatten, mussten sie damit anfangen!
Aber ihm war auch klar, dass es dumm gewesen wäre, irgendetwas anderes von ihnen zu erwarten. Dieser Hagel aus Pfeilen würde die Männer in ihren schweren Rüstungen nicht töten und vermutlich nicht mal verwunden, aber für ihre Pferde galt das nicht. Keine Armee der Welt konnte einfach nur tatenlos dastehen und zusehen, wie siebentausend Bogenschützen sie unter Beschuss nahmen, die jeder bis zu zwölf Pfeile in der Minute abschießen konnten. Entweder man griff dann an, oder man zog sich zurück, um sich aus der Reichweite der für die Pferde tödlichen Geschosse zu bringen. Aber das hier waren französische Ritter, und ein Rückzug stand für sie gar nicht erst zur Diskussion – was jedoch nicht zwangsläufig bedeutete, dass eine Attacke die klügere Wahl war.
Der morastige Boden ließ die Pferde mit ihren Reitern nur langsam vorankommen, während unablässig Pfeile auf sie niedergingen. Im Gegensatz zu den Rittern trugen die Pferde nur einen metallenen Kopfschutz, der Rest des Körpers war ungeschützt, und so sackte ein Tier nach dem anderen tödlich getroffen zusammen und bildete für die nachfolgenden Reiter ein zusätzliches Hindernis. Schlimmer jedoch waren die Pferde, die verletzt wurden und in Panik gerieten. Viele von ihnen gehorchten ihren Reitern nicht mehr, sondern bäumten sich vor Schmerzen auf und versuchten davonzugaloppieren. Die Attacke gegen die Engländer hatte sich innerhalb weniger Augenblicke in ein Chaos aus Verwirrung, Schlamm, Blut und Leibern verwandelt. Da die Kavallerie sich außerstande sah, auch nur in die Nähe der Engländer zu gelangen, trat sie den Rückzug an. Der ohnehin schon morastige Untergrund war inzwischen in eine Schicht aus Matsch verwandelt worden, in der tote und verwundete Pferde wie Riffe im Meer dalagen.
Henry beobachtete, wie die französische Kavallerie kehrtmachte, und gestattete sich ein flüchtiges Lächeln. Er wusste nur zu gut Bescheid über den aufreizenden Effekt des Bogenschießens. Selbst ein noch so gut in eine Rüstung gehüllter Ritter konnte von einem Pfeil getötet oder zumindest verletzt werden, wenn die Umstände gegen ihn sprachen. Die Narben in seinem eigenen Gesicht waren die Folge eines Pfeils, den ein walisischer Rebell auf ihn abgefeuert hatte, als der dem erst sechzehn Jahre alten Prince Henry in der Schlacht von Shrewsbury gegenübergestanden hatte. Im Gegenzug war der Befehlshaber der Rebellen, Sir Henry Percy, ebenfalls von einem Pfeil ins Gesicht getroffen worden, was in seinem Fall allerdings tödlich geendet nach sich gezogen hatte.
Der König sah nur wenige Männer in ihren Rüstungen auf dem Schlachtfeld liegen, doch bei den meisten von ihnen waren dafür nicht die Pfeile der Engländer verantwortlich, sondern ihre eigenen Pferde, die sie bei ihrem Sturz in den Morast mit sich gerissen und unter sich begraben hatten. Aber die Franzosen würden wahrscheinlich nicht einfach dastehen und warten, während sie von den Engländern beschossen wurden. Selbst wenn es ihnen gelang, wieder Ordnung in ihre Formation zu bringen und ihre eigenen Schützen in Stellung gehen zu lassen, hatten die mit ihren Armbrüsten keine Chance gegen die Langbogen seiner Männer. Das bedeutete folglich …
Garsul konnte die entsetzte Fassungslosigkeit der anderen deutlich spüren. Es erschien einfach lachhaft und völlig unmöglich, dass eine solche Masse von schwer bewaffneten Kriegern durch nichts weiter als angespitzte Holzstäbchen abgewehrt worden war, die man mit bloßer Muskelkraft auf sie abgefeuert hatte.
Aber die berittenen Einheiten stellten nur einen Teil der französischen Streitmacht dar, und es war offensichtlich, dass die Kameraden der Reiter diese Schmach nicht ungesühnt lassen würden.
Der ursprüngliche Schlachtplan von Charles d’Albert hatte sich inzwischen als hinfällig entpuppt. Unter diesem beständigen Pfeilhagel war es ihm einfach nicht möglich, seine eigenen Streitkräfte neu zu organisieren. Das lag zum einen natürlich an den gefährlichen Geschossen selbst, zum anderen aber auch daran, wie sich seine Armee zusammensetzte. Die Adligen und die Ritter wollten zu viele Niederlagen gerächt sehen, ihre zahlenmäßige Überlegenheit war schlicht erdrückend, und dazu kamen dann noch die spöttischen und verächtlichen Rufe, die ihnen von den englischen Bürgerlichen mit ihren Langbogen bei ihrem Rückzug an den Kopf geworfen worden und für die Blaublütigen über jedes erträgliche Maß hinausgegangen waren.
Also rückten sie auf eigene Faust gegen die Engländer vor.
Die erste Welle der Franzosen, die aus fast fünftausend Rittern und Waffenknechten bestand, wurde von Connétable d’Albert persönlich befehligt, begleitet von Marschall Boucicault, Duc de Orléans und Duc de Bourbon, während der Comte de Vendôme und Sire Clignet de Brebant das Kommando über die unterstützenden Kavallerieflügel hatten. Die zweite Welle unterstand der Befehlsgewalt von Duc de Bar und Duc d’Alençon sowie von Comte de Nevers, dicht gefolgt von Comte de Dammartin und Duc de Fauconberg als Befehlshaber der dritten Welle.
Insgesamt standen zehntausend Waffenknechte bereit, um ihre gut fünfzehnhundert Pendants auf englischer Seite niederzuringen. Wenn sie erst einmal aus dem Weg geräumt waren, würde man mit den Bogenschützen kurzen Prozess machen.
Allerdings …
»Das glaube ich einfach nicht«, rief Kurgahr.
»Vielleicht liegt das daran, dass wir schon so lange über unsere Technologie verfügen«, gab Garsul zu bedenken, der seinen Blick noch immer nicht von dem Bildschirm abwenden konnte. »Wie lange ist es her, seit einige tausend Barthoni das letzte Mal versucht haben, ein morastiges Feld zu überqueren? Vor allem eines, in dem man so im Schlamm versinkt wie da?«
Die von Regenwasser getränkte, umgepflügte Erde war von den Hufen der französischen Pferde bereits zu einem morastigen Brei zertreten worden, und nun verwandelten Tausende von Füßen das Ganze in eine noch weichere Masse, die das Vorankommen umso beschwerlicher machte. Was unter normalen Umständen schon mühselig gewesen wäre, entwickelte sich so zu einem Albtraum für die Männer, die fünfzig bis sechzig Pfund schwere Rüstungen am Leib trugen, unter denen sich die Luft staute. Einige von ihnen, die sich in der Mitte des Felds befanden, mussten sich durch knietiefen Schlamm kämpfen, und bei jedem Schritt, den sie zustande brachten, schlug ihnen das Trommelfeuer der englischen Pfeile entgegen.
Henry verfolgte mit unerbittlichen Blicken das Geschehen, während er über die Narben in seinem Gesicht strich. Die schweren Kettenhemden und Rüstungen der Franzosen mochten zwar die Pfeile seiner Bogenschützen abwehren, aber es waren auch diese Pfeile, die die Angreifer dazu zwang, die Visiere ihrer Helme zu schließen und sich zu ducken, damit keinem von ihnen das widerfuhr, was Henry und Percy bei Shrewsbury erlebt hatten. Aus eigener Erfahrung wusste Henry, wie sehr die Sicht bei geschlossenem Visier eingeschränkt war. Sogar das Atmen erwies sich durch die wenigen Löcher im Metall als Tortur – vor allem, wenn man sich durch knietiefen Morast kämpfen musste und dabei in dem heißen, verschwitzten Gefängnis der eigenen Rüstung steckte. Erschöpfung war ein wichtiger Faktor, ging es ihm ohne Gefühlsregung durch den Kopf, und das galt auch für Gedränge. Je weiter die Franzosen sich vorkämpften, umso schmaler wurde der Streifen Land zwischen den Wäldern. Die Männer mussten zwangsläufig näher zusammenrücken, was sie noch langsamer werden ließ, als sie es ohnehin waren.
Und nicht einmal die beste Rüstung war in der Lage, jeden Pfeil abzuwehren. Immer wieder gingen Männer zu Boden – manche von ihnen tot, andere verwundet, während wieder andere lediglich den Halt verloren hatten und hingefallen waren –, die alle dafür sorgten, dass der Platz für ihre Kameraden noch enger wurde. Indem sie versuchten, einen Bogen um die Gestrauchelten zu machen, damit sie die nicht noch tiefer in den Morast drückten, geriet dann auch noch die ursprüngliche Formation aus den Fugen. Wer sich noch auf den Beinen halten konnte, der wurde immer wieder von irgendeinem der Tausende von Pfeilen getroffen, die zwar nur in seltenen Fällen die Rüstung durchdrangen oder jenen schmalen Freiraum fanden, der das Fleisch darunter ungeschützt ließ. Aber ein mit einem Langbogen abgeschossener Pfeil konnte mit der Wucht von rund hundertvierzig Pfund und manchmal sogar zweihundert Pfund auf sein Ziel treffen, und ein solcher Aufprall hatte etwas von einem Treffer mit dem Vorschlaghammer. Diese schmerzhaften Schläge, die neben allem anderen den Franzosen zu schaffen machten, mussten irgendeine Wirkung zeigen.
Garsuls Haut zuckte vor Unbehagen. Das war kein Schock mehr, den hatte er bereits hinter sich gelassen. Nein, das war ein dumpferes, fast schon betäubendes Gefühl.
Aller Gegenwehr zum Trotz erreichte der schleppende Vormarsch der Franzosen schließlich die englische Verteidigungslinie. Mittlerweile standen die Krieger so gedrängt, dass keiner von ihnen noch einen Schritt nach vorn machen konnte, wenn sich nicht die Menge insgesamt bewegte. Nach Garsuls Schätzung war ihr Vorrücken um mindestens siebzig Prozent allein aus dem Grund verlangsamt worden, dass sie keinen Platz hatten. Und doch hatten sie diese dreihundert qualvollen Yards zurückgelegt, die der Feind von ihnen entfernt gewesen war.
Die französischen Waffenknechte waren erschöpft, Henrys Männer dagegen ausgeruht und zum Kampf bereit. Die kurze Front seiner eigenen Waffenknechte war nur vier Reihen tief, während die Bogenschützen von ihrer Position am Rand aus nun die Flanken des Gegners unter Beschuss nahmen, bis ihnen buchstäblich die Pfeile ausgingen. Als dann aber die vorderste Linie der Franzosen auf die Engländer traf, mussten die vor der geballten Wucht des Gegners zurückweichen – zwar nicht weit, aber es genügte die Tatsache, dass sie zurückgedrängt wurden. Dennoch kämpften sie mit aller Energie, um jeden Yard so lange wie möglich zu verteidigen, ehe sie ihn aufgaben. Die Formation der Franzosen stand so dicht gedrängt, dass die einzelnen Soldaten nicht genug Freiraum hatten, um ihre individuellen Waffen zum Einsatz zu bringen. Dann rückte auch schon die zweite Welle heran, und das Gedränge wurde noch schlimmer.
Das war auch der Moment, da die Bogenschützen alle Pfeile aus ihren Köchern verschossen hatten. Sie gaben ihre Position an den Flanken auf und griffen zu Äxten, Schwertern, Dolchen, Spitzhacken und Hämmern. Zwar trugen sie keine Rüstung, doch dadurch waren sie viel beweglicher als ihre schwerfälligen und mit Morast überzogenen Widersacher, und auch wenn sie nicht das Gesicht mit einem Visier schützen konnten, wurde ihre Sicht zum Ausgleich durch nichts behindert. Und während sie sich bis dahin körperlich nicht so hatten anstrengen müssen, waren viele Franzosen vom Marsch durch den Morast, von der Hitze und von der verbrauchten Luft in den engen Helmen so abgekämpft, dass sie kaum in der Lage waren, ihre Waffen hochzuheben.
Diese Situation hätte mit sorgfältiger Planung vorbereitet worden sein können, und tatsächlich war sie das auch. Nämlich durch Henry, der auf diese Weise den Vorteil ausgleichen konnte, den die französischen Waffenknechte unter normalen Umständen innehatten. Kein Franzose, der nun von den Bogenschützen zu Boden geschickt wurde – und sei es nur, dass er ausrutschte und den Halt verlor –, hatte noch eine Chance, sich wieder aufzurichten und weiterzukämpfen.
»Clahdru!«, murmelte Hartyr fast drei Menschenstunden später. »Es scheint einfach nicht … wie kann jemand …?«
Er ließ seine Frage unvollendet, und Garsul schüttelte sich unwillkürlich. »Menschen« waren keine Barthoni, das war klar. Aber obwohl er sich seit Jahrzehnten dem Erkunden verschrieben hatte und obwohl er der Ansicht war, dass jede empfindungsfähige Spezies mit Würde und Respekt behandelt werden sollte, konnte er sich nicht dazu durchringen, diese Menschen als »Volk« anzusehen. Zugegeben, Joraym hatte recht gehabt, und es war ihm peinlich, zugeben zu müssen, dass der Xeno-Anthropologe seine Vorurteile durchaus richtig eingeschätzt hatte. Doch das änderte nichts daran, dass es sich bei ihnen um Empfindungsfähige handelte, und was die »Engländer« und die »Franzosen« sich gegenseitig angetan hatten, würde ihn für den Rest seines Lebens in Albträumen verfolgen.
Er beneidete auch nicht den Rat darum, dass der sich den vertraulichen Bericht ansehen musste, den er in Kürze abschicken würde.
Vor der Position der »Engländer« türmten sich die Leichen zu Bergen, die zum Teil sogar Garsul überragt hätten. Clahdru allein wusste, wie viele Franzosen im Morast erstickt oder vom Gewicht der auf ihnen liegenden toten Kameraden erdrückt worden waren. Es war so schlimm, dass die dritte Angriffswelle sich geweigert hatte, gegen die Engländer vorzurücken. Nach Garsuls Meinung war das eine kluge Entscheidung gewesen, wenn man überlegte, was bereits drei Viertel ihrer Rüstung tragenden Kameraden widerfahren war. Es erschien unglaublich, hochnäsig und lächerlich, dass eine zahlenmäßig so unterlegene Streitmacht einen derartigen Gegner besiegen konnte, und doch hatten die Engländer genau das geschafft. Der Beleg für ihre Wildheit und ihre Blutrünstigkeit war schlicht erdrückend und entsetzlich.
»Halten Sie sie immer noch für ›jugendlich‹ und ›unreif‹, Joraym?«, fragte Schiffskommandant Syrahk zynisch.
»Ich weiß nicht.« Der Xeno-Anthropologe klang zutiefst erschüttert. »Ich meine, sie sind ja auch jugendlich und unreif, etwas anderes können sie auf ihrer momentanen Entwicklungsstufe gar nicht sein. Aber so etwas …?« Joraym warf den Kopf in der Barthon-Geste der Verwunderung in den Nacken. »In der gesamten Literatur bin ich noch nie auf eine solche Brutalität gestoßen.«
»Urteilen wir nicht gleich zu hart über sie«, warf Kurgahr ein und zog damit die verdutzten Blicke des Schiffskommandanten und des Xeno-Anthropologen auf sich, was er mit einem Schnauben kommentierte. »Ich will nichts von dem entschuldigen, was wir hier gesehen haben. Aber ich habe mich mit genügend Literatur befasst und weiß, dass ein solches Verhalten auch bei anderen Spezies zu finden ist. Es gab Phasen in unserer prä-technischen Ära, in denen wir uns Dinge erlaubt haben, die uns heute mit Entsetzen erfüllen würden. Vielleicht nicht wegen etwas so Belanglosem wie politischen Meinungsverschiedenheiten, und auch nichts, was entfernt an das hier herankommt. Aber wenn einer Herde der Hungertod drohte und wenn sie gezwungen war, neue Flächen für sich zu beanspruchen, dann war die auch zu ziemlich schlimmen Taten fähig. Und ich glaube, wenn Sie sich intensiver mit der Vergangenheit mancher unserer fleischfressenden Nachbarn befassen, werden Sie auch dort so manche blutige Episode finden.«
»Und dann wären da ja auch noch die Shongairi«, meldete sich Garsul zu Wort und erntete dafür etliche finstere Blicke, woraufhin er mit den oberen Schultern zuckte. »Ich will damit nur sagen, dass diese Kreaturen hier wenigstens eine Entschuldigung für ihre gesellschaftlich und technisch primitiven Verhältnisse haben. Ganz im Gegensatz zu den Shongairi.«
»Das stimmt zwar«, entgegnete Joraym in einem Tonfall, als gebe er sich größte Mühe, seine Distanz zu wahren. »Aber die Shongairi sind zwangsläufig ein wenig … eigenartig. Sie wissen, wie ich das meine. Immerhin sind sie … Fleischfresser.« Die Abscheu des Xeno-Anthropologen vor dem fast schon obszönen Begriff war ihm deutlich anzusehen. »Ich sage das nicht gern, aber diese ›Menschen‹ sind Omnivoren. Die haben nicht diese Entschuldigung vorzuweisen, Garsul.«
»Ich weiß, aber …«
»Augenblick!«, rief Syrahk dazwischen. »Da tut sich was!«
»Mein Lord!«
Henry sah auf, als er den Ausruf des Boten hörte. Der König kniete neben dem Lager, auf dem sein jüngster Bruder Humphrey lag, der Duke of Gloucester. Humphreys fünfundzwanzigster Geburtstag war noch keine drei Wochen her, und Henry hatte persönlich die Wachen zu ihm geführt, als er niedergestreckt worden war. Sie hatten ihn aus dem Mahlstrom geholt und zu den Heilkundigen gebracht, doch er war von einer gegnerischen Waffe in den Bauch getroffen worden, und solche Verletzungen verliefen in den meisten Fällen tödlich.
»Was ist?«, fragte der König in schroffem Ton. Erschöpfung und Sorge um seinen Bruder legte sogar über seine sonst so unerschütterliche Miene einen düsteren Schatten.
»Mein Lord, ich glaube, die Franzosen formieren sich neu!«
Abrupt stand Henry auf und durchschritt den schützenden Kordon aus Rittern und Waffenknechten, um sich selbst ein Bild zu machen. Die Nachhut der Franzosen war zunächst nicht vorgerückt, doch nun setzte sich auch diese dritte Welle in Bewegung. Henrys Miene versteinerte. Allein in der vordersten Linie fanden sich fast so viele Krieger, wie seine komplette restliche Armee umfasste. Hinzu kam, dass die Bogenschützen alle Pfeile aufgebraucht hatten und es Stunden dauern würde, um für sie Nachschub aus dem Vorratswagen zu beschaffen. Außerdem waren seine Männer erschöpft und nicht in Formation, und sie hatten ihre Gefangenen noch nicht gesichert. Buchstäblich Tausende von Franzosen lagen im Morast, die zwar erschöpft waren und aus eigener Kraft nicht mehr aufstehen konnten, die aber keine Verletzungen davongetragen hatten.
Und sie waren noch im Besitz ihrer Waffen.
Henry schaute über das Feld zu den verbliebenen Franzosen und schnaubte aufgebracht. »Bringt Sir Thomas zu mir!«, befahl er.
»Sofort, Euer Majestät!«
Ein Bote rannte los und kehrte Minuten später mit Sir Thomas de Camoys zurück, der während der Schlacht den linken Flügel der englischen Truppen befehligt hatte. Nach dem Tod von Edmund of Norwich, dem Duke of York, der den Befehl über den rechten Flügel gehabt hatte (und der so wie Hunderte Franzosen unter einem Berg toter Soldaten und Pferde erdrückt worden war), war de Camoys zu Henrys ranghöchstem Befehlshaber aufgestiegen.
»Euer Majestät«, sagte de Camoys und verbeugte sich, während Henry mit dem Finger auf die dritte Welle der Franzosen zeigte, in die Bewegung gekommen war.
»Diese Hurensöhne wollen uns angreifen, Sir Thomas«, erklärte der König. »Wir können nicht zulassen, was hier geschehen würde«, er deutete auf die schlammverschmierten Franzosen, die sich vor der Linie der Engländer türmten, »wenn sie tatsächlich durchkommen.«
Diesmal musste sich Garsul übergeben.
Vielleicht war es nur die angesammelte Abscheu, die zu viel für ihn geworden war, aber vielleicht steckte auch mehr dahinter. Auf jeden Fall war es für ihn zu viel, als er sah, wie die Engländer begannen, systematisch die hilflosen Franzosen abzuschlachten. Sie trieben Dolche durch geschlossene Visiere, oder sie hackten mit Äxten die Rüstungen auf, um an die Männer zu gelangen, die sich unter dem schützenden Panzer befanden.
Schließlich wandte er sich vom Bildschirm ab.
»Ton aus!«, befahl er energisch. »Wir müssen uns das nicht auch noch anhören!«
Als die Übertragung der Schreie und der flehentlichen Bitten und der Stoßgebete verstummte, musste sich Garsul schütteln.
Clahdru, dachte er angewidert. Clahdru, beschütze mich. Bei deiner Gnade, lass mich nie wieder so etwas sehen! Ich dachte, meine »geheimen Befehle« laufen allem zuwider, wofür die Erkundung steht, aber das ist jetzt nicht mehr der Fall. Jetzt weiß ich, wie vorausschauend es vom Rat war, diese Befehle auszugeben!
»Wir sind hier fertig«, erklärte er dann tonlos. »Wir haben alle Daten, die wir benötigen, und bei Clahdru – wir haben mehr ›gesellschaftliche‹ Daten gesammelt, als jedes geistig gesunde Wesen sich jemals ansehen möchte. Schiffskommandant.« Er sah Syrahk an. »Ich will, dass wir innerhalb von zwei Tagessegmenten den Orbit verlassen und Kurs auf die Heimat nehmen.«
Planet KU-197-20
Im Jahr 74.065 der Hegemonie
.I.
»Und, mein furchtloser Jäger? Bist du bereit für deinen Vorstoß in die tiefste, dunkelste Wildnis? Und hast du auch genug Pemmican und Dörrfleisch eingepackt?«, erkundigte sich Sharon Dvorak mit einem lieblichen Lächeln auf den Lippen.
»War deine letzte Frage eine Anspielung?«, erwiderte ihr Ehemann argwöhnisch, drehte sich um und zog forschend eine Augenbraue hoch. »Das war es doch, nicht wahr? Das war eine Anspielung! Nein, das war eine richtiggehende spitze Bemerkung – ja, genau, das war es!«
»Es ist wirklich traurig, dass ein erwachsener Mann – jedenfalls ein theoretisch erwachsener Mann –, dass der in solchen Dingen so empfindsam sein kann«, seufzte Sharon und schüttelte, von unendlicher Traurigkeit erfüllt, den Kopf.
»O ja, ganz bestimmt«, schnaubte Dave Dvorak. »Und das von der Frau, die behauptet, mich zu lieben! Ah, ich weiß. Du bist nur so gemein, weil es das letzte Mal, als wir dich auf die Jagd mitgenommen haben, diesen kleinen Fauxpas gab.«
»Ach, wirklich?« Sharon sah ihn mit Unschuldsmiene an. »Du meinst damit nicht zufällig das Versäumnis, genügend Essen mitzubringen, oder? Diesen kleinen Gedächtnisaussetzer meines Bruders bezüglich der Nahrungsmittel, wie du, wenn ich mich nicht irre, anmerktest.«
»Es war kein Gedächtnisaussetzer«, stellte Dvorak unglaublich würdevoll klar. »Wir hatten es nur für eine gute Gelegenheit gehalten, damit du lernst, von dem zu leben, was die Natur einem gibt – so wie wir Jäger und Sammler das machen. Du weißt schon, Nüsse und Beeren, Pilze aus dem Wald anstelle von Champignons aus der Dose und so weiter.«
»Ich könnte schwören, ich hätte meinen geliebten Ehemann gehört, wie er sich ohne Ende darüber beklagt, dass er nichts außer Nüssen und Beeren zu essen bekommt.«
»Da spielt dir bestimmt nur deine Erinnerung einen Streich.«
»Meinst du? Dann hast du auch nicht gesagt: ›Stell ihm ein Bein, dann setze ich mich auf ihn, und du durchsuchst seine Taschen nach ein paar Schokoriegeln.‹ Oder?«
»Na ja, ich schätze, etwas in der Art könnte mir rausgerutscht sein. Schließlich wollte der gierige Mistkerl nicht mit uns teilen … also … natürlich, weil mein Blutzucker zu niedrig ist. Immerhin hatte ich nichts zu essen bekommen«, fügte er hastig hinzu. »Vorausgesetzt natürlich, diese ganze Episode hat sich tatsächlich so zugetragen, was ich doch stark bezweifle.«
»Nein, natürlich ist das nie passiert.«
Sharon gab ihm einen für ihre Verhältnisse sanften Klaps auf die Stirn, was nicht ganz so einfach war, musste sie dafür doch hoch reichen, weil er einen Kopf größer war als sie. Allerdings hatte sie im Lauf der Jahre reichlich Erfahrung sammeln können.
Er grinste sie an und schlang die Arme um sie. Sie hatte genau die richtige Größe, damit er sein Kinn auf ihren Kopf legen und die Umarmung genießen konnte. »Und du willst ganz sicher nicht mitkommen?«, fragte er dann ernst. »Rob und ich können für dich immer noch Platz schaffen.«
»Ihr zwei könnt euch gern im strömenden Regen in den Wald setzen, aber ich werde es mir vor dem Fernseher gemütlich machen und mich mit dieser Schachtel Pralinen vergnügen, die mir jemand spendiert hat. Aber natürlich werde ich dabei ein schrecklich schlechtes Gewissen haben.«
»Es könnte immer noch aufhören zu regnen«, führte Dvorak aus, wobei er sich Mühe geben musste, das Geräusch zu ignorieren, das der prasselnde Regen auf dem Dach verursachte.
»Ja, und das Pferd könnte vielleicht das Singen erlernen.« Sie schüttelte den Kopf, während sie ihn anlächelte. »Geh schon. Vergnügt euch. Ich werde dich auch mit VapoRub einreiben, wenn du mit einer Lungenentzündung nach Hause gekrochen kommst. Aber erwarte nicht von mir, dass ich für dich Partei ergreife, wenn deine dich liebenden Kinder mit Tränen in den Augen ansehen, weil du ihnen eine Portion Bambi Stroganoff zum Abendessen vorgesetzt hast.«
»Hah! Als ob dieser alberne Film irgendeinen von euch jemals von einer Portion Fleisch abgehalten hätte! Velociraptoren kümmert es nicht, woher das Fleisch kommt. Wichtig ist nur, dass es frisch ist.«
»Das weiß ich. Aber du weißt genauso, dass sie sich nicht die Gelegenheit entgehen lassen, dich mit traurigen Blicken zu bedenken.« Wieder schüttelte Sharon den Kopf. »Und gib nicht mir die Schuld, sondern deiner Mutter.«
Dvorak dachte kurz darüber nach und suchte nach einer passenden Erwiderung, doch es wollte ihm nichts einfallen. Also begnügte er sich damit, ihr die Zunge rauszustrecken, sie noch einmal an sich zu drücken und sich dann auf den Weg zum wartenden Pick-up zu machen.
»Und? Hat sie dir Vorhaltungen gemacht?«
»Lass dir gesagt sein«, erklärte Dave Dvorak in ernstem Tonfall an seinen Schwager Rob Wilson gerichtet, »dass ich in meinem Haushalt der Herr bin. Jede meiner Launen ist ein unbedingter Befehl, jeder meiner Wünsche wird von allen auf der Stelle erkannt und erfüllt.«
»O ja, ganz sicher«, gab Wilson zurück und verdrehte die Augen. »Du erinnerst dich doch daran, dass ich meine süße kleine Schwester schon seit fast vierzig Jahren kenne, nicht wahr?«
»Wenn das der Fall ist, dann solltest du aber auch wissen, dass deine süße kleine Schwester es bestimmt nicht mag, wenn du mit solchen Jahreszahlen um dich wirfst«, hielt Dvorak ihm vor.
»Ich kann sie noch immer in drei von vier Versuchen schlagen.« Wilson hob ein wenig das Kinn an.
»Ich meine, mich an ein Thanksgiving-Essen erinnern zu können«, konterte Dvorak schwärmerisch, »bei dem sie dir beinahe die rechte Kniescheibe gebrochen hätte.«
»Aber nur, weil ich ihr nicht wehtun wollte.«
»Wenn du das sagst.« Dvorak wandte den Blick von der Straße ab und sah grinsend seinen Schwager an. »Bist du dir auch ganz sicher, dass es nicht so war, dass sie dir nicht wehtun sollte?«
»Tja, weißt du, die Möglichkeit habe ich schon mal in Erwägung gezogen, aber nur ganz, ganz flüchtig«, räumte Wilson ein, dann mussten sie beide lachen, und Dvorak schaute wieder durch den auf die Windschutzscheibe prasselnden Regen nach draußen.
Die beiden Männer verstanden sich gut. Dvorak, ein von der Nationalen Schusswaffenvereinigung NRA zertifizierter Ausbilder für den Umgang mit Schusswaffen, war Chef einer Indoor-Schießanlage. Wilson, der zwanzig Jahre beim US Marine Corps gedient hatte, war anschließend zur Polizei gegangen, wo er es in einer kleineren Gemeinde bis zum Sergeant gebracht und als Schusswaffenausbilder gearbeitet hatte, bis es bei einer Verfolgungsjagd zu einem Unfall kam, bei der er sich ein Bein brach. Da diese Verletzung eine dauerhafte erhebliche Einschränkung seiner Beweglichkeit nach sich zog, musste er seinen Dienst quittieren und bekam eine Berufsunfähigkeitsrente ausgezahlt. Er zählte zu den besten Pistolenschützen, denen Dvorak je begegnet war (er führte üblicherweise Buch beim einmal wöchentlich stattfindenden Wettschießen auf seiner Anlage), und noch als Wilson bei der Polizei gewesen war, hatte er nebenbei bei Dvorak gearbeitet. Sein eigenes NRA-Zertifikat hatte er noch während seines Polizeidienstes erhalten, also war es nur logisch gewesen, dass er sich in das Geschäft einkaufte und Vollzeit dort arbeitete. Es war eine sehr angenehme Konstellation, die ihnen beiden die Gelegenheit gab, jede Woche beträchtliche Mengen Munition zu verschießen und dafür auch noch bezahlt zu werden. Sharon Dvorak und Veronica Wilson sprachen zwar immer von »den Jungs und ihren Spielzeugen«, aber keiner von beiden störte sich daran. Und abgesehen davon waren beide Frauen dafür bekannt, dass sie noch besser schossen als die Männer.
Die Jagdsaison gehörte zu seinen bevorzugten Zeiten im Jahr, auch wenn er sich angesichts des Wetters an diesem Tag die Frage gefallen lassen musste, wieso das eigentlich der Fall war. Allerdings war es auch erst fünf Uhr, und bis zum Anbruch der Dämmerung blieb noch Zeit genug für eine Wetterbesserung, sagte er sich voller Zuversicht.
Im Augenblick waren sie auf der US-276 in Richtung Travelers Rest unterwegs, Fernziel war die Caesars Head/Jones Gap Wildlife Management Area gleich südlich der Grenze zwischen den Bundesstaaten South und North Carolina. Bislang war die Jagdsaison für Dvorak enttäuschend verlaufen – er hatte erst eine seiner Marken aufgebraucht –, und Wilson zog ihn damit immer wieder gerne auf, hatte er doch nur noch eine Marke übrig. Wäre das Verhältnis umgekehrt gewesen, dann hätte er sich wohl dazu durchringen können, an diesem nassen Oktobermorgen im Bett zu bleiben. Aber das war eben seine Charakterschwäche.
Na ja, dachte er und beugte sich vor, um am oberen Rand durch die Windschutzscheibe zu dem immer noch nachtschwarzen Himmel zu schauen. Wenn ich heute eine Marke verbrauche, dann habe ich mir das auch verdammt noch mal verdient. Grinsend lehnte er sich zurück. Ich kann mir das schon richtig vorstellen. »Hier, Frau – Jäger bringt Essen heim. Geh kochen!« Unwillkürlich schüttelte er den Kopf. Ich werde von Glück reden können, wenn ich nicht derjenige bin, der im Kochtopf landet. Vorausgesetzt natürlich, dass ich nicht sowieso am Herd stehe.
Lauter Donner zog über die Landschaft hinweg, laut genug, um sogar das laute Fahrgeräusch auf dem Asphalt zu übertönen, auf dem das Wasser stand. Dvorak tat einfach so, als hätte er nichts gehört.
.II.
Das Rufsignal des Kommunikators von Flottenkommandant Thikair meldete sich mit einem Pfeifton.
Später würde er sich daran erinnern, wie prosaisch dieser Klang doch gewesen war und … wie normal. Doch in diesem Augenblick, als er von einem Stapel Papierkram aufsah und nicht wusste, was ihn erwartete, empfand er diese Störung als äußerst willkommen. Er drückte auf die Annahmetaste, und im gleichen Moment war seine freudige Erleichterung verflogen, da er das Gesicht des Befehlshabers seines Flaggschiffs erkannte … der ihm besorgt entgegenblickte.
»Was gibt es, Ahzmer?«, fragte er, ohne mit einer formalen Begrüßung Zeit zu vergeuden.
»Flottenkommandant, wir haben soeben einen vorläufigen Bericht von den Scoutschiffen empfangen. Diesem Bericht zufolge haben sie eine recht … nun, beunruhigende Entdeckung gemacht«, antwortete Kommandant Ahzmer.
»So?« Thikairs Ohren stellten sich interessiert auf, als Ahzmer eine Pause folgen ließ.
»Flottenkommandant, sie haben recht hoch entwickelte Übertragungen abgefangen.«
»Übertragungen?« Sekundenlang waren diese Worte für ihn ohne erkennbare Bedeutung, dann aber kniff Thikair die Augen zusammen, und sein Fell sträubte sich. »Wie hoch entwickelt?«, wollte er deutlich energischer wissen.
»Sehr hoch entwickelt, fürchte ich, Flottenkommandant«, kam die betrübte Antwort. »Wir empfangen digitale und analoge Signale mit einer beeindruckenden Bandbreite. Das ist mindestens Aktivität der Stufe Drei. Vielleicht sogar«, Ahzmer legte die Ohren an, »Stufe zwei.«
Thikair legte daraufhin die Ohren noch flacher an als der Kommandant. Er spürte, dass die Spitzen seiner Eckzähne sichtbar wurden. Er hätte nicht zulassen dürfen, dass sein Gesichtsausdruck so viel verriet, aber er und Ahzmer kannten sich seit Jahrzehnten, und es war offensichtlich, dass der das Gleiche gedacht hatte wie er.
Der größte Teil der Flotte war vor gerade mal vier Tageszwölfteln in den Normalraum zurückgekehrt, nachdem sie subjektiv acht Standardjahre im kryogenischen Schlaf verbracht hatten. Nach der Zeitrechnung im Rest der Galaxis hatte der Flug rund sechzehn Standardjahre gedauert, da auch die besten Geschwindigkeitsmodifizierer selbst im Hyper keine Geschwindigkeit erlaubten, die über dem Fünf- bis Sechsfachen dessen lag, was das Licht unter Normalraumbedingungen erreichen konnte. Die großen Schiffe und die Transporter waren noch immer zwei Standardmonate Normalraum-Reise von ihrem Ziel entfernt und glitten nach wie vor gleich riesigen, eleganten hastbar mit verborgenen Krallen und Fangzähnen durchs endlose Dunkel, während die medizinischen Mitarbeiter mit der zeitraubenden Aufgabe begannen, die nach etlichen Tausenden zählenden Bodentruppen wiederzubeleben, die bald zum Einsatz kommen würden. Die leichteren Scoutschiffe mit ihrer deutlich geringeren Tonnage konnten im N-Raum und H-Raum gleichermaßen mehr aus ihrem Antrieb herausholen, weshalb er sie auch vorausgeschickt hatte, damit sie sich ihr Ziel schon einmal genauer ansahen. Nun allerdings wünschte er, er hätte das nicht getan.
Hör auf damit, ermahnte er sich mit Nachdruck. Deine Unwissenheit hätte ohnehin nicht mehr allzu lange angehalten. Und so hast du wenigstens etwas Zeit, um dir Gedanken darüber zu machen!
Sein Verstand begann zu rotieren, während er sich nachdenklich zurücklehnte und eine sechsfingrige Hand nach unten nahm, um über seinen Schwanz zu streichen.
Das Problem bestand darin, dass die Autorisierung für diese Operation durch den Hegemonierat auf dem Bericht des Erkundungsteams basierte, wonach die intelligente Spezies der Zielwelt – die »Menschen«, wie sie sich selbst nannten – nur den Status einer Zivilisation der Stufe Sechs erreicht hatte. Die beiden anderen Systeme auf Thikairs Liste gehörten zur Stufe Fünf, auch wenn eines von ihnen sich klammheimlich dem Grenzwert zur Stufe Vier genähert hatte. Es war ein schwieriges Unterfangen gewesen, den Rat dazu zu bewegen, diese beiden Missionen abzusegnen. Die Notwendigkeit, die Sache der Shongairi vor dem Rat so beharrlich zu diskutieren, war überhaupt erst der Grund gewesen, dass die Mission lange genug hinausgezögert worden war, um sie zu einer drei Systeme umfassenden Operation zusammenzufügen.
Aber eine Kultur der Stufe Sechs war primitiv genug, um ihre »Kolonisierung« praktisch nebenbei zu autorisieren. Es war die Art von Mission, die jedes Mitglied der Hegemonie in Angriff hätte nehmen können. In diesem speziellen Fall war die Genehmigung sogar noch schneller als üblich erteilt worden. Thikair wusste, dass einige der Omnivoren im Rat – und sogar ein paar Herbivoren – mit heimlicher Befriedigung ihre Zustimmung gegeben hatten, was den Fall KU-197-20 anging. Die visuellen und akustischen Aufzeichnungen des ursprünglichen Erkundungsteams hatten bei der Mehrheit der Mitgliedsspezies der Hegemonie blankes Entsetzen ausgelöst. Auch wenn man den Menschen zugute halten musste, dass sie primitiv waren, hatten die Bilder bei den meisten Hegemoniemitgliedern doch mehr oder weniger unverhohlene Abscheu ausgelöst.
Thikairs Spezies hatte nicht angewidert reagiert, was einer der Hauptgründe dafür war, dass diese Heuchler im Rat kaum einen Hehl daraus gemacht hatten, wie zufrieden sie darüber waren, den Fall KU-197–20 an die Shongairi zu übergeben. Dennoch hatten sie sich nie mit der Eroberung einer Zivilisation der Stufe Drei einverstanden erklärt, und erst recht nicht mit Stufe Zwei! Tatsache war, dass alles, was es auf die Stufe Zwei geschafft hatte, automatisch den Protektoratsstatus erhielt, bis Stufe Eins erreicht war. Danach erlangte diese Zivilisation den Status eines potenziellen Mitglieds der Hegemonie, sofern sie sich vor der Aufnahme nicht selbst zerstörte – was bei einem bemerkenswerten Prozentsatz von ihnen dann auch tatsächlich geschah.
Feiglinge, dachte Thikair missbilligend. Schmutzwühler! Unkrautfresser!