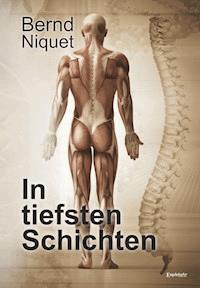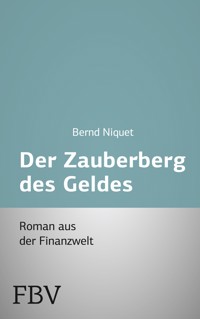
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FinanzBuch Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
"Wir müssen in großen Dimensionen denken, so können wir an die Großen ran" lautete die Grundüberlegung von Alexander von Schulenburg und Bernhard von Mandelwindel bei der Gründung ihres eigenen Staates. Besessen von Geld, das Ihnen die Schätze der Welt käuflich macht, bauen Sie einen hypermodernen Merkantilismus auf. Die ewige Jagt nach frischem Kapital nimmt gänzlich neue Dimensionen an und mündet in eine rasante Romanhandlung. Bernd Niquet, der als Wirtschaftskolumnist im gesamten deutschsprachigen Raum einen hervorragenden Ruf genießt, wirft mit seinem neuen Roman einen ironischen Blick hinter die Fassaden der Wirtschaftswirklichkeit. Utopie und wahre Fakten werden auf eindrucksvolle Weise miteinander verbunden und vermitteln ein profundes Verständnis, was die Weltwirtschaft im Innersten zusammenhält. Der bekannte Wirtschafskolumnist Bernd Niquet bewegt sich mit seinem neuen Werk einmal mehr auf der Passhöhe der Erzählkunst. Spannend, rasant und mit unvergleichlich kosmopolitem Esprit schildert er seinen Lesern, was ein Wirtschaftssystem im Innersten zusammenhält und von wem es gelenkt wird. Die "Herren des Geldes", verkörpert durch die beiden Hauptfiguren Alexander von Schulenburg und Bernhard von Mandelwindel machen sich nach der Diskussion um die Vor- und Nachteile von sagenumwobenen Staatengebilden wie Monaco, Schweiz und Luxemburg gleich selbst daran einen eigenen Staat aufzubauen. In ihrer Republik "Schwarzenstein" herrscht ein hypermoderner Merkantilismus, der auch im internationalen Vergleich vorderste Plätze belegt. Mit Abraham Grünspan kristallisiert sich bald der größte Vermögensbesitzer der Welt heraus. Doch je höher der Aufstieg, desto tiefer ist der Fall. Der Staatenführer stolpert in seinen Untergang - neue Visionäre werden an seine Stelle treten und wieder genau den gleichen Weg einschlagen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 246
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Bernd Niquet
Der Zauberberg des Geldes
Bernd Niquet
Der Zauberberg des Geldes
Roman aus der FinanzweltMit einem Vorwort von Joachim Bessing
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:
Nachdruck 2013
© 2002 by Finanzbuch Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Nymphenburger Straße 86
D-80636 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Realisierung: Michael Volk, München
Umschlaggestaltung: Münchner Verlagsgruppe GmbH
Druck: Books on Demand GmbH, Norderstedt
ISBN Print 978-3-89879-760-3
ISBN E-Book (PDF) 978-3-86248-386-0
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-86248-819-3
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.finanzbuchverlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unterwww.muenchner-verlagsgruppe.de
eBook by ePubMATIC.com
Für Kerstin –in besonderer Erinnerung des Pitztals, wo nicht nur die Idee zu diesem Buch ihren Anfang nahm
Vorwort
MUSKELN AUS GELD
„Ich bin in Boogie-Laune“, sagte mein neuer Freund, als wir um Mitternacht die Galerie verließen. Wir waren uns zu Beginn des Abends vorgestellt worden, die Galeristin hatte zu einem Pre-Vernissage-Diner ihrer Ausstellung von Bildern des Mexikaners Manolo da Campo eingeladen. Wir saßen dort an zwei langen Tafeln vor eigens dafür rosa gestrichenen Wänden aus Beton. Hinter uns hingen die Ikonen del Campos wie böse rosa Schatten: Betty Page gibt Karl Marx einen Blowjob, das Michelin-Männchen schmilzt im Fegefeuer, Metallica tackern das Schneewittchen an ein Kreuz und so weiter.
Diese lustige Pop-Ironie – wo hatte ich das schon einmal gesehen?, oder darüber gelesen?, oder davon gehört?
Vom Bürgersteig her, durch die raumhohen Schaufenster betrachtet, muss die Szenerie ausgesehen haben, als ob eine Reisegruppe von dreißig sehr reichen, sehr gut aussehenden Menschen versehentlich in den Magen eines Höllenwurms gewandert wäre – was sie nicht weiter zu stören schien.
Denn kleinwüchsige Kellnerinnen aus Genf mit platinblonden Seitenscheitelfrisuren servierten ihnen Thai Fingerfood und Weißwein, Rotwein, Prosecco; die Tischgespräche drehten sich um Collageninjektionen, Andreas Baader und die Performance der Prada-Yacht im Americas Cup. Und die ganze Zeit dachte ich, dass mir das Szenario dieses Abends seltsam bekannt vorkommt. Ein seltsamer Re-Run, aber: wovon?
Unser Taxi hielt vor der bekannten Diskothek „Parkcafé“, die für diesen Abend in ihrem Inneren bis hinauf zur acht Meter hohen Decke mit marineblauem Schottenkaro ausgekleidet war. Die Uniformen der auf uns zugleitenden Kellner waren aus demselben Stoff geschnitten. „Relight My Fire“ von Dan Hartman lief gerade aus, der DJ spielte „I Will Survive“.
Die Mädchen trugen ihr blondes Haar mit Hornspangen zum Pferdeschwanz zusammengefasst und lachten mit sehr vielen Zähnen, in denen sich die Perlen ihrer Halsketten spiegeln konnten; ihre Begleiter hatten die Ärmel ihrer Oxfordhemden von Polo Ralph Lauren bis in die Ellbogen aufgerollt. Beim Tanzen fielen ihnen wellig nach hinten gegelte Haarsträhnen in die Stirn.
Mein neuer Freund sah genau so aus wie die anderen Gäste und bestellte Champagner an einer der Bars. Der Keeper fragte: „Welcher Jahrgang?“.
Das ist doch, dachte ich – ist das nicht eine Szene aus … ? Ja, aus was denn nur?
„Alles umsonst“, raunte mein neuer Freund mit den Gläsern in der Hand und ich roch sein After Shave: „Eau Sauvage“ von Christian Dior – Duft einer längst vergangenen Zeit.
Über den Anlass der Party wurde viel spekuliert: Der oder die Gastgeber seien um die fünfundzwanzig Jahre alt. Zu feiern gebe es um die siebenundzwanzig Millionen Mark an Venture-Capital, die irgendjemand – gestern?, vorgestern?, letzten Monat? – in ihr Start-up geblasen hatte. Das Start-up selbst sei irgendetwas Serviceorientiertes im Netz, möglicherweise ein Portal.
Mein neuer Freund bestellte uns noch eine Flasche, zündete sich eine Zigarette an und schaute sich dabei um – den Kopf leicht eingezogen, seine Schneidezähne gebleckt, den Kragen eins weiter aufgeknöpft — und sagte: „Jetzt brauche ich noch etwas Liebe“.
Die Musik wurde lauter, mein neuer Freund verschwand auf der Tanzfläche zwischen den Körpern und jemand neben mir sagte laut schniefend: „Metall!“.
Eine Zeitschleife zog sich fester um mich und begann schon damit, sich zu schließen. Und dann hatte ich es plötzlich: Ja! Das war es doch: Hier sah es so aus wie in New York, Ende der achtziger Jahre; dem New York von Bret Easton Ellis und Patrik Bateman, seinem Helden aus „American Psycho“. Das gibt’s doch nicht! Die Achtziger sind endlich da – Willkommen, ihr Lieben, was habt ihr euch Zeit gelassen!
1986, ’87 und auch noch 1988 saßen viele zu Hause auf ihrem Bett und sagten sich jeden Monat: „Scheiße, was ich hier gerade alles verpasse!“
1986, ’87 und auch noch 1988 war „Tempo“ die wichtigste Zeitschrift Deutschlands. Damals standen in „Tempo“ jeden Monat die unfassbarsten Geschichten zu den unglaublichsten Fotos.
Damals gab „Tempo“ der deutschen Jugend ihr Selbstbewusstsein zurück.
Denn „Tempo“ sagte: „Schaut her, ihr seid doch gar nicht so unhip!“
Aber „Tempo“ sagte auch: „Ihr könntet noch viel hipper sein!“
Weil sich Tempos Erfinder, der Österreicher Markus Peichl, vor allem von den Achtundsechzigern distanzieren wollte, brauchte er für die Welt von „Tempo“ einen archetypischen Bewohner, der durch seine bloße Anwesenheit vor Ort die Langhaarigen, Gitarrenmusikhörenden und Diskutierfreudigen von gestern in die Flucht schlagen würde.
„Tempo“ pickte sich dafür den Yuppie heraus. Eine gute, eine sehr gute Wahl. Der Yuppie war zwar im Grunde nichts weiter als ein Bankangestellter, aber dazu: jung, reich (wie man hört), sexy (das kriegen wir schon hin) und eben durch und durch Kapitalist. Aber was heißt schon Kapitalist? Der Yuppie ist der Super-, der Turbokapitalist – schlimmste Fratze des Geldes unter allen Sonnen!
„Aber schaut dieser Yuppie denn wenigstens gut aus?“
„Glaub’ schon.“
„Okay, dann machen wir’s!“
Und der Zeitgeist fuhr ein in die mythische Begriffshülle des Yuppie, einer Abkürzung für: Young Urban Professional People. Als ob das allein etwas Neues sei: jung zu sein, in einer Stadt zu wohnen und einen Beruf auszuüben.
Aber der Yuppie wohnte auch nicht in Bonn oder München. Hier und da hatte der eine oder andere Redakteur schon gehört von den Yuppies in Manhattan, hatte schon Fotos betastet, auf denen glatte Gesichter mit Pferdeschwanz, Walkman, Haifischkragen und Rucksack irgendwo herumstanden oder mit aktentaschengroßen Funktelefonen im Straßencafé saßen. Dass die importiertes Mineralwasser tranken und mit gefrorenem Orangensaft oder Rinderhälften ihr Geld machten, in teuer möblierten Fabriketagen wohnten, zur Musik von „Adeva“ ihre roten Hosenträger schnalzen ließen und eine rotweiß gepunktete Krawatte fortan „Power Tie“ hieß – das wurde zum Gemeinwissen, zum erklärenden Teil unter dem Lexikoneintrag „Yuppie, der“.
Auch von Kokain war dabei die Rede. Und als Kokain nicht mehr sexy genug war, erfand „Tempo“ einfach und selbst neue Drogen. Zum Beispiel den „Beißer“: Eine saugefährliche, tausendmal aufputschendere Abart des Kokains, an dem sich – selbstverständlich – Yuppies berauschten, um noch länger, noch härter arbeiten und verdienen zu können.
Geld war sexy, Arbeit war sexy, Workaholic wurde zur schönsten Sucht von allen.
Was aber fehlte, waren die Yuppies in Deutschland. Immer wieder mussten sich deshalb die Broker der Privatbank Hornblower & Fisher von Stylisten die Haare zurückkämmen und sich Ray-Ban-Brillen auf die Nasen stecken lassen für eine Fotoproduktion. Nach deren Erscheinen fanden sich dann viele Hamburger Redakteure und Düsseldorfer Werber in ihrem Bild der achtziger Jahre bestätigt. Und viele neue verlangten um Einlass; wollten auch noch mit dazu, mitten auf das Gruppenbild: „Deutschland, die Achtziger: Yuppies!“ Das mit dem Ausrufezeichen war wichtig. Das Ausrufezeichen stand in den Achtzigern hinter jedem Wort. Jedes Wort, jede Marke eine Behauptung, ein Statement, eine Wahrheit für sich.
1989 musste Markus Peichl die Chefredaktion des von ihm gegründeten „Tempo“ verlassen, weil seinem Verleger Thomas Ganske die Führung des Heftes zu unrentabel zu werden drohte und „Tempo“ sagte: „Jetzt kommt das Sinnjahrzehnt“.
Anfang der neunziger Jahre gab es in jedem „Tatort“, in jeder Vorabendserie, jedem Musikvideo einen Yuppie mit zurückgekämmtem Haar, mit roten Hosenträgern und Platin-Kreditkarte in seinem Loft.
1991 erschien der Roman „American Psycho“ von Bret Easton Ellis in deutscher Übersetzung bei Kiepenheuer & Witsch. Ein Kapitel daraus erschien zwei Jahre zuvor in einer amerikanischen Anthologie unter dem Titel „The End of the Nineteeneighties“.
1991 waren die achtziger Jahre endlich vorbei. Die Yuppies verschwanden samt Hosenträgern aus den Zeitschriften und machten Platz für die Raver in Trainingsanzügen.
Und heute, nach einem knappen Jahrzehnt Sinnterror aus Style, Haltung und daraus strategisch erwachsener Ironie; nach einem knappen Jahrzehnt, in dessen Verlauf sich immerhin alle bürotechnischen Gerätschaften von ihrer ursprünglichen Aktentaschengröße auf ein schlankes zwanzigstel davon verjüngen konnten; nach einem knappen Jahrzehnt, an dessen Ende zwar nicht jeder von Berufs wegen sein Geld mit gefrorenem Orangensaft oder Rinderhälften machen muss, aber kann; am Anfang eines neuen Jahrzehnts, für das es noch keine Parole gibt, aber dafür wenigstens wieder eine Frage: „Where do you want to go today?“ – heute also sind wir wirklich beim Wesentlichen angelangt. Dem Einzigen, was zählt: Geld! Das Sinnjahrzehnt ist endlich angebrochen.
Heute stehe ich morgens im Zeitschriftenladen und vor mir lässt sich ein Mittdreißiger fünfzehn Zeitschriften zum Thema Geld und Börse einpacken.
Heute sitze ich eingekeilt im Frühstückscafé und unterhalte mich mit meinem Gegenüber, aber weiß nie, wann er mir zuhört und wann seinen Angestellten in Los Angeles, die ihn über die Freisprecheinrichtungen in seinen beiden Ohren jederzeit erreichen können – sie kündigen sich für mich unhörbar an, dank Vibrationsalarm.
Heute höre ich öfter einmal Stellenangebote wie: „Hast du mir einen, der rechnen kann? Der muss nichts können, der soll nur dasitzen, rechnen und keine Fragen stellen.“
Oder anerkennende Bemerkungen über einen knapp Zwanzigjährigen in weiten Hosen: „Der ist ein Big Swinging Dick – erst zweiundzwanzig und hat jetzt diesen Zwei-Milliarden-Fonds aufgelegt.“
„Knackig!“, sagt da der andere und lächelt nicht, sondern lässt sein Kartenetui der englischen Privatbank Cazanove & Co klappern, deren Mindestdepots bekannt und deren Kartenetuis dazu aus geprägtem Wildleder gearbeitet sind. Jede Putzfrau hat eine Kreditkarte. Nur Bares ist Wahres. Und Knackig ist die Rede sowieso, die ganze Zeit über: Ein so genannter Businessplan kann zwar sexy sein, aber möglicherweise fehlen ihm noch die Titten. Oder überhaupt der Sex, kommt ganz auf die Idee an. Und ohne Titten, ohne Sex, beißt keiner an, spritzt keiner ein, haut keiner drauf.
„Was hast du noch auf dem Amboss?“, hörte ich neulich in Berlin einen Macher den anderen fragen. Und mein Gegenüber empfängt über die linke Freisprecheinrichtung gerade die Absage einer Frauenstimme, mit der er in einer halben Stunde verabredet war.
„Macht nichts“, sagt er und lässt dabei seinen beigen Hosenträger schnalzen „Wird die Kuh eben nicht gefickt.“
„Hast du nicht eben noch erzählt, du seist verheiratet?“, frage ich.
„Bist du schwul?“, fragt er mich und lacht.
Und ich denke an den Mann in der Consors-Werbung, wie er seinen Nadelstreifenanzug selbst bügelt, weil er seine Aktien auch selbst handelt bei Consors.de; und wie er den Sushi-Koch im Restaurant wie einen Fußabtreter behandelt, weil der Server von Consors.de auch alles macht, was er will. Und an den blonden Typen auf dem Markusplatz in Venedig, der seine Cyberbrille anschreit, bis die Tauben fliegen, damit der Server an seiner Brille die Aktien verkauft und kauft, wie er es will, und der gleich danach seine Freundin belügt, weil seine Aktienspiele sie nichts angehen.
Und ich frage mich, wo die achtziger Jahre bloß so lange gesteckt haben.
Joachim Bessing
„Was ist der Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank?“Bertolt Brecht
„We don’t need a revolution in the summertime.“Cosmic Rough Riders
O. Einleitung
Alle ökonomischen Überlegungen und Tatsachen, die in der folgenden Geschichte gesagt und genannt werden, sind zutreffend und wahr. Das wirft ein bezeichnendes Bild auf unsere Zeit.
Die Protagonisten hingegen sind weitgehend fiktiv. Ähnlichkeiten zu lebenden Personen sind jedoch unvermeidbar und daher auch nicht völlig unbeabsichtigt. Auch das wirft natürlich ein bezeichnendes Bild auf unsere Zeit.
Und die Geschichte selbst? Es gibt sicherlich einige Dinge, die einer Verwirklichung in der Realität im Wege stehen könnten. Doch das ändert leider nichts. Das Leben der von Schulenburgs, Grünspans und Greenspans eröffnet uns die Welt, wie sie tatsächlich funktioniert. Ob wir es glauben möchten oder nicht.
Doch wer versteht davon heute überhaupt noch etwas? Bei politischen und gesellschaftlichen Fragen konnte ja noch jeder irgendwie mitreden. Seit die Herrschaft der Politik jedoch durch die Herrschaft der Finanzmärkte abgelöst ist, sind es nur noch ganz wenige Spezialisten. Alle anderen erfreuen sich hingegen nur noch umso intensiver am Feuilleton. Möge deshalb wenigstens Gott sie schützen.
Bernd Niquet
Berlin, im April 2001
1. Das Klack-klack in der Wüste
„Das haben wir nun davon“, sagte Alexander von Schulenburg zu Bernhard Graf von Mandelwindel. Und er hatte Recht damit. Doch was um Gottes willen war eigentlich passiert?
Es kam so: Alexander von Schulenburg stand unmittelbar vor der Tresortür. Sie war nur sehr schwer zu öffnen. Mit seinem ganzen Gewicht musste er sich dagegen lehnen. Und erst dann, ganz langsam, bekam er sie ein Stück weit auf. Es quietschte laut, doch nun stand sie zumindest einen Spalt breit offen. Letztlich jedoch war auch diese Anstrengung mit Sicherheit ihre Mühe wert. Denn gleich wäre er endlich am Ziel angekommen, das wusste er. Gleich würde er zum ersten Mal das ganze Geld sehen. Und dann wäre der Plan endlich aufgegangen.
Es stimmte also tatsächlich, was die Medien immer verbreiten, denn es lohnt sich wirklich, sich selbständig zu machen. Auch wenn das im Fernsehen und in den Zeitungen sicherlich durchaus etwas anders gemeint war. Doch egal: Jetzt stand Alexander von Schulenburg an der Spitze – und damit genau dort, wo alle anderen eigentlich immer hin wollten. Jetzt würde man über ihn berichten, jetzt wäre er ein Star. Schließlich hatte er es als Einziger geschafft, diese seine gigantische Idee in die Tat umzusetzen.
Aber was war das? Plötzlich hörte er ein klapperndes Geräusch. Es war wie ein Mahlen oder ein Räuspern. Und dann flutschte auch noch ein kleines Stückchen Fell vorbei. Alexander von Schulenburg war irritiert. Was machte denn so ein kleines Stück Fell hier unten im Tresor? Hier sollte doch eigentlich gar kein Fell etwas verloren haben. Nein, hier sollte doch vielmehr das Geld sein.
Mit letzter Kraft öffnete er die Tür noch ein Stück weiter, so dass er nun den ganzen Tresorraum einsehen konnte. Doch plötzlich erschrak er heftig. Auf einmal waren hunderte von Augenpaaren auf ihn gerichtet. Und alle möglichen Farben waren dabei – rote, braune, grüne und blaue. Alexander von Schulenburg lief es kalt über den Rücken, ihm schwindelte, und er fühlte den Schock in sich. Doch sofort rappelte er sich wieder auf, schlüpfte zurück in die Maske seines faustischen Geistes und stellte sich selbst die Wissensfrage: Waren das nun Rote Neuseeländer, Deilenaar und Kleine Silber? Oder doch eher Hermeline, Farbenzwerge, Fuchszwerge gar?
Auf jeden Fall jedoch waren es Kaninchen. Und alle machten sie Männchen. Was für ein Bild. Es hätte direkt Freude erzeugen können, wenn, ja wenn es dabei nicht eigentlich um das Geld gegangen wäre. Aber da standen sie nun, aufrecht wie die Fellsoldaten. Was allerdings erst in zweiter Linie interessant war. Primär ging es jetzt nämlich vielmehr um etwas ganz anderes: Denn die kleinen Nager hatten die ganzen Geldscheine aufgefressen. Und zwar alle, ratzekahl verputzt.
Das warf natürlich sofort ein neues Problem auf: Warum fraßen Kaninchen eigentlich Geldscheine? Doch ehe Alexander von Schulenburg dieser sehr interessanten und noch wichtigeren Frage weiter nachspüren konnte, gab es plötzlich einen heftigen Knall. Und Alexander von Schulenburg erwachte neben seinem Bett auf dem Fußboden des Hotels zum Zauberberg in Schwarzenstein.
Das Hotel zum Zauberberg ist ein wunderschönes Hotel. Erbaut in der Belle Époque, mit großzügigen Fluren und Zimmern ausgestattet, thronte es hoch über der kleinen Gemeinde Schwarzenstein zu Füßen majestätischer und schneebedeckter Berge. Das Hotel zum Zauberberg bietet jeden Luxus. So hat man beispielsweise die Fußböden sämtlich mit Fußbodenheizung und einer weichen Veloursauflage versehen, so dass man durchaus auch im tiefsten Winter barfuß durch die Zimmer gehen kann. Die Sturzgeschwindigkeit von der Bettkante wurde dadurch jedoch anscheinend nur marginal abgefedert.
Vielleicht verspürte Alexander von Schulenburg deshalb auch augenblicklich einen derart heftigen Kopfschmerz. Er betastete seinen Körper. Hatte er etwa auch noch eingepullert, wie es seinem Freund Bernhard Graf von Mandelwindel neulich bei ähnlicher Gelegenheit einmal passiert war? Nein, glücklicherweise nicht. Es gab eben doch noch Unterschiede, auf die man setzen konnte. Er rappelte sich auf und klopfte an die Durchgangstür zum Nebenzimmer. „Ja“, antwortete Bernhard von Mandelwindel auf die Frage, wie es denn wäre, wenn man sich in fünf Minuten unten beim Frühstück treffen würde. Und schlüpfte schnell in seinen eleganten Morgenmantel, den er noch am Vorabend vom Aufbügeln aus der Hotelwäscherei zurückbekommen hatte.
Draußen begann bereits seit einiger Zeit ein Tag von allererster Qualität. Keine Wolke zeigte sich am Himmel und die Skilifte ratterten bereits in aller Einsamkeit vor sich hin. Alexander von Schulenburg hatte am Frühstückstisch Platz genommen und sinnierte über die Ereignisse der Nacht: „Es waren wieder die Kaninchen“, sagte er, als Bernhard Graf von Mandelwindel sich ebenfalls in den Sessel fallen gelassen hatte. „Es sind immer die Kaninchen, Bernhard. Immer die Kaninchen, Bernhard. Ich sage es dir, Bernhard, die Kaninchen werde ich nicht mehr los. Und vielleicht gilt das sogar für uns alle, Bernhard.“
Bernhard von Mandelwindel kannte diese Reden seines Freundes bereits und nickte deswegen auch nur geruhsam mit dem Kopf, nahm eine Semmel in die Hand und widmete sich fortan in erster Linie dem Frühstück. Mit dieser Geste traf der junge Graf von Mandelwindel natürlich genau den Punkt. Denn Alexander von Schulenburg hatte Recht. Und beide wussten es, weshalb die Worte eigentlich überflüssig waren.
Die Familie der von Schulenburgs sowie die der Grafen von Mandelwindel waren beide sehr alte Adelsgeschlechter, deren Stammbäume sich jeweils bis zum Hofe von Karl dem V. zurückverfolgen ließen. Dies war insofern nicht ohne Brisanz, als sich Karl der V. bei seiner Wahl zum König durch die deutschen Kurfürsten im Jahre 1519 mit einem Darlehen in Höhe von 540.000 Rheinischen Goldgulden von den Fuggern unterstützen ließ, die hierfür ihrerseits als Sicherheiten Bergwerke verpfändet bekamen. Bergwerke, die ihnen einerseits stetige Einnahmen gewährten, auf der anderen Seite jedoch auch einen Einfluss auf den neuen König sicherten. Und auch wenn Geschichte sich sicherlich eher selten wiederholte, so reimte sie sich doch in vielen Fällen.
Alexander von Schulenburg und Bernhard von Mandelwindel waren also bereits in jungem Alter in gewisser Weise Männer von Welt. Ganz so, wie man sich so etwas gemeinhin vorstellt. Doch wie stellt man sich so etwas eigentlich vor? Auf jeden Fall war man weit gereist. Denn so ein Studium lastete selbstverständlich nicht aus. Weshalb es sich anbot, die Semesterferien – und vielleicht auch noch ein bisschen länger – an dem einen oder anderen der exotischsten Orte dieser Welt zu verweilen. So waren sie denn auch, wenn sie nicht gerade in Schwarzenstein logierten, eher auf irgendwelchen fernen und exklusiven Inseln anzutreffen, die am besten nur mit dem Boot oder dem Wasserflugzeug zu erreichen waren, als irgendwo sonst.
Dennoch hatten sie natürlich Ehrgeiz – zumindest teilweise. Und dann war da auch noch das Geld. Wenn Alexander von Schulenburg und Bernhard von Mandelwindel nur eines auf ihren vielen Reisen gelernt hatten, dann war das etwas über das Geld. Konkret: Dass man einerseits davon niemals genug haben konnte. Aber auch, dass es andererseits gerade dieses Geld war, welches die Welt in ihrem Innersten zusammenhielt. Wenn es denn überhaupt noch etwas gab, was die Welt in ihrem Innersten zusammenhielt. Was freilich im Umkehrschluss dann aber auch heißen musste, dass es ebenfalls das Geld sein würde, was dafür verantwortlich wäre, wenn dieses Innere dann irgendwann einmal ganz plötzlich und unvermutet auseinander fliegen würde.
Diese kleine Erkenntnis reifte in unseren zu dieser Zeit noch relativ unbekümmerten Weltenbummlern, als sie an einem Dienstag im Oktober 1998 auf der Terrasse ihres Stammhotels am Strand der kleinen Insel vor der thailändischen Küste saßen und der Kellner sich anschickte, die zweite Flasche herrlich gekühlten Rosé zu öffnen. Nur wenige Jahre war es jetzt her, dass nicht nur Thailand, sondern schlichtweg das gesamte Asien in den Strudel dieser enormen Währungskrise geraten war, deren Ausmaß alle bisherigen Vorstellungen hinter sich gelassen hatte.
Ein derartiger Taifun an den Devisenbörsen konnte natürlich nicht ohne gewisse Nachwirkungen bleiben. Und diese trugen die folgenden Namen: Wirtschaftskrise, Entlassungen, Armut. Kurzum, das Ende der zuvor gehegten Träume. Konnten die Vermögenden aus aller Welt, geblendet vom hellen Schein des Modells Asien, noch vor der Krise gar nicht genug Geld hierher transferieren, so konnten sie es nunmehr überhaupt nicht mehr abwarten, so schnell und so viel wie möglich wieder abzuziehen.
Alexander von Schulenburg und Bernhard von Mandelwindel mussten also nur über das Weinglas hinweg, über den Zaun ihres paradiesischen Refugiums schauen, um leibhaftig zu erleben, wie die Welt in Wirklichkeit funktionierte. Und das war irgendwie ganz anders, als sie es bisher gedacht hatten. Denn natürlich wurde die Erde auch in früheren Zeiten von Despoten, Goldsuchern und sonstigen zweifelhaften Persönlichkeiten regiert. Doch andererseits war ja auch stets eine ganze Menge vernünftiger Leute dabei gewesen. Die überdies nicht einmal in jedem Falle adelig gewesen sein mussten. Doch was war das schon gegen das Geschehen von heute?
Alexander von Schulenburg hatte sich anschließend sofort die Badehose angezogen, sich kopfüber in die Fluten des Pazifiks gestürzt und währenddessen doch die ganze Zeit an eine Wüste gedacht. Dabei hätte Alexander von Schulenburg und Bernhard von Mandelwindel die ganze Sache eigentlich überhaupt nicht betreffen müssen. Schließlich war beinahe über Nacht hier alles um mehr als fünfzig Prozent billiger geworden. Für sie jedenfalls.
Wenn da nur nicht diese Wüste gewesen wäre. Diese Wüste, die es doch eigentlich überhaupt nicht hätte geben dürfen. Denn hatten nicht die Verteidiger des Marktes, also die Marktfundamentalisten – wie alle anderen Fundamentalisten auch – stets nur von den großen Segnungen des Marktes gesprochen? Ja, was war denn nun aus ihren Predigten geworden? Wo war sie, die große Initialzündung, die Verheißung von Wohlstand und Freiheit über den Markt? Warum hatten sich nur alle davongemacht, bevor der Beweis überhaupt erbracht wurde. Erst die ganzen Gebete, dreimal täglich, auf dem kleinen Teppich, ausgerichtet nach Westen, ganz weit nach Westen, bis hin zur Wall Street. Und nun nur noch das große Schweigen.
Natürlich sind die asiatischen Umgangsformen andere als diejenigen, auf die gemeinhin die Manager aus dem Westen vertrauen. Und selbstverständlich besitzt Asien auch ansonsten seine Eigenheiten. Doch wie konnte das, was vorher so chancenreich gewesen sein sollte, auf einmal das genaue Gegenteil davon darstellen? Ja, wie war denn die große Hausse überhaupt erklärbar, wenn alles bereits von Anfang an in den falschen Bahnen gelaufen sein sollte?
Hier passte doch irgendetwas nicht zusammen, fand Alexander von Schulenburg. Es machte alles keinen Sinn. Und genau an diesem Punkt begann dann auch die wirkliche Geschichte mit den Kaninchen.
Der große Vorteil lag im Übrigen darin, dass man dazu nicht einmal Traumdeutung betreiben oder tiefenpsychologische Kenntnisse besitzen musste. Es passte auch so plötzlich alles zusammen. Denn ohne Zweifel glich das Schicksal Asiens in weiten Teilen demjenigen von Australien. Allerdings lagen mittlerweile 150 Jahre dazwischen. Doch auch das machte letztlich nichts.
Alles begann, als Thomas Austin im Jahre 1859 vierundzwanzig Wildkaninchen auf seinem Grundbesitz in der Nähe von Geelong in Victoria ausgesetzt hatte. In Ermangelung von natürlichen Feinden wurde aus diesen vierundzwanzig wackeren kleinen Rackern in relativ kurzer Zeit die Zahl von 500 Millionen Stück. Und heute leidet Australien unter riesigen Bodenerosionen und besteht zu zwei Dritteln aus Wüste.
Jetzt beugte sich Alexander von Schulenburg nach vorn und schlug mit der flachen Hand auf den Tisch: „Und ich frage dich, Bernhard, wo ist hier der Unterschied zum Geld? Denn welchen natürlichen Feind hat das Geld, Bernhard? Genau, die Antwort lautet: Es hat gar keinen natürlichen Feind, das Geld. Das sage ich dir, Bernhard. Geld hat keinen Feind, deswegen breitet es sich auch überall aus. So lange, bis ansonsten nur noch Wüste da ist. Und dann zieht es eben woanders hin.“
Zwei Feinde der kleinen Racker hatte Alexander von Schulenburg hierbei allerdings unterschlagen. Und das waren der Dingo und die Myxomatose-Viren. Doch der Dingo allein konnte das Problem schon deshalb nicht lösen, da man ja auch auf ihn Jagd gemacht hatte – und ein toter Dingo recht schlecht ein springlebendiges Kaninchen reißen konnte. Und auch gegen die hässlichsten Viren, von den Menschen bewusst in Umlauf gebracht, um der Kaninchenplage Herr zu werden, wurden früher oder später Resistenzen gebildet. Weder die Natur noch das Eingreifen des Menschen konnte Australien mithin vor seinem Schicksal retten.
Und genauso ging es Asien heute auch. Warum sollte es hier auch anders sein? Denn welchen Unterschied gab es eigentlich zwischen dem Willen eines Kaninchens und dem der Entscheidungsträger an den Finanzmärkten? Letztlich ist doch immer nur ein mehr oder weniger großer Haufen schwabbeliger grauer Masse, Gehirn genannt, dafür verantwortlich, was passiert und was nicht passiert.
Denn weder Mensch noch Kaninchen können die Welt so wahrnehmen, wie sie ist. Die Welt da draußen ist, wie die Welt da draußen ist. Und der entscheidende Rest sind nur Repräsentationen in eben dieser schwabbeligen grauen Masse. Im Grund genommen jedoch nicht einmal das: Alles, was existiert, sind optische und akustische Signale, auf welche unsere Zellen in der etwa drei Pfund schweren schwabbeligen grauen Masse dadurch reagieren, dass sie elektrische Impulse aussenden, das heißt Neuronen losschießen.
Aus diesem Sende- und Empfangsmechanismus der Neuronen werden schließlich feste Verbindungen, Synapsen genannt. Von derartigen Synapsen existieren etwa 1 Billiarde oder 1.000 Billionen pro drei Pfund grauer schwabbeliger Masse – also etwa 666 Millionen pro Gramm grauer schwabbeliger Masse. Das, was uns manchmal bunt und duftend, ein anderes Mal jedoch dunkel und depressiv erscheint, ist also in Wirklichkeit nichts anderes als ein leises Klack-klack. Klack-klack, der Neuronenschuss. Klackklack, ein Stimulus – und das vereinzelte Teil weiß ganz genau, wie es reagieren muss. Klack-klack, das ist die einzige Sprache, die wir wirklich verstehen. Nur Klack-klack – und schon ist die Entscheidung gefallen. Hierin sind wir alle gleich. Klack-klack, hier wird’s zum Ereignis. Nur Klack-klack – und das ist auch schon alles.
Was unterscheidet also wirklich den Chef der größten deutschen Bank von einem Kurzhaar-Rammler in seiner Kaninchenwelt? Überall immer nur Klack-klack, Zack-zack, Hopp-auf – und fertig. Immer mehr, immer weiter, immer größer und vor allem immer schneller. Zack-zack, Hopp-auf – und fertig. Immer nur Klack-klack, und schon ist die Entscheidung gefallen. Mehr nicht. Nur Klack-klack, und das ist schon alles. Und ab zur nächsten Nummer.
Natürlich gibt es aber auch Unterschiede. Der eine hat Fell und der andere nicht. Doch seit dem Eintreten der Geschlechtsreife waren sie beide schließlich stets unruhiger geworden. Und so hatte der eine dann in Ermangelung geeigneter Objekte angefangen, selbst Gegenstände zu decken, seine Urinmarken zu setzen, und war darüber hinaus an seinem Sexualtrieb beinahe umgekommen. Aber der andere doch auch! Nur dass er seine Kräfte auf ein anderes Terrain umleiten konnte. Weshalb seine Gesellschaft heute eine der größten Banken der Welt ist, der Draht am Käfig des Kaninchenstalls hingegen durchgebissen zurückbleibt.
Denn es geht doch schlichtweg immer nur um das eine: Klack-klack, Zack-zack, Hopp-auf – und fertig. Immer mehr, immer weiter, immer größer und vor allem immer schneller. Zack-zack, Hopp-auf – und fertig. Immer nur Klack-klack, und schon ist die Entscheidung gefallen. Mehr nicht. Nur Klack-klack, und das ist schon alles. Und ab zur Nächsten.
Nun ist die Nächste dem einen die Partnerin und dem anderen die Gelegenheit. Doch genau das verwischt ja auch den Unterschied. Denn ganz egal, ob Kaninchenbraut oder Investmentchance: Es geht doch schlichtweg immer nur um das eine: Immer mehr, immer weiter, immer größer und vor allem immer schneller. Klack-klack, Zack-zack, Hopp-auf – und fertig. Und ab zur Nächsten. Ganz so, als ob der Wüstensand noch nicht in allen Ritzen spürbar wäre.
So wie jeder andere Traum, so hatte also auch dieser Traum seine Bedeutung. Doch erneut versagen wir uns hier der Traumdeutung. Denn wichtig war eigentlich nur, dass Alexander von Schulenburg anderenfalls vielleicht gar nicht mehr auf diese alte Idee zurückgekommen wäre, die er schon so lange im Hinterkopf trug. Und von der er auch schon die ersten Ausarbeitungen gemacht hatte, dann jedoch immer wieder davon abgekommen war.
2. Die Herren des Geldes — und das Geld aus dem Nichts
Mittlerweile schien die Sonne bis auf den Frühstückstisch. „Vielleicht gibt es wirklich nur einen einzigen Feind des Geldes“, sinnierte Alexander von Schulenburg nun, als die Bedienung zwei neue Kännchen Kaffee und frische Semmeln brachte. „Ich meine, wenn wir alles Metaphorische einmal weglassen.“ Er blinzelte mit seinen Augen in die Sonne und sagte zu seinem Freund: „Was ist der natürliche Feind des großen Geldes? Klare Frage, klare Antwort: Noch mehr Geld!“
Bernhard von Mandelwindel schaute ihn etwas irritiert an, denn das mit dem Metaphorischen verstand er gar nicht so recht. Es war natürlich auch schwierig, weil es einerseits zu plakativ und andererseits Kaninchen viel zu putzig waren, um ernsthaft die Aufmerksamkeit von Männern auf sich zu ziehen. Was natürlich keinesfalls bedeuten soll, dass Alexander von Schulenburg in Wirklichkeit kein richtiger Mann war. Nein, nein, hier funktionierte tatsächlich alles prächtig, viel besser sogar — wie wir ja bereits im Einzelfall gesehen haben — als dies manchmal bei Bernhard von Mandelwindel der Fall war.
Es war vielmehr so, dass Alexander von Schulenburg schon immer zwei Seelen in seiner Brust gespürt hatte. Und egal, worum es ging, die eine war immer dafür und die andere stets dagegen. Die eine hegte Sympathie und die andere wollte zerstören. Vielleicht war Alexander von Schulenburg auch gerade deswegen von seiner Idee so fasziniert, weil sie es schaffte, diese beiden komplementären Teile in einem fast harmonischen Miteinander in sich zu vereinigen.