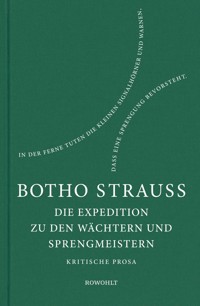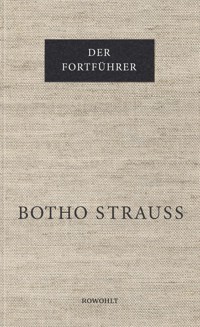Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Tacheles!
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Diese Anthologie ist mehr als eine bloße Kompilation: In seinem Nachwort erinnert sich Heinz Strunk an jenen Tag in der Harburger Bücherhalle, als ihn die Sprache eines Buches traf wie ein Blitz. Der Autor hieß Botho Strauß, und wenn sich Strunks eigene Texte vollkommen anders lesen, so wird doch in der hier vorliegenden, subjektiven, ganz und gar nicht repräsentativen Auswahl aus dem Werk des Verehrten das Gemeinsame erkennbar. «Es ist ein Glück für mich, einen klugen Autor zum Leser zu haben.» (Botho Strauß) «Ich kenne keinen, der ihm gleichkommt. Botho Strauß ist der Autor meines Lebens.» (Heinz Strunk)
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:1 Std. 48 min
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Botho Strauß
Der zurück in sein Haus gestopfte Jäger
Über dieses Buch
Diese Anthologie ist mehr als eine bloße Kompilation: In seinem Nachwort erinnert sich Heinz Strunk an jenen Tag in der Harburger Bücherhalle, als ihn die Sprache eines Buches traf wie ein Blitz. Der Autor hieß Botho Strauß, und wenn sich Strunks eigene Texte vollkommen anders lesen, so wird doch in der hier vorliegenden, subjektiven, ganz und gar nicht repräsentativen Auswahl aus dem Werk des Verehrten das Gemeinsame erkennbar.
«Es ist ein Glück für mich, einen klugen Autor zum Leser zu haben.» (Botho Strauß)
«Ich kenne keinen, der ihm gleichkommt. Botho Strauß ist der Autor meines Lebens.» (Heinz Strunk)
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, April 2014
Copyright © 2014 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Umschlaggestaltung Frank Ortmann
ISBN 978-3-644-52611-2
Hinweis: Im Inhaltsverzeichnis werden generell nur Texte mit Überschriften aufgeführt – einige überschriftslose Texte werden allerdings anzitiert. Aus technischen Gründen können nicht alle überschriftslosen Texte anzitiert werden.
Die in den Nachweisen vorangestellten Seitenverweise beziehen sich auf die Printausgabe dieses Titels.
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Ein Mann, durch ...
Der arme Angeber
Tag und Nacht
Der zurück in sein Haus gestopfte Jäger
Frau mit Telefon
Hunderttausend Grobiane
Mittags kommt die ...
Der Hintermann
Zu Besuch
Die Zahlen
Der Listenschließer
Doppelrolle
Bernd und Bäumin
Dem Gott der Nichtigkeiten
Skizze zu einem Schicksal
Die Händlerin auf der hohen Kante
Späte Schüchternheit
Die beiden Talentsucher
Nachwort
Nachweise
Zitierte Werke von Botho Strauß
Ein Mann, durch Schläge und Beraubung so erniedrigt, daß er sich kaum noch aufrecht hält und immer wieder auf die Erde gleiten muß, von einer Bank im Park, von einem Sessel im Schuhgeschäft oder auch mitten auf einer Fahrbahn, wo er sich, zu Boden gestreckt, mit beiden Händen vorwärtsstoßend, über die Fahrbahn schleift, die Wange mit halb geöffnetem Mund über den Kieselpfad oder den Asphalt ziehend, die ganze rechte Gesichtshälfte schon blutig geschürft. Seine Frau hält auf der Straße alle Wagen an, solange das krauchende Wesen die Fahrbahn überquert. Bis es zwischen den Leitplanken des Mittelstreifens wie eine erschöpfte Echse mit der Schnauze in den Abfall sinkt, Nahrungsreste von Dosenrändern und Joghurtbechern leckt und sich kindlich zusammenrollt im Dreck: «Da, wo ich hingehöre.» Die Frau muß ihn nun allein lassen, sie kann ihn niemals dazu bewegen, mit ihr wieder nach Hause zu kommen. Ganz still, erschüttert und doch einsichtsvoll hilft sie ihm, wartet sie dem Kriechmenschen auf und kehrt immer wieder zu ihm zurück, während er täglich ein Stück weiterkommt, sich erzlangsam seinem Ziel nähert, das hinter den Straßen, den Häusern ihm verheißen: die Blauen Berge der Großen Deponie.
Sie konnte es nie verwinden, damals nicht das letzte Wort gehabt zu haben. Nun sitzen sie noch einmal voreinander, vierzig Jahre nach ihrem unversöhnlichen Abschied. Beide mit etwas fahrigen Händen, und es sind die seinen, die sich beschwichtigend auf ihren Unterarm legen und die sie, wiederum unversöhnt, von ihrem Arm nimmt und ihm zurückgibt, still und mit trauriger Entschlossenheit, die alten Hände, die er wieder zu sich nimmt und mit gekrümmten Fingerkuppen an die Tischkante hängt. Sie sagt: «Ich habe damals vergessen, dich zu verfluchen. Ich hole es nach: Verdirb!»
Botschaft eines Kambodschaners an seine Frau, bevor er von den Roten Khmer hingerichtet wurde:
«Ich liebe dich, aber du wirst es nie erfahren.
Denn du bist ein Stern, und ich bin nur
ein Erdenwurm, der zermalmt wird.»
Denn der Staub ist dunkel und das Schicksal versagt mir den Stolz des tapferen Kämpfers, der, deiner Liebe würdig, untergeht. Als Opfer, als einer, der aus seinem Haus gefangen wurde, bin ich so verschwindend und unbedeutend, daß du mich in der Reihe der Opfer nicht einmal wiedererkennen würdest. Ich schäme mich, daß ich, dein Mann, ein solch Unbekannter und wahllos Gegriffener der feindlichen Mordmaschine bin. Mein Tod ist eine klägliche und unentschuldbare Verfehlung in der großen und grenzenlosen Geschichte unserer Liebe. Du Überlebende bist unendlich über mir; dem Nichts, dem Erdenwurm erscheinst du wie ein Stern. Der Stern wird von der Liebe des Nichts nie erfahren. Und doch ist sie ewig, denn diese Botschaft besitzt die allmächtige Kraft dessen, was ein Mann zuletzt gesagt hat.
Ein Mann, dem sich die Dinge, die er begehrlich betrachtet, unverzüglich an den Leib kopieren. Er steht vor einem Antiquitätenladen. Er ist verliebt in eine zierliche Taschenuhr. Wenig später wird sie ihm, in Form eines billigen Imitats, aus der rechten Wange operiert. Er hatte versucht, das Teil aus seiner Haut zu reißen, es hing noch am Gewebe und wuchs in die Wunde zurück.
Der zerschlissene Mensch in seinem einzigen, einst königsblauen Overall, verdreckt, mit einem Pflaster auf der dünnen Backe, trat in die U-Bahn, und irgend etwas Eben-noch-Bewußtes, Reste seiner zerfetzten Selbstvergewisserung sagten ihm, daß er falsch eingestiegen war. Sein Kopf zitterte leicht voraus dem Verstehen, zitterte wie eine Nadel an einem Detektor oder uralten Seismographen. Der Kopf, der brüchige Bienenkorb da mitten auf seinen Schultern, dies Ding zur Hinhaltung des Todes, war kaum mehr noch als ein kleines Frühwarnsystem, das das verbrauchte Individuum davon zurückhalten sollte, stets und überall das Falsche zu tun, die schlechteste Richtung zu wählen. Kurz bevor die U-Bahn anfuhr, verließ der Zerschlissene den Wagen wieder. Oh, all die Abgerissenen einer Stadt, die schnell in die Züge treten und kurz vor der Abfahrt wieder hinauslaufen!
Die freien Wege erfindet die Box, cysta cogitans, und alle führen in sie zurück.
Wir tasten im schwarzen Korb nach der Stelle, wo das bleichere Dunkel, die Wörter …
A., nur ein Parteigenosse, ein Mitläufer im Nazi-Regime, sitzt, jetzt als ein alter Mann, vorn in einem Kino und plötzlich in einer alten Wochenschau oder einem Hitler-Dokumentarfilm erkennt er sich wieder im schreienden Volk, sieht er sich, den jungen brüllenden Mann, in einer Großaufnahme. Ja, denkt er und fühlt sich anonym bis in die Fingerspitzen, ich war dabei, ich habe geschrien, ich war ein Volk – ein Schrei. Jetzt sitze ich allein unter vielen Jungen in einem dunklen Kino, lauter kritische Köpfe, die sich nur wundern können über unseren Schrei, die sogar in johlendes Gelächter darüber ausbrechen und keinerlei Ehrfurcht vor dem Bösen empfinden.
Ein ehemaliger Kursteilnehmer bei uns, ein junger Telefontechniker, Züchter von Weimaranerhunden im Nebenberuf, kam am frühen Nachmittag, etwas zu früh, von seiner Arbeit nach Hause. Er fand seine Wohnung kahl, vollkommen ausgeräumt. Seine Frau aber stand an der nackten Wand, lehnte mit dem Rücken an, und ihr gegenüber, ebenfalls mit dem Rücken an die nackte Wand gelehnt, stand ein Mann, den er nie zuvor gesehen hatte. Mit ihm lag jedoch seine Frau in den letzten, erschöpfenden Zügen eines langen Streits, eines die Affäre beendenden, wie es schien, da die Sätze, die sie jetzt noch wechselten, wie aus einer längst ausgepreßten Leidenschaftsfrucht troffen und ihr Sinn ins Abstruse ent- wich.
Er, der Fremde, sagte: Wenn wir die Möbel tiefer ins Zimmer gerückt hätten … Tiefer, ganz tief, nach hinten, noch tiefer …
Seine ihm nicht weniger fremde Frau sagte: Das Zimmer ist nicht so tief, daß man sich irgend etwas hätte vom Leib rücken können, und schon gar nicht, um es genau zu sagen, mich etwa –
Da bemerkte er an seiner Frau ein vorher nie gesehenes Rucken des Kopfes, und zwar zu dem anderen hin, dem Fremden, so wie man jemanden mit angehobenem Kinn auf- oder herausfordert: Komm Komm Komm! … Ich zeig es dir! Aber nichts kam mehr von der anderen Seite. Sie ruckte den Kopf auffordernd, ohne noch etwas zu erwarten, als ob es schon eine Marotte geworden war.
Der Mann, der heimkehren wollte, drehte dieser ihm vollkommen unbegreiflichen oder unzugänglichen Realität kurz entschlossen den Rücken, verließ die Wohnung und unternahm erst Stunden später einen zweiten Versuch nach Hause zu kommen. Tatsächlich fand er diesmal seine Wohnung komplett so eingerichtet vor, wie er sie am Morgen verlassen hatte. Auch begrüßte ihn wie üblich seine Frau, wenn auch die Zeichen der Erschöpfung nicht ganz von ihr gewichen waren. Doch ein dritter Mensch befand sich augenscheinlich nicht mehr in seinen vier Wänden. Also ließ er die Sache auf sich beruhen.
Zur Disproportion von Seele und Komfort: es ist lächerlich, mit einem Handy am Ohr gekrümmt am Bartresen zu sitzen, zu horchen, zu sprechen und eine anderswo zu einem radikalen Abschied bereite Person durch ständig wiederholte Anrufe umstimmen zu wollen, dabei aber selber ein reales Fragezeichen zu verkörpern vom gebeugten Kopf über den buckligen Rücken bis zur Kehre in den Knien und den Unterbeinen, die sich ins Gestänge des Barhockers klemmen.
Unvermietetes Zimmer. Im leeren Raum am Fenster mit der Lamellenjalousie steht Franz K. und liest in einem großen Unterhaltungsmagazin. Er liest, wie ein italienischer Jude am Betreten eines Volksbads gehindert wurde. Wie einem portugiesischen Juden von einer Taxen-Kutsche über die Zehen gefahren wurde. Wie einem deutschen Juden die Lehrerlaubnis an der Universität entzogen wurde. Jedesmal, wenn er in diesem Unterhaltungsmagazin von der Demütigung eines Juden liest, ist er so betrübt, daß er um eine Elle kleiner und etliche Pfunde leichter wird, bis er schließlich auf Däumlingsgröße und Strohhalmgewicht geschwunden ist und nicht weiter im Unterhaltungsmagazin von den immer greulicher werdenden Mißhandlungen der Juden lesen kann.
Es gelingt ihm, sich auf die Fensterbank zu schwingen und zwischen den Lamellen der Jalousie hindurchzuklettern mit keinem anderen Ziel vor Augen, als sich aus dem unvermieteten Zimmer, das sich im dreiundzwanzigsten Stockwerk eines Hochhauses befindet, in die Tiefe zu stürzen. Doch ist er vor Gram und Entsetzen so geschwächt, daß es ihm unmöglich wird, das dichtschließende, sicherheitsverriegelte Fenster zu öffnen. Da er wegen seiner senfkornkleinen Augen aber keine Buchstaben mehr lesen kann, ist es ihm auch nicht möglich, im Zuge der Geschichte bis auf Staubfasergröße hinunterzuschwinden und sich schließlich durch eine Ritze ins Freie zu schleichen. So bleibt er ein klägliches Zwischending, eine halbe Kleinigkeit, eingeklemmt zwischen Fensterrahmen und Fensterfüllung. Etwas, das sich weder vor noch zurück bewegen kann. Dabei wird die Sehnsucht, sich in die Tiefe zu stürzen, immer unbezwinglicher und immer unerfüllbarer. Er war ja der einzige Bewerber für dieses unvermietete Zimmer gewesen, das im übrigen für unvermietbar angesehen werden mußte, da es schlecht geschnitten, schlecht gelegen war. Er war der einzige Bewerber und hatte sich beim Warten auf den Makler in dieses große Unterhaltungsmagazin vertieft, das vorher derselbe Makler nach einem (seinerseits) vergeblichen Warten auf einen Kunden liegengelassen hatte. Er selber kam nun als Bewerber für das unvermietete Zimmer nicht mehr in Frage, und ein nächster, der das Fenster endlich hätte aufreißen können, stand nicht in Aussicht.
Wenige Schallpartikel genügen, um eine perfekte Klangwiederherstellung eines verschollenen Tondokuments zu ermöglichen. Eine Spur Schweiß aus dem Schweißtuch der Veronika – und der Heiland kehrt wieder? Napoleon aus einem Schnupftuch mit Spermaresten wiederhergestellt? Die wahre Apokalypse: Auferstehungstechnologie. Alle Helden kehren zurück – abwärts in unsere Tage! Wo aber gar kein Zeit-, Geschichts-, Handlungsspielraum für diese Rückkehrer bereit steht und wo sie gefangen sitzen in einem gläsernen Käfig zum Anschauen: der wirkliche Napoleon. Die Menschen verlieren jedes Interesse an ihren Mitmenschen. Sie wollen nur noch mit Außerkontemporären zu Mittag essen.
Ein Trinker-Ehepaar im Kaufhaus Quelle steht in der Schlange vor der Kasse an. Der Mann hält sich grummelnd und zu Boden blickend an der Seite seiner Frau. Diese kneift mehrmals ohne äußere Veranlassung das rechte Auge kräftig zu, als teile sie mit einem Unsichtbaren ein frivoles Geheimnis. Die gestörten Nerven spielen ein kurzes, immer wiederkehrendes Programm. In geringen Abständen wirft sie, von einem automatischen Entsetzen angetrieben, knapp den Kopf herum und lächelt dann ebenso freundlich wie angstverzerrt in eine Richtung, wo gar niemand ist und woher auch kein Anruf an sie erging. Ein flatterhaftes Drama läuft über ihr gerötetes, gedunsenes, schuppiges Gesicht, ausgelöst allein durch das bedrängte Schlangestehen, die enge Stellung unter fremden Menschen. Das Lächeln, die Scherben eines Lächelns scheinen nach allen Seiten hin ein Zuviel der Bedrängung freundlich abzuwehren. Der Mund mit strahlender Grimasse entblößt eine von links nach rechts immer niedriger und löchriger werdende Zahnstummelreihe. Sie hat einen sehr großen zitronengelben Wecker eingekauft. Wozu sich wecken? Zum ersten Schluck? Ich stand vor dem Hauptausgang neben der Glastür und wartete mit einem unhandlichen Gartenmöbel auf einen Freund, der die übrigen Stücke brachte. Das Trinker-Paar kam eben heraus, als wir unsere Fracht zum Nachhausetragen uns aufluden. Da machte die Frau zu ihrem Mann die Bemerkung, daß es freilich besonders geschickt von uns sei, so dicht beim Ausgang herumzupacken. Obschon wir ihnen nicht unmittelbar im Weg waren, schien es ihr ausgesprochen wohlzutun, sich selber in der Ordnung und uns als Störung zu empfinden und dies auch festzustellen. Der Freund knurrte sie rüde an: «Halt’s Maul, alte Kuh.» Als ich dies hörte, war mir, als trete jemand einem Unfallopfer obendrein in den Bauch. Denn ich hatte mir ihren Schicksalsstreifen ja eine Weile angesehen und konnte nichts als Anteilnahme für sie empfinden. Als wir die beiden auf der Straße überholten, hielt die Frau ihren Mann an und sagte leise, als ginge da jemand Berühmtes vorbei: «Sagt der einfach alte Kuh zu mir!» «Wer?» fragte der Mann. «Na der da», sagte die Frau und nickte zu uns hin. Nun hatte sie mit soviel vorbeugendem Lächeln und geisterhaftem Verbindlichtun alles um sich herum zu bannen versucht, was sie verletzen könnte, und dann hatte es sie am Ende doch noch schwer getroffen. Wirklich beschwert, nicht aufgebracht blieb sie stehen und wiederholte sich den Schimpf, und er kam ihr noch unerhörter vor.
Seine Liebe war ein Akt diabolischer Nächstenliebe.
Er ließ eine Frau, die ihm nichts bedeutete, einmal heftig aufleben. Er schenkte ihr ein berauschendes Selbstgefühl – übergab es und verschwand. Das war sein Laster: sich an die Bedeutungslosen heranzumachen und ihnen zu gewähren, sich völlig grundlos an sich selbst zu berauschen. Dieser Grundlosigkeit finsterer Geselle war er nun.
«Bilder der Freude», sagte sie, «es sind Bilder der Freude.» Und noch einmal kam dieser leise Ton von damals, aus den frischen Jahren, da die Gemälde entstanden waren, über ihre geschrumpften Lippen.
Besuche bei Nadja, Berlin Ende der sechziger Jahre, Muskauer Straße, trübes Loft im Kreuzberger Hinterhaus, das Wohnen liederlich, der Mut frech, die Kunst sorglos. Zerbröckelnde Häuserfassaden, Milieu der Alten und der Türken der ersten Generation, bleibende Kriegsschäden, dachte man, aber zwanzig Jahre später hatten Reichtum und Restauration hier alle Spuren von Milieu getilgt.
Torsten, der naive Künstler, malte wie besessen, füllte Leinwand um Leinwand mit den monumentalen Vergrößerungen der Schamlippen seiner Gefährtin, nichts anderes als diese unmäßigen Falten und Lappungen, die junge Vagina jener Frau, die inzwischen ein wenig grau geworden ist und die Strickjacke um die mageren Schultern enger zieht. Als er starb (schon mit zweiunddreißig nach einer durchzechten Nacht in Albufeira, schlief einfach weiter mit stehendem Herzen), hinterließ er ihr diese Zeugnisse einer großen Sinnenfreude, sechzig Acryl-Porträts ihres Geschlechts, ein Erbe, das sie damals so wenig genierte wie heute, wenn sie mit fremden Männern vor die Leinwände tritt und ihnen die hyperrealen Enthüllungen ihrer Jugend zeigt. Doch Händler und Galeristen haben bisher nur kurz und kopfschüttelnd vor dem Werk ihres Geliebten gestanden. Es blieb bis heute unentdeckt und trat aus dem Zwang, dem Glück, das den Maler bei seiner Arbeit erfüllte, niemals heraus. Inzwischen betrachtet sie die Malerei gern zusammen mit ihrem erwachsenen Sohn, der gerade seinen Ersatzdienst abgeleistet hat, und erläutert ihm Bildaufbau und Farbenspiel, die unbeirrte, kraftvolle Linie des frühverstorbenen Vaters, dessen Gemälde aus der Fabriketage den Weg in die Welt noch vor sich haben. Für sie sind es Kunstwerke und deshalb jeden Tag aufs neue, über alle Tage hinaus: Bilder der Freude.
Was uns bewegt, besitzt eine Bewegungsgestalt. Zur Feinbestimmung einer Person gehörten Angaben über den Spin, den Drehimpuls ihrer Wesensteilchen. Er entscheidet, ob ihr «Schwung» sich auf uns überträgt oder nicht. Manchmal ist man empfänglich nur für den subpersonalen Spin eines Menschen und vermag ihn weder mit dem Auge noch mit sonstigen Sinnen von anderen Menschen zu unterscheiden.
Es begann Mitte August 1998, als einige Jugendliche in Rimini sich zusammenrotteten und um Mitternacht durch die Straßen rannten, wobei sie in rhythmischen Stößen und im Chor «Valerio Valerio» riefen. Die Rufe, die sich nun Nacht für Nacht wiederholten, wurden jedesmal stärker und ekstatischer gerufen und blieben allen, auch den Rufenden selber, rätselhaft. Einwohner beschwerten sich, Polizisten vernahmen die Störenfriede, niemand wußte mehr, weshalb er so kräftig «Valerio Valerio» gerufen hatte. Bis sich eines Tages aus Rom ein Valerio O. meldete und folgende Erklärung gab. Er habe kürzlich bei einem Openairkonzert in Rimini versucht, ein großes Transparent, wie man ihn geheißen, ganz allein aufzuhängen. Dabei sei er in große Schwierigkeiten gekommen, es sei ihm wieder und wieder nicht recht gelungen, das Banner gerade und ordentlich zu befestigen. Unterdessen habe sich unten in der Zuschauerarena schon lange vor Beginn des Konzerts eine große Schar von Jugendlichen versammelt und ihn anfeuernd im Chor ständig «Valerio Valerio» gerufen. Woher sie seinen Namen wußten, sei ihm unbekannt geblieben. Doch habe seine Ungeschicklichkeit – oder sein verzweifelter Kampf um Geschicklichkeit beim Anbringen des Transparents sie offenbar sehr beeindruckt. Er dort in der Höhe sei ihnen von einer Minute zur nächsten zu einem Symbol für eine uns alle bedrohende, unheimliche Ungeschicklichkeit geworden. So kam es, daß sie fortan nicht ablassen konnten, in geradezu beschwörende «Valerio»-Rufe auszubrechen. Wie es schien, hätten sie diese Rufe oder Anrufungen beibehalten, ihr Unbehagen sei bis jetzt nicht wieder von ihnen gewichen. Wenn sie nun nachts durch die Gassen stürmten, so gedächten sie vielleicht nicht nur seines, des namentlichen Valerios, Ungeschicks, sondern ihre Chöre richteten sich zugleich an den Geist der Linkischkeit, der das Entgleiten oder Versagen zentraler menschlicher Fertigkeiten sofort und ohne weiteres herbeiführen könnte.
«Na, Frau Lehmann, wie geht’s uns denn heute?» Die Frau – das Tuch, das Leichentuch reicht ihr schon bis ans Kinn, ihr Gesicht, ihr eingesunkenes, ist nicht mehr als ein schrumpeliger gelber Fleck auf dem weißen Kissen, schwach sagt sie bloß: «Och …», als habe sie weiter nichts zu beklagen. […] In einem anderen Bett auf dem Gang liegt jemand, dem das Leinen schon über das Gesicht geschlagen ist. Doch ist er nicht tot. Aber da er Beine und Hände nicht rühren kann, hat er in das Tuch gebissen, um es sich vom Gesicht zu ziehen. Es sieht aus wie eine Leiche mit weiterfressendem Mund, die ihre Zudecke verschlingt, dabei die Füße und Biß um Biß langsam den ganzen nackten Körper enthüllt …
Als er am Abend in den öffentlichen Gärten spazierte, begegnete ihm eine kleine Horde behinderter und verkrüppelter Jugendlicher. Die Unordnung ihrer Schritte, das unkontrollierte Ausstoßen von Schreien und sinnfernen, halb tierischen Lauten erschreckte ihn in seiner Lage auf ganz unangemessene Weise. Einer hatte ein zum Fürchten entformtes, kropfig wasserköpfiges Gesicht, und das rechte Auge saß ihm irgendwo dort, schräg abgerutscht, wo sonst der Mund ist, und der Mund saß dort, wo eigentlich der Kragenknopf, der Kehlkopf ist. Um dem gräßlichen Schwarm auszuweichen, lehnte er sich abgewandt an einen Baum. Einer sprach unentwegt mit einer hilflos krakeelenden Stimme auf die Betreuerin ein. Als sie dann in unmittelbarer Nähe waren, mußte er sich doch umdrehen und hinschauen. Der Junge mit dem gänzlich verballhornten Schädel trottete ein wenig auf ihn zu, und als wollte er seinen Blick, dessen Entsetzen er zumindest spürte, beschwichtigen und zugleich tadeln, legte er den Zeigefinger auf seine herunterhängende Stirn. Sieh mein Wesen, so schien er ihm zu bedeuten, ein Monster betrachtet jemand wie du doch nicht als Monster. Durch diese Annäherung sehr mild geworden, schloß er nun die verhärmte, doch geduldige junge Betreuerin mit ihrer dicken Brille und dem kurzen Jeansrock verehrungsvoll in sein Herz. Als er der Gruppe nachblickte, sah er, wie sich einige umarmten, die Arme einander ungelenk um die Schultern schlangen, als hätten sie glücklich ihn überstanden, hinter sich gebracht. Warum nur, fragte er sich, diese übertriebene Erregung gegenüber dem Abnormen, den Kranken, die uns in die Pflicht der Liebe nehmen? Ich spüre sehr genau diese scheue, gemeine, verräterische Liebe bei mir, diese brutale Rührung zu den Hilflosen hin. Eine Mischung von unqualifizierter Identifikation und einem wunderbar warm abfließenden Schuldgefühl, wenn der kreatürliche Affekt der Abwehr wieder einmal veredelt und umgepolt werden konnte. Der Verwünschungstrieb muß sich binnen kurzer Augenblicke, da er keinen Ausweg findet, derart steigern, daß er in die unverschämteste Zuwendung umschlägt.
In einer Nacht, in der ein Mann umständehalber nicht bei seiner Frau liegt, sondern im fremden Bett bei einer Unbekannten, findet er ohnehin keinen ruhigen Schlaf. Er wälzt den Kopf im Kissen und träumt von tausend Unbekannten, die alle auch noch in sein Leben treten wollen. Er jagt durch einen Sphärenwirbel nie gesehener Gesichter. Und neben ihm die nackte Schulter und der stete Atem einer Zugewandten, die alles ruhigen Gewissens bei sich bewahrt.
Der arme Angeber
Er ist ein Aufschneider und Phantast. Ein Großsprecher und ein Spinner. Ein Windmacher. Mein Lieblingstyp, heimlicher Genosse: der arme Angeber. Seine Ahnen sind der Hochstapler, der Heiratsschwindler, der Scharlatan, der Prahlhans und der Mythomane. Er ist der bunte Unglückliche, der die Frauen anzieht. Unzuverlässig und ruhlos. Einsamer Spieler, der über niemanden gewinnt, mit niemandem im Streit. Hoch auffliegend und abgrundtief stürzend, und noch von ganz unten hört man seine Rodomontaden der Verzweiflung und der Selbstanklage.
Beim Frisör sitzt er und muß stillhalten im Sessel. Dem Mädchen, das ihm die Haare schneidet, läuft’s aus Augen und Nase. «Schon der vierte Schnupfen in zwei Monaten!» Er macht sie leis verrückt mit Komplimenten und tiefen Blicken in ihr Spiegelbild. Sie lächelt, sie kichert, sie hustet und lacht. Er lobt die Gehilfin vor ihrem Chef mit ausgesuchten Worten. «Was für ein Spinner!» sagt die Kleine, als er fort ist, doch ihre vertrieften Augen strahlen. «Redet der einen Stuß!»
«Aber charmant war er», sagt anerkennend und etwas altmodisch der Chef.
«Er hat mich heut abend zum Essen eingeladen.»
«Und? Gehst du hin?»
«Mal sehen. Möchte mal wissen, ob das nicht bloß leere Versprechungen waren.»
Natürlich erscheint er nicht. Jede Durchführung langweilt ihn, nur die Eröffnung zählt. In ihr erschöpft sich sein Interesse und sein Überschwang. Stattdessen finden wir ihn abends in einer U-Bahn, weit draußen in einer Vorstadtsiedlung, wo er eigentlich nichts verloren hat. Aber er bleibt in der Linie sitzen und verklärt eine beleibte Blonde, eine stattliche Mama; entfaltet ihre verschlossenen Gesichtszüge, modelliert mit seinen Worten ein schönes Lächeln, ein belustigtes Auge. Er will keineswegs verführen – er flieht die Handlung. Er ist ein Schwätzer. Ein Vagabund der Conférence. Manch einem, der nicht genauer zuhört, möchte es wohl scheinen, als liefe da jemand mit einem schweren Talkshow-Tick durch die gehemmte reale Mitwelt. Aber wie er’s macht, ist es viel seltsamer und unbekannt und stimmt die meisten Angesprochenen heiter, bringt sie auf leichtere Gedanken, und sie genießen halb erstaunt, halb verlegen die Wohltat eines Unsinns, der belebt.
In der Regel unterscheidet er mit sicherem Instinkt die ansprechbaren Menschen von den allzufest versiegelten. Fast immer sind es Frauen, bei denen noch am längsten der Funke einer ziellosen Erwartung glimmt und das uns angestammte Neugierde-Verhalten nicht restlos verkümmert ist. Frauen, allein unterwegs oder gern auch mit einer Freundin, da sind sie sogar noch leichter zu unterhalten.
«Hätte ich nicht einen Aufschrei gehört, wäre ich nicht zu Ihnen gekommen Den Aufschrei Ihres ganzen Wesens … Man muß sich etwas zutrauen, man muß mutiger sein, viel mutiger. Sehen Sie, ich komme viel herum. Seit vier Jahren bin ich Trainer der deutschen Tischtennisnationalmannschaft, da lernen Sie sich durchzusetzen …»
Einmal allerdings versieht er sich, gerät an eine Rundfunkreporterin, die dann sofort zurückschnappt, ihn nicht mehr ausläßt. Er entwischt verschreckt, sie setzt ihm nach. Der Mann ist ihr kurios genug, ein ausgefallener Zeitgenosse, er muß vors Mikrofon. Er befiehlt sie dem Teufel und wehrt sich rabiat, ganz ohne Schmelz und Witz. Er fühlt sich in seinem geheimen Umtrieb aufgestört und bloßgestellt. Zuhaus ist er in einem Dreckloch von Dreizimmerwohnung. Seine Frau, alkoholkrank, verlor die Arbeit. Er sorgt nach besten Kräften für sie. Er hängt sehr an ihr. Bis vor kurzem war sie angestellt als Modezeichnerin, hat es dann aber nicht mehr geschafft. Er selbst hatte nie einen ordentlichen Beruf. Nach dem abgebrochenen Studium der Volkswirtschaft wurde er Mitinhaber einer Leasing-Firma. Die Sache ging schief, er saß auf der Straße. Dreimal die Woche fährt er jetzt Wäsche aus. Er las immer viel, mit Vorliebe historische Romane. Aber auch handlungsstarke Dramen. Er weiß nicht, was er tut, wenn er ausgeht und Menschen anspricht. Er tut es mit blindem Gespür; halb Laster, halb Mission, als gelte es, dem einzelnen eine frohe Botschaft vom anderen einzelnen zu überbringen.
Immer wieder auch bricht er zusammen, verfällt dem schweren Trübsinn. Entweder verstummt er dann vollkommen oder klagt aufwendig und endlos über die Nichtswürdigkeit seines Daseins. Die Frau, die sich selbst kaum auf den Beinen halten kann, versucht ihn zu trösten und wieder aufzurichten. Sie träumt nur noch vom Auswandern und einem Farmerleben bei ihrer Schwester in Bolivien.
Eines Tages verliebt er sich wirklich. Das Spiel ist aus, die Tragödie beginnt. Sie ist Einkäuferin für Schmuckwaren. Sie wurde Zeuge einer groß angelegten Szene, in der der Schwätzer einen verklemmten Jüngling anwarb für den gemischten Chor der Innungskrankenkasse. Sie mußte sofort über ihn lachen. Als er sie ansieht, kann er nicht mehr davonlaufen. Er geht mit ihr, wird ihr Liebhaber. Ihre Überlegenheit ist offenkundig, er ist ihr ganz ergeben. Er verliert jedes Interesse an anderen, beiläufigen Menschen. Er verstumpft als Aufschneider, erschlafft als Windmacher. Er verrät seine Frau – er betrügt sie nicht nur, sondern verleugnet sie.
Eines Abends wartet sie vor dem Hotel, in dem die beiden Verliebten sich aufhalten und zu Abend essen. Als sie herauskommen, tritt sie auf ihren Mann zu und bittet, seiner Begleiterin vorgestellt zu werden. Der Mann drängt sie schroff beiseite wie eine halbverrückte, lästige Person. Er steigt in ein Taxi mit der Schönen und fährt davon. Er begleitet die Händlerin auf einer ihrer ‹Tourneen›. Krankhafte Eifersucht befällt ihn, da er ertragen muß, daß sie fast regelmäßig die Abende mit ihren Geschäftspartnern verbringt. Er wird unausstehlich. Der ausgediente Phantast, der kleinlaute Großsprecher, der jeden Charme der Prahlerei eingebüßt hat, wirkt nun doppelt banal, wesenlos; und so wie er sich kläglich an sie klammert, sie mit Vorwürfen traktiert, möchte sie ihn schleunigst wieder loswerden. «Was bildest du dir ein? Welche Ansprüche stellst du? Wer bist du überhaupt?» Er wird vor die Tür gesetzt und muß bitter leiden.
Schließlich kehrt er nach Hause zurück, findet dort aber seine Frau nicht mehr. Ein Freund erzählt, wie schlimm es ihr ergangen sei. Am Ende habe sie in die Klinik gemußt. Nein, nicht in der Stadt, sondern irgendwo in der Nähe von Stuttgart. Er reist also dorthin und will sie aus dem Sanatorium holen. Die Ärzte halten ihn zurück und beschwichtigen ihn. Sie liegt gerade in einem Heilschlaf und sollte weitere drei Monate verschont bleiben mit allem, was sie belasten oder beunruhigen könnte. Er darf sie im Schlaf sehen und ein paar Blumen hinstellen. Sie wird nicht einmal erfahren, daß sie von ihm sind.
«Wir wollen sie gesund machen», sagt der Arzt, «es gibt Chancen, aber man kann sie schnell verspielen.»
«Aber es könnte ihr doch helfen, wenn sie wüßte, daß ich wieder an ihrer Seite bin.»
«Warten. Ruhe. Lange Zeit.»
Er wartet lange, doch sie kommt nicht zurück. Er erkundigt sich in der Klinik, dort heißt es, sie sei vor ein paar Wochen entlassen worden. Sie ist nicht wieder nach Hause gekommen. Eine Zeitlang treibt es ihn, kreuz und quer in der Stadt nach ihr zu suchen. Es fällt ihm schwer, er bringt es kaum noch über sich, fremde Menschen anzusprechen. Er fährt jetzt öfter Wäsche aus. Er liest viel.
Später, über ein Jahr später sieht er sie zufällig im Park am Arm eines kleinen, älteren Mannes, der einen schwarzen Hut trägt. Er ruft ihren Namen. Sie reagiert nicht. Er läuft hinter ihr her. Da dreht sie sich um. Er bleibt wie erstarrt stehen. Er ruft sie noch einmal. Sie schüttelt den Kopf. Nein, sie ist es nicht. Das Paar geht weiter. Er hat sich nicht getäuscht: Sie ist eine Fremde geworden.
Die Menschen der westlichen Welt begannen sich eines Tages der Nacktheit ihres Gesichts und ihrer Stirn zu schämen. Die Scham kam über alle wie eine Weltneuheit. Wie einst Rap oder Handy. Sie suchten ihr Gesicht zu bedecken, hatten aber keine Sitte, die ihnen einen passenden Schutz lieferte. Sie litten an einer Anziehpsychose und konnten nicht mehr aufhören, sich mit Kleidern zu verhüllen, bis sie als dicke unförmige Kleider-Stoff-Ballen herumrollten. Mann und Frau sahen aus wie alte Lumpenknäuel, Vettel und Schrat, zwei Klamottenpakete, die zuweilen mit langen Stöcken aufeinander eindroschen, weil Hiebe mit Armen, Tritte mit Füßen im Stoff versanken, zwei um und um Verhüllte, die, um sich zu lieben, Minuten brauchten, den Unterleib freizuwühlen.
«Sie sind eine verschlossene Frau und werden es für mich immer bleiben.»
«Ich verschlossen? Habe ich nicht den ganzen Abend mein Leben vor Ihnen ausgebreitet wie ein Badetuch am Meeresstrand? Mit einem einzigen Blick können Sie mich überblicken.»
«Trotzdem. Für mich bleiben Sie ein Buch mit Sieben Siegeln.»
Bei diesem Mann hätte sie am allerwenigsten damit gerechnet, daß er eine Einladung zum Abendbrot ausschließlich dazu nutzte, sich satt und mehr als satt zu essen. Als er nach Mitternacht immer noch nicht einhielt, richteten sich ihre grämlichsten Gefühle gegen ihn und befreiten sich schließlich in einer Suada der Verhöhnung.