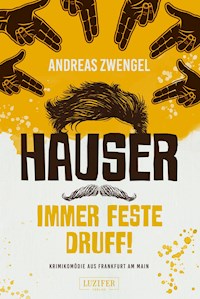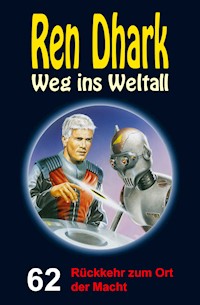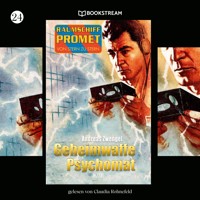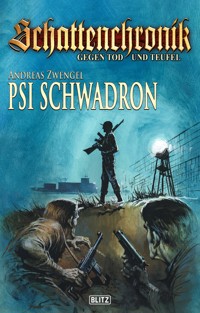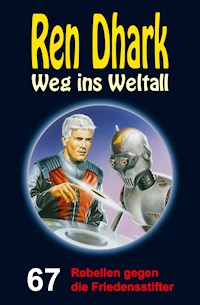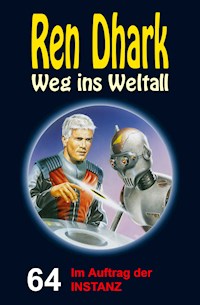Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: ONLY eBook - Science Fiction
- Sprache: Deutsch
Vor über einhundert Jahren griffen die Marsianer nach der Erde. Mit ihren dreibeinigen Kampfmaschinen wüteten sie in der Hauptstadt des Britischen Empire und versetzten die ganze Welt in Angst und Schrecken. Die Menschheit verdankte ihr Überleben nur einem glücklichen Zufall, denn die irdischen Bakterien erwiesen sich für die Aliens als tödlich. H. G. Wells beschrieb die dramatischen Ereignisse in seinem Buch »Krieg der Welten«. In den folgenden Jahrzehnten war die Gefahr noch allgegenwärtig und selbst eine harmlose Radiosendung konnte eine Massenpanik auslösen. Doch als die Menschen endlich in der Lage waren, Sonden zum Mars zu schicken, fanden sie dort keine Spuren von Leben. Sie begannen, sich in Sicherheit zu wiegen. In trügerischer Sicherheit. Nur die B. X. A., eine kleine, kaum beachtete Regierungsorganisation, ist noch wachsam und für eine denkbare neue Invasion gewappnet. Als an mehreren abgelegenen Orten unerklärliche Phänomene auftreten, wird den Männern und Frauen der B. X. A. bewusst, dass der zweite Krieg der Welten längst begonnen hat. Diesmal sind die Marsianer besser vorbereitet – und die Menschheit steht vor ihrer größten Bewährungsprobe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 838
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
In dieser Reihe bisher erschienen:
* * *
e501 Andreas Zwengel Der zweite Krieg der Welten
e502 Diverse Raumschiff Promet Sammelband 01
e503 Alfred Wallon America 2200
e504 Alfred Wallon Der Ufer der Ewigkeit
DER ZWEITE KRIEG DER WELTEN
ONLY EBOOK SCIENCE-FICTION
BUCH 1
ANDREAS ZWENGEL
INHALT
Erster Teil: Sie kommen!
Prolog
Die Insel
Am Ende der Straße
Die Schiffe kommen
Der Analyst
Rotes Kraut
Die Halle
Fieberwelle
Tagesordnung
Unter dem Vulkan
Für meine Schwester
Aus dem Meer
Düstere Ahnung
Trophäensammler
Zweiter Teil: Zone Eins
Mülldienst
Die Geschwister
Ausgerechnet Grönland
Moebius
Die Landung
Die erste Invasion
Augenzeugen
Aus Mangel an Beweisen
Öffnung
Dritter Teil: Götterdämmerung
Der Krieg der Welten
Letzte Ruhe vor dem Sturm
Ein neuer Mitarbeiter
Wir waren gewarnt
Das Verlies
#Tripods
Verteidigungslinien
Cobra
Unbefugtes Betreten
Vor den Toren der Stadt
Vierter Teil: Rote Augen
Der Ausbruch
Auf feindlichem Gebiet
Fieberwelle
B. X. A.
Der Schläfer erwacht
Krisenmanagement
Sperrzone
Infiziert
Heathrow
Sauerstoff
Flugzeuge am Himmel
Fünfter Teil: Belagerung
Tod in der Luft
Einsatz der Digger
Die Behörde
Im Untergrund
Heimkehr
Der komische Kerl
Widerstand
Alarm
Zentrum
Sturm auf die Burg
Sechster Teil: Verschwörung
Zusammenbruch
Kampf um Castle Cairnbarrow
Der Bunker
London fällt
Schadensbegrenzung
Menschliche Helfer
Royal Exchange
Hoher Besuch
Aus heiterem Himmel
Siebter Teil: England brennt
Die zweite Welle
Die Blutbank
Die Jagd beginnt
London calling
Der hinkende Tripod
Fluchtpunkt
Guerillas
Lose Enden
Tour de force
Begleitschutz
Letzte Option
Auslöschung
Achter Teil: Endspiel
1902
Der Gefangene von Castle Cairnbarrow
In tiefer Trauer
Im Gedächtnispalast
Böses Blut
Schläfer
Auf den Schultern von Giganten
Eine Frage der Technik
Feindliche Übermacht
Selbstzerstörung
Der Botschafter des Mars
Epilog
Über den Autor
Dieses Buch gehört zu unseren exklusiven Sammler-Editionen
und ist nur unter www.BLITZ-Verlag.de versandkostenfrei erhältlich.
In unserem Shop ist dieser Roman auch als E-Book lieferbar.
Bei einer automatischen Belieferung gewähren wir Serien-Subskriptionsrabatt. Alle E-Books und Hörbücher sind zudem über alle bekannten Portale zu beziehen.
© 2020 Blitz Verlag
Ein Unternehmen der SilberScore Beteiligungs GmbH
Mühlsteig 10 • A-6633 Biberwier
Redaktion: Danny Winter
Lektorat: Harald Junker
Titelbild: Tithi Luadthong
Umschlaggestaltung: Mario Heyer
Alle Rechte vorbehalten
eBook Satz: Gero Reimer
www.BLITZ-Verlag.de
ISBN 978-3-95719-272-1
e401 vom 21.07.2024
ERSTER TEIL: SIE KOMMEN!
PROLOG
Dénia, Spanien, Februar
Im Morgengrauen donnerte ein Konvoi aus drei schweren Geländewagen durch die ausgestorbenen Ortschaften entlang der spanischen Ostküste. Ihr Ziel war ein Privatflughafen nördlich von Dénia, wo bereits eine Maschine auf das Team aus Kryptologen, Semiologen und Linguisten wartete.
Cathie Storm saß schweigend neben ihrem Leibwächter auf der Rückbank des mittleren Wagens. Sie blickte hinaus auf die vorbeirauschende Landschaft. Dies war eine beliebte Touristengegend und in den Sommermonaten wären um diese Zeit schon die ersten Jogger unterwegs gewesen.
Ein Mann hatte sie engagiert, ihr freie Hand bei der Wahl ihres Teams gelassen und ihr die Aufgabe mit einem breiten Lächeln angeboten. „Entschlüsseln Sie diese Botschaft!“
Cathie wurde die Bilder nicht los, die sie zwei Wochen lang in jeder denkbaren Vergrößerung angestarrt hatte. Den Durchbruch hatten sie weit nach Mitternacht erzielt, vor weniger als fünf Stunden. Nun gab es keine Sekunde Ruhe mehr für sie. Mit einem Mal ging es nur noch darum, Cathies Team so schnell wie möglich auszufliegen.
Ihr Leibwächter schob sich einen frischen Nikotinkaugummi in den Mund. Liam Wallace war ein mittelgroßer, bulliger Kerl und entsprach nicht ihrer Vorstellung von einem Personenschützer. Aber immerhin war er breit genug, um sie vollständig zu verdecken. Er war maulfaul und herrisch. Keiner aus ihrem Team mochte ihn besonders. Sie vermutete, es gefiel ihm einfach, die Wissenschaftler herumzuscheuchen, aber anzusehen waren ihm solche Gefühle nicht. Der Mann schien nur einen einzigen Gesichtsausdruck zu haben, und der war ziemlich mürrisch.
Gleich zu Beginn hatte Wallace ihnen die Handys abgenommen und bis heute nicht zurückgegeben. Die ganze Zeit waren sie völlig von der Außenwelt isoliert gewesen. Die Zeit war mühselig und unangenehm gewesen, aber Cathie und ihre Kollegen hatten es überstanden. Mit der Bezahlung dieses hoch dotierten Auftrages konnte sie eine ganze Weile Urlaub machen und genau das hatte sie nun auch vor.
Die Geheimhaltung war immer noch nicht nachvollziehbar und die Abschottung erschien ihr im Nachhinein geradezu lächerlich. Absolut niemand interessierte sich für sie und die Arbeit, die sie erledigten. Ihr ganzes Team war sich darüber einig, dass Wallace sich nur wichtigmachen wollte. Ein kleines Licht, dem man etwas Macht zum Missbrauchen gegeben hatte.
Früher musste er einmal ein ernst zu nehmender Profi gewesen sein, aber inzwischen achtete er nicht mehr auf sich und hatte wohl auch niemanden, der es für ihn tat. Er roch nach Schweiß, schlechtem Essen und noch einigem mehr. Er rauchte und versuchte, es durch billiges Aftershave zu überdecken. Sein Pfefferminzatem tarnte noch ein weiteres seiner Laster, seinen Hang zu billigem Fusel. Der Mann mochte offenbar sein Leben nicht besonders und hing auch nicht daran.
Cathie war zwar immer noch der Meinung, dass sie keinen Leibwächter brauchte, aber wenn ihr Auftraggeber darauf bestand, dann musste es doch nicht die günstigste Variante sein. Das war schon fast eine Beleidigung. Wallace hatte so wenig von Kevin Costner an sich, dass sie zusammen schon fast wie eine Parodie auf den Film Bodyguard wirkten.
Vor ihnen auf der Straße stand ein Wagen der Stadtwerke. Zwei Arbeiter schraubten von einer Hebebühne aus an der Ampelanlage.
„Abbiegen!“, befahl Wallace.
„Warum, die reparieren …“
„Falscher Wochentag, falsche Uhrzeit. Abbiegen!“
Der Konvoi bog von der Hauptstraße ab und rauschte durch ein Wohngebiet.
„Wir werden unseren Flug verpassen“, beschwerte sich Cathie.
Der hintere Wagen fiel zurück, um zu überprüfen, ob sie verfolgt wurden. Wallaces Männer an Bord würden ihnen, wenn nötig, Rückendeckung geben. Die beiden vorderen Wagen des Konvois sausten in riskantem Tempo durch die friedlichen Straßen. Die junge Kryptologin hielt sich krampfhaft am Türgriff fest, während Wallace keine Zeichen von Aufregung zeigte. Er kaute nur seinen Kaugummi etwas schneller als zuvor.
Cathie spürte plötzlich, dass sie mit der Annahme dieses Auftrags einen großen Fehler begangen hatte. Sie und ihr Team hatten die Fotos ohne jede weitere Erklärung erhalten, nur mit der Anweisung, die seltsamen Zeichen darauf zu entschlüsseln.
Offenbar hielt man sie für dämlich und das ärgerte die Kryptologin noch im Nachhinein.
Sie erinnerte sich noch an alle Einzelheiten des ersten Tages. Sie benötigte zwanzig Minuten für die Erkenntnis, dass man die Bilder nicht auf der Erde aufgenommen hatte, und weitere siebzig, um festzustellen, woher sie tatsächlich stammten. Bei der Vorauswahl musste ihr Auftraggeber alle Fotos aussortiert haben, die einen eindeutigen Hinweis auf die Herkunft geben konnten. Dabei waren sie wirklich geschickt vorgegangen und hatten sogar Farbfilter benutzt, um die typische rote Färbung des Untergrundes zu verbergen. Aber eines war ihnen allerdings entgangen.
Auf einem Foto war ein Teil des Sternenhimmels zu sehen. Nur ein winziger Ausschnitt, aber er reichte Cathie aus, um festzustellen, dass diese Sicht von keinem Punkt der Erde aus möglich war. Aus einem ganz einfachen Grund. Zuerst war es nur ein Verdacht und sie verstand, weshalb es bisher alle übersehen haben mussten. Sie brauchte selbst eine Vergrößerung in sehr hoher Auflösung, aber als Cathie Storm das Ergebnis in Händen hielt, stieß sie einen Pfiff aus. Sie sah einen sehr hellen, bläulichen Punkt über dem Horizont, und es handelte sich offenbar um die Erde. Diese Aufnahmen stammten vom Mars.
Einer der Marsrover musste sie aufgenommen haben. Sie fragte sich, wie ihr Auftraggeber an so hochsensibles Material gelangt war. Aber noch viel interessanter erschien ihr die Frage, wer diese Botschaft auf dem Mars hinterlassen hatte und was sie bedeutete, denn von Menschen stammte sie ganz sicher nicht.
Ihre Arbeit erhielt durch diese Erkenntnis einen ganz neuen Antrieb. Sie war zwar schon zuvor neugierig und motiviert gewesen, doch von diesem Zeitpunkt an verhielt sie sich regelrecht manisch. Sie trieb ihre Mitarbeiter gnadenlos zu Höchstleistungen an, um das Geheimnis so schnell wie möglich zu lösen. Doch als es ihnen dann tatsächlich gelang, wünschte Cathie, sie hätte niemals davon erfahren.
Nun mussten sie lebend aus diesem Land herauskommen, um ihrem Auftraggeber davon zu berichten. Wallace ließ nicht zu, ihn telefonisch zu benachrichtigen und wollte selbst auch gar nicht hören, was sie herausgefunden hatten. Er hatte strikte Anweisungen bekommen und war entschlossen, sie zu befolgen.
Ihre Fahrt ging entlang eines Kanals am Rand des erwachenden Vorortes. Der Fahrer machte seine Passagiere auf ein Fahrzeug aufmerksam, das parallel zu ihnen auf der anderen Seite des Kanals fuhr. Es war ein weißer Lieferwagen mit seitlicher Schiebetür, und jeder im Sicherheitsgeschäft verband mit solchen Fahrzeugen eine bestimmte Assoziation.
Ein Stück voraus lag eine Brücke, die beide Seiten des Kanals miteinander verband. Der Konvoi beschleunigte und der Lieferwagen tat es ihm gleich. An eine zufällige Begegnung glaubte ohnehin niemand, aber nun hatten sie ihre Bestätigung.
„Wer ist das? Was wollen die?“, fragte Cathie aufgeregt, erhielt aber keine Antwort.
Die beiden Geländewagen bogen an der Brücke nach links in den Ort hinein.
Cathie warf einen Blick zurück und suchte nach dem dritten Wagen. „Wo sind Ihre Kollegen?“
„Aufgehalten oder ausgeschaltet oder beides“, antwortete Wallace knapp.
Wie zur Bestätigung erschien einige Häuserreihen hinter ihnen eine schwarze Rauchwolke über den Dächern.
„Oh mein Gott, wir müssen zurück und ihnen helfen!“, schrie Cathie. Wallace antwortete nicht, sondern blickte starr voraus.
„Verdammt!“, knurrte der Fahrer. Vor ihnen war die Ortsdurchfahrt blockiert. Die Straßenführung wurde wegen der eng stehenden Häuser einspurig und die Durchfahrt war mit einer Ampel geregelt. Vor der roten Ampel auf ihrer Seite stand ein Traktor, der zu breit war, um ihn einfach zu umfahren. Die beiden Geländewagen mussten halten.
Cathie blickte zwischen den Vordersitzen hindurch in den Wagen vor ihnen. Durch das Rückfenster winkten ihr die beiden italienischen Semiologen zu, die maßgeblich an der Entschlüsselung der Botschaft beteiligt gewesen waren. Die beiden Männer grinsten und zuckten mit den Achseln, um ihr zu signalisieren, dass es Situationen gab, in denen man einfach nichts anderes tun konnte als zu warten.
In diesem Moment sprang der Fahrer von dem Traktor herunter. Er trug eine Skimaske und klebte einen rundlichen Gegenstand mitten auf die Windschutzscheibe des vorderen Wagens. Cathie hielt es für einen Sprengsatz, doch er explodierte nicht. Stattdessen begann er, deutlich sichtbar zu vibrieren, und plötzlich bestand die gepanzerte Frontscheibe aus einem feinrissigen Netz, bevor sie in kleinen Brocken ins Wageninnere fiel.
Sofort tauchte ein zweiter Maskierter auf und richtete ein Sturmgewehr auf die entstandene Öffnung. Cathie stieß einen Schrei aus, als sich das Rückfenster des Wagens blutrot verfärbte.
„Großer Gott, was sollen wir jetzt tun?“, fragte Cathie. Als sie keine Antwort erhielt, drehte sie sich zu ihrem Leibwächter um, aber der befand sich nicht mehr an seinem Platz. Geräuschlos war er aus dem Wagen geglitten und hatte die Tür hinter sich geschlossen. Wahrscheinlich verdrückte er sich gerade.
Der Schütze kam um den vorderen Wagen herum und tauchte vor ihrer Motorhaube auf. Der Fahrer duckte sich nach unten und versuchte dabei, seine Waffe zu ziehen. Der Killer auf der Straße hob sein Sturmgewehr, sodass die Mündung direkt auf Cathie gerichtet war. Der Kryptologin stockte der Atem. Doch im selben Moment erhielt der Killer zwei blutige Treffer in Hals und Gesicht. Er verschwand und an seiner Stelle tauchte Wallace auf.
Er ging neben dem Wagen in die Hocke und lehnte sich mit dem Rücken gegen den Kotflügel, während er das Magazin auswarf und ein neues, extralanges in die Pistole schob. Der Leibwächter atmete tief durch, kam in die Höhe und drehte sich dabei suchend im Kreis.
Ein Geschoss sauste dicht an ihm vorüber und er erwiderte das Feuer. Die Pistole stieß einen langen Feuerstoß aus. Wallace stand zwischen den Wagen und schoss in jede Richtung auf die maskierten Angreifer, die nun überall erschienen. Dabei wurde er auch selbst getroffen. Cathie sah einige Male seinen bulligen Körper unter einem Einschlag zucken. Wallace blutete bereits aus mehreren Wunden, doch der verdammte Kerl war einfach zu stur, um zu Boden zu gehen.
Sie wollte eine Tür öffnen und fliehen. Alles war besser, als in dieser Todesfalle hocken zu bleiben. In dem Gebäude zur Rechten gab es eine Passage, die zu einem Parkplatz führte. Zwei maskierte Männer lagen ausgestreckt auf dem Boden. Wallace musste sie nach dem Aussteigen erledigt haben, um einen Fluchtweg zu schaffen. Auf diesem Weg konnte sie vielleicht entkommen.
Noch bevor Cathie ihren Entschluss in die Tat umsetzen konnte, erschien auf der Galerie über dem Durchgang ein weiterer Maskierter, der eine Panzerfaust auf ihren Wagen richtete. Das ist so ungerecht, ich habe doch niemandem etwas getan, dachte Cathie noch.
Das Geschoss explodierte dicht neben dem Fahrzeug, und die Druckwelle verbog den schweren Wagen wie eine Eierschale. Cathie wurde im Inneren herumgeschleudert und hörte deutlich Knochen in ihrem Körper brechen. Die Schmerzen raubten ihr beinahe das Bewusstsein und eigentlich wäre ihr dies sogar lieber gewesen. Jede Bewegung sandte quälende Wellen durch ihren Körper.
Der Fahrer hing in seinem Sitz, und der Winkel seines Kopfes zeigte, dass sein Rückgrat nicht mehr intakt sein konnte. Sie vermutete, dass durch die Druckwelle ihr Trommelfell geplatzt war. Jedenfalls hörte sie die Schüsse draußen nur sehr gedämpft und dann gar nicht mehr.
Cathie lag wimmernd über die Rückbank ausgestreckt, unfähig, sich aufzurichten und nach draußen zu sehen. Sie sah ihre Tasche und streckte die Hand danach aus, als ihr einfiel, dass Wallace alle Handys aus Sicherheitsgründen eingesammelt hatte. Schönen Dank auch, wo immer du gerade sein magst, dachte sie düster. Sie befanden sich in der Mitte eines Dorfes; irgendjemand würde doch sicher die Polizei verständigen.
Rauch stieg auf und drang ins Wageninnere. Draußen brannte etwas. Cathie musste husten und sah plötzlich Blut in ihren Schoß tropfen. Hastig wischte sie sich über die Lippen und betrachtete ihre blutverschmierte Hand. Waren das innere Blutungen oder hatte sie sich nur bei der Explosion auf die Zunge gebissen?
Die Kryptologin packte mit beiden Händen eine Seite des Beifahrersitzes und zog sich daran in die Höhe. Dabei bemerkte sie die Pistole des Fahrers, die halb aus seinem Gürtel ragte. Sie ließ mit einer Hand den Sitz los und streckte sie nach der Waffe aus. Es fehlten nur Millimeter, bis ihre Fingerspitzen den Griff berühren würden, da bohrte sich in ihrem Inneren etwas Spitzes in etwas Weiches. Cathie riss vor Schmerz die Augen weit auf, ihre Hand rutschte vom Beifahrersitz ab und sie fiel zurück auf die Sitzbank.
Die Maskierten draußen stritten und schrien sich an. Die Stimmen drangen wie aus großer Entfernung zu ihr durch. Cathie würde ihr Leben durch die Hand von blutigen Amateuren verlieren. Offenbar waren sie mit der Wirkung des Raketenwerfers nicht völlig zufrieden und hatten kein zweites Geschoss dabei. Sie kamen zu dem Geländewagen gerannt und versuchten, die Türen zu öffnen, aber der Fahrer hatte schon beim ersten Schuss die Zentralverriegelung gedrückt. Sie schlugen auf die Scheiben ein, aber die schienen noch widerstandsfähiger als die Türen zu sein. Dann machten sie sich daran, die verzogene Tür aufzuhebeln. Ihnen blieb nicht mehr viel Zeit, bevor die Polizei eintraf, deshalb versuchten sie wie rasend, zu ihr vorzudringen.
Cathies Körper fühlte sich an, als würde es ohnehin jeden Moment mit ihr zu Ende gehen, aber das war diesen Kerlen nicht genug. Sie wollten hundertprozentig sicher sein, dass alle Mitglieder des Teams starben.
Die Tür war bereits einen Spalt weit aufgebogen, weit genug, um einen Gewehrlauf hindurchzustecken. Cathie zog sich unter höllischen Schmerzen auf die andere Seite der Sitzbank, um aus der Schusslinie zu gelangen. Unterhalb der Hüfte dagegen fühlte sie überhaupt nichts mehr.
Cathie Storm hatte nur noch einen Gedanken: Sie musste ihre Informationen weitergeben, selbst wenn es an ihre Mörder war. Jemand musste die Menschheit warnen. Die junge Wissenschaftlerin hatte keine Ahnung, wer diese Männer waren und welche Ziele sie verfolgten, aber sie mussten wissen, in welcher Gefahr sie und der Rest der Menschheit schwebten.
„Sie kommen!“, stieß sie zusammen mit blutigen Bläschen zwischen ihren Lippen hervor. „Sie kom…!“
Ein Arm streckte sich durch die Öffnung in der Tür, und die Mündung einer Pistole wurde gegen ihre Stirn gepresst. Cathie sah dem Mann in die Augen, als er abdrückte.
DIE INSEL
Tristan da Cunha, Südatlantik, April
„Willkommen auf der entlegensten Insel“, stand auf dem großen Schild in Edinburgh of the Seven Seas. Die Bewohner der einzigen Siedlung auf Tristan da Cunha kokettierten mit ihrem einsiedlerischen Dasein inmitten des Südatlantiks. Pro Jahr liefen nur zehn Schiffe die Insel an, und auf einem von ihnen war Nigel Banks angekommen. Elf Tage hatte seine Reise von Kapstadt aus gedauert, und an ihrem Ende war er bereit gewesen, der Insel auf eigene Kosten eine Landebahn zu bauen.
Nigels bürgerliches Leben in London ging gerade den Bach runter. Er suchte er nach einem Neuanfang und fand ihn in einer ungewöhnlichen Zeitungsannonce. Also meldete er sich auf eine freie Lehrerstelle, 5337 Meilen von der britischen Hauptstadt entfernt. Wenn er schon irgendwo ganz neu anfing, dann wollte er gleich Nägel mit Köpfen machen.
Nun war er seit zwei Tagen auf Tristan da Cunha, hatte ein kleines Haus bezogen und würde am nächsten Morgen seine Stelle als Lehrer für Mathematik und Naturwissenschaften für die gerade mal zwei Dutzend Kinder auf der Insel antreten.
Nigel war ein unauffälliger und unscheinbarer Mann, dem niemand einen solchen Schritt zugetraut hätte, am wenigsten er selbst. Immer noch berauscht von dem eigenen Wagemut, lag er an diesem Morgen in seinem Bett und lauschte dem Wind, der über sein kleines Haus strich. Nigel hatte schnell festgestellt, dass sich das Wetter auf Tristan da Cunha nicht allzu sehr von dem auf der Insel unterschied, die er gerade für immer verlassen hatte.
Es war die Einsamkeit, die ihn lockte. Auf so einem isolierten Fleckchen Erde rückten die Menschen automatisch dichter zusammen. Jeder kannte jeden, selbst nach kurzer Zeit, und alle waren in irgendeiner Form aufeinander angewiesen. Aber wenn man Stille und Abgeschiedenheit suchte, dann fand man sie nur wenige Schritte von der eigenen Haustür entfernt. Und zwar in einem Ausmaß, wie man es höchstens im Weltall vermutet hätte.
Nur nicht an diesem Morgen. Der Nachbar fluchte so laut in seinem Garten, dass Nigel es bald aufgab, weiterschlafen zu wollen. Für gewöhnlich war Roger ein sehr ausgeglichener Mann, dem sein Garten über alles ging. Für ihn gab es kein botanisches Problem, das er nicht innerhalb von Minuten lösen konnte.
Heute schien dies nicht der Fall zu sein, und Nigel war neugierig, um welches Problem es sich dabei handelte. Er zog die Vorhänge seines Schlafzimmers auf und blickte hinüber zu Rogers Garten. Der alte Mann schlug mit der Harke auf irgendetwas am Boden ein. Möglicherweise handelte es sich um einen Maulwurf.
Zehn Minuten später spazierte Nigel im Morgenmantel mit einer Tasse Tee in der Hand zum Nachbargrundstück und stützte sich mit den Unterarmen auf die Steinmauer, die den Garten eingrenzte. Roger wütete mit dem Rücken zu ihm und schien seine Anwesenheit überhaupt nicht zu bemerken. Der alte Mann, bisher ein Ausbund an Ruhe und Ausgeglichenheit, war völlig außer sich. Seine Kleidung wies dunkle Schweißflecken auf und sein hochroter Kopf ließ befürchten, dass er jeden Moment einen Herzinfarkt erleiden könnte.
Der Anlass für sein ungewöhnliches Verhalten schien das purpurfarbene Unkraut zu sein, das seinen halben Garten bedeckte. Es wucherte überall zwischen den Kartoffelpflanzen und vermischte sich mit deren grünen Trieben. Die ordentlich gezogenen Reihen waren zerstört und dicke, rote Stränge drückten die Kartoffeln aus der Erde heraus. Diese Pflanzen waren dabei, die gesamte Ernte zu ruinieren.
„Was ist das für ein Zeug?“, fragte Nigel.
Roger zuckte zusammen und fuhr zu ihm herum. Erst jetzt hatte er die Anwesenheit seines neuen Nachbarn bemerkt. Schnaufend ließ er die Harke sinken und wischte sich mit dem Unterarm den Schweiß von der Stirn. „Keine Ahnung, ich habe so was noch nie zuvor gesehen, und dabei dachte ich, ich würde jedes Gewächs auf der Welt kennen. Aber was ich bisher darüber sagen kann: Es ist gierig, wächst schnell und ist nicht kaputt zu kriegen.“
Er wies auf einen Behälter. Offenbar war Roger dem Unkraut mit einem Pflanzengift zu Leibe gerückt. Er schien sich wenig Sorgen über dessen Gefährlichkeit zu machen. Nigel hatte aufgehört, es zu verwenden, als es von „möglicherweise krebserregend“ auf „wahrscheinlich krebserregend“ hochgestuft worden war. Roger dagegen schien sich zum gleichen Zeitpunkt mit einem größeren Vorrat eingedeckt zu haben, denn was für Menschen schlecht war, musste auch bei Pflanzen wirken. In diesem Fall erwies es sich allerdings als völlig wirkungslos.
„Wenn ich dem Zeug nicht bald Herr werde, hole ich Benzin und brenne alles ab.“
„Das würde deinen ganzen Garten ruinieren.“
Roger schnaubte. „Von meinen eigenen Pflanzen ist sowieso kaum noch etwas übrig.“
Nigel sah sich um und musste ihm recht geben. Das rote Unkraut war dabei, sich wie ein pflanzlicher Teppich über den Garten zu legen.
„Und es geht nicht nur mir so; schau dich mal um!“
Nigel streckte den Kopf, aber die Steinmauern der Nachbarn verwehrten ihm die Einsicht. Kurz entschlossen kletterte er auf Rogers Mauer hinauf und betrachtete die anderen Gärten. Alle waren zumindest teilweise davon bedeckt, und an manchen Stellen schauten nur noch die Mauerkronen hervor.
Nigel fiel auf, dass sich mehr Menschen als gewöhnlich auf den Straßen aufhielten. Sie strömten in Gruppen zusammen und redeten alle durcheinander. Nigel und Roger gingen zu der größten Ansammlung hinüber und bekamen schnell heraus, wo das Problem lag.
„Das Internet ist ausgefallen, und die Satellitentelefone funktionieren nicht mehr.“
„Was ist mit Radio?“
„Wir empfangen weder BFBS 1 noch Saint FM. Wir sind komplett abgeschnitten.“
„Im Camogli Hospital und im Supermarkt ist der Strom ausgefallen. Das Zeug hat die Leitungen zerstört; jetzt wird es wirklich ernst. Selbst die CTBTO ist lahmgelegt.“
„Ich dachte, die seien völlig autark?“
„Die wer?“, fragte Nigel an seinen Nachbarn gewandt.
„Die Organisation des Vertrags über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen“, erklärte Roger. „Dir sind vielleicht schon die beiden weißen Kugeln westlich von Edinburgh aufgefallen?“
„Ich dachte, das wäre eine Wetterstation oder so was.“
„Die CTBTO besitzt auf der Insel drei Überwachungsstationen zur Aufdeckung von Nuklearversuchen. Mit Infraschall, Hydroakustik und Edelgaserkennung überwachen sie das Meer, um unterseeische Nuklearexplosionen zu entdecken.“
Nigel kniff misstrauisch die Augen zusammen und musterte seinen Nachbarn. „Du verscheißerst mich?“
Roger grinste. „Nein, das ist kein Scherz, frag mal die Nordkoreaner. Darüber hinaus fungieren die Messdaten auch für die Tsunamiwarnung; wir sind also ziemlich wichtig hier. Wir verdanken der CTBTO, dass wir auf der Insel über ein funktionierendes Stromnetz verfügen. Oder verfügt haben.“
„Die kriegen das schon wieder hin“, rief ein korpulenter Mann, in dem Nigel seinen neuen Direktor erkannte. „Kümmern wir uns zuerst um das dringendere Problem.“
Eine alte Frau hob kämpferisch die Faust. „Na los, bereiten wir diesem roten Spuk ein Ende!“
* * *
Das Unkraut entwickelte sich innerhalb weniger Stunden von einem lästigen Ärgernis zu einer ernsthaften Bedrohung. Es wuchs unaufhörlich, es wuchs schnell und es wuchs zu einer erschreckenden Größe. Roger gab es auf, mit der Harke auf das Zeug einzuschlagen, sondern bearbeitete es mit einer Axt. Nigel bekam eine Bogensäge in die Hand gedrückt und bekämpfte damit die stärkeren Triebe.
Ihr Einsatz war aussichtslos. Für jeden Strang, den sie durchtrennten, schlängelte sich sofort ein weiterer zwischen ihren Beinen hindurch. Und nicht nur das. Durchtrennte Teile, die zu dicht beieinanderlagen, schlossen sich wieder zusammen. Es war einfach nur beängstigend.
Die Nachbarn am östlichen Ende der Stadt setzten um, was Roger bisher nur angedroht hatte; sie rückten dem Unkraut mit Feuer zu Leibe. Bald stieg überall aus den Gärten dunkler Rauch zum Himmel empor.
Roger rief einen Mann zu sich, der mit einem leeren Benzinkanister unterwegs war. „Was ist, brennt es nicht?“
„Kaum. Das Zeug scheint eine Menge Wasser in sich zu speichern. Mit dem Benzin zerstören wir zwar die Oberfläche, aber kaum ist das Feuer aus, sprießt es nur umso schneller. Wie frisch gedüngt“, sagte der Mann und gab einen schluchzenden Laut von sich. Sein gesamter Besitz war bereits überzogen und durchsetzt von diesem unheimlichen Gewächs.
„Wenn wir nichts dagegen unternehmen, sieht es hier bald aus wie auf dem Mars“, sagte Nigel und die beiden anderen Männer sahen ihn erstaunt an. „Was ist los?“
„Diesen Zusammenhang habe ich noch gar nicht gesehen“, murmelte Roger.
„Welchen Zusammenhang?“, fragte Nigel, aber dann fiel es auch ihm ein.
Er kannte die Geschichten vom roten Kraut, auch wenn sie für ihn kaum mehr als das waren: Geschichten. Wie alles, was die Marsianer betraf, wurde es von vielen jüngeren Leuten heute angezweifelt. Selbst Nigel mit seinen 44 Jahren war im Laufe der Jahre skeptisch geworden. Sein Vater war 1948 zur Welt gekommen, sein Großvater 1920 und sein Urgroßvater war zu der Zeit, als die Invasion stattgefunden haben sollte, gerade mal drei Jahre alt gewesen. Für Nigel war die Geschichte nur eine Erzählung. Wie ein Ammenmärchen, mit dem man kleine Kinder einschüchterte, wenn sie nicht ins Bett gehen wollten. „Eine Invasion vom Mars, herrje! Normalerweise müsste man Leute einsperren, die davon erzählen.“
Roger schüttelte den Kopf. „Ein Schulfreund meines Großvaters hat die Invasion in London miterlebt. Er hat uns oft besucht, und wenn du ihm zugehört hast, dann gab es keine Zweifel. So viel Fantasie hat niemand.“
Die meisten Briten zweifelten nicht daran. Für sie war die Invasion ein historisches Ereignis, wie die Schlacht bei Waterloo oder die Mondlandung.
Nigel teilte die Überzeugung seines Nachbarn nicht. „Dieser Sachbuchautor, Moebius, hat doch nachgewiesen, dass eine solche Invasion gar nicht stattgefunden haben kann. Seine Bücher sind Bestseller und Millionen Leser können nicht alle irren.“
„Nicht die Menge macht es“, knurrte Roger. „Das ist wie mit den Fliegen und der Scheiße. Ich glaube beim Menschen nicht an Schwarmintelligenz.“
„Aber wir haben die Bilder vom Mars gesehen. Seit Jahren schicken wir Sonden und so was da hoch; die hätten doch etwas finden müssen?“
Jedes Kind kannte die Bilder. Nirgends eine Spur von Leben auf dem Mars. Gerade jetzt war die nächste Sonde auf dem Weg. Sie würde endgültig alle Zweifel zerstreuen und die offenen Fragen beantworten. Anschließend würden die Geschichten über die Marsianer ins Reich der Mythen und Legenden wandern.
„Ich weiß es wirklich nicht, Nigel. Vielleicht haben sie sich damals vom Mars zurückgezogen, wer weiß das schon. Ich würde von diesem Zeug hier jetzt nicht unbedingt auf Marsianer schließen, aber ganz ehrlich, es würde mich freuen, endlich mal Klarheit bei dieser ganzen Invasionsgeschichte zu haben. Ich würde gerne damit aufhören können, mich davor zu fürchten.“
Viele würden dies begrüßen, da sie die ewigen Mahnungen und Warnungen leid waren, die sie sich seit ihrer Kindheit von den Älteren anhören durften.
Es gab sicher eine vernünftige Erklärung für die Veränderungen in der Vegetation auf Tristan da Cunha, sie mussten diese bloß noch finden. Selbst für die Wunder, die in der Bibel geschildert wurden, hatte man nach heutigem Wissensstand einfache naturwissenschaftliche Erklärungen. Vielleicht hatte die Forschungseinrichtung auf der Insel damit zu tun, und sie machten dort möglicherweise Experimente ganz anderer Art.
Laute, gequälte Schreie aus unzähligen Kehlen halten plötzlich durch den Ort.
„Mein Gott, die Herde!“, entfuhr es Roger.
AM ENDE DER STRASSE
Mêdog, Autonomes Gebiet Tibet, April
Rund 14.000 Kilometer in nordöstlicher Richtung entfernt, rannte der elfjährige Yeshe aufgeregt durch das Haus, auf der Suche nach seiner jüngeren Schwester Nyima. Die Siebenjährige war verschwunden, ihr Zimmer verlassen. Er hatte bereits damit gerechnet, dass sie eine Dummheit begehen würde, denn ihr Vater war am Vortag nicht von der Arbeit im Nachbarort zurückgekehrt.
Seit dem Tod ihrer Mutter bei einem Erdrutsch im letzten Oktober war Yeshe für seine Schwester verantwortlich, während der Vater arbeitete. Und ihr Vater arbeitete fast ununterbrochen, um sie alle ernäh-
ren zu können. Deshalb vermutete Yeshe auch, dass er letzte Nacht in Mêdog geblieben war, um etwas zu trinken.
Das geschah nicht sehr häufig, aber es war schon vorgekommen. Sein Vater brauchte von Zeit zu Zeit einen Abend für sich, um nicht durchzudrehen. Yeshe verstand das. Er verstand zwar nicht, was sein Vater an diesen Abenden tat, aber er begriff deren Bedeutung für ihn. Außerdem brachte er ihnen anschließend immer ein Geschenk mit, weil ihn sein schlechtes Gewissen plagte.
Nyima bekam von diesen Nächten nie etwas mit. An manchen Abenden schlief sie ein, bevor der Vater spät nach Hause kam, und am nächsten Morgen belog Yeshe seine Schwester, der Vater sei bereits wieder zur Arbeit aufgebrochen. Wenn er dann am folgenden Abend heimkehrte, war aus Nyimas Sicht alles in Ordnung, außer dass sie ärgerlicherweise einen Abend mit ihrem Vater verschlafen hatte.
Dieses Mal war es anders verlaufen. Nyima erwachte mitten in der Nacht, weil sie einen Albtraum hatte. Verängstigt lief sie in das Schlafzimmer des Vaters und fand es leer vor. Sie begann sofort zu schreien. Der Verlust der Mutter war noch lange nicht verwunden, und der Gedanke, auch noch das zweite Elternteil verlieren zu können, versetzte sie in Panik. Yeshe gelang es nur sehr schwer, seine Schwester zu beruhigen. Er erzählte ihr eine ganze Reihe von Lügen, um sie bis zum Abend zu vertrösten. Bereits seit dem Nachmittag wartete Nyima am Fenster und wandte ihren Blick nicht von dem Weg ab, auf dem ihr Vater nach Hause kommen würde.
Die übliche Zeit seiner Heimkehr kam und verstrich, ohne dass der Vater erschien. Nyima war mit einem Mal besorgniserregend ruhig. Sie weigerte sich, den Platz am Fenster zu verlassen, und ihr Bruder ließ ihr ihren Willen. Er machte sich nun selbst große Sorgen. Zwei Nächte in Folge war noch nie vorgekommen, und zum ersten Mal bedachte auch er die Möglichkeit, seinem Vater könnte etwas zugestoßen sein.
Yeshe rief durch das Haus, aber er wusste, dass ihm seine Schwester nicht antworten würde. Das konnte sie nicht, denn sie war längst auf dem Weg nach Mêdog. Er kannte sie gut genug, um zu wissen, dass es so war. Er war vertraut mit ihrer nervtötenden Selbstsicherheit und Entschlossenheit, die sie so viel älter erscheinen ließ, als sie eigentlich war. Er hatte sie nicht ernst genommen und versucht, sie auf den folgenden Tag zu vertrösten. Nun hatte sie es selbst in die Hand genommen. So ein Mädchen war seine Schwester. Sie besaß die Fähigkeiten, die man eher einem Jungen zuschrieb und die Yeshe selbst leider völlig fehlten.
Er blickte aus dem Fenster, wo sich die Abenddämmerung bereits ankündigte. Dort draußen war eine Siebenjährige allein unterwegs, zu einem der abgeschiedensten Orte des ganzen Landes.
* * *
Der Weg nach Mêdog war selbst am helllichten Tag beschwerlich, aber nach Einbruch der Dunkelheit grenzte es an Selbstmord. Yeshe hoffte nur, dass seine Schwester genug Vorsprung hatte, um ihr Ziel noch bei Tageslicht zu erreichen.
Er selbst würde dies auf keinen Fall schaffen. Zwar erhellte der Schein seiner Taschenlampe den Weg unmittelbar vor ihm, aber er kam so langsam vorwärts, dass die Batterien niemals für die ganze Strecke ausreichen würden.
Yeshes Dorf war kleiner als der Hauptort Mêdog, obwohl auch der weniger als zweitausend Einwohner hatte. Vor Fertigstellung der großen Straße waren besonders viele Touristen aufgetaucht, um noch einmal die unberührte Natur und die traumhaften Landschaften zu genießen. Sie hatten unentwegt darüber gejammert, dass die Menschen und die Landschaft ihre Ursprünglichkeit und Authentizität verlieren würden. Sein Vater sah die Angelegenheit eher pragmatisch. Zuvor waren die Dörfer nur durch die Bergwege miteinander verbunden gewesen. Alle Lebensmittel und andere benötigten Artikel hatten sie mit Pferden, Maultieren oder auf dem eigenen Rücken transportiert. Wer dies über längere Zeit getan hatte, der würde sich nicht über eine befestigte Straße und einen LKW beschweren. Yeshes Vater hatte dank dieser Straße eine gute Arbeit gefunden, weil sie nun in Mêdog auch Dinge für andere Dörfer herstellen und verkaufen konnten.
Ihr Vater nahm jeden Tag den Bus, doch der fuhr so spät nicht mehr. Wer ein Auto besaß, hatte um diese Uhrzeit keinen Grund mehr, nach Mêdog zu fahren. Außerdem befürchtete Yeshe, dass seine Schwester sich vor einem nahenden Auto eher verstecken würde, als es anzuhalten. Er hoffte bloß, dass Nyima der Straße gefolgt war und sich nicht auch noch verirrt hatte. Sie kannte zwar die Umgebung des Dorfes, doch mit der aufkommenden Dunkelheit verlor auch die Landschaft ihr gewohntes Aussehen.
Entschlossen marschierte er gegen die Dunkelheit an, setzte einen Fuß vor den anderen und schaltete seine Taschenlampe nur dann an, wenn er ein beunruhigendes Geräusch hörte oder von der Straße abkam. Die Touristen konnten sich anfangs die Schwärze überhaupt nicht ausmalen, die hier herrschte. In ihren Ländern verhinderten die nächtlichen Lichter der Großstädte, dass es jemals völlig dunkel wurde.
Es vergingen mehrere Stunden, und er fürchtete, sich verlaufen zu haben. Kein Licht kennzeichnete die Lage des Ortes. Yeshe war ganz sicher, in der richtigen Richtung zu suchen. Mêdog war zwar keine Großstadt, doch auch dort brannten immer irgendwelche Lichter. Doch in dieser Nacht herrschte vollkommene Dunkelheit, als würde Yeshe auf ein Stück unberührter Natur blicken. Er musste auf das Tageslicht warten, aber er hatte das Gefühl, als sei der komplette Ort verschwunden.
DIE SCHIFFE KOMMEN
Ittoqqortoormiit, Grönland, April
Die Eingangstür wurde aufgestoßen und eine mehrköpfige Putzkolonne stürmte herein. Die Frauen und Männer machten sich sofort an die Arbeit, verteilten sich auf die Räume und begannen, die Spuren des Winters zu beseitigen. Das Dach der kleinen Kirche hatte den Schneemassen dieses Mal nicht standhalten können und war an mehreren Stellen gebrochen. Das eindringende Wasser hatte sich während der vergangenen Monate unbemerkt seinen Weg durch das Gebäude gebahnt, und der Schaden war erst aufgefallen, als die Gottesdienstbesucher den Schimmelgeruch bemerkt hatten. Der Frühjahrsputz musste dieses Mal etwas aufwendiger ausfallen.
Knud und Mikaela standen oben auf der Galerie und sahen dem geschäftigen Treiben zwischen den Sitzbänken zu. Die Zweiundzwanzigjährige lehnte dicht neben ihrem Freund am Geländer und wirkte recht locker. Ihre Beziehung hatte auch den zweiten Winter überstanden, und ihnen stand eine gute Zeit bevor.
Die Stimmung in der ganzen Siedlung war ausgelassen und entspannt. Die Wintermonate lagen hinter ihnen und die Versorgungsschiffe waren durch das aufbrechende Eis auf dem Weg zu ihnen. Jeder der knapp 450 Bewohner des kleinen Ortes fieberte deren Eintreffen entgegen. Die Schiffe würden alle die Spezialitäten mitbringen, auf die sie so viele Monate im Jahr verzichten mussten. Jeder im Ort kannte die Vorlieben und Gelüste seiner Nachbarn, weil sie sich schon seit drei Monaten gegenseitig davon vorschwärmten.
Mikaela wartete sehnsüchtig auf frisches Obst, Gemüse und Salat. Auf Dinge, für die sie nicht zuerst eine Konservendose öffnen musste. Knud erwartete neue Bücher. Sein E-Book-Reader war völlig abgegriffen, und er wollte endlich einmal wieder beim Lesen ein Buch in der Hand halten. Jeder im Ort träumte von seinen privaten Bestellungen.
„Nicht träumen, sondern arbeiten!“, donnerte die befehlsgewohnte Stimme von Pastor Lundblad vom Mittelgang herauf. Der Pastor war ein strenger Mann, der von seinen Schäfchen Demut und Unterordnung erwartete, so wie er es selbst in seiner Kindheit gelernt hatte. Er wollte nicht wahrhaben, wie sich die Zeiten änderten, und der Einfluss der Kirche immer mehr zurückging. Das Ansehen von Priestern hatte seinen Tiefpunkt erreicht. Als Mann in Soutane durfte er es sich kaum noch erlauben, ein Kind freundlich anzulächeln, ohne dass sich die Eltern schützend um es scharten und ihn misstrauisch musterten. Sein ganzer Berufszweig stand unter Generalverdacht.
Wohl deswegen hatte er sich an diesen Ort versetzen lassen, wo seiner Meinung nach die Welt noch in Ordnung war und ein Priester der Hirte seiner Gemeinde sein konnte.
Die Bewohner ließen ihn in dem Glauben und waren nachsichtig mit ihm, solange er seine autoritären Anwandlungen nicht übertrieb.
Pastor Lundblad ging auf die Kanzel hinauf und dirigierte von dort aus das Reinigungsteam. Er wies auf verschmutzte Stellen und schimpfte, wenn seine Helfer nicht schnell oder ordentlich genug arbeiteten.
Knud stieg auf eine Leiter und streckte sich zu den Deckenpaneelen, um die Schrauben zu lösen. Mikaela hielt ihm einen Mundschutz hin, den er kopfschüttelnd ablehnte.
„Glaubst du, du bist zu tough für Schadstoffe?“, fragte sie spitz. Knud war hochgewachsen und breitschultrig; das rote Gesicht wurde von einer breitgeklopften Nase dominiert, die aus seiner Zeit als Amateurboxer stammte. Er sah nicht gut aus, aber er war witzig, treu und hatte ein Herz aus Gold. Alles Eigenschaften, die keiner ihrer bisherigen Freunde besessen hatte. Deshalb sollte er Mikaela auch möglichst lange erhalten bleiben.
Knud überlegte kurz, was er darauf erwidern sollte; dann entschied er sich für die schnellere Variante und griff sich den Mundschutz. Mit einer lässigen Bewegung streifte er ihn einhändig über, ohne mit der anderen Hand die Paneele loszulassen.
„Bist du auch so gespannt, was uns erwartet?“, fragte er mit gedämpfter Stimme.
Mikaela hoffte, dass der Schaden nicht zu groß war, denn der Pastor würde sie nicht gehen lassen, bevor alles behoben war.
Die Paneele waren an den Stellen verfärbt, wo das Wasser durchgesickert war. Knud würde sie austauschen müssen. Die spannendere Frage war jedoch, wie es darunter aussah. Von außen hämmerte in diesem Moment jemand auf dem Dach herum. Das war Knuds Freund Tjark, der es von außen flickte.
Wenn alles gut ging, konnten sie am frühen Nachmittag mit der Arbeit fertig sein. Langsam ließ er die Paneele herab und besah sich den Schaden. Das Dämmmaterial war leicht verschimmelt, aber noch zu retten. Er ließ sich von Mikaela ein Cuttermesser und das Schimmelspray reichen. Er schnitt die befallenen Stellen heraus, besprühte alles gründlich und fügte dann neue Stücke ein, die seine Freundin für ihn am Boden zurechtschnitt.
Als er die letzte Schraube festdrehte, zwinkerte er Mikaela zufrieden zu.
„Gebt euch mehr Mühe, die Kirche muss blitzen, wenn die Schiffe kommen“, rief Pastor Lundblad von der Kanzel. Es war eine Tradition, die er eingeführt hatte, dass für die Besatzungen der eintreffenden Versorgungsschiffe ein Gottesdienst gehalten wurde. Die Begeisterung dafür war auf allen Seiten äußerst gering, aber niemand wagte es, dem Pastor zu widersprechen.
Mikaela und Knud warfen sich einen Blick zu. Er verdrehte die Augen, achtete aber darauf, dass Lundblad es von der Kanzel aus nicht sehen konnte. „Wir könnten von hier verschwinden“, sagte er. „Die anderen sind mit ihrer eigenen Arbeit beschäftigt und würden es nicht einmal bemerken.“
Damit lag er sicher richtig. Das siebenköpfige Team unten arbeitete sich wie ein Wirbelwind durch das Erdgeschoss, putzte, wischte, saugte und entsorgte. So verlockend das Angebot auch war, Mikaela fiel die Einwilligung schwer. „Lass uns erst einmal die Kirche auf Vordermann bringen, dann können wir immer noch gehen.“
Knud war enttäuscht. Seine Schwester und ihr Mann arbeiteten ebenfalls gerade in der Kirche. Das bedeutete, Mikaela und er hätten das Haus ausnahmsweise einmal für sich allein gehabt und müssten keinen geräuschunterdrückten Beischlaf ausüben, wie sonst immer.
Mikaela ignorierte seinen enttäuschten Blick und widmete sich wieder ihrer Aufgabe. Sie achtete darauf, dass der Pastor nicht in ihre Richtung blickte, und beugte sich zu Knud. „Wenn die Schiffe da sind, könnten wir uns während des Gottesdienstes an Bord schleichen und ein paar neue Orte ausprobieren.“
Sein Mund klappte auf und ihm war deutlich anzusehen, wie er es sich in allen Einzelheiten ausmalte.
Als gegen Abend die Arbeit endlich beendet war, trafen sich alle vor der Kirche, wo Pastor Lundblad ihnen dankte und auf einen großen Topf mit Suaasat zeigte. Die kräftige Suppe mit Reis und Zwiebeln dampfte und verströmte einen verführerischen Geruch. Daneben stand ein Teller mit Robbenfleischspießen, an denen sich alle bedienten.
Knud zündete sich eine Zigarette an und nahm zwischen den einzelnen Bissen einen Zug. Mikaela hasste seine Angewohnheit, beim Essen zu rauchen, aber sie hatte ihn zu spät kennengelernt, um ihm dies noch abzugewöhnen.
Tjark wies auf den qualmenden Schlund seines Freundes, in dem gerade wieder ein Stück Robbenfleisch verschwand. „Das sieht aus, als würden wir einem Vulkan Opfer bringen.“
Knud begann zu lachen, bis ihm die Tränen kamen und er wegen eines Hustenanfalls unterbrechen musste. Er hustete immer weiter und krümmte sich dabei. Inzwischen hatten alle anderen aufgehört zu lachen und musterten ihn besorgt.
„Meine Güte, Alter, du solltest vielleicht etwas weniger rauchen“, sagte Tjark besorgt.
Knud winkte ab, schaffte es aber nicht, den Husten zu unterdrücken.
„Das liegt bestimmt an dem verdammten Dämmmaterial. Sicher so ein billiger Asbestmist aus dem Schlussverkauf.“ Mikaela funkelte den Pastor wütend an.
„Es ist natürlich völlig unwahrscheinlich, dass es an den zwei Packungen Zigaretten liegt, die er jeden Tag wegpafft“, gab Lundblad ungerührt zurück.
„Lass ihn uns nach Hause bringen“, sagte Knuds Schwester. Sie hakte ihren Bruder unter und ihr Mann griff auf der anderen Seite zu. Mikaela ging vor, um ihnen die Türen zu öffnen. Zu Hause angekommen, schafften sie Knud mit vereinten Kräften in sein Bett.
Der Husten hatte aufgehört, aber er wirkte deswegen kein bisschen gesünder. Stattdessen schien er nun hohes Fieber zu bekommen und verfiel in einen apathischen Zustand.
Mikaela verabreichte ihm Aspirin, denn etwas Stärkeres hatte sie nicht mehr; dann legte sie sich zu ihm ins Bett. Sie wischte den Schweiß von seiner Stirn. Er schaffte es nicht mehr, seine Augen zu öffnen.
„Das wird schon wieder“, flüsterte sie, gab ihm einen Kuss auf die heiße Stirn und löschte das Licht.
DER ANALYST
Cairnbarrow, Schottland, 7. Mai
Leonard Murphy trug einen alten Parka, der offenbar lange Zeit als Hundedecke gedient hatte. Die Kapuze war tief ins Gesicht gezogen, als er durch den kleinen schottischen Ort Cairnbarrow marschierte. Als Tarnung war das unzureichend und zog höchstens neugierige Blicke auf den großen, bärenhaften Vermummten. Seine Hände waren tief in den Taschen des Parkas vergraben, und er starrte stur auf seine Stiefel. Murphy hatte nie Blickkontakt mit anderen Bewohnern. Natürlich heizte sein exzentrisches Verhalten die Gerüchteküche im Ort noch an, aber er überließ es Arnold, bei den Bürgerversammlungen seine Harmlosigkeit zu beteuern.
Der Engländer lebte seit zwölf Jahren in dem Dorf, ohne nennenswerte Kontakte geknüpft zu haben. Jeden Tag marschierte er zur Burg und tat dort irgendwelche merkwürdigen Dinge, über die die Dorfbewohner nur spekulieren konnten. Wahrscheinlich vermuteten sie auf Castle Cairnbarrow einen perversen Swingerklub oder etwas in der Art.
Er passierte die letzten Häuser des Ortes und schritt die schmale Straße hinunter zur Burg.
Castle Cairnbarrow stand auf einer vorgelagerten Erhebung, fast zweihundert Yards von der eigentlichen Küste entfernt, sodass sie aus keiner Richtung vor dem Wind geschützt war. Vom Dorf aus führte der Weg steil abwärts, um dann vor der Burg wieder anzusteigen. An manchen Tagen musste man sich Sorgen machen, auf der Mitte der Strecke nasse Füße zu bekommen, und an allen Tagen fühlte man sich an dieser Stelle wie in einem künstlichen Windkanal für Testflugzeuge.
Der gewaltige Felsen im Meer, auf dem die Burg stand, war von steil abfallenden Klippen umgeben. Von dort aus ging es vierzig Meter in die Tiefe, wo sich die Brandung mit tödlicher Wucht gegen den Felsen warf. Von keiner Seite hatten früher Angreifer auf das Hochplateau gelangen können und der einzige Zugang war leicht zu verteidigen gewesen. Es war der perfekte Ort für eine Festung.
In seiner langen Geschichte wurde Castle Cairnbarrow unzählige Male angegriffen, oftmals über längere Zeiträume belagert, aber niemals erobert. Seine Besitzer wurden denunziert, exkommuniziert und wieder rehabilitiert, aber sie beugten sich niemals einem anderen Willen als ihrem eigenen. Der Geist dieser Starrköpfe schien in den Gemäuern verblieben und auch auf seine aktuellen Besitzer übergegangen zu sein.
Der Eingang zur Burg wurde durch ein stark befestigtes Torhaus bewacht. Dank seiner Lage in einem Felsspalt erhielt es noch eine zusätzliche Verankerung und stellte sogar für heutige Verhältnisse ein zähes Hindernis dar.
Murphy wusste, dass ihn die getarnten Kameras über dem Tor bereits registriert hatten und nun jeden seiner Schritte erfassten. Er verzichtete darauf zu grüßen, falls ihn jemand aus dem Ort beobachtete. Sie sollten ihn nicht für verrückter halten, als sie es ohnehin schon taten.
Neben dem Tor hing in drei Metern Höhe eine gusseiserne Glocke von der Größe eines Kuhkopfes, die mit einer Kette betätigt wurde. Beim Anblick der Glocke glaubte man sofort, dass sie in der ganzen Burg zu hören sein würde.
Murphy ignorierte den Griff der Kette und drückte seine Hand gegen einen unscheinbaren Stein in der Wand, der in Wahrheit ein Fingerabdruckscanner war. Sofort schwang das gewaltige Holztor mit den eisernen Beschlägen zur Seite, und zwar mit einer Leichtigkeit, die das Material Lügen strafte.
Dahinter folgte ein gepflasterter Aufgang zum Innenhof der Burg. Von innen betrachtet wirkte Castle Cairnbarrow längst nicht mehr so baufällig und verwittert wie auf der Außenseite. Die diente lediglich dazu, aufdringliche Touristen zu verscheuchen.
Aus demselben Grund gab es kein Namensschild und erst recht keinen offiziellen Hinweis darauf, wer an diesem Ort seinen Sitz hatte.
Murphy schlug die Kapuze des Parkas zurück, legte seine Hand auf den Türgriff des Hauptgebäudes und wartete, bis der Summer ertönte. Dann drückte er die Tür auf und grüßte den Pförtner, der seinen Weg auf den Monitoren verfolgt hatte.
„Guten Morgen, Leonard“, grüßte der Pförtner freundlich. „Bist früh dran.“
„Die Vorbereitungen dauern heute etwas länger. Ist alles angekommen?“
„Wartet oben, wie immer.“
Murphy nickte dankbar und begann, die breite Steintreppe in den ersten Stock hinaufzusteigen. Unterwegs zog er den Reißverschluss des Parkas nach unten und betrat dann seinen Arbeitsplatz.
Wenn man durch die Eingangstür in den Saal kam, sah man direkt auf den großen Konferenztisch, an dem die Sitzungen stattfanden. Links davon gab es einen etwas kleineren Tisch für die Mahlzeiten. Ansonsten enthielt der Raum drei stationäre Computerarbeitsplätze und vier Laptops. Alle waren mit dem Server verbunden, auf dem jeder Mitarbeiter sein eigenes Profil angelegt hatte. Der Saal war mit einem riesigen Flachbildfernseher und einer digitalen Whiteboardtafel ausgestattet. Sowie mit zwei Sofas und drei Sesseln, um es sich bei längeren Präsentationen bequem zu machen.
An der linken Wand quoll die Präsenzbibliothek aus den Regalen. Gegenüber standen Hunderte von Aktenordnern, in denen sich ihr gesammeltes Wissen in analoger Form befand.
Murphy bereitete den Saal auf das Eintreffen der anderen vor. Er hängte seinen Parka auf, lüftete kurz durch, fuhr die Computer hoch und ging dann in die kleine Küche mit Durchreiche. Wie der Pförtner versprochen hatte, waren alle seine Bestellungen bereits in den Kühlschrank eingeräumt worden.
Er wusch Mangold und schnitt ihn klein. Dann dünstete er Knoblauch in etwas Butter an und gab den Mangold dazu. Mit geübten Handgriffen tupfte er den abgespülten Lachs trocken und beträufelte ihn mit Zitronensaft. Dabei bewegte er sich zur Melodie von „I See a Darkness“. Er würfelte Tomaten und schnitt Pellkartoffeln in Scheiben, bevor er sie in eine gefettete Auflaufform legte. Der nächste Song begann und er schmetterte „The Galway Girl“. Den Lachs und den gewürzten Mangold gab er hinzu, goss eine heiße Brühe mit Schmelzkäse darüber und bestreute alles mit Paniermehl. Dann schob er die Auflaufform in den Backofen und stellte die Zeitschaltuhr ein, damit der Auflauf rechtzeitig für das Mittagessen fertig sein würde.
Murphy sang leidenschaftlich gerne, wenn er kochte. Nicht wirklich gut, aber dröhnend und voll mitreißender Begeisterung, und die Frauen in seiner Umgebung wurden dadurch entspannt und zutraulich. Immerhin etwas. Er war jetzt siebenunddreißig Jahre alt und ohne Chance auf eine große Karriere, nachdem er zwölf Jahre in diesem Job ohne Ansehen und Prestige verbracht hatte. Mit dieser Referenz in seinem Lebenslauf würde er überall auf der Welt Personalchefs zum Lachen bringen.
Er hörte jemanden den Saal betreten und wusste sofort, um wen es sich handelte. So wie er immer der Erste war, traf Orell Franzen immer als Zweiter ein. Er kam grußlos herein und wollte sich sofort an die Arbeit machen. Helen bemühte sich vergebens, ihm zwischenmenschliche Umgangsformen nahezubringen. Orell betrachtete alles analytisch – wie ein Roboter – und ließ dabei den menschlichen Faktor meist außer Acht. Die Tatsache nämlich, dass Menschen entgegen Regeln und Gesetzen agieren konnten und nicht selten auch unlogisch handelten.
„Einen schönen guten Morgen, Orell“, grüßte er übertrieben förmlich und Orell schreckte aus seinen Gedanken auf.
„Oh, hallo Leonard – du hast mich erschreckt.“
„Wie jeden Morgen, wenn ich dich begrüße.“
„Tatsächlich? Ist mir noch gar nicht aufgefallen“, sagte Orell überrascht und zog die graue Strickjacke aus, die er sich immer für den kurzen Weg von seiner Wohnung bis in den Saal überzog. Darunter trug er einen scheußlichen Pullover mit Rautenmuster. Nicht ohne Belustigung stellte Murphy fest, dass die Rauten auf der fülligen Körpermitte eine etwas andere Form hatten als jene, die weiter oben seine Hühnerbrust bedeckten. Orells großer Kopf und der gedrungene Körper verliehen ihm das Aussehen einer Kröte. Schon in seiner Jugend sah er aus wie der späte Peter Lorre. Glücklicherweise machte er sich wenige Gedanken um sein körperliches Erscheinungsbild, obwohl er immer perfekt gepflegt war. Eine Folge all der morgendlichen Rituale, die er so schätzte. Rasieren, Zähneputzen, Hautpflege; alles erfolgte auf die empfohlene Weise.
Orell war wie immer unruhig und hektisch. Er wuselte in der Küche herum und deckte den Tisch, um die Zeit zu überbrücken, bis die anderen Mitarbeiter eintrafen und die eigentliche Arbeit begann. Für einen zwanghaften Charakter wie ihn waren diese sozialen Rituale eine regelrechte Tortur, und er versuchte stets jeden Ablauf zu beschleunigen, um nicht noch mehr wertvolle Zeit zu vergeuden.
Zwei Minuten vor neun setzte sich Orell auf seinen Stuhl und legte seine Unterlagen bereit. Eine halbe Minute später kam Murphy aus der Küche und stellte zwei Warmhaltekannen auf den Tisch, eine mit Tee und eine mit Kaffee. Anschließend setzte er sich Orell gegenüber. Niemals auf einen anderen Platz, denn das schadete Orells Konzentration.
Um exakt eine Minute vor neun betrat Arnold Zähringer den Saal, ging um den Konferenztisch herum und nahm wie gewöhnlich an dessen Kopfende Platz. Niemand würde glauben, dass es sich bei diesem gütigen, humorvollen Endsiebziger, den sich jedes Kind als Großvater wünschte, um einen immens erfolgreichen Selfmademan handelte, der in gleich mehreren Wirtschaftszweigen ein Vermögen gemacht hatte. Er wirkte auf jeden Fall viel zu harmlos. Aber ein harmloser Mann wäre nicht in der Lage, eine Behörde wie diese zu leiten. Eine solche Aufgabe erforderte einen entschlossenen Mann mit Durchsetzungsvermögen und Beziehungen.
Um Punkt neun Uhr blickte Arnold zuerst missbilligend auf die leeren Stühle und dann auf die Eingangstür.
Murphy goss sich seelenruhig einen Becher Kaffee ein. Er wusste, dass Arnold niemals eine Sitzung beginnen würde, bevor alle Mitarbeiter anwesend waren. Genauso wenig, wie es Helen jemals gelingen würde, pünktlich zu erscheinen. Diesen kleinen Machtkampf führten sie, seines Wissens nach, bereits seit über zwanzig Jahren miteinander. Die beiden größten Leidtragenden dieser Auseinandersetzung waren allerdings Orell und Celia. Orell, weil er diese Form der Zeitverschwendung nur sehr schwer aushalten konnte, und Celia, weil sie von Arnold den Auftrag bekommen hatte, Helen pünktlich zum morgendlichen Arbeitsbeginn zu schaffen.
Vor der Tür war lautes Getrappel zu hören und dann wurde die Tür aufgestoßen. Arnold blickte seinen beiden Mitarbeiterinnen entgegen. „Jetzt können wir ja beginnen.“
ROTES KRAUT
Tristan da Cunha, Südatlantik, April
Tristan da Cunha war eine Vulkaninsel und damit die Spitze eines gewaltigen Unterseevulkans. Allein diese Spitze erhob sich bis zum Kraterrand 2060 Meter in die Höhe, und Nigel mochte sich gar nicht ausmalen, was alles unter der Wasseroberfläche lag. Mit einem Vulkan, der seit Jahrtausenden inaktiv war, hätte er leben können, aber dieser hier war zuletzt 1961 ausgebrochen, also vor einem geologischen Augenzwinkern.
Sein neuer Nachbar Roger hatte ihm gleich am ersten Tag stolz das schwarze Lavagestein gezeigt, das fast bis an den Ort heranreichte. Es war damals sehr knapp gewesen. Die gesamte Bevölkerung wurde von der Insel evakuiert. Anschließend mussten die meisten Häuser, der Hafen und die Langustenfabrik wieder aufgebaut werden. Nach dem Vulkanausbruch wurde die Fabrik noch zweimal völlig zerstört. Beim ersten Mal durch einen Orkan, beim zweiten Mal durch einen Brand. Sie wurde immer wieder neu errichtet, weil sie die Haupteinnahmequelle der Bewohner darstellte. Heute war sie auch ein Symbol für die Widerstandskraft und Unbeugsamkeit der Menschen auf der Insel.
Jetzt wurde die Langustenfabrik wieder von einem ernst zu nehmenden Gegner bedroht. Und nicht nur sie, sondern auch jede andere Lebensgrundlage auf der Insel.
Angelockt von den kläglichen Tierlauten eilten die Bewohner herbei. Mehrere Schafe waren in dem roten Unkraut gefangen, das sich immer weiter um sie herum zusammenzog. Die meisten waren aus dem Ring entkommen, bevor er sich schloss, aber einige zögerten zu lange. Bisher waren sie immer weiter den Berg hinauf zurückgewichen, doch nun hatte das Kraut sie eingeschlossen.
Das Wachstum des Krauts verlief weiterhin mit beängstigender Geschwindigkeit, wie Schlangen, die sich in Zeitlupe bewegten. Die Schafe rannten unentwegt an den Gewächsen entlang und versuchten, eine Lücke auszumachen. Ein Schaf sprang, schaffte aber nicht einmal die halbe Distanz. Es landete inmitten der sich windenden Stränge, versuchte herumzurollen und wieder auf die Beine zu kommen, aber es fand keinen Boden unter dem Kraut. Die Stränge legten sich um seine strampelnden Beine. Dünnere Triebe wuchsen um das Tier herum in die Höhe und schlossen sich über ihm.
Die Bewohner sahen fassungslos zu. Das erbärmliche Klagen des Tieres erschütterte sie sichtlich.
„Dieses Mistkraut wird es erdrücken“, ächzte Roger und schien in sich zusammenzusinken. Das Schaf war nicht mehr zu sehen, und auch seine Laute klangen erstickt, als hätte sich das Kraut bereits ins Maul des Tieres gezwängt. Alle Zuschauer zuckten zusammen, als sie laut und vernehmlich das Brechen von Knochen hörten. Dann war es still.
„Oh mein Gott“, hauchte Nigel. Er wollte nur noch weg, doch bisher hatte sich keiner aus der Reihe der Zuschauer entfernt. Wie gefesselt standen sie nebeneinander und starrten auf die Stelle, wo das Schaf verschwunden war. Die Stränge dort schienen noch schneller und kräftiger zu wachsen als bisher.
Mit Entsetzen stellte Nigel fest, dass dieses Unkraut nicht auf Wasser angewiesen war, sondern sich auch andere Flüssigkeiten zunutze machen konnte. Wie beispielsweise das Blut eines Schafes.
„Wir haben genug gesehen und verschwinden“, sagte Rogers Nachbar Barney und seine Familie nickte entschlossen. „Wenn ihr schlau seid, dann kommt ihr mit uns. Wir warten ab, bis dieses Zeug eingeht und wir wieder zurückkönnen, aber bis dahin wollen wir nicht hier festsitzen.“
„Ich werde diese Insel nur mit den Füßen voran verlassen!“, brüllte Roger.
„Wir müssen hier weg!“, rief Nigel. „Wir müssen zum Hafen und in die Boote!“
„Wir können die Insel doch nicht diesem Kraut überlassen.“
„Schau dich doch mal um! Die Insel ist längst verloren!“, schrie Nigel und hatte damit vollkommen recht. Es war nicht nur der Ort, der sich fest im Würgegriff dieses Gewächses befand. Überall entlang der Küste breitete es sich völlig ungehindert aus und wanderte bereits die Steigung zum Krater hinauf. Bald würde das rote Unkraut die ganze Insel überzogen haben und dann war es besser, wenn man sich nicht mehr auf ihr befand.
Barney redete ebenfalls auf Roger ein und schien den Widerstand des alten Mannes aufweichen zu können, doch dann wurde er ziemlich scharf von seiner Frau gerufen und eilte seiner Familie hinterher.
Kurz entschlossen packte Nigel seinen Nachbarn am Arm und zog ihn unsanft mit sich hinunter zum Hafen. Einige Boote hatten bereits abgelegt. Es waren kleine Fischerboote, die sich ganz sicher nicht für eine Atlantiküberquerung eigneten, aber zumindest würde man mit ihnen aus der unmittelbaren Gefahrenzone entkommen können.
Überall in den Häusern wurden eilig die wichtigsten Besitztümer und Proviant eingepackt. Die ersten Stränge drängten sich bereits zu den Türen und Fenstern herein.
„Ich will noch ein paar Sachen einpacken“, rief Roger.
„Dafür ist keine Zeit.“
„Wer hat dich eigentlich zu meinem Retter ernannt?“, brüllte Roger plötzlich und riss seinen Arm frei. „Gerade mal zwei Tage auf der Insel und will mir Befehle geben.“
Nigel blieb stehen und sah den alten Mann an. Roger hatte recht. Warum versuchte er, ihn zu etwas zu zwingen, was er nicht wollte? „Viel Glück!“, wünschte Nigel und rannte allein weiter.
Er sah Barney und seine Familie, die gerade am Ablegen waren. Nigel winkte mit beiden erhobenen Armen und schrie so laut er konnte, als er die Rampe zum Steg hinablief. Barney drehte sich zu ihm, aber der Besitzer des Bootes betätigte den Gashebel. Das Wasser hinter dem Boot wurde aufgewirbelt, und der Bug hob sich in die Höhe. Die Leinen waren los, aber das Boot bewegte sich nicht von der Stelle.
Nigel blieb mitten auf der Rampe stehen und sah hinunter ins Wasser. Etwas Rotes bewegte sich unterhalb der Wasseroberfläche, und dann blieb die Schiffsschraube mit einem heftigen Ruck stehen. Die Stränge hatten sich bereits im Hafenbecken ausgebreitet und waren in die Schraube des Bootes geraten. Mehrere Meter hatten sich darum gewickelt, bis sie blockierte.
„Das Zeug hängt an der Schraube!“, rief Nigel vom Land aus. „Ihr müsst zurückkommen!“
„Verdammt noch mal, ist man denn nirgendwo davor sicher?“, brüllte der Besitzer und versuchte, mit einer Stange die Ranken von der Schiffsschraube zu lösen. Ein völlig aussichtsloses Unterfangen, wenn man gesehen hatte, wie sich dieses Zeug an Land ausbereitete.
„Der Zugang zum Hafen schließt sich, komm zurück!“, rief eine bekannte Stimme Nigel zu. Er blickte zum oberen Ende der Rampe, wo Roger stand und ihn aufgeregt zu sich winkte. Der alte Mann wies auf die dichte Hecke, die sich von beiden Seiten auf ihn zuschob und bald aufeinandertreffen würde.
Nigel meldete die Gefahr an Barney weiter, doch die Leute auf dem Boot hatten nicht die Absicht, wieder von Bord zu gehen.
„Wir verlassen die Insel, selbst wenn wir rudern oder schwimmen müssen!“, schrie Barney und sprach damit wohl für alle an Deck. Das war natürlich Blödsinn, denn die nächste bewohnte Insel war fast 1600 Meilen entfernt.
Nigel blickte zu Roger, der langsam von der Rampe zurückwich, dann zu Barney, der zusammen mit dem Besitzer verzweifelt versuchte, die Schraube zu befreien.
„Verdammt!“, fluchte Nigel laut und rannte die Rampe wieder hinauf. Er lief durch die Öffnung in dem wuchernden Kraut, die gerade noch drei Meter breit war und sich innerhalb der nächsten etwa zwanzig Minuten schließen würde. Er betete dafür, dass Barney und die anderen an Bord es schaffen würden, aber er glaubte nicht daran.
„Gibt es noch irgendwo einen Zugang zum Wasser mit Booten?“
Roger schüttelte den Kopf. „Boote gibt es nur hier, und alle, die noch fahrtüchtig waren, sind inzwischen auf See. Den Rest hat das Kraut in seiner Umklammerung.“
„Wo können wir noch hin?“
Roger wies zur Bergspitze hinauf. „Wir können versuchen, vor dem Kraut oben zu sein. Vielleicht funktionieren dort unsere Satellitentelefone.“
Nigel nickte heftig. „Eine Evakuierung per Hubschrauber sollte dort oben möglich sein.“
„Ja, falls es irgendjemandem gelingt, rechtzeitig herzukommen.“
DIE HALLE
Mêdog, Autonomes Gebiet Tibet, April
Trotz der unzugänglichen Lage und der ständigen Bedrohung durch die Natur erweckte dieses Gebiet die Begehrlichkeiten von China, einem unabhängigen Tibet und auch von Indien.
Yeshe interessierte sich nicht für Politik, genau wie sein Vater. Der sagte immer, es sei völlig egal, unter wessen Regierung sie lebten. Bis die Auswirkungen der Politik ihr abgelegenes Dorf erreichten, habe sie ohnehin längst wieder gewechselt.
Yeshe näherte sich dem Hauptort Mêdog. Bisher war ihm kein Mensch entgegengekommen. Auch kein einziges Fahrzeug. Natürlich war es noch früh am Morgen, aber längst nicht mehr Nacht. Niemand hielt sich auf den Straßen auf, und in den Häusern war kein Licht zu sehen. Es herrschte Totenstille.
Irgendwo musste doch jemand ein Frühstück zubereiten oder ein Badezimmer benutzen. Nicht einmal Tiere waren zu sehen oder zu hören. Yeshe hoffte, seine Schwester und seinen Vater möglichst schnell zu finden, denn dieser Ort war ihm unheimlich, noch bevor er ihn richtig betreten hatte.
Yeshe erinnerte sich an ein Gespräch seines Vaters mit dem Nachbarn, das er vor drei Tagen mit angehört hatte. Die beiden Männer regten sich darüber auf, dass immer mehr Bewohner des Hauptortes spurlos verschwanden. Zuerst nur einzelne, dann immer mehr, und inzwischen mochten es schon an die zwei Dutzend sein. Sie kannten natürlich auch den Schuldigen dafür: die Straße. Leute von außerhalb kamen nach Mêdog, zeigten die Errungenschaften der modernen Welt und prahlten mit dem Luxus der größeren Städte. Nicht alle konnten diesen Verlockungen widerstehen, und so machten sie sich nachts still und heimlich aus dem Staub und ließen ihre Familien unversorgt zurück. Yeshe verstand nicht alle Worte, mit denen sie die Verschwundenen bezeichneten, aber diejenigen Worte, die er kannte, hatte sein Vater ihm verboten zu benutzen.
Lagen sie mit ihrer Vermutung richtig? Hatte sich der ganze Ort aufgemacht, um in den Großstädten ein besseres Leben zu führen? Yeshe konnte sich das nicht vorstellen. Nicht bei allen auf einmal. Aber wo waren dann die Einwohner?
Yeshe erreichte das erste Haus und begann, gegen die Tür zu schlagen. Zuerst noch zögerlich, falls tatsächlich jemand zu Hause sein sollte, aber dann benutzte er die Faust, und am Ende traktierte er die Tür mit dem Fuß. Er wiederholte die vergebliche Prozedur noch bei zwei anderen Häusern, dann gab er auf.
Bei einem Haus fand er ein offenes Fenster und kletterte hinein. Sein Vater hatte ihm so etwas verboten, aber in dieser Situation hätte er es sicher gebilligt. Vorsichtshalber rief Yeshe laut nach den Bewohnern, doch niemand antwortete. Er rechnete auch längst nicht mehr damit. Es wurde Zeit, die Tatsachen zu akzeptieren: Er war völlig allein in dem Ort. Er öffnete die Haustür von innen und trat hinaus.
Ein Knurren ließ ihn zusammenzucken. Er erwartete, einen Wolf oder eine noch schlimmere Bestie zu erblicken. Etwas, das all die anderen Tiere im Ort gefressen hatte.