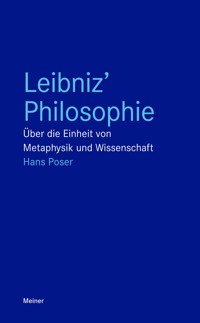7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Reclams Universal-Bibliothek
- Sprache: Deutsch
Zu Recht gilt René Descartes (1596–1650) als wichtigste Gründungsfigur des modernen Rationalismus: Für viele ist er der erste moderne Philosoph überhaupt. Die vorliegende Einführung in das Gesamtwerk nimmt nicht nur die berühmten »Meditationen« mit ihrem radikalen Zweifel und der Formel »Ich denke, also bin ich« in den Blick, sondern auch Descartes' wissenschaftliche Texte zu Mathematik und Physik oder zu medizinisch-anthropologischen Themen: eine Einführung genau so, wie man sie braucht. E-Book mit Seitenzählung der gedruckten Ausgabe: Buch und E-Book können parallel benutzt werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 257
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Hans Poser
Descartes
Eine Einführung
Reclam
2., durchgesehene und ergänzte Ausgabe
2020 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Covergestaltung: Cornelia Feyll, Friedrich Forssman
Coverabbildung: Portrait René Descartes von Frans Hals
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2020
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN978-3-15-961816-6
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-019697-7
www.reclam.de
Inhalt
1 Empirismus und Rationalismus
2 Leben und Werk
3 Die Methode der Analyse und Synthese
4 Der Aufbau der Erkenntnis
5 Die neuen Wissenschaften
6 Ausblick
Literaturhinweise
Zum Autor
[7]1 Empirismus und Rationalismus
René Descartes (1596–1650) wird als Begründer der Philosophie der Neuzeit und eines tiefgreifend veränderten Verständnisses der Wissenschaften gesehen, kurz: als Beginn der Moderne. Um das zu verdeutlichen, gilt es, etwas früher einzusetzen und ein entsprechend breites Feld abzustecken. Mit der Renaissance tritt in der Sicht auf die Welt ein Umbruch ein: Der geschlossene mittelalterliche Kosmos wird gesprengt – und dies nicht nur durch einen Rückgriff auf die Antike und deren Wiedergeburt, wie die Bezeichnung Renaissance verheißt, sondern durch Öffnung ganz neuer Horizonte. Hierzu gehört an erster Stelle das ungeheure Selbstbewusstsein, mit dem der Mensch der Renaissance auftritt, und zwar im Doppelsinn des Wortes, nämlich sowohl im Bewusstsein des eigenen Wertes als auch im Bewusstsein der Reflexion auf sich selbst. Dieses Selbstbewusstsein findet seinen Niederschlag in all jenen künstlerischen und literarischen Leistungen, die, ausgehend vor allem von Florenz, Europa erobern sollten. Zum ersten Mal in der Geschichte wird die Einzigartigkeit und Singularität des Individuums, seine Individualität, seine Unverwechselbarkeit, Selbständigkeit und Selbsttätigkeit zu einer zentralen Denkfigur.
Daneben ist eine andere, gänzlich neuartige Entwicklung zu nennen, wie sie uns in den sich entfaltenden Wissenschaften begegnet. Sie bezieht sich anfangs nur bedingt, dann aber zunehmend stärker auf die Erfahrungswissenschaften, allen voran auf die Medizin. Zunächst vorsichtig, stellen die erwachenden Wissenschaften ihre Einsichten im Sinne der Lehre von der doppelten Wahrheit als ein [8]gegenüber den Glaubenswahrheiten weniger wertvolles, bloß menschliches Wissen dar, das in solcher Gestalt nicht mit der Theologie in Konflikt gerät. In wachsendem Selbstbewusstsein schleudern sie schließlich der Inquisition mit Giordano Bruno (1548–1600) im Jahre 1600 ein »Und sie bewegt sich doch!« entgegen in der Überzeugung, dass die Autorität der alten Autoritäten endgültig zerbrochen sei. Jene Aussage bedeutete nicht bloß, für eine andere Auffassung der Relativbewegung von Erde und Sonne einzutreten, sondern der Erde die Bedeutung zu nehmen, das Zentrum des gottgeschaffenen Kosmos zu sein, um das sich alles dreht – nicht nur im kinematischen Sinne.
Dieser Umbruch, den der Humanismus, den die Philosophie der Renaissance einleitete, mag heute meist nicht mehr so schroff gezeichnet werden, wie dies eben geschah; entscheidend bleibt jedoch, dass der Umbruch an der Schwelle zum 17. Jahrhundert vollzogen ist. Es fehlte hingegen eine Perspektive, eine Sichtweise, welche die neuen Elemente zu einem neuen Weltbild zusammenzuführen vermochte. Dieses hatte der Subjektivität des Individuums ebenso Rechnung zu tragen wie den Wissenschaften einen zentralen Platz einzuräumen. Es konnte sich nicht mehr auf die auctoritas von Lehrmeinungen stützen; es bedurfte einer veränderten Berufungsinstanz und damit auch einer anderen Methode zur Entwicklung des gesuchten Weltbildes.
Worin aber sollte das Fundament bestehen? So stehen Zweifel und Skepsis am Anfang, und – da man sich ja auf andere, also auf Autoritäten gerade nicht stützen wollte – zugleich die Notwendigkeit, diesen Neuaufbau beim Individuum, beim erkennenden Subjekt einsetzen zu lassen [9](das damit dem Erkenntnisobjekt als etwas grundsätzlich anderes gegenübertritt). Da dies im Übrigen zugleich mit der kopernikanischen Theorie, die die Sonne in das Zentrum des Universums steckt und die Erde an den Rand drängt, zum drängenden Problem wird, ergibt sich eine große Spannung: Während das anthropomorphe Weltbild des Mittelalters (der Mensch ist das Maß aller Dinge) zerbricht und die Erde als einer von vielen Planeten an einen peripheren Platz des Universums rückt, soll das erkennende Individuum so sehr im Zentrum stehen, dass alle Erkenntnis in ihm wurzelt.
Wie lässt sich diese Aufgabe lösen, was vermag diese einander zuwiderlaufenden Grundforderungen nach allgemeinsten, von allem Individuellen unabhängigen Naturgesetzen auf der einen Seite und der Betonung des Individuums und seiner Erkenntnisleistung auf der anderen Seite zusammenzubringen? Zwei Ansätze sind es, die sich mit Nachdruck anbieten, das Problem zu bewältigen, der des Empirismus und der des Rationalismus. Diese Bezeichnungen selbst sind viel jüngeren Datums, wenngleich sich beide Positionen in der Geistesgeschichte zurückverfolgen lassen, die eine bis zu Aristoteles (384–322 v. Chr.) und seiner Hinwendung zum Erfahrungswissen, die andere bis zu Platon (um 428–347 v. Chr.), der auf das Allgemeine abzielte; doch mit einer solchen Rückwendung zur Antike würde man das Anliegen verfehlen, das Empirismus und Rationalismus eint: Beide suchen in skeptischer Absicht eine vom Individuum ausgehende Sicherung und Begründung aller Erkenntnisse – aller, nicht nur der Erfahrungswissenschaften und der Mathematik, sondern auch der Ethik als Begründung der Regeln menschlichen Handelns.
[10]Von ›Rationalismus‹ und ›Empirismus‹ schematisierend zu sprechen, wie dies hier geschieht, mag in gewisser Hinsicht leichtfertig erscheinen – handelt es sich doch um Begriffsbildungen des 19. Jahrhunderts, die einer Systematisierung der Philosophiegeschichte dienen sollten und die doch die Vielschichtigkeit der Wechselbeziehungen zwischen beiden Seiten übergeht. Zur groben Orientierung bleibt die Unterscheidung dennoch hilfreich, weil sie wichtige Grundzüge gut zu verdeutlichen vermag. So verstanden, sind beide Ansätze gegeneinander abzugrenzen. In der Philosophiegeschichte pflegt man auf Namen zurückzugreifen; danach zählen als Empiristen vor allem Francis Bacon (1561–1621), Thomas Hobbes (1588–1679), John Locke (1632–1704), George Berkeley (1685–1753) und David Hume (1711–1776). Ihnen stehen die Rationalisten René Descartes, Nicolas Malebranche (1638–1715), Arnold Geulincx (1624–1669), Baruch de Spinoza (1632–1677), Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) und Christian Wolff (1679–1754) gegenüber, um nur die wichtigsten zu nennen.
Doch Namen sagen nicht viel. Hilfreicher ist eine allgemeine Kennzeichnung und Gegenüberstellung. Gemeinsam ist beiden Strömungen das Bemühen um eine Fundierung der Erkenntnis, beide wollen deshalb in skeptischer Absicht alle Inhalte unseres Denkens durchmustern und auf eine neue, solide Grundlage stellen. In Bezug auf die Sicherheit und Unverbrüchlichkeit eben dieser Grundlage trennen sich aber deren Wege.
Die Empiristen sehen die Grundlage im Erfahrungsgegebenen, während die Rationalisten sie in der Vernunft erblicken. Wir müssen dies richtig verstehen: Kein Empirist [11]meint, auf Vernunft verzichten zu können; aber er sieht in ihr nur ein Werkzeug, nicht jedoch die Grundlage, von der aus der neue, sichere Aufbau der Erkenntnis zu erfolgen habe, denn, so argumentiert Locke, nichts kann im Verstand sein, was nicht zuvor in den Sinnen war.
Der Rationalist hingegen wird die Notwendigkeit, Erfahrungen zu machen, nicht leugnen; aber, so wird er argumentieren: Ohne den Filter des Verstandes, ohne dessen Vermögen, dieses Material kritisch zu prüfen und aufeinander zu beziehen, wäre Erfahrungserkenntnis gar nicht möglich. Das Primäre ist für ihn also die Vernunft – und die besteht nicht nur in einem logisch-kombinatorischen Verstand, sondern aus Inhalten, die zumindest dispositionell, also als Veranlagung, angelegt sein müssen, um Erkenntnis gewinnen und begründen zu können. Die Sicherheit und die sicheren Grundaussagen stammen allein aus der Vernunft!
Nun mag es scheinen, als suchten zwar beide Richtungen, der kontinentale Rationalismus und der englische Empirismus, die Begründung an verschiedener Stelle, doch seien sie deshalb methodisch – zumindest zunächst – nicht wesentlich voneinander verschieden: Denn beide sind gezwungen, all das, was wir in unserem Denken an Vorstellungen, Begriffen, Ideen und Theorien vorfinden, zu analysieren, um die Rückführung auf die jeweilige Basis vornehmen zu können. Das trifft in gewisser Weise zu; doch setzen beide schon bei etwas gänzlich Verschiedenem ein: Der Empirist analysiert die Sprache, fragt im Anschluss nach den zusammengesetzten Begriffen und sucht schließlich diejenigen Begriffe auf, die einfach sind. ›Einfach‹ heißt dabei für ihn ein Begriff, der unmittelbar einem [12]Wahrnehmungsgegebenen auf solche Weise zugeordnet ist, dass eine Auflösung begrifflich nicht möglich ist, weil sie in der Wahrnehmung nicht möglich ist. Beispiele hierfür wären ›rot‹, ›hart‹, ›Erdbeergeschmack‹. Sinnvoll, wird dort argumentiert, ist ein Begriff nur dann, wenn er entweder einfach in diesem Sinne oder aber nach bestimmten Assoziationsregeln aus diesen einfachen Begriffen zusammengesetzt ist.
Ganz anders dagegen der Rationalist: Auch er sucht einfache, nämlich unzerlegbare Begriffe; aber sein Kriterium lautet, dass diese in ihrem Inhalt durch sich selbst erkannt werden müssen. Solche einfachsten Begriffe sind deshalb gerade nicht auf Wahrnehmungen bezogen; vielmehr bleibt das Denken gewissermaßen bei sich, es muss sein eigener Garant sein. Diese Begriffe beziehen sich also nur auf das Denken und sind insofern das Allgemeinste, das überhaupt gedacht werden kann; es handelt sich mithin um das, was seit Aristoteles als »Kategorien«, als Grundbegriffe unseres Denkens bezeichnet wird, wie beispielsweise »Substanz«, »Essenz«, »Existenz«, »Möglichkeit«, »Notwendigkeit«. Eine bloße Möglichkeit beispielsweise ist in der Wirklichkeit nirgends empirisch auffindbar, denn dort ist alles wirklich und nicht (bloß) möglich; wir müssen den Begriff der Möglichkeit also aus unserem Denken selbst schöpfen!
An diesen Ansätzen wird deutlich, wo die Wurzeln beider Denkrichtungen liegen. Während der Empirist die Grundbegriffe des Rationalismus nur als Abstrakta zulassen möchte, die durch Verallgemeinerung gewonnen und deshalb nur nomina – Namen – sind, wird der Rationalist in seinen Grundbegriffen etwas sehen, dem eine [13]eigenständige Seinsweise als Begriff, als Idee zukommt: Sie sind in diesem Sinne real, eine res. So schließen sich die Empiristen einer nominalistischen Tradition an (und das bis heute), während die Rationalisten in der Nachfolge des platonischen Begriffsrealismus stehen.
Aus diesen verschiedenen Ansatzpunkten ergeben sich zwangsläufig zwei unterschiedliche Methoden für den Aufbau der Erkenntnis:
Wenn der Empirist vom Erfahrungsgegebenen ausgeht, also von der individuellen, singulären Wahrnehmung, dann muss er zu allgemeinen Aussagen induktiv fortschreiten. Seine Methode wird deshalb vor allem in der Induktion bestehen, wie Bacon sie beschrieben hat und wie Hume den methodischen Weg der Erkenntnis als Weg vom Besonderen zum Allgemeinen kennzeichnete.
Ganz anders dagegen der Rationalist: Er geht gerade nicht vom Singulären und Individuellen aus, sondern von dem, was jedem Vernünftigen kraft seines Verstandes unmittelbar und zweifelsfrei einleuchtet. Dies kann nur etwas Allgemeines sein, aus dem alles andere vermöge der Ableitung, der Deduktion, sei es in Gestalt der Logik, sei es in mathematischen Ableitungen, gewonnen werden muss. So nehmen mathematische und logische Untersuchungen bei den Rationalisten einen ungleich größeren Raum ein als bei den Empiristen. Und wenn Immanuel Kant (1724–1804) später sagen wird, etwas sei nur so weit eine Wissenschaft, als Mathematik darin enthalten sei, so steht er damit in dieser Tradition des Rationalismus.
Schließlich gilt es, einen weiteren Punkt festzuhalten, der sich nicht so unmittelbar methodisch umsetzt, der aber dennoch auf Schritt und Tritt spürbar wird: Die [14]Empiristen halten an ihrer skeptischen Grundhaltung auch nach dem Rückgang auf die Wahrnehmungsgegebenheiten fest und setzen in dieser Einstellung an zu einer Kritik am Seele-Begriff und der Unsterblichkeit der Seele, am Substanzbegriff und damit an Gott als oberster Substanz, an der Sprache und damit an der Vorurteilsbeladenheit allen Denkens. Demgegenüber bedeutet der methodische Zweifel der Rationalisten nur ein Bemühen um eine sichere Grundlegung, von der aus der Neuaufbau erfolgen soll, und dies nicht mit dem Ziel einer Kritik, sondern in der Absicht, die Welt bis hin zu Gott als begreifbar nachzuweisen: Menschliches Denken, menschliche Erkenntnis ist nicht in enge Grenzen eingeschlossen, denn die Welt in ihrer Gesetzmäßigkeit, die Ethik in ihrer Vernünftigkeit, die ExistenzGottes schließlich sind erfassbar, Kausalität und Finalität der Welt erscheinen durchschaubar.
Der Erfolg der Naturwissenschaften ist auf dem Hintergrund dieses rationalistischen Paradigmas zu sehen. Sie stellen den vernünftigen Zugriff auf die Welt dar, den der Rationalismus als grundsätzlich möglich nachzuweisen trachtet. Der Vernunftoptimismus – der im Übrigen zusammen mit der skeptisch-ideologiekritischen Komponente des Empirismus im 18. Jahrhundert die Aufklärung hervorbringen sollte –, dieser Optimismus findet seine systematische Eingrenzung erst in KantsKritik der reinen Vernunft als Kritik der Vernunft an sich selbst. Das ist der Grund, weshalb man wohl noch die Wolff’sche Schule, also die Philosophie des Aufklärers Christian Wolff und seiner Schüler, nicht aber Kant dem Rationalismus zurechnet. Dennoch – bewundernswert bleibt die denkerische Kraft, [15]die, auf sich selbst gestellt, jene philosophischen Systeme hervorbrachte, in denen die Philosophie nicht mehr die Magd der Theologie ist, sondern in denen der Mensch, durch die kopernikanische Theorie zu einem Zufallsprodukt am Rande des Universums erniedrigt, sich selbst zum erkennenden Zentrum dieser Welt erhebt und sie erkennend als einen Kosmos erweist. So kann Hegel (1770–1831) Descartes als den »wahrhaften Anfänger der modernen Philosophie«1 preisen, der – nach mehr als einem Jahrtausend der Abhängigkeit – die Philosophie zu ihrem ureigensten Gegenstand zurückführe, nämlich zum Prinzip des Denkens und zur Reflexion auf eine Welt, in der alles reguliert ist durch das Denken.
Fassen wir kurz die Bestimmungsstücke zusammen, die soeben für den Rationalismus herausgearbeitet wurden: Sein Ziel ist die begründete Erkenntnis durch Ratio und der Erweis der Erkennbarkeit der Welt. Seine Methode besteht im Zweifel an Autoritäten, Überlieferungen und Wahrnehmungen, in einer Analyse der Denkinhalte, ausgerichtet auf eine Freilegung der einfachsten Begriffe und allgemeinsten Prinzipien, um hierauf gesichertes Wissen bauen zu können: Die Axiomatik in Gestalt der Regeln für die Art des Vorgehens wird so nach dem Vorbild der GeometrieEuklids (um 300 v. Chr.) zum einenden Methodenideal. Mit der großen Bedeutung, die im Rationalismus dieser Methode zukommt, wird nicht nur die theoretische Grundlage für Galileo Galileis (1564–1642) These nachgetragen, das Buch der Natur sei in mathematischen Zeichen [16]geschrieben, sondern auch das Fundament für jenen Optimismus gelegt, der in der Vernunft das menschliche Mittel der Naturbeherrschung und späterhin auch der Geschichtssteuerung sehen wird.
Diese Kennzeichnung macht deutlich, dass der Rationalismus eine erkenntnistheoretische, nicht eine ontologische Position bezieht, fragt er doch primär nach der Erkenntnisbegründung unter dem Vorrang, dem Primat der Vernunft, während die Frage nach der Seinsweise der Erkenntnisgegenstände zurücktritt und höchst unterschiedlich beantwortet wird. So ist die vielfach zu findende Behauptung unzutreffend, der Rationalismus müsse dem Idealismus, der Empirismus dem Realismus zugerechnet werden. Für den Empiristen gilt zwar, dass Hobbes etwa Materialist, nämlich Atomist war (es gibt kleinste Teilchen, die als solche nicht mehr teilbar sind); doch nach einer Übergangsphase bei Locke sind Berkeley und Hume Sensualisten, also subjektive Idealisten. Dagegen ist Descartes Dualist – es gibt für ihn sowohl das Denken als auch die Materie –, ebenso Malebranche, während Spinoza Monist ist und Denken und Materie als zwei Aspekte ein und desselben ansieht. Erst Leibniz ist Idealist in einer spezifischen Vereinigung von Elementen des objektiven und des subjektiven Idealismus; Christian Wolff hingegen kehrt zum dualistischen Standpunkt Descartes’ zurück, wie später auch Kant – wenngleich auf andere Weise.
Gerade dieser Wechsel der Positionen bezeichnet aber bereits Probleme, die sich dem Rationalismus stellen und die sich angesichts der genannten Ziele zum Leitfaden wählen lassen. Dazu zählen
[17]das Verhältnis von Erfahrung und Vernunft,
das damit zusammenhängende Verhältnis von Körper und Geist (Leib und Seele),
das Problem des Verhältnisses von Vernunft und Leidenschaft (Affekt) sowie
das Problem der Freiheit und der Begründung der Ethik.
Ein weiteres Problem tritt hinzu: Wenn diese Welt erkennbar ist, wenn auch die Grundaussagen der Ethik aus der Vernunft gewonnen werden können, so stellt sich dem Rationalismus die brennende Frage, wie das erkennbar Schlechte in der Welt mit der Güte Gottes vereinbar ist – das sogenannte Theodizeeproblem. Man wird das Problem deshalb zu denjenigen Fragen zählen müssen, die für den Rationalismus zentral sind oder sich zwangsläufig ergeben, auch wenn es bei Descartes allenfalls angelegt, bei Spinoza zurückgedrängt und erst bei Leibniz in seiner ganzen Breite behandelt wird.
Warum, so ist am Ende dieser Einleitung zu fragen, gilt der Rationalismus, gilt Descartes’ Denken nun aber als Beginn der neuzeitlichen Philosophie? Was ist daran so neu, so anders? Warum auch wird dies erst in zweiter Linie von Bacon, dem Begründer des Empirismus, gesagt? Schließlich ist doch alles so neu nicht: Der Ausgang vom Einzelnen findet sich bei Aristoteles; und das berühmte cartesische cogito ergo sum – »Ich denke, also bin ich« – hat schon Kirchenvater Augustinus gesagt. Die Forderung nach methodischem Vorgehen kennzeichnete Platon in seiner dihairetisch-dialektischen Methode, die Begriffe systematisch ordnet und in ihrem inneren Bezug erfasst, ebenso wie Aristoteles, der gerade aus solchen Gründen die Logik[18]entwickelte. Das ideale Modell eines axiomatischen Systems schließlich stammt von Euklid. Hatten die Mathematiker in bewundernswerten Gedankengebäuden der Geometrie nicht längst schon jene Systematik entwickelt und angewandt, welche die Rationalisten suchen? Hatten nicht die Jesuiten Tycho Brahes (1546–1601) Konzept akzeptiert und sich bemüht, moderne Astronomie – durchaus im Sinne von Kopernikus (1473–1543) – zu treiben? Von den vorgenommenen Kennzeichnungen bliebe also nur die eine, die Kritik an Autoritäten!
All dies mag zutreffen, und doch wäre es eine bloß äußerliche Beschreibung. Denn während sich etwa der empiristische Ansatz mühelos mit Hilfe der Lehre von der doppelten Wahrheit (also einer Trennung von christlicher Glaubenswahrheit und weltlichem Wissen) in eine nominalistische Scholastik integrieren ließ, wurden alle solchen Versuche vom Rationalismus zurückgewiesen. Damit aber war eine der zentralen Lehren des Tridentinum (Trienter Konzil, 1545–63) als Auftakt zur Gegenreformation zurückgewiesen, wonach nämlich die Tradition echter Bestandteil der Auslegung der Heiligen Schrift und damit Bestandteil der Heilslehre sei. Ein Ansatz wie der des Rationalismus, der nicht bereit ist, eine Tradition zum Wahrheitsbeweis heranzuziehen, greift die Basis der katholischen Lehre ebenso wie die Grundlage der sich entwickelnden protestantischen Orthodoxie an. Dieser Angriff erfolgte überdies mit dem Anspruch, allein die Vernunft sei beim Geschäft der Erkenntnis am Werk, eine menschliche Vernunft, die eine Offenbarung gar nicht als Inhalt einer wissenschaftlichen Aussage würde gelten lassen können. Dies alles schließt eine Vernunftreligion, Gottesbeweise oder [19]Unsterblichkeitsbeweise der Seele nicht aus – ganz im Gegenteil, zeigen sie doch die Leistungsfähigkeit solcher Vernunft. Wenn Descartes also der Neubegründer der Philosophie genannt wird, so liegt es wesentlich an dieser Sichtweise, die dem erkennenden Einzelnen und dessen Vernunft den Vorrang vor der Tradition einräumte.
[20]2 Leben und Werk
René Descartes, früher gelegentlich »Des Cartes« oder latinisiert »Cartesius« geschrieben und wegen seiner Zugehörigkeit zum niederen Adel auch bezeichnet als »Sieur du Peron«, wurde am 31. März 1596 in La Haye (heute: La Haye-Descartes) in der Touraine geboren. Sein Großvater war Arzt, sein Vater wie auch sein Bruder Justizbeamter; seine Mutter starb, als Descartes ein Jahr alt war. Etwa ab 1607 bis 1614 besuchte er die im Jahr 1604 gegründete Jesuitenschule in La Flèche (Anjou), eine der besten und modernsten Schulen Europas. Er lernte dort Latein und Griechisch, die aristotelisch orientierte scholastische Philosophie und Mathematik, er erwarb Kenntnisse über Galilei und das kopernikanische Weltbild und erhielt die Erlaubnis zur Lektüre von auf dem Index stehenden verbotenen Schriften. Für einen jungen Mann von Welt, wenn auch von niederem Adel, traten Schauspiel, Fechten und Federball hinzu. 1616 bestand er in Poitiers das Bakkalaureat und das Lizentiat der Rechte, ohne jedoch später die Stelle eines Juristen anzutreten. Vielmehr wollte er, wie er später sagen wird, die Welt kennenlernen. So zog er zur militärischen Ausbildung nach Holland zu Moritz von Nassau (1567–1625), dessen Militärschule hohes Ansehen genoss. Dort traf er 1618 Isaac Beeckman (1588–1637). Diese Begegnung muss Descartes’ Interesse an Philosophie geradeso wie an Physik und Mathematik geweckt haben, denn Beeckman, ein acht Jahre älterer Mediziner, vermittelte ihm die Auffassung, Physik müsse, um strenge Wissenschaft zu werden, in Mathematik verwandelt werden. So schrieb Descartes für Beeckman sein erstes kleines Werk, das Compendium [21]Musicae (Leitfaden der Musik), das eine Proportionenlehre musikalischer Intervalle im Geiste der pythagoreischen Tradition zum Inhalt hat und insofern dem Gedanken einer Mathematisierung entgegenkam.
Im Jahre 1619, ein Jahr nach Beginn des Dreißigjährigen Krieges, finden wir Descartes in Kopenhagen und Danzig, in Polen, Österreich, Ungarn und Böhmen und schließlich in Frankfurt am Main bei der Kaiserkrönung Ferdinands II. Während die Kampfhandlungen ruhten, verbrachte er den Winter 1619/20 in Ulm im Gespräch mit dem Mathematiker Johann Faulhaber (1580–1635), einem Rosenkreuzer. Am 10. November 1619 hatte Descartes drei Träume, die ihn sehr bewegten und ihn eine Wallfahrt nach Loreto geloben ließen. Wichtiger aber: Nach heute verlorenen Aufzeichnungen, auf die sich sein erster Biograf Adrien Baillet stützte, bestärkten ihn diese Träume in dem Gedanken, eine universelle Wissenschaft nach einheitlicher Methode aufzubauen.2
Ein Jahr später war Descartes möglicherweise an der Schlacht am Weißen Berge beteiligt, durch die der böhmische König Friedrich von der Pfalz (1596–1632) seine Krone verlor, eben jener König, dessen Tochter Elisabeth von der Pfalz (1618–1680) zwei Jahrzehnte später in intensivem Gedankenaustausch mit Descartes stehen sollte. Während er 1622 in Rennes, Poitou und Paris weilte, reiste er zwei Jahre darauf nach Italien. Dass er bei dieser Reise auch sein Gelübde einer Wallfahrt nach Loreto einlöste, ist möglich; sicher ist hingegen, dass es nicht zu einer Begegnung mit Galilei kam. 1625 kehrte Descartes nach Paris [22]zu selbständiger wissenschaftlicher Tätigkeit zurück. Durch den Verkauf von Liegenschaften der Mutter war er finanziell unabhängig geworden; so konnte er sich ungestört Problemen der Dioptrik widmen, der Lehre vom Licht in durchsichtigen Medien. Mit Pater Marin Mersenne (1588–1648), dem ›Briefträger des wissenschaftlichen Europas‹, verband ihn eine enge Freundschaft. (Mersenne, selbst Mathematiker und Physiker, vermittelte zahlreiche Briefwechsel, die auch anderen Lesern zugänglich gemacht wurden und damit in dieser halb-öffentlichen Form Vorläufer der späteren wissenschaftlichen Zeitschriften darstellten.) Es entstand der Gedanke der morale provisoire, einer vorläufigen Moral, deren Grundsätze ein Jahrzehnt später im Discours de la Méthode entwickelt werden sollten.
Im Jahre 1628 emigrierte Descartes in die Niederlande, in das europäische Land, in dem am ehesten Meinungs- und Religionsfreiheit herrschten. Zugleich waren die Niederlande ein Zentrum des Handels und der Wissenschaften. Hier finden wir ihn im Gespräch mit dem Theologen Abraham Heidanus (1597–1678) und dem Philosophen Adrian Heereboord (1614–1661), mit den Medizinern Cornelius van Hogelande (um 1590–1662), der auch Alchemist war, und Henricus Regius (1598–1679), der Descartes’ erster Schüler werden sollte. Befreundet war er mit Constantijn Huygens (1596–1687), Sekretär des Prinzen von Oranien; und zu dessen Sohn Christiaan (1629–1695) – einem berühmten Physiker – entwickelt sich ein väterliches Verhältnis. Seinen Wohnsitz wechselte er vielfach, möglicherweise, um nicht so leicht auffindbar zu sein – getreu seiner Lebensmaxime »bene vixit, qui bene latuit« (»Gut hat gelebt, wer sich gut [23]verborgen hat«)3. In den Jahren 1623 bis 1629 entwarf er die Regulae ad directionem ingenii (Regeln zur Leitung des Verstandes), die jedoch nicht vollendet wurden und erst 1701 im Druck erschienen, die aber beispielsweise Leibniz, der sich eine Abschrift besorgt hatte, schon früher bekannt geworden waren. Anliegen der Regulae ist es, für alle Wissenschaften eine an der Mathematik orientierte Methode zu entwickeln, ein Ansatz, der – scheinbar im Plauderton – 1637 im Discours de la Méthode (Abhandlung über die Methode, seine Vernunft richtig zu leiten und die Wahrheit in den Wissenschaften zu suchen) aufgenommen wird. Doch der Discours gilt nicht nur der Darstellung dieser neuen Methode, deren sich jeder Mensch bedienen kann, weil im Grundsatz alle an der Vernunft teilhaben – er entwickelt erstmals das »Ich denke, also bin ich«4. Nun ist diese Schrift als Einleitung zu exemplarischen Beispielen der geplanten neuen Wissenschaft gedacht; sie erschien zusammen mit einer Arbeit zur Lichtbrechung, La Dioptrique, einer zur Geometrie, La Géométrie, in der das entwickelt wird, was wir heute Analytische Geometrie nennen, und einer Abhandlung mit dem Titel Les Météores (Die Himmelskörper), in der es um Phänomene am Himmel wie Wolken und den Regenbogen geht. Schon diese Verbindung zeigt, dass Descartes’ Philosophie gar nicht anders als in ihrem Zusammenhang mit den Wissenschaften gesehen werden darf, auch wenn es der Discours war, welcher ihn rasch berühmt machte. [24]Bereits 1632 war die Schrift Le Monde (Die Welt) entstanden, die Descartes aber wegen der Verurteilung Galileis (1633) und aus Sorge um Auseinandersetzungen mit der katholischen Kirche nicht veröffentlichte.
Ein erster Entwurf der Meditationes war schon gegen 1634 entstanden; 1641 erschien das Werk unter dem Titel Meditationes de Prima Philosophia (Meditationen über die Grundlagen der Philosophie, in denen die Existenz Gottes und die Unsterblichkeit der Seele [von der zweiten Auflage an: die Verschiedenheit der menschlichen Seele vom Körper] bewiesen werden).
Die Meditationes sind das zentrale philosophische Werk Descartes’, denn in ihm entwickelt er jenen eigenen Ansatz, der als die Begründung des Rationalismus gilt. Vor dem Druck waren sie über Mersenne einer Reihe renommierter Fachleute mit der Bitte um Stellungnahme zugegangen. Diese Einwände stammen neben zwei Sammelberichten, die Mersenne zusammengestellt hatte, von dem Theologen De Kater (Caterus, um 1590–1655), der die Gottesbeweise kritisierte, dem englischen Philosophen Thomas Hobbes, der in seiner materialistischen Seelentheorie die völlige Gegenposition zu Descartes und dessen Unterscheidung von Seele und Körper vertrat, dem Theologen Antoine Arnauld (1612–1694), der sich vor allem mit theologischen Problemen auseinandersetzte, und dem empiristischen Philosophen Pierre Gassendi (1592–1655), der sich gegen Descartes’ These von den eingeborenen Ideen wandte; in der zweiten Auflage von 1642 wurden Kritiken von Pater Pierre Bourdin (1595–1653) hinzugefügt. Sie alle wurden, ergänzt um Entgegnungen Descartes’, zusammen mit den Meditationes gedruckt.
[25]Dass die neue Grundlegung nicht nur philosophische Erwägungen zu tragen vermag, sollen die 1644 erscheinenden Principia Philosophiae (Prinzipien der Philosophie) zeigen, in denen Descartes – nach einer kurzen Zusammenfassung der Meditationes – den Versuch unternimmt, die ganze Theorie der physischen Welt auf dem neu geschaffenen Fundament aufzubauen. Dasselbe Ziel verfolgt er für eine Theorie der menschlichen Empfindungen und eine Theorie der Funktionsweise des menschlichen Körpers, beide ursprünglich als Teil der Principia geplant, doch erst mit den 1649 erscheinenden Passions de l’Âme (Die Affekte der Seele) und dem postum 1661 veröffentlichten Traité de l’Homme (Abhandlung über den Menschen) verwirklicht.
Von drei Frankreichreisen abgesehen, lebte Descartes von 1628 bis 1649 in den Niederlanden. Aufgrund einer Einladung der Königin Christine von Schweden (1626–1689), der zu folgen er mehrfach hinauszögerte, die aber immer drängender vorgetragen wurde, reiste er im Herbst 1649 nach Stockholm. Doch die Monarchin war viel zu beschäftigt, um sich der Philosophie zu widmen; erst Mitte Januar des folgenden Jahres fand sie Zeit, sich dreimal die Woche, morgens um fünf Uhr, in Philosophie unterweisen zu lassen. Descartes, von Natur alles andere als ein Frühaufsteher, holte sich zu so nächtlicher und eisiger Stunde eine Lungenentzündung, und da er allen Ärzten misstraute und deren Hilfe von sich wies, starb er nach neun Tagen, am 11. Februar 1650. Dass dies in Wirklichkeit kein natürlicher Tod, sondern ein Mord gewesen sei, heraufbeschworen durch das angespannte Verhältnis von Protestanten und Katholiken am schwedischen Hof, wird immer wieder behauptet, auch wenn die Indizien dafür sehr schwach sein [26]mögen. – Sechzehn Jahre später wurden Descartes’ sterbliche Überreste nach Frankreich überführt. Schon drei Jahre zuvor waren seine Schriften auf den Index gesetzt worden, während sich sein Denken, sein Wissenschaftsverständnis und seine Philosophie über ganz Europa ausbreiteten. Von Holland und dort insbesondere von den Medizinern weitergetragen, erfasste es in einem halben Jahrhundert praktisch alle Universitäten: Der Cartesianismus hatte sich auf dem Kontinent als neue, die Wissenschaften begründende Weltsicht durchgesetzt.
[27]3 Die Methode der Analyse und Synthese
Wenn das Ziel des Rationalismus der Erweis der Verstehbarkeit der Welt und insbesondere die Begründung unseres Wissens ist, so bedarf es einer Methode, welche die Sicherheit eines jeden Schrittes gewährleistet. Sie entwickelt zu haben, gilt in der Geschichte der Philosophie als eines der hauptsächlichen Verdienste Descartes’.5 Erst ein methodisches Vorgehen lässt aus einzelnen, isolierten Wissensbeständen eine wissenschaftliche Aussage entstehen. Mehr noch: Wenn Erkenntnis auf richtigem Denken beruht, so werden die Regeln des richtigen Denkens, die Kriterien der Wahrheit und die Methode der Erkenntnisgewinnung und -sicherung zum Zentralproblem schlechthin.
Das, was Descartes zum Methodenproblem zu sagen hat, ist im Discours de la Méthode bei weitem nicht so konzipiert, wie man angesichts der Bedeutung des methodischen Zugangs hoffen sollte; es empfiehlt sich deshalb, zum besseren Verständnis vom unvollendeten, postum veröffentlichten Frühwerk der Regulae auszugehen.
3.1 Die Regulae ad directionem ingenii
Descartes’ methodologische Schrift der Regulae ad directionem ingenii, an der er 1623 und noch einmal 1628 arbeitete, weist hinsichtlich ihrer Deutung in der Literatur in zwei gänzlich verschiedene Richtungen. Während ein größerer Teil der Interpreten in ihr die Vorbereitung jener knappen [28]vier methodischen Regeln erblickt, die Descartes im Discours de la Méthode formulieren sollte, sehen andere einen derart radikalen Umbruch zwischen beiden Schriften, dass Descartes »frühestens im Winter 1628/29 zum Cartesianer wird«, denn die Regulae beruhten »auf Prinzipien, die mit der Philosophie Descartes’ nach 1629 im Widerspruch stehen«.6 Beide Auffassungen haben gute Gründe für sich; da aber Descartes selbst nicht von einem radikalen Bruch spricht, sondern mehr die Kontinuität seines Denkens betont, soll hier der Versuch unternommen werden, eher das Verbindende zu sehen, ohne allerdings die Differenzen beiseiteschieben oder leugnen zu wollen.
Worum geht es in den Regulae? In ihnen zielt Descartes darauf ab, die so erfolgreiche mathematische (oder geometrische) Methode der Analyse und Synthese auf alle Wissenschaften überhaupt auszudehnen, um damit zu einer völlig neuartigen Einheit aller Erkenntnis in Gestalt einer Mathesis universalis7 zu gelangen. Das ist zunächst nichts Neues, bedeutet es doch nur, dass man, vor ein (geometrisches) Problem gestellt, dieses so lange zerlegt, bis man bei schon Bekanntem und Bewiesenem ankommt. In der nachfolgenden Synthese werden die ursprünglichen Analyseschritte, nun ausgehend vom Bewiesenen, zum Ausgangsproblem zurückverfolgt, und zwar dergestalt, dass diese Synthese ein Beweis ist: An die Stelle der ursprünglichen Frage tritt eine begründete Aussage. Diese Vorgehensweise der Geometrie findet sich in der Scholastik, aufgeteilt in [29]zwei Methoden, die Scientia quia, die ausgehend vom Gegebenen nach den jeweiligen Gründen oder Ursachen fragt, und die auf diese folgende Scientia propter quid, die diese Gründe zu einer Begründung umkehrt. Auch die frühe Neuzeit betont die Bedeutung dieses Vorgehens – so beispielsweise Hobbes. Dennoch setzt Descartes einen neuen Akzent, indem er beide Verfahren zu einer einheitlichen Methode zusammenfügt und sie – stärker als die Scholastik oder Hobbes es taten – in die Nähe ihres Ausgangspunktes, in die Nähe der Mathematik rückt.
Die Schrift sollte aus drei Teilen zu je zwölf »Regeln zur Ausrichtung der Erkenntniskraft« bestehen. Sie beabsichtigte, die geometrische Algebra zu einer Universalwissenschaft dergestalt zu erweitern, dass unsere Erkenntniskraft (ingenium) »über alles, was es gibt, zuverlässige und wahre Urteile«8 zustande bringt. Denn »Alles Wissen ist sichere und evidente Erkenntnis«9. Das, wodurch die Erkenntniskraft geleitet werden soll, ist die Methode; Regel IV sagt lapidar: »Zum Untersuchen der Wahrheit der Dinge ist eine Methode notwendig«10.
Diese soll nicht disziplinspezifisch, sondern universell