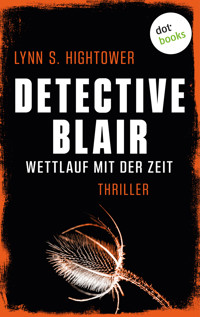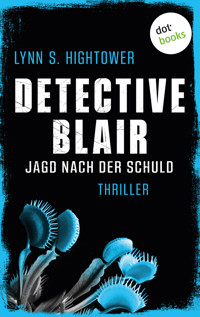Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Sonora Blair ermittelt
- Sprache: Deutsch
Wenn Jäger zu Gejagten werden: Der fesselnde Thriller »Detective Blair – Spiel mit dem Feuer« von Lynn S. Hightower jetzt als eBook bei dotbooks. Mitten in der Nacht wird Detective Sonora Blair an einen Tatort gerufen. Ein Collegestudent wurde mit Handschellen an das Lenkrad seines Wagens gefesselt, mit Benzin übergossen – und angezündet. Seine Überlebenschancen: gleich null. Selbst für die mit allen Wassern gewaschene Polizistin aus Cincinnati, die für ihren Beruf lebt, ist dieser Fall harter Tobak. Die letzten Worte des sterbenden jungen Mannes führen Sonora auf die Spur einer eiskalten Mörderin – mit einer Leidenschaft für Flammen. Doch je näher Sonora der gefährlichen Psychopathin kommt, desto mehr gerät sie in ihr Visier … »Teuflisch fesselnd von der ersten bis zur letzten Seite.« Publisher's Weekly Jetzt als eBook kaufen und genießen: der packende Thriller »Detective Blair – Spiel mit dem Feuer« von Lynn S. Hightower ist der erste Band ihrer Reihe um Cincinnatis tougheste Polizistin, Sonora Blair. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 522
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Mitten in der Nacht wird Detective Sonora Blair an einen Tatort gerufen. Ein Collegestudent wurde mit Handschellen an das Lenkrad seines Wagens gefesselt, mit Benzin übergossen – und angezündet. Selbst für die mit allen Wassern gewaschene Polizistin aus Cincinnati, die für ihren Beruf lebt, ist dieser Fall harter Tobak. Die letzten Worte des Sterbenden führen Sonora auf die Spur einer eiskalten Mörderin – mit einer alles zerstörenden Leidenschaft für Flammen. Doch je näher Sonora der gefährlichen Psychopathin kommt, desto mehr gerät sie in ihr Visier …
»Teuflisch fesselnd von der ersten bis zur letzten Seite.« Publisher’s Weekly
Über die Autorin:
Lynn S. Hightower wurde in Tennessee geboren und lebt heute in Kentucky. Sie studierte Journalismus sowie Kreatives Schreiben. Um ihren gefeierten Kriminalromanen ihren authentischen Charakter zu geben, beobachtet sie die Arbeit der lokalen Mordkommission aus nächster Nähe, begleitet Streifenbeamte und war Zeugin von Autopsien. Sie wurde mit dem renommierten Shamus Award ausgezeichnet.
Lynn S. Hightower veröffentlichte bei dotbooks bereits die Thriller um Sonora Blair mit den Bänden »Detective Blair – Spiel mit dem Feuer«, »Detective Blair – Kampf mit dem Gesetz«, »Detective Blair – Wettlauf mit der Zeit«, »Detective Blair – Jagd nach der Schuld«.
Die Website der Autorin: lynnhightower.com
***
eBook-Neuausgabe Januar 2022
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1995 unter dem Originaltitel »Flashpoint« bei HarperCollins, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 1997 unter dem Titel »Flashpoint Killer« bei Droemer Knaur.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1996 by Lynn S. Hightower
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1997 Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., München
Copyright © der Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/DmitryPrudnichenko, Nacho David
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ae)
ISBN 978-398690-139-4
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Detective Blair – Spiel mit dem Feuer« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Lynn S. Hightower
Detective BlairSpiel mit dem Feuer
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Manes H. Grünwald
dotbooks.
Für Matt Bialer,
den besten Agenten der Welt
Flashpoint / Flammpunkt
Die niedrigste Temperatur, bei der sich die durch Verdampfung entstehenden Gase an der Oberfläche flüssiger Stoffe entzünden.
World Book Dictionary, Bd. I
Kapitel 1
Sonora schlief nicht, als der Anruf kam. Sie lag zusammengerollt auf der Seite, die Bettdecke über dem Kopf, und nahm nur verschwommen wahr, wie der Wind die Telefonkabel im Takt gegen die Rückwand des Hauses peitschte. Beim zweiten Läuten hob sie den Hörer des Telefons auf dem Nachttisch ab und ahnte bereits, daß dieser Anruf nichts Gutes bedeutete. Zu solch früher Morgenstunde mußte es sich um eine dienstliche Sache handeln.
»Mordkommission, Blair.«
»Melden Sie sich immer am Telefon, als ob Sie im Dienst wären?«
»Nur wenn Sie anrufen, Sergeant. Aber egal, Sam hat Rufbereitschaft, nicht ich.« Sie strich sich mit den Fingerspitzen über den Nacken. Ihr Kopf schmerzte.
Einen Moment blieb es still am anderen Ende der Leitung. Dann: »Sam und Sie werden die Sache gemeinsam übernehmen. Verdammt häßliche Geschichte, Sonora. Ein Mann ist in seinem Wagen in Brand gesteckt worden.«
Sonora knipste die Nachttischlampe an. Die Birne flackerte kurz und ging aus. »Klingt nach Versicherungsbetrug, der außer Kontrolle geraten ist. Warum übernehmen das nicht die Leute vom Brandstiftungsdezernat?«
»Die haben uns ja angerufen. Das Opfer, Name Daniels, Mark, ist mit Handschellen ans Lenkrad seines Wagens gefesselt und mit einem Brandbeschleuniger übergossen worden.« Sonora zuckte zusammen. »Klingt eindeutig. Wo?«
»Mount Airy Forest, rund zwei Meilen im Wald. Ein Streifenpolizist steht zur Einweisung an der Straße. Delarosa ist eben zum Tatort losgefahren, erwartete Eintreffzeit vier Uhr fünfzig.«
Sonora schaute auf die Uhr. Vier Uhr zwanzig.
»Das Opfer lebt noch, ist bewußtlos, könnte aber wieder zu sich kommen, doch wenn, dann allerdings wohl nicht mehr für lange. Der Mann liegt drüben in der Uni-Klinik, und ich möchte, daß Sie dorthin fahren. Sehen Sie zu, daß Sie noch was aus ihm rausholen können, auch wenn’s nur zu einer Aussage auf dem Sterbebett reicht. Könnte eine Schwulensache sein, verstehen Sie? Das sind ja die Typen, die sich normalerweise um diese Jahreszeit dort rumtreiben. Kriegen Sie ihn dazu, daß er noch auspackt, wer’ s gewesen ist. Wenn wir ein bißchen Glück haben, können wir den Fall noch morgen früh abschließen.«
»Es ist schon längst ›morgen früh‹.«
»Machen Sie’s gut, Blair.«
Sonora zog sich hastig an, schlüpfte in eine schwarze Baumwollhose, die gerade noch der Polizei-Kleiderordnung entsprach, strich durch die wirren Strähnen ihres Haares, schaute in den Spiegel – und gab auf. Zu zerzaust, zu durcheinander vom Schlaf. Das war ganz bestimmt kein Tag für eine schicke Frisur. Sie faßte die Enden zusammen und schlang ein schwarzes Samtband darum. Unter den Augen hatte sie dunkle Ringe, und die Lidränder waren gerötet. Sie wünschte, sie hätte Zeit für ein Wunder wirkendes Make-up, aber wenn dieser Daniels im Sterben lag, hatte sie keine Zeit zu verlieren. Und er würde ganz sicher an ihrem Aussehen keinen Anstoß nehmen.
Sie machte das Licht im Flur an und warf einen Blick in die Kinderzimmer. Beide Kinder schliefen fest. Sie ging um die Wäschestapel herum, die in einer schwer durchschaubaren, nur ihrem Sohn verständlichen Systematik nach »sauber« und »schmutzig« auf dem Boden aufgeschichtet waren. Er schlief verkehrt herum im Bett, auf dem Kissen lag ein Buch mit dem Titel »Hochentwickelte Drachen und ihre Höhlensysteme«.
»Tim?«
Seine Augenlider zuckten, blieben aber zu. Im Schlaf sah er mit dem kurzgeschnittenen weichen schwarzen Haar jünger aus als dreizehn.
»Tim, komm, wach auf.«
Er fuhr hoch und sah sie mit weit aufgerissenen, verwirrten Augen an.
»Tut mir leid, mein Schatz, ich muß wegen einer dringenden dienstlichen Sache weg. Ich schließe hinter mir ab, aber bitte paß auf deine Schwester auf, okay?«
Er nickte und blinzelte gequält ins Licht – zu jung und zu müde, mitten in der Nacht aufgeweckt zu werden.
»Wieviel Uhr ist es?« fragte er.
»Kurz nach vier. Du kannst noch lange schlafen. Aber steh bitte auf, wenn der Wecker klingelt. Du mußt dafür sorgen, daß Heather pünktlich zur Schule kommt.«
»Okay. Paß auf dich auf, Mom. Lad deine Pistole durch.« Er ließ sich zurück aufs Bett fallen und drehte dem hellen Lichtschein, der vom Flur ins Zimmer fiel, den Rücken zu.
Sonora ließ die Tür einen Spalt offen und ging zum Zimmer ihrer Tochter. Ein Gewirr nackter Barbie-Puppen, davon einige ohne Kopf, lag wie nach einer Bombenexplosion verstreut auf dem verschlissenen gelben Teppich. Sonora suchte sich vorsichtig einen Weg zum Bett, registrierte erfreut die korrekten Kleiderstapel, die sorgfältig neben dem aufgepolsterten Hundekorb aufgeschichtet waren, und die ordentlich hingestellten Schuhe. Es war September, erst ein paar Wochen nach Beginn des neuen Schuljahrs, und die Aufgeregtheit der Erstkläßlerin mußte sich noch legen.
Ein rot-weiß gefleckter Hund knurrte leise und hob dann den Kopf vom Kissen im Bett, auf dem er dicht neben dem zarten schwarzhaarigen Mädchen geschlafen hatte. Er war ein recht großer Hund, schon ziemlich alt, hatte ein dichtes Fell und wissende braune Augen.
Sonora tätschelte seinen Kopf. »Brav, Clampett.«
Der Hund wedelte mit dem Schwanz. Sonora sah drei baumwollene Zopfbänder neben den lavendelfarbenen Tennisschuhen ihrer Tochter liegen – Zopfbänder für Zöpfe, nur daß Mommy nicht da sein würde, sie zu flechten.
Sonora verzog das Gesicht. »Vielen Dank, Heather, ich werde bestimmt Schuldgefühle bei der Arbeit an meinem Mordfall haben.«
Sie küßte ihre Tochter auf die Pausbäckchen, überprüfte sorgfältig die Türschlösser sowie die Alarmanlage und verließ dann das Haus.
Es regnete wieder, allerdings jetzt nicht mehr so stark, und die Scheibenwischer schafften es in der Intervall-Schaltung. Die Windschutzscheibe war jedoch beschlagen, was die Sicht erschwerte, und Sonora zuckte jedesmal unter dem grellen Glitzern der Scheinwerfer entgegenkommender Autos auf der regennassen Straße zusammen. Ihre Nachtsichtfähigkeit war nicht so, wie sie eigentlich sein sollte.
Das Gebäude der Universitätsklinik versteckte sich mit seinem Schotterhaufen und Bretterstapeln hinter einem Baugerüst. Wenigstens die Gesundheitsfürsorge schien Hochkonjunktur zu haben. Sonora kam an einem großen Schild mit der Aufschrift »Bauausführung Fa. Mesner« vorbei.
Der Eingang zur Notaufnahme war hell erleuchtet; zwei Krankenwagen standen unter dem Vordach und einige Streifenwagen in der kreisförmig angelegten Zufahrt. Das Parkhaus war nicht beleuchtet. Sonora quetschte sich zwischen den Krankenwagen durch und stellte ihr Auto am Rand der Auffahrt ab. Aus dem Handschuhfach holte sie eine Krawatte mit Blumenmuster, die nicht besonders gut zu ihrem Hemd paßte, sich aber zumindest nicht mit seiner Farbe biß, streifte die Schlinge mit dem lose gebundenen Knoten über den Kopf und zog sie dann unter dem Kragen des maßgeschneiderten Hemdes fest. Der Blazer auf dem Rücksitz war zerknittert, doch Sonora fand, daß es nicht sehr schlimm war. Sie stieg aus und schloß den Wagen ab.
In der Halle hinter dem Eingang hing der Geruch nach Krankenhaus und vom Regen nassen Cops schwer in der Luft; noch stärker aber war der intensive Brandgeruch. Das leise Knistern und Gemurmel aus Polizei-Handfunkgeräten wurde hin und wieder vom Klingeln ankommender, offensichtlich sehr langsamer Aufzüge unterbrochen. Eine Krankenwagenbesatzung schob eine Liege durch die Halle, und Sonora trat zur Seite, einem Sanitäter ausweichend, der eine Blutkonserve hochhielt. Die Gruppe ließ eine Spur aus vereinzelten Blutstropfen hinter sich.
Sonora sah plötzlich alles nur noch verschwommen, und sie blieb stehen und rieb sich die Augen.
»Specialist Blair?«
Der Streifenpolizist vor ihr konnte höchstens zweiundzwanzig oder dreiundzwanzig sein. Seine Uniform war naß und voller Rußflecken.
»Mein Name ist Finch. Captain Burke hat gesagt, ich soll mich bei Ihnen melden. Ich war gleich nach Kyle am Tatort.
Er hat schlimme Verbrennungen.«
»Kyle?«
»Kyle Minner, Officer Minner. Er war kurz vor mir da.«
Sonora legte ihm die Hand auf den Arm. »Haben Sie jemanden gesehen, gehört, daß ein Wagen weggefahren ist?«
Der Polizist schluckte. »Nein, nichts. Es war … Der Mann schrie, und seine Haare brannten. Ich hab nichts gesehen außer ihm.«
»Okay, das ist in Ordnung. Sind Sie verletzt?«
»Nein, Ma’am.«
»Wie schlimm hat es Minner erwischt?«
Finch schluckte wieder. »Ich weiß es nicht.«
»Ich werde mich nach ihm erkundigen und Ihnen Bescheid geben. Was können Sie mir über das Opfer sagen? Daniels heißt der Mann, nicht wahr?«
»Der Wagen ist auf einen Keaton Daniels zugelassen. Das Opfer ist sein Bruder Mark, College-Student, zweiundzwanzig, lebt in Kentucky und ist zu Besuch hier. Er hat sich den Wagen anscheinend von seinem Bruder ausgeliehen.«
»Und was ist im einzelnen passiert?«
»Unsere Vermittlung erhielt einen anonymen Anruf aus dem Park. Der Anrufer sagte, es gehe da was Seltsames vor sich. Ich dachte, es handle sich um Teenager, die dort Unsinn machen oder so was. Als ich hinkam, stand das Auto schon in hellen Flammen. Der Mann schrie, und es klang … o Gott … irgendwie unwirklich. Minner hat gerade in unserem Büro bei der Parkverwaltung gearbeitet, einen Bericht getippt, und ist also nur ungefähr eine Minute von der Stelle entfernt. Er ist vor mir dort, will die Autotür aufreißen, packt den Türgriff, zuckt mit der Hand zurück, und die Haut schält sich von der Handfläche ab. Dann greift er durch das offene Fenster der Fahrertür nach dem Mann und will ihn rausziehen. Aber es … er … Minner schreit irgendwas von Handschellen. Nachher, als wir auf den Krankenwagen gewartet haben, hat er mir gesagt, der Mann sei mit Handschellen ans Lenkrad gefesselt gewesen. Jedenfalls, Officer Minner befreit Daniels aus den Handschellen …«
»Befreit Daniels aus den Handschellen?«
Finchs Augen wurden feucht. »Die Hände von dem Mann waren fast ganz verbrannt. Sieht so aus, als ob Minner ein paarmal dran gezogen hätte, und dann sind die Hände durchgerutscht.«
Sonora kniff die Augen zusammen.
»Es war die einzige Möglichkeit, die einzige Chance, ihn aus dem Wagen zu kriegen. Der Mann steht in Flammen, Minner steht in Flammen, sie rollen sich auf dem Boden rum, also werfe ich meine Jacke über sie und ersticke die Flammen.«
»Haben Sie wirklich keine Verletzungen?«
»Nur meine Augenbrauen sind ein bißchen versengt. Minner hat schlimme Brandwunden. Und das Opfer, dieser Daniels, der ist fast ganz verkohlt.«
»Sind Sie mit den beiden im Krankenwagen hergekommen?«
»Ja, Ma’am.«
»Hat Daniels was gesagt?«
»Er war bewußtlos. Aber als ich zu dem brennenden Wagen kam, hat er was geschrien. Klang wie ›key‹ oder so was.«
»Key wie Schlüssel?«
Finch zuckte mit den Schultern.
»War das alles?«
Der Streifenpolizist nickte.
»Gute Arbeit, Officer«, lobte ihn Sonora. »Wollen Sie nach Hause?«
»Ich möcht hierbleiben und hören, wie es Kyle geht. Ach ja, und O’Conner hat den nächsten Verwandten des Opfers hergebracht, Daniels’ Bruder.« Finch nickte zu einem Mann hinüber, der im Flur außerhalb des hellen Lichtes stand und zu ihnen herschaute.
Sonora sah in die Richtung und erblickte einen großen, kräftigen Mann mit bleichem, übernächtigtem Gesicht.
»Hat jemand mal mit einem der Ärzte geredet?«
»Ein Doktor kam eben aus der Notaufnahme und hat mit dem Bruder gesprochen.«
»Haben Sie gehört, was er gesagt hat?«
»Nur, daß sie sich große Sorgen um Marks Zustand machen, aber alles tun würden, was sie nur könnten.«
»Scheiße. Dann ist klar, daß Daniels es nicht schaffen wird.
Sie haben schon die Segel gestrichen.«
»Ma’am?«
»Egal. Sorgen Sie dafür, daß jemand dem Bruder eine Tasse Kaffee bringt. Sieht aus, als ob er eine brauchen könnte. Und holen Sie sich selbst auch eine.« Sonora ging an den Plastiksofas vorbei zur Schwingtür der Notaufnahme und stieß sie auf.
Kapitel 2
In der Notaufnahme war das Licht hell genug, um neue Energien wachzurufen. Sonora stieß auf eine dunkelhäutige Frau in blauem baumwollenem Hosenanzug und mit Häubchen auf dem Kopf, der Schwesterntracht des Krankenhauses. Ihre Füße steckten in Plastiksandalen.
»Gracie! Genau die Frau, die ich jetzt brauche.«
»Bist du wegen des Mannes mit den Brandverletzungen hier?« Gracie nahm Sonora am Arm und zog sie aus dem Weg eines Krankenpflegers, der ein Infusionsgestell vor sich herschob.
»Wie steht es um ihn?«
Gracie deutete auf eine abgeteilte Kabine, deren weiße Vorhänge sich durch dahinter stattfindende Bewegungen bauschten.
»Sie haben Dr. Farrow, den Verbrennungsspezialisten von der Shriners-Klinik, verständigt. Der müßte jeden Augenblick eintreffen, aber es wird wohl zu spät sein. Der Notarzt hat ihm zur Entgiftung Thiosulfat gegeben, doch sein Blutsauerstoffwert ist miserabel. Er liegt unter dem Beatmungsgerät und kann nicht mit dir sprechen.«
»Ja-/Nein-Fragen?«
Gracie kniff die Augen zusammen. »Er ist bei Bewußtsein. Du kannst es ja mal versuchen.«
Sie führte Sonora an einem Mann vorbei, der einen anscheinend außergewöhnlich schweren Stahlkarren vor sich herschob. Sie gingen an der Seite, wo sich der Vorhang teilte, in die Kabine. Sonora runzelte die Stirn. Der diensthabende Arzt war Dr. Malden, und der mochte sie nicht.
»Okay?« fragte sie.
Er schenkte ihr kaum Beachtung, sagte aber auch nicht nein. Sie schaute über Gracies Schulter.
Mark Daniels war bei Bewußtsein, und das war, wie Sonora dachte, während das Team sich um ihn kümmerte, ihr Glück und sein Pech. In seinen Augen stand der Tod. Sonora nahm nur vage die Ärzte und technischen Assistenten wahr, die mit geschäftigen Händen den Alptraum der medizinischen Technologie auf Daniels losließen. Die Luft war erfüllt von Brandgeruch, Wortfetzen aus dem medizinischen Fachchinesisch flogen hin und her – hypovolämischer Schock, Ringer-Lösung, zentraler venöser Druck … Jemand beurteilte laut die Schwere der Verbrennungen – »anteriore Rumpfseite achtzehn Prozent«. Eine andere Stimme verkündete: »Körpertemperatur auf sechsundzwanzig Grad Celsius abgesunken. Herzarrhythmie. Auskultation der Lunge erforderlich.« Daniels Schädeldecke glänzte weiß unter dem fast vollständig verbrannten Haar; sie schien im Gegensatz zur verkohlten und starren Hautoberfläche der Brust, der Arme und des Halses zu pulsieren. Seine Gesichtszüge waren kaum mehr zu erkennen, die Lippen nur noch ein zerflossener, verwischter Fleischklumpen. Eine Augenhöhle war schwarz verkrustet, und das rechte Ohr sah aus wie ein Stück zerschmolzene dunkle Metallfolie.
Von der rechten Hand war fast nichts mehr übriggeblieben. Sonora starrte auf weiße Knochenstümpfe. Am Ende der linken Hand baumelte ein schwarzer Fleischklumpen, der aussah wie die geballte Faust eines kleinen Kindes.
Sonora schaltete ihren Recorder ein. »Mr. Daniels, ich bin Specialist Sonora Blair, Cincinnati Police Department.«
Er bewegte den Kopf. Sie wiederholte ihre Worte, und plötzlich kam ein Blickkontakt zu seinem weniger verletzten Auge zustande. Er konzentrierte den Blick auf ihr Gesicht, und Sonora hatte das seltsame Gefühl, sie und Daniels seien Welten von den Ärzten, technischen Assistenten und dem grellen, aufdringlichen Licht entfernt.
»Ich werde Ihnen ein paar Fragen zu dem Täter stellen, der diesen Angriff auf Sie verübt hat. Mr. Daniels? Schütteln Sie den Kopf, wenn die Antwort nein ist, und nicken Sie bei ja. Okay? Haben Sie verstanden?«
Er nickte und verschmierte dabei das weiße Laken mit einer zähen Flüssigkeit von seinem Kinn. Der dicke Tubus des Beatmungsgeräts teilte die zerschmolzenen Lippen, und der Sauerstoff ließ die angesengten Lungenflügel anschwellen und wieder in sich zusammenfallen.
»Haben Sie … kennen Sie den Täter?«
Daniels reagierte nicht, hielt jedoch die Augen weiter fest auf sie gerichtet. Er dachte nach. Schließlich nickte er.
»Kennen Sie ihn schon lange?«
Daniels schüttelte den Kopf.
»Also nicht lange?«
Wieder schüttelte er den Kopf. Mehrmals hintereinander.
»Sie haben ihn heute nacht getroffen?«
Er nickte, drehte dann aber den Kopf hin und her. Sonora fragte sich, ob er bei klarem Verstand war. Ja, er begriff alles, das sah sie in seinen Augen. Er versuchte ihr irgend etwas zu sagen. Sie runzelte die Stirn und überlegte.
Du mußt ganz von vorne anfangen, ganz langsam vorgehen, sagte sie sich. »Mann oder Frau? Mr. Daniels, war der Täter ein Mann?«
Kopfschütteln. Heftig. Kein Mann.
Seine Frau, dachte Sonora. Seine Exfrau. Seine Freundin.
»Der Verbrecher war also eine Frau?«
Sonora trat zur Seite, um dem Arzt Platz zu machen, aber sie sah sein Nicken. »Zeuge erklärt, daß der Täter eine Frau war«, sagte sie in das Mikrofon des Recorders. »Eine Frau, die Sie kennen?«
Nein, lautete die Antwort.
»Ihre Ehefrau?« Nein. »Ihre Freundin?« Nein. »Sie haben sie erst heute nacht kennengelernt und mitgenommen?«
Ja. Das war es also. Eine Fremde.
Er verlor den Blickkontakt, schien immer schwächer zu werden. »Jung?« fragte sie. »Unter dreißig?«
Er sah sie wieder an, wach und aufmerksam, trotz der chaotischen Hektik um ihn herum, trotz der Überlastung seiner Sinne. Sonora spürte plötzlich den dringenden Wunsch, ihn zu berühren.
Aber sie hatte Angst davor, hatte Angst, sie könnte ihm weh tun, eine Infektion auf ihn übertragen, den Zorn der Ärzte erregen.
Sie versuchte den Faden wieder zu finden. Daniels beobachtete sie mit großen, lidlosen Augen. Das Feuer hatte seinen Körper zu einer fast embryonalen Krümmung verzogen.
Sonora legte zwei Finger auf das verkohlte Fleisch seines Arms und meinte, so etwas wie Dank in seinen Augen zu lesen. Vielleicht bildete sie sich das auch nur ein.
Ich muß Fragen stellen, dachte sie, den Mörder dieses Mannes finden.
»Jung?« fragte sie noch einmal. »Unter dreißig?«
Er zögerte, dann nickte er.
»Eine Schwarze?«
Nein.
»Weiße?«
Ja.
»Prostituierte?«
Zögern. Nein.
Jung. Weiß. Keine Prostituierte wahrscheinlich.
»Schwarzes Haar?«
Nein.
»Blond?«
Ja. Deutliches Nicken.
»Augenfarbe?« fragte Sonora. »Blau?«
Er reagierte nicht mehr.
»Braun?«
Eine Veränderung ging mit ihm vor. Ein Alarmton schrillte auf, der Arzt schrie irgend etwas. Sonora trat von der Liege zurück und schlüpfte durch den Spalt in den Vorhängen aus der Kabine. Sie brauchte nicht erst auf den Monitor des EKGs zu schauen, sie wußte auch so, daß die Linie keine Zacken mehr anzeigte.
Kapitel 3
Officer Finch stand in einem Kreis andächtig lauschender Cops, erzählte wieder und wieder seine Story und beantwortete Fragen. Sonora zögerte, ging dann aber doch an der Gruppe vorbei. Für Finch würde es zumindest einen therapeutischen Wert haben, darüber zu reden, und er war zu jungenhaft, als daß er mit seinen Schilderungen bei den anderen Alpträume heraufbeschwor. Darstellungen dieser Art schienen eher aus der Schwesternstation zu ihnen zu dringen.
Bei diesem Fall würde man sich, was die Medien betraf, nicht durchmogeln können. Die Cops würden zwar jedem Zivilisten gegenüber zurückhaltend mit Äußerungen sein, aber die Krankenhausangestellten würden mit Freuden plaudern. Sie waren die schlimmsten Quasselstrippen, noch schlimmer als Rechtsanwälte. Jemanden in eine Krankenhausakte aufzunehmen war gefährlicher, als den Klatschkolumnisten Oprah und Phil alles über ihn zu erzählen – wenn auch nicht ganz so schlimm, wie alle Unterlagen dem Klatschtalkmaster Geraldo zuzufaxen.
»Specialist Blair!«
Sonora zuckte zusammen. Tracy Vandemeer von Kanal 81 kam auf sie zu, gefolgt von einem Kamerateam. Keine anderen Medienvertreter in der Nähe, sie sind alle am Tatort, dachte Sonora. Dort wäre sie jetzt auch gerne. Sie machte eine abwehrende Handbewegung zur Kamera hin.
»Tracy, Sie sind viel zu früh hier. Bitte keine Aufnahmen, bevor ich nicht Make-up aufgelegt habe.«
Tracy Vandemeer blinzelte. Sie hatte ausreichend Zeit, wenn auch weniger Grund gehabt, sich zu schminken. Sie trug eine schicke rote Seidenbluse und einen engen Lycra-Rock, den sich nur eine Frau erlauben konnte, für die Schokolade und Kinderkriegen Fremdwörter waren.
»Specialist Blair, können Sie mir die Identität des …«
»Ach Tracy, Sie kennen doch die Spielregeln. In ein paar Stunden wird unsere Presseverlautbarung rausgehen. Alle Fragen müssen über meinen Sergeant laufen.«
Vandemeer lächelte. »Kommen Sie, Sonora. Ich bin an einen letzten Termin gebunden, zu dem mein Bericht fertig sein muß.«
»Unterbrechung der ›Sendung für die Landwirtschaft‹ durch einen Sonderbericht?«
Vandemeers Lächeln verschwand, und Sonora fiel eine Sekunde zu spät ein, daß Tracy ihre Karriere einmal als Reporterin bei den Sechsuhr-Morgennachrichten begannen und über den Stand der Maisernte berichtet hatte.
»Für diese Bemerkung werde ich Sie von Ihrer häßlichsten Seite filmen lassen, Sonora.«
»Was? Es ist für Sie einen Bericht wert, wenn ich beim Betreten und Verlassen der Notaufnahme gezeigt werde?«
»Wenn Sie mir keine anderen Informationen liefern.«
»Ich höre Sie schon verkünden: ›Angehörige der Mordkommission vergißt, sich die Haare zu kämmen.‹ Denken Sie daran, das an CNN weiterzugeben.«
Tracy Vandemeer ließ das Mikrofon sinken, schaute sich um und musterte die Gruppe der Cops in der Ecke. Sonora nutzte das Nachlassen des Interesses, sich zu verdrücken. Vandemeer würde bei dem Club der jungen Cops da drüben kein Glück haben.
Sonora blickte sich auf der Suche nach einem Angehörigen des Sicherheitsdienstes des Krankenhauses um und bemerkte den Bruder des Opfers drüben im Flur, die Schulter an die Wand gelehnt. Plötzlich schoß ihr der Gedanke durch den Kopf, daß ihr Gesicht das letzte gewesen war, das Mark Daniels gesehen hatte.
Marks Bruder nahm einen Schluck von seinem Kaffee. Die freie Hand hatte er tief in der Tasche seines Mantels vergraben. Regentropfen glitzerten auf dem marineblauen Regenmantel, den er aufgeknöpft hatte und dessen Gürtel auf den Boden hing. An der offenstehenden Tür hinter seinem Rücken war ein Schild mit den Worten: KRANKENHAUSSEELSORGE/BESPRECHUNGSRAUM FÜR FAMILIENANGEHÖRIGE.
Sonora betrachtete ihn aufmerksam, während sie auf ihn zuging, nach Flecken auf dem weißen Hemd, Ruß auf den Schuhen und der sandfarbenen Hose suchend. Sie atmete tief durch die Nase ein, um herauszufinden, ob er nach Rauch roch. Das war nicht der Fall. Sie wünschte, er hätte den Mantel ausgezogen, denn so war nicht zu erkennen, was darunter steckte.
Sonora lächelte und schaltete die fürsorgliche Mom-Sprache ein. »Ihr Mantel ist naß. Sie sollten ihn ausziehen.«
Die Augen des Mannes wirkten glasig, aber dann sah er sie plötzlich konzentriert an, mit einem gequälten Blick, den Sonora nur zu gut kannte. Es war ein Blick, der um ein Wunder bettelte, um Seelenfrieden, ein Blick, der Sonora bis in die Träume verfolgte.
»Der Mantel?«
Er zog ihn langsam aus und legte ihn über den Arm. Das weiße Hemd war zerknittert, aber sauber und unbeschädigt. Wenn dieser Mann etwas mit dem Mord zu tun hatte, mußte er Zeit gehabt haben, die Kleider zu wechseln.
Man darf keine Möglichkeit ausschließen, dachte Sonora und streckte ihm die Hand hin.
»Specialist Sonora Blair, Cincinnati Police Department.« Er hielt den Blick auf sie gerichtet, während er ihre Hand mit festem Griff umschloß. Er hatte braune, intelligente Augen, und er war jünger, als sie zunächst angenommen hatte. Sein Haar war schwarz, dicht und lockig.
»Keaton Daniels.«
Aha, Keaton, dachte Sonora. Key? Mark hatte »key« geschrien, als Officer Minner ihn aus dem brennenden Wagen gezogen hatte. Doch wahrscheinlich war es Keat und nicht key wie Schlüssel.
»Wie geht es Mark?« fragte er.
Seine Stimme war tief, von Angst überlagert. Er hielt immer noch ihre Hand, schien sich dieser Tatsache aber nicht bewußt zu sein. Die automatische Tür zischte auf, und Sonora schaute über ihre Schulter.
Ein anderes Fernsehteam lungerte draußen in der Sperrzone herum, und ein Reporter in Jeans und einer alten Army-Jacke debattierte heftig mit einem der Polizisten.
Sonora führte Daniels in den Besprechungsraum.
Das Zimmer war eine Oase, in dem sich ein abgetretener grüner Teppich, ein braunes Vinyl-Sofa und ein gepolsterter Sessel befanden. Sonora ließ Daniels in dem Sessel Platz nehmen – die beste Sitzmöglichkeit im Haus für ein wenig Bequemlichkeit und einen Moment der Ruhe, da war sich Sonora sicher.
»Eine Sekunde, Mr. Daniels, ich bin sofort zurück.«
Sie schlüpfte in den Flur und winkte einem der Polizisten, einen Blick auf sein Namensschild werfend.
»O’Connor? Schaut so aus, als ob es da drüben einige Leute gäbe, um die Sie sich kümmern sollten.« Sie deutete in die Empfangshalle. »Die hektischen Typen von Kanal 26 sind gerade angekommen, und es ist ja meistens nicht nur eine Ameise, die einen beim Picknick stört. Sehen Sie zu, daß sie im Patienten-Wartezimmer bleiben. Ich möchte nicht, daß einer von denen in der Notaufnahme rumschnüffelt. Gegen Tracy und ihre Leute habe ich nichts, aber behalten Sie den Reporter von Kanal 26 im Auge. Der Mann da drüben in dem schicken Anzug ist Norris Weber vom Sicherheitsdienst des Krankenhauses. Er war mal einer von uns, ehe er pensioniert wurde. Sprechen Sie sich mit ihm ab. Ich bin mit dem Bruder des Opfers im Zimmer der Krankenhausseelsorge und will nicht, daß er belästigt wird. Haben Sie das alles verstanden?«
»Ja, Ma’am.«
»Danke für Ihre Mitarbeit.«
Sonora ging in die Notaufnahme und redete noch einmal mit Gracie. Es wäre peinlich, wenn sie Keaton Daniels die Nachricht vom Tod seines Bruders übermitteln würde und es vielleicht doch gelungen war, ihn noch einmal ins Leben zurückzurufen.
Vor der geschlossenen Tür des Besprechungsraums blieb Sonora stehen und legte eine neue Kassette in den Recorder.
Dann ging sie hinein.
Keaton Daniels saß auf der Kante des Sessels. Er hatte den Regenmantel wieder angezogen, obwohl es sehr warm in dem kleinen Zimmer war.
»Mr. Daniels?«
»Ja?« Er sah sie wie gelähmt, zugleich aber auch argwöhnisch an.
»Tut mir leid, ich wollte nicht so lange wegbleiben.«
»Wie geht es Mark? Kann ich zu ihm?«
Das Vinyl-Sofa quietschte, als Sonora sich setzte. Ihre Knie stießen gegen seine, und sie drehte sie schnell zur Seite. Dann schaute sie auf seine linke Hand – Trauring.
»Kann ich jemanden anrufen, den Sie bei sich haben wollen?
Ihre Frau vielleicht?«
Keaton Daniels blickte zu Boden. »Nein, vielen Dank.«
»Oder einen Freund?«
Keaton sah sie wieder an. »Meine Frau und ich leben getrennt. Ich rufe später vielleicht einen Freund an.«
Sonora nickte und beugte sich vor.
»Sind Sie Detective?« fragte er plötzlich.
»Ja.«
»Ich dachte, mein Bruder hätte einen Verkehrsunfall gehabt.
Als Sie … als Sie sich eben vorgestellt haben, nannten Sie als Dienstgrad Specialist.«
»Specialist ist die allgemein übliche Bezeichnung. Das hat die Polizeigewerkschaft so durchgesetzt. Ich bin Detective bei der Mordkommission, Mr. Daniels. Wir werden bei verdächtigen To … bei verdächtigen Tatumständen hinzugezogen.« Er schluckte. »Bei verdächtigen …«
»Es tut mir sehr leid, aber ich muß Ihnen sagen, daß Ihr Bruder Mark gestorben ist.«
Er hatte gewußt, daß er nicht überleben würde, wirkte aber dennoch wie gelähmt. Seine Schultern sackten nach unten, er schluckte, räusperte sich und kämpfte dagegen an, aber die Tränen würden aufsteigen. Sonora wußte das. Und er wußte es auch.
»Sagen Sie es mir.« Er brachte die Worte kaum heraus. »Sagen Sie mir, was passiert ist.«
»Wir sind noch dabei, uns ein Bild von der Sache zu machen. Die Polizei und die Feuerwehr wurden zu einem brennenden Fahrzeug gerufen. Ihr Bruder war in dem Wagen. Wir gehen davon aus, daß das Feuer absichtlich gelegt wurde.«
Keaton Daniels sah sie mit einem seltsamen, verwirrten Blick an. Und jetzt kamen die Tränen, liefen über seine stachligen, unrasierten Wangen, und seine Augen wurden rot.
Sonora berührte mit ihren Fingern seine Hand. »Soll ich Sie allein lassen? Soll ich diesen Freund anrufen?«
Er schüttelte langsam den Kopf, und Sonora wurde an Mark Daniels’ weißen, einer schleimigen Schnecke ähnlichen Kopf erinnert, der feuchte Spuren auf der Bettdecke hinterlassen hatte. Sie fragte sich, wie Mark vorher ausgesehen hatte, ob er so attraktiv gewesen war wie sein Bruder.
»Ich muß Ihnen ein paar kurze Fragen stellen, je eher, desto besser. Aber wenn Sie …«
»Nein, nein, fragen Sie nur.«
»Sind Sie sicher?«
»Ja.«
Ein paar Sekunden vergingen. Sonora fummelte an ihrem Recorder herum.
»Mr. Daniels, haben Sie heute … gestern mit Mark gesprochen, ihn gesehen?«
Er legte die Hände um seine Knie. »Ja. Er ist zu Besuch bei mir. Wir waren zum Abendessen in einem Restaurant. Dann hat er mich zu Hause abgesetzt und fuhr weiter, da er noch ausgehen wollte.«
»Wissen Sie, wohin er zu fahren beabsichtigte?«
»Zu einer Kneipe mit Namen Cujo’s. Cujo’s Café-Bar.«
»Oben in der Gegend von Mount Adams?«
»Ja.«
Sonora nickte. »Das ist uns bekannt. Sie hatten keine Lust, ihn zu begleiten?«
»Ich bin Lehrer, und ich mußte noch was für den Unterricht am nächsten Tag zusammenbasteln, so eine Ausschneide- und Klebearbeit, nicht schwierig, aber sehr zeitraubend. Ich hatte Mark vorgeschlagen, mir dabei zu helfen, doch das war ihm wohl zu … zu langweilig. Und ich wollte sowieso früh ins Bett gehen. Wir aßen also zusammen, und er entschloß sich, noch zum Cujo’s zu fahren und ein Bier zu trinken oder so was.«
»Allein?«
»Ja.«
»Mit Ihrem Wagen?«
»Er ist Student an der Universität von Kentucky, und ein Studienfreund hat ihn hierher mitgenommen. Der Freund setzte ihn bei mir ab, und ich wollte ihn dann am Wochenende wieder zurückbringen. Auf dem Weg beabsichtigten wir unsere Mutter zu besuchen.« Er schaute auf den Boden, dann sah er wieder Sonora an. »Ich muß sie anrufen, oder soll ich damit bis zum Morgen warten und sie nicht aus dem Schlaf reißen?«
»Rufen Sie sie heute nacht noch an. Sie könnte Ihnen sonst Vorwürfe machen. Es sei denn … Geht es ihr vielleicht gesundheitlich nicht gut?«
»Sie ist nicht wirklich krank.«
Sonora fand das recht interessant und nahm sich vor, dem nachzugehen. »Dieses Cujo’s, ist das eher eine Bar oder ein Cafe?«
»Eher eine Bar.«
»Gehen Sie selbst auch manchmal hin?«
»Ab und zu. Früher war ich oft dort. Dann habe ich das seinlassen.«
»Wie meinen Sie das?«
Daniels verzog das Gesicht. »Meine Frau und ich leben getrennt. Eine Zeitlang ging ich abends oft aus; in Bars und andere Kneipen und auch ins Cujo’s. Aber so was hängt einem ja schnell zum Hals raus. Ich mußte mich letztlich wieder auf meine Arbeit besinnen. Es ist nicht gut, wenn man den Kindern jeden Morgen mit einem Kater gegenübersteht. Ganz zu schweigen davon, daß man so einen Lebenswandel mit einem Lehrergehalt nicht lange durchstehen kann.«
»Wie alt sind die Kinder, die Sie unterrichten?«
»Ich unterrichte Schulanfänger. Erste und zweite Klasse.«
»Grundschule?«
Ihre Überraschung schien ihn zu ärgern. »Schulanfänger in den Klassen eins und zwei gibt es nur an Grundschulen.«
Sonora ließ das Thema fallen. »Wo waren Sie mit Mark zum Abendessen?«
»Im LaRosa’s. Wir haben uns eine Pizza geteilt.«
»Und Bier dazu getrunken?«
Daniels kniff die Augen zusammen. »Ich hatte ein Sprite, Mark ein Dr. Pepper.«
»Besteht die Möglichkeit, daß Mark sich mit Freunden treffen wollte?«
»Das glaube ich nicht. Er kannte ja hier niemanden.«
»Und was ist mit dem jungen Mann, der ihn bei Ihnen abgesetzt hat?«
»Der war auf dem Weg nach Dayton, soweit ich weiß. Er heißt Caldwell. Carter Caldwell.« Er rieb sich mit den Fingern über das Kinn. »Hören Sie, ich verstehe das alles nicht. Gab es irgendeinen Vorfall in dieser Bar?«
»Das weiß ich bei diesem Stand der Ermittlungen noch nicht, Mr. Daniels. Es klingt abgedroschen, aber ich muß die Frage trotzdem stellen. Hatte Ihr Bruder irgendwelche Feinde? Echte Feinde?«
»Feinde? Mark? Er ist ein Student, fast noch ein Kind, Detective. Und ein unheimlich netter Junge. Keine Drogen, keine Aufputschmittel. Er ging gern zu Partys.«
»Hat er viel getrunken?«
Er hob die Schultern. »Wie es in diesem Entwicklungsstadium üblich ist. Die meisten jungen Leute machen diese Phase durch.«
Sonora nickte, um einen neutralen Gesichtsausdruck bemüht, behielt aber im Hinterkopf, daß vielleicht ein Alkoholproblem vorlag.
»Er war doch noch fast ein Kind.« Die Tränen flossen nun ungehemmt. »Zweiundzwanzig. Er war zu jung und zu nett, um Feinde zu haben.«
»Hatte er viele Freundinnen?«
»Er hat eine feste Freundin in Lexington. Sie sind seit zwei Jahren zusammen.«
»Und sie ist die einzige Freundin?«
»Ich denke schon. Er war mit etlichen anderen Mädchen befreundet, wenn Sie verstehen, was ich meine, aber ohne festere Bindung.«
»Er war also beliebt?« fragte Sonora.
Keaton Daniels nickte.
»Ist Ihnen je zu Ohren gekommen, daß er ein Mädchen in einer Bar aufgegabelt hat?«
»Nein.«
»Bitte, denken Sie noch mal nach.«
»Nein, und auf keinen Fall hier, in einer fremden Stadt. Er war zweiundzwanzig, in seinem Verhalten aber jünger, als es die Jahreszahl aussagt.«
»Hat Ihr Bruder mal darüber gesprochen, daß er bei einer Prostituierten war? Scherze darüber gemacht oder Sie um Rat gefragt?«
Die Tränen versiegten. Daniels rutschte in seinem Sessel nach vorn.
»Was ist eigentlich hier los? Sagen Sie mir endlich …«
Sonora lehnte sich zurück. »Mr. Daniels, Ihr Bruder ist heute nacht ermordet worden. Ich muß jedes Detail ausloten, jede Möglichkeit in Betracht ziehen. Bitte helfen Sie mir dabei.«
»Wie konnte er in dem Wagen verbrennen? Hat irgendwas an dem Auto nicht funktioniert oder so? Hat Mark irgendwie das Bewußtsein verloren?«
»Wie ich schon sagte, Mr. Daniels, wir sind noch …«
»Um Himmels willen, Detective …« Er griff nach ihrem Arm und drückte so fest zu, daß es fast weh tat. Dann stand er auf, beugte sich über sie und krallte die Finger in die Armlehne des Sofas. »Was genau hat man … wer es auch war … was hat man ihm angetan?«
»Mr. Daniels …«
»Bitte. Sagen Sie es mir.«
Sie erhob sich und zwang ihn damit ein Stück zurückzutreten. Aber er blieb dicht vor ihr stehen, sein Gesicht nur Zentimeter von ihrem entfernt.
»Mr. Daniels, setzen Sie sich wieder hin, okay?«
Sie roch den Duft seiner Seife, den Kaffee in seinem Atem. Lange Sekunden standen sie sich so Auge in Auge gegenüber. »Bitte setzen Sie sich wieder hin, Mr. Daniels. Ich werde Ihnen alles sagen, was ich weiß. Ich habe auch einen Bruder, okay?«
Er setzte sich, und der Regenmantel spannte über seinen breiten Schultern.
Sonora ließ sich ihm gegenüber nieder. Als sie eine Hand auf seinen Arm legte, spürte sie, daß er zitterte. »Ich kenne nicht alle Einzelheiten, ich war noch nicht am Tatort. Mark ist in Ihrem Wagen oben im Mount Airy Forest aufgefunden worden. Seine Hände waren mit Handschellen ans Lenkrad gefesselt. Man hat ihn mit einem Brandbeschleuniger übergossen und angezündet.«
»O mein Gott …«
»Legen Sie ruhig den Kopf auf Ihren Arm, Mr. Daniels.«
»Ich verstehe nicht …«
»Bitte tun Sie, was ich sage.«
Er wollte sich wehren, nur für einen kurzen Moment, ließ es dann aber zu, daß sie seinen Kopf nach unten drückte.
Gut gemacht, Blair, dachte sie. Du mußt unbedingt dem Sergeant berichten, wie es dir gelungen ist, den Bruder des Opfers ruhigzustellen.
»Okay? «
»Ja, okay.«
Er setzte sich langsam wieder auf und lehnte sich in seinem Sessel zurück. Sein Gesicht war kreidebleich.
»Ich brauche Zeit.«
»Natürlich.«
»Kann ich … Kann ich nach Hause gehen, zum Haus meiner Frau? Für ein paar Stunden?«
»Ich werde Sie hinfahren lassen.«
»Danke.«
»Bleiben Sie sitzen. Ich hole …«
Daniels stand langsam auf, sich mit einer Hand an der Wand abstützend.
»Vorsichtig«, sagte Sonora und hielt ihn am Arm.
Kapitel 4
Als Sonora das Krankenhaus verließ, war es draußen bereits hell. Der Himmel war noch düster, aber es hatte aufgehört zu regnen. Sie fuhr zu schnell, und die Reifen ihres Nissan spritzten Wasser nach beiden Seiten. Als es den steilen Berg hinunterging und der Wagen immer schneller wurde, trat sie auf die Bremse. Nur nebenbei registrierte sie, daß sie gerade eine Ampel bei Gelb überfahren hatte.
Im Geist sah sie Mark Daniels unter dem grellen Licht und den Torturen der Notaufnahme vor sich.
Es war neblig, und Sonora schaltete die Scheinwerfer ein. Ihr Radio gab im Hintergrund das übliche beruhigende Knistern statischer Elektrizität von sich. Man war nie ganz allein. Sie schaute auf die Uhr und dachte daran, daß die Kinder jetzt aufstehen und sich für die Schule fertigmachen würden.
Sie bog nach rechts in die Colerain Road ein. Ein dunkler Wall aus Bäumen zog sich links von der Straße dahin – Mount Airy Forest. Sonora kam an Eingängen für Besucher in den Park vorbei, an der Statue des heiligen Antonius, und sie sah nur den Schein der Straßenlaternen entlang der Colerain Road, keinerlei Lichter im Wald. Die Haupteinfahrt in den Park war von Polizeiwagen blockiert. Sonora zeigte ihren Ausweis, woraufhin sie durchgewunken wurde. Der schmale, zweispurige Weg war stellenweise abgetrocknet, was dem Asphalt ein scheckiges Aussehen verlieh.
Drei hölzerne Hinweisschilder, das unterste verbogen, sagten ihr, daß eine Geschwindigkeitsbegrenzung von fünfundzwanzig Stundenmeilen einzuhalten war, Kraftfahrzeuge die asphaltierten Wege nicht verlassen durften und der Park von sechs Uhr bis zweiundzwanzig Uhr geöffnet war. Darüber hinaus wurde sie darauf hingewiesen, daß auf Radfahrer geachtet werden mußte, daß man den Wagen nicht abseits der offiziellen Parkplätze abstellen durfte und daß Hunde an der Leine zu führen seien.
Habt euren Spaß in diesem Park, Kinder, dachte Sonora.
Sie kam an einem arg mitgenommenen Wohnwagen mit der Aufschrift GERÄTELAGER vorbei. Die meisten Bäume hier waren Eichen, Birken und Buchen. Als sie das Schild Oak Ridge Lodge sah, wußte sie, daß sie bald am Ziel war.
Das Fahrzeug der Spurensicherung stand halb auf dem Rasen, halb auf dem Weg. Die Angehörigen des Teams – sie trugen blaue Overalls mit der Aufschrift POLIZEI auf dem Rücken und schwere Brandschutzstiefel an den Füßen – waren noch mit ihren Routinearbeiten beschäftigt. Sonora stellte ihren Wagen hinter einem bronzefarbenen Ford Taurus ab – dem Dienstwagen, der ihr und ihrem Partner zur Verfügung stand – und nahm eine neue Kassette, ihr Notizbuch und ein Formular »Tatort-Untersuchungsbericht« aus dem Handschuhfach.
Sie zog es stets vor, sich dem Tatort aus einiger Entfernung zu Fuß zu nähern – langsam hingehen und dabei jedes Detail sorgfältig ins Auge fassen. Sie kam am Kombi des Feuerwehrchefs und an Streifenwagen vorbei. Wieder dachte sie an Mark Daniels. Warum war er hierhergefahren? So weit weg vom Cujo’s und dem Mount Adams. Und noch weiter weg von Kentucky.
Sie legte im Gehen eine neue Kassette in den Recorder, knüllte die Zellophanhülle zusammen und steckte sie in die Jackentasche.
Wie hatte die Mörderin den Tatort verlassen? Zu Fuß? Hatte sie es von langer Hand geplant und einen Wagen vorher hier abgestellt? Hatte sie einen Komplizen? Was war das für eine Frau, die einen zweiundzwanzigjährigen Jungen ans Lenkrad seines Wagens fesselt, ihn mit brennbarer Flüssigkeit übergießt und dann ein Streichholz dranhält?
Die Leute von der Spurensicherung waren in ihrer Arbeit schon weit fortgeschritten, und Sonora, die sonst immer mindestens eine Stunde vor ihnen am Tatort war, hatte das Gefühl, etwas verpaßt zu haben.
Sie zählte die Leute. Der Sergeant, der Coroner, eine Menge Uniformierter.
»Sonora?«
Sie stieg vorschriftswidrig über ein gelbes Absperrband und ging auf einen breitschultrigen, kräftigen Mann zu, dem sein dunkles, weiches Haar in die Stirn fiel. Er hatte blaue Augen und Krähenfüße in den Augenwinkeln, die zu gleichen Teilen auf häufiges Lachen und häufige Sorgen zurückzuführen waren. Seine Gesichtsfarbe war dunkelbraun, und er wirkte sehr jungenhaft. Man schätzte ihn regelmäßig jünger, als er war, und bei Frauen löste er stets mütterliche Hätschelgefühle aus.
Er war der Typ Mann, der sich Footballspiele anschaute, der Typ Mann, den man anrufen würde, wenn man nachts bedrohliche Geräusche hörte – atemberaubend normal in einer Welt voller Spinner. Er und Sonora waren seit fünf Jahren dienstliche Partner.
»He, Sam.«
»Wurde langsam Zeit, daß du hier erscheinst, Mädchen.«
»Du riechst nach Rauch.«
»Und du siehst scheußlich aus. Wie steht’s um das Opfer?«
Sonora verzog das Gesicht.
»Tot, nicht wahr?«
Sie nickte. »Zweiundzwanzigjähriger College-Student aus Kentucky. Könnte dein Lieblingsvetter vom Lande sein. Ihr seid doch alle miteinander verwandt in dieser Gegend, nicht wahr?«
»Hat er noch eine Aussage machen können?«
»Er war ans Beatmungsgerät angeschlossen. Nur Ja-/Nein-Fragen.«
Sam nickte und schaute grimmig drein.
»Der Killer war eine Frau«, sagte Sonora.
»Was? Ehrlich?«
»Blondine, braune Augen, glaube ich, aber er ist mir über der präzisen Beantwortung dieser Frage weggestorben. Ich bin da also nicht sicher. Und jung, zwischen fünfundzwanzig und dreißig.«
»Prostituierte?«
»Er sagte nein. Wenn ich es richtig verstanden habe, hat er sie gestern abend zum erstenmal getroffen. Wahrscheinlich in einer Bar. Der Bruder sagt aus, er habe noch ins Cujo’s fahren wollen, als sie sich getrennt haben.«
Sam runzelte die Stirn. »Warum haben sie sich getrennt?«
»Der Bruder mußte heute ziemlich früh zur Arbeit.«
»Cujo’s, hm?«
»Liegt drüben in Mount Adams.«
»Piekfeiner Laden.«
»He, nicht in jeder Bar verkehren nur Cowboys.«
»Laß das nicht deinen Bruder hören.«
Sonora lächelte flüchtig.
»He, Mickey, berichte ihr von deinen wichtigsten Erkenntnissen.«
Ein kleiner Mann mit kräftigen Armmuskeln tauchte unter der rußgeschwärzten Motorhaube des Wagens auf. Sonora schaute durch das Seitenfenster in das ausgebrannte Innere des Wracks, das einmal ein Cutlass gewesen war.
»Rollende Feuerfalle, ansonsten bekannt als Automobil.« Mickey trug eine blaue Jacke mit der Aufschrift DEZERNAT BRANDSTIFTUNG auf dem Rücken und schwere Brandschutzstiefel.
Sonora sog prüfend die Luft durch die Nase ein. »Weiß man schon, was für ein Brandbeschleuniger benutzt wurde?«
»Benzin. Wir werden das im Labor noch mal untersuchen. Ich habe eine Probe.« Er zeigte auf ein verkohltes Stück Gummi unter dem Gaspedal, das sich abgeschält und die Metallrillen im Pedal freigelegt hatte. »In diesen Rillen da haben sich Spuren der Flüssigkeit erhalten, genug, um sie als Beweismittel dem Gericht präsentieren zu können. Das Feuer war höllisch, und die Explosion hat die Windschutzscheibe und das Rückfenster zersplittern lassen.«
»Explosion?«
»Natürlich. Benzin – klar? Das Feuer hat das Glas zum Schmelzen gebracht. Aber alles im Inneren des Wagens ist aus Plastik, und das bedeutet Mineralöl, und das wiederum bedeutet Inferno. Ganz schöner Grill, das kann man wohl sagen.«
»O Gott! Ist es das, was ich rieche?«
»Verbranntes Fleisch«, sagte Sam. »Ganz charakteristisch.« Sonora dachte an die Rinderlende in der Tiefkühltruhe zu Hause. Wahrscheinlich würde sie dort noch eine Weile liegenbleiben.
Mickey ging wieder zur Motorhaube des Wagens, und jeder einzelne Schritt schien ihm weh zu tun. Er war schlichter Feuerwehrmann gewesen, bis er bei einem Nachteinsatz einmal in ein tiefes Loch gestürzt war und sich einen Bandscheibenschaden zugezogen hatte. Die meisten Feuerwehrmänner, die Sonora kannte, verletzten sich nicht bei der direkten Feuerbekämpfung, sondern zogen sich Rückenzerrungen bei der Pflege ihrer Ausrüstung zu oder stürzten eben im Dunkeln in irgendwelche Löcher.
Mickey zeigte unter die Haube. Seine dicken Handschuhe waren voll Ruß.
»Ich habe die Benzinpumpe, den Vergaser und die Verkabelung mehrfach überprüft. Alles klar.«
Sonora fragte sich, was klar war.
»Der Keilriemen ist verbrannt, und vom Lüfter sind nur noch geschmolzene Spuren zu finden.« Er schaute zu ihr hoch. »Wie ich sehe, fasziniert Sie der Blick unter die Motorhaube nicht besonders.«
»O doch, alles fasziniert mich«, entgegnete Sonora schnell.
»Nehmen Sie es nicht persönlich, Mickey«, sagte Sam. »Sie schaut mißmutig drein, weil ihr Bäuchlein ihr weh tut.«
Mickey rieb sich mit dem Unterarm über die Augen. »Da ist noch ’ne Menge Benzin im Tank.«
»Es ist nicht in Brand geraten?« fragte Sonora.
Sam grinste. »Das hab ich ihn auch gefragt.«
»Benzin ist nicht so brennbar, wie man immer denkt«, antwortete Mickey. »Es ist eigentlich dumm, damit Feuer zu legen, denn es ist sehr flüchtig, verdampft schnell. Wenn das Benzin-Sauerstoff-Gemisch stimmt, knallt dir die Flamme ins Gesicht. Nach meiner Erkenntnis haben sich die meisten Brandstifter, die Benzin eingesetzt haben, selbst schwer verletzt. Und doch kann man ein brennendes Streichholz in eine Benzinpfütze werfen, und es passiert gar nichts. Es gibt da viel bessere Sachen.«
»Danke für den Tip«, sagte Sonora.
»Das Feuer ist nicht richtig an den Tank rangekommen. Und anders, als man das im Fernsehen immer sieht, explodiert der Tank nicht notwendigerweise. Es sei denn, man fährt einen Pinto oder wird gerade von NBC gefilmt.«
»Sie gehen davon aus, daß der Killer Benzin aus dem Tank benutzt hat, um das Feuer zu entfachen?«
»Ich halte das für möglich. Er hat verdammt viel Sprit eingesetzt. Tatsache ist, daß wir auf dem Boden direkt neben dem Einfüllstutzen des Tanks geschmolzene Plastikmasse gefunden haben. Ich nehme an, er hat einen Plastikschlauch zum Absaugen benutzt.«
Sonora sah Sam an.
Mickey hob die Hand. »Noch was. Wir haben im Wagen den Rückstand von einem dünnen Seil oder einer Wäscheleine oder so was gefunden und Asche von demselben Material außerhalb des Wagens.«
»Auch Reste von einem Knoten?«
Sam schüttelte den Kopf. »Da war kein Knoten.«
»Sieht so aus, als ob der Killer das Seil als eine Art Docht, sozusagen als Zündschnur, benutzt hätte. Er hat es draußen angezündet und vorher irgendwo am Fahrersitz festgebunden …«
»An Daniels festgebunden«, fiel Sam ihm ins Wort.
Mickey nickte. »Durchaus möglich.« Er deutete auf das zerschmolzene Lenkrad. »Dort hat das Feuer angefangen. Sehen Sie die Birne der Innenbeleuchtung da oben?«
Sonora schaute hin. Die Birne war seltsamerweise noch ganz. Die Fassung, die zur Fahrerseite zeigte, war jedoch geschmolzen. Sie starrte die Birne an, aber Mickey war ungeduldig und lenkte ihre Aufmerksamkeit auf den verheerenden Ursprung des Feuers auf der Fahrerseite des Wagens.
»Hier ist der Ausgangspunkt des Feuers. Da hat’s am längsten und intensivsten gebrannt. Sehn Sie das?«
Zwei gekrümmte, geschmolzene Metallbögen hingen an dem Klumpen, der einmal das Lenkrad gewesen war.
»Handschellen, jetzt fast verflüssigt.«
Sonora biß sich auf die Lippe. Sie mußte an Mark Daniels denken, an seine verkohlten Hände, die geballte Kinderfaust, das Weiße der Handknochen.
»Sind Sie sicher, das auch einer Jury beweisen zu können?«
»Kein Problem. Man kommt zum Tatort und sieht, was passiert ist. Ich erkenne, was hier abgelaufen ist.«
»Ist alles auf Video?«
»Ja, alles.«
Sonora schaute auf den Dreck aus Asche und Löschschaum im vorderen Teil des Wagens. »Zu schade, daß ihr Kerle immer den Tatort verhunzt.«
»Ja, Feuerwehrleute sind solche rücksichtslosen Bastarde. Die meinen immer, es wäre ihr Job, Brände zu löschen.«
Sam steckte eine Zigarette in den Mund und schaute mit dem ruhigen, konzentrierten Blick, der bei Vernehmungen – und ganz allgemein bei Frauen – Wunder bewirkte, ins Innere des Wagens.
Sonora kreuzte die Arme vor der Brust und sah Mickey an.
»Übrigens, Sie sprachen immer von einem Mann als Täter. Es war aber eine Frau.«
Mickey schaute sie verblüfft an. »Eine Frau hat das gemacht?« »Überrascht, was?«
Er zuckte mit den Schultern. »Wenn ich so richtig darüber nachdenke, eigentlich nicht. Ich bin lange genug verheiratet.«
Sam nahm die nicht angesteckte Zigarette aus dem Mund und rollte sie zwischen den kräftigen, schwieligen Fingern.
»Rauch ja nicht an meinem Tatort«, sagte Sonora.
»Deinem Tatort? Ich hab sie ja gar nicht angesteckt, ich will nur den Tabak riechen. Da ist der Sergeant. Sieht aus, als ob er dich sucht, Mädchen.«
»Einen Moment noch. Terry?«
Eine Frau im Overall kam aus dem Gebüsch etwa hundert Meter vom Wagen entfernt. Sie hatte langes, schwarzes, nachlässig zurückgebundenes Haar und breite, vorstehende Wangenknochen, die von ihrer indianischen Herkunft zeugten, trug eine Brille mit schwarzem Rand und bewegte sich mit der gedankenverlorenen, verwirrten Abwesenheit, die Sonora stets mit College-Professoren in Verbindung brachte, welche sich auf hohe Forschungszuschüsse abstützen konnten.
Sie sah Sonora an und blinzelte. »Fußabdruck.«
Eine Welle der Erregung stieg in Sonora auf. »Sie haben einen Fußabdruck gefunden?«
Terry schob ihre Brille höher auf die Nase und hinterließ dabei eine Schmutzspur auf der Stirn. »Ja, einen kleinen, eine Frau in hochhackigen Schuhen. Und das ist doch komisch, hier draußen im Wald. Hatte der tote Mann jemanden dabei?« »Seine Mörderin«, sagte Sonora.
Kapitel 5
Im Department nannte man Sergeant Crick »die Bulldogge«.
Er winkte Sonora mit gekrümmtem Zeigefinger zu sich und verschränkte dann die Schinken ähnelnden Arme vor der tonnenweiten Brust – ein Buddha in Warteposition. Gegen einen dunkelblauen Dodge Aries, seinen Dienstwagen, gelehnt, machte er keinen besonders glücklichen Eindruck. Sein Körper sah wie der eines zu fett gewordenen Boxers aus, sein Gesicht war stets rot und so verbiestert, daß darüber spekuliert wurde, ob er am Anfang seiner Polizeikarriere einmal mit einem Schaufelblatt voll im Gesicht getroffen worden sei. Gerüchten zufolge arbeitete er an freien Sonntagen in der Kindertagesstätte seiner Kirchengemeinde. Die Leute fragten sich, ob er den Kindern wegen seines Aussehens nicht Angst einjagte.
Lockere deinen Schlips, dachte Sonora, dann wird auch deine Stimmung besser.
»Ich höre jetzt hoffentlich von Ihnen, daß Sie noch eine Aussage des Opfers auf dem Totenbett bekommen haben, Blair.« Cricks Stimme war tief, wie man es bei seinem Körperbau nicht anders erwartete, darüber hinaus aber auch angenehm sonor, wenn er sich darum bemühte. An freien Abenden sang er in einem Freizeitquartett.
Sonora lehnte sich leicht gegen Sam. »Bei dem Killer handelt es sich um eine Frau, Weiße, blondes Haar, wahrscheinlich braune Augen und jung, zwischen fünfundzwanzig und dreißig. Daniels hat sie erst gestern abend kennengelernt. Er wurde nach Aussage seines Bruders letztmals gesehen, als er sich auf den Weg zu einer Bar namens Cujo’s machte. Der Bruder ist übrigens der Besitzer des Wagens.«
»Er hat den Wagen des Bruders, aber der Bruder fährt nicht mit ihm? Das gefällt mir irgendwie nicht.«
Sam trat mit gespielter Überraschung einen Schritt zurück. »Na, jetzt aber, Sergeant. Ich hab ja Typen getroffen, die ohne weiteres ihren Bruder umbringen würden, allerdings nicht, wenn dabei ihr eigener Wagen zu Schrott geht.«
Sonora fuhr fort: »Terry hat einen Fußabdruck gefunden. Sie macht gerade einen Gipsabdruck.«
»Gut.« Crick kratzte sich an der Nasenspitze. »Cujo’s, hm?
Blöder Name für eine Bar.«
»Ja, Sir.«
»Delarosa?«
Sam richtete sich auf. »Das Opfer war nackt und mit Handschellen ans Lenkrad des Wagens gefesselt.«
»Sind Sie sicher, daß der Mann nackt war?«
»Die Leute, die ihn rausgeholt haben, sagen das. Und ich habe Mickey gefragt. Keine Anzeichen von verbranntem Stoff auf dem Fahrersitz, kein Gürtelschloß, keine Metallösen, kein verbrannter Gummi von Schuhen. Ich weiß nicht, wo die Kleider des Mannes sind, aber es sieht nicht so aus, als ob sie im Wagen gewesen wären.«
»Interessant. Weiter.«
»Teile eines Seils oder einer Wäscheleine wurden außerhalb des Wagens gefunden. Mickey meint, sie hat den Mann ans Lenkrad gefesselt, das Seil – oder was auch immer es war – durch das Lenkrad gezogen, um Daniels geschlungen, dann aus dem Fenster raushängen lassen und draußen angezündet. Der Brandbeschleuniger war anscheinend Benzin. Sieht so aus, als ob sie es aus dem Tank des Wagens geholt hätte. Mickey hat auch einen kleinen geschmolzenen Metallklumpen gefunden, von dem er annimmt, es sei mal ein Schlüssel gewesen. Ein kleiner Schlüssel.«
»Von einem Schließfach? Einem Schrank oder Spind?«
Sam zuckte mit den Schultern. »Könnte zu allem möglichen passen.«
»Sind Wagenschlüssel gefunden worden?« fragte Crick.
»Bisher noch nicht. Aber der Wagen ist an vielen Stellen noch verdammt heiß und voll mit Löschschaum. Die Schlüssel könnten irgendwo im Auto liegen, nur nicht an einer ins Auge fallenden Stelle.«
Sonora sah Sam an. »Sie hat die Schlüssel – mit Daniels auf dem Fahrersitz – bestimmt nicht in der Zündung steckenlassen. Selbst in Handschellen hätte er vielleicht den Motor starten können.«
Sam nickte. »Jedenfalls, sie fesselt ihn ans Lenkrad, schlingt das Seil um ihn und übergießt ihn mit Benzin. Das Seil hängt ungefähr zwei Meter aus dem Wagen, und sie steht an seinem Ende, denn sonst würde sie sich selbst mit in die Luft jagen. Die Fenster sind offen, es kommt also genug Sauerstoff in den Wagen. Sie steckt das Ende des Seils an, und Daniels sitzt da und muß zusehen, wie sich ihm das Feuer nähert. Dann macht’s wumm, und der Wagen steht in hellen Flammen.«
Sonora kratzte sich am Kinn. »Der Fußabdruck ist klein, von einer Frau in hochhackigen Schuhen. Wo ist sie in solchen Schuhen hingegangen? Wie schnell konnte sie gehen?«
»Vielleicht hat sie später die Schuhe gewechselt«, meinte Sam.
Sonora nickte. »Ich frage mich, ob sie ihren Wagen hier in der Gegend abgestellt hatte? Wir müssen den Park absuchen und die Nachbarn ringsherum befragen.«
Jetzt nickte Crick zustimmend. »Ich kümmere mich darum, daß wir die Leute dafür kriegen.«
»Gibt es irgendwelche Zeugen?« fragte Sam.
»Keinen einzigen. Der Anruf, der bei uns einging, war anonym und kam von der Telefonzelle am Haupteingang des Parks.«
»Mann oder Frau?« fragte Sonora.
»Mann.« Crick sah erst sie, dann Sam an und zupfte an seinem Ohrläppchen. »Also, ich sorge für ein Suchkommando und kümmere mich um die Befragung der Anlieger. Sie beide fahren zu dieser Bar. Wahrscheinlich hat Daniels die Frau dort aufgegabelt.«
Sonora preßte die Lippen aufeinander. »So ist’s recht! Gleich sagen Sie auch noch, Daniels hätte zu enge Jeans getragen und sein Hemd bis zur Hüfte aufgeknöpft gehabt.«
»Was soll das denn heißen?«
»Wer hat wen ›aufgegabelt‹, Sergeant? Sie hatte Handschellen und ein Seil dabei, und sie hatte, darauf möchte ich wetten, einen Fluchtwagen hier in der Gegend abgestellt. Wir reden ja wohl nicht von Vergewaltigung einer zufällig ›aufgegabelten‹ Frau und deren anschließender Rache, oder doch? Diese Frau war auf Mord aus. Diese Frau war hinter ihm her.«
Sonora zuckte zusammen. Ihr Magengeschwür meldete sich mit einem Stechen, das ein wenig an nagenden Hunger erinnerte, dann aber nur noch aus Schmerz bestand.
Sie sah Sam an. »Ich lasse meinen Wagen hier, du fährst, okay?«
Sam langte in seine Jackentasche, zog ein Päckchen Red-Man-Kautabak heraus und stopfte sich etwas davon in den Mund. »Du siehst irgendwie deformiert aus. Als ob du einen Tumor unter deiner Wange hättest.«
Sam neigte sich auf dem Fahrersitz zur Seite, griff in die andere Jackentasche und holte ein zerdrücktes, zylinderförmiges, in Papier und Zellophan gewickeltes Päckchen heraus, auf dessen Vorderseite kleine Erdbeeren abgebildet waren. Er warf das Päckchen in Sonoras Schoß.
»Fütter dein Magengeschwür.«
»Je weniger ich esse, um so schlechter fühle ich mich, aber je schlechter ich mich fühle, um so weniger mag ich essen.«
»Das war zu kompliziert für mich.« Sam startete den Wagen, wendete und fuhr aus dem Park.
Sonora wickelte das Päckchen auf, löste die getrocknete Frucht von der Folie und rollte diese zu einem Röhrchen zusammen. »Seit wann ißt du die denn?«
»Ich kaufe sie für Annie, die ist ganz wild darauf. Sie will damit versuchen, ein bißchen zuzunehmen.«
»Ich dachte, sie hätte ein oder zwei Pfund zugenommen, als ich sie zum letztenmal gesehen habe. Wann war das – vor zwei Wochen?«
Sam lächelte nicht, aber in seinen Augen war ein warmer Ausdruck, als ob er Sonora für ihre Worte dankbar wäre. Annie war sieben, klein für ihr Alter und so dünn, daß ihrem Vater fast das Herz brach. Als sie einen Monat im Kindergarten hinter sich hatte, war bei ihr Leukämie diagnostiziert worden, und Sam hatte sich damals kopfüber und unbesonnen auf einen wichtigen Fall gestürzt, von dem er Sonora nur bei langweiligen Überwachungsaufgaben oder nach ein paar Drinks erzählte. Er hatte dabei keinen Partner gehabt und die Sache gründlich vermasselt, was dazu geführt hatte, daß er sich mit seinem jetzigen Dienstgrad zufriedengeben mußte. Er würde nicht mehr befördert werden. Wenn Crick sich nicht für ihn eingesetzt hätte, wäre er sogar gefeuert worden. »Wie geht es Annie denn nun?«
»Sie wird zu schnell müde. Shel und ich machen uns Sorgen, denn sie verliert außerdem Gewicht, was nicht sein dürfte, und die Zahl der weißen Blutkörperchen geht wieder hoch.« Sam spuckte eine Ladung Tabak aus dem Wagenfenster. »Kein kleines Mädchen sollte Ringe unter den Augen haben, wie das bei Annie der Fall ist.«
Sonora schaute ihren Partner prüfend an und entdeckte neue Falten in dem müden Gesicht. Die beiden letzten Jahre waren schwer für ihn gewesen – den Job durchzustehen und sein kleines krankes Mädchen am Leben zu erhalten.
»Sie ist schrecklich geschwächt.«
»Annie oder Shel?«
»Im Grunde beide. Nun iß endlich deine Erdbeerrolle.«
Sonora knetete die Rolle aus getrockneten Erdbeeren, Maissirup und rätselhaften Chemikalien zu einem kleinen Ball. Sam hielt vor einer roten Ampel an und schaute trübsinnig durch die Windschutzscheibe.
»Bei dem Killer handelt es sich also um eine Frau, hm?«
»Ja, und sie hat das nicht zum erstenmal gemacht«, antwortete Sonora.
Sam spuckte wieder einen Klumpen Tabak zusammen mit schmutzigbraunem Saft aus dem Seitenfenster. »Der Streifenwagen muß sie ganz knapp verpaßt haben. Vielleicht haben die Cops noch was von der Tat mitgekriegt.«
»Ich habe mit dem Streifenpolizist, der als zweiter ankam, im Krankenhaus gesprochen. Er hat nichts als das Feuer gesehen. Der erste am Tatort – sein Name ist Minner – hat versucht, Daniels noch aus dem Wagen zu ziehen. Aber du hast recht, wir sollten das überprüfen. Minner war noch bewußtlos, als ich das Krankenhaus verließ.«
Sam sah sie an. »Was hast du eben gemeint, als du gesagt hast, sie hätte das nicht zum erstenmal gemacht? Die Mörderin?«
»Es war gut geplant und perfekt ausgeführt.«
»Wir haben bis jetzt aber doch kaum mehr getan, als ein bißchen in der Sache rumgestochert.«
»So weit, so gut, okay? Wir haben es nicht mit einer Anfängerin zu tun, sondern mit einem professionellen weiblichen Killer.«
»Der kurzentschlossen zuschlägt?«
»Nein, nicht so. Mit geradezu liebevoller Vorbereitung und Planung. Wie jemand, der Spaß an der Sache hat.«
»Also so was wie ein psychopathischer Serienmörder.«
»Nein, Mann, nicht psychopathisch – ich glaube, daß ein ganz normaler Mensch Daniels in Brand gesteckt und so getötet hat.«
»Eine Frau, hast du gesagt.«
»Auch Frauen können Serienmörder sein.«
»Ja natürlich, Sonora. Ich wette, deine Mama hat dir in ihrer Erziehung freie Hand gelassen, was du einmal werden willst. Es gibt, denke ich, ebenso viele weibliche Serienkiller, wie es weibliche Kriminalbeamte gibt.«
»Meinst du, es würde so eine Art Grenze für Mörder existieren? Ich setze auf unser bewährtes System, Sam – nachprüfen, ob es ähnliche Fälle auch schon in den Zuständigkeitsbereichen anderer Mordkommissionen gegeben hat.«
»Und ich setze auf den Bruder oder die Ehefrau.«
»Es gibt keine Ehefrau, nur eine Freundin. Der Bruder – nein, Sam. Das glaube ich nicht.«
»Okay, Sonora, dann schauen wir uns doch mal die Freundin an. Oder fassen eine Prostituierte ins Auge. Denke an Sadomasochismus, der aus dem Ruder gelaufen ist.«
»Okay. Weißt du, was mir Sorgen macht?«
»Ich kenne drei Dinge, die dir Sorgen machen – Autoreparaturen, Collegegebühren und Zahnärzte.«
»Die rufen Entsetzen bei mir hervor. Ich rede aber von Sorgen, die diesen Fall betreffen. Ich wäre sehr beruhigt, wenn Mickey einen geschmolzenen Klumpen finden und sagen würde, es seien die Wagenschlüssel.«
»Was ja noch kommen kann.«
»Sie hat die Kleider mitgenommen und möglicherweise auch die Schlüssel. Das heißt Keaton Daniels’ Schlüssel – Autoschlüssel und vielleicht auch Haustürschlüssel.«
»Was könnte sie mit den Schlüsseln anfangen?«
»Sie könnte die Zulassung des Wagens mit allen Angaben über den Besitzer an sich genommen haben.«
»Man sollte den Bruder warnen.«
»Das werde ich tun. Und bei der Gelegenheit werde ich ihm sagen, er soll seine engen Jeans zu Hause lassen und sein Hemd bis obenhin zuknöpfen.«
»Ich versuche mich zu erinnern, ob du vor deinem Magengeschwür auch schon so giftig warst.«
Kapitel 6
Sie waren auf halbem Weg nach Mount Adams, als Sonoras Mobiltelefon piepste.
»Ich wette, Heather hat den Schulbus verpaßt«, murmelte sie.
»Hallo? Hi, Shelly. Für dich, Sam, deine Frau.«
Er nahm das Telefon.