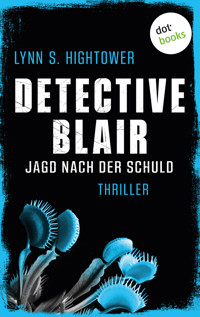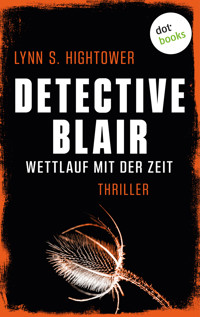
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Sonora Blair ermittelt
- Sprache: Deutsch
Kann sie das entführte Mädchen retten? Der fesselnde Thriller »Detective Blair – Wettlauf mit der Zeit« von Lynn S. Hightower als eBook bei dotbooks. Die 15-jährige Joelle ist zu einem Reitausflug aufgebrochen – und nie zurückgekehrt. Alles, was das Suchteam findet, sind Reifenspuren, ein Reitstiefel … und Blut, viel zu viel Blut. Sonora Blair, Detective bei der Polizei von Cincinnati, weiß: Jede Minute, die ergebnislos verstreicht, kann den Unterschied zwischen Leben und Tod des Mädchens bedeuten. Doch keiner der Nachbarn und Bekannten von Joelles Familie will kooperieren: Warum verschanzen sie sich hinter einer Mauer aus Schweigen? Erst als das Pferd des Mädchens bei einer Auktion auftaucht, gelingt es Sonora, eine Spur zu finden. Aber die Wahrheit hinter der Entführung ist verstörender als alles, was Sonora in ihrer Laufbahn als Polizistin erlebt hat … »Scharfsinnig, schockierend und schamlos zufriedenstellend!« Bestsellerautorin Val McDermid Jetzt als eBook kaufen und genießen: der packende Thriller »Detective Blair – Wettlauf mit der Zeit« von Lynn S. Hightower ist der dritte Band ihrer Reihe um Cincinnatis tougheste Polizistin, Sonora Blair! Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 438
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Die 15-jährige Joelle ist zu einem Reitausflug aufgebrochen – und nie zurückgekehrt. Alles, was das Suchteam findet, sind Reifenspuren, ein Reitstiefel … und Blut, viel zu viel Blut. Sonora Blair, Detective bei der Polizei von Cincinnati, weiß: Jede Minute, die ergebnislos verstreicht, kann den Unterschied zwischen Leben und Tod des Mädchens bedeuten. Doch keiner der Nachbarn und Bekannten von Joelles Familie will kooperieren: Warum verschanzen sie sich hinter einer Mauer aus Schweigen? Erst als das Pferd des Mädchens bei einer Auktion auftaucht, gelingt es Sonora, eine Spur zu finden. Aber die Wahrheit hinter der Entführung ist verstörender als alles, was Sonora in ihrer Laufbahn als Polizistin erlebt hat …
»Scharfsinnig, schockierend und schamlos zufriedenstellend!« Bestsellerautorin Val McDermid
Über die Autorin:
Lynn S. Hightower wurde in Tennessee geboren und lebt heute in Kentucky. Sie studierte Journalismus sowie Kreatives Schreiben. Um ihren Romanen authentischen Charakter zu geben, beobachtet sie die Arbeit der lokalen Mordkommission aus nächster Nähe, begleitet Streifenbeamte und war Zeugin von Autopsien. 1994 gewann sie den renommierten Shamus Award.
Lynn S. Hightower veröffentlichte bei dotbooks bereits »Detective Blair – Spiel mit dem Feuer«, »Detective Blair – Kampf mit dem Gesetz«, »Detective Blair – Jagd nach der Schuld«.
Die Website der Autorin: lynnhightower.com
***
eBook-Neuausgabe Februar 2022
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1998 unter dem Originaltitel »No Good Deed« bei Delacorte Press, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 1999 unter dem Titel »Tödlicher Ritt« bei Droemer Knaur.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1998 by Lynn S. Hightower
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1999 der deutschsprachigen Ausgabe Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., München
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Charly Thisbe
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ae)
ISBN 978-3-98690-281-0
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Detective Blair 3« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Lynn S. Hightower
Detective BlairWettlauf mit der Zeit
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Frauke Czwikla
dotbooks.
Für Wendell Berry
»Ich verrate Ihnen was; das ganze Pferdegeschäft hat mehr mit Betrug zu tun, als jeder es vom Autohandel annimmt.«
Doug Campbell
Autohändler und Pferdebesitzer
Kapitel 1
Zum ersten Mal sah Sonora die Farm, als es dämmerte und Pferde in den Koppeln herumtrabten. Nichts wies auf einen Ort hin, wo fünfzehnjährige Mädchen ein Pferd für einen Nachmittagsritt satteln und niemals zurückkehren ‒ obwohl Sonora nicht wußte, wie solch ein Ort aussehen sollte. Mädchen und Pferd waren nachmittags gegen drei Uhr dreißig verschwunden.
Das Kind war nicht spurlos verschollen. Es hatte eine Blutlache und einen abgetragenen Reitstiefel hinterlassen. Sonora steuerte den Geländewagen vom dunklen Band der Landstraße auf die staubige Zufahrt zur Pferdefarm. Der Himmel war so blau und schwarz wie ein Bluterguß. Es würde bald dunkel sein.
Grobkörniger Staub wurde von Reifen aufgewirbelt, die dringend erneuert werden mußten. Der Geländewagen knallte in ein Schlagloch und stauchte Sonoras Rücken. Neue Stoßdämpfer wären auch keine schlechte Idee. Sobald Gott und Visa es erlaubten.
Drei Streifenwagen parkten in einem merkwürdigen Winkel am Ende der Zufahrt, und blaue Blinklichter flackerten über die Front eines verwitterten Stalls mit zwanzig Boxen.
Pferde schauten heraus. Licht strahlte aus den winzigen vergitterten Boxenfenstern.
Sonora parkte den Geländewagen neben einem goldfarbenen Taurus. Sam war also mit dem Dienstwagen da. Vielleicht hatte er das Rätsel gelöst.
Sie schob die Automatik auf Parken, stieg aus, ließ die Türen unverschlossen und hielt kurz inne, um einen Blick auf die Gebäude der kleinen Zehn-Hektar-Farm zu werfen. Die Zäune waren in einem schlechtem Zustand ‒ etliche Latten zerbrochen, ganze Teile durchgesackt und der Anstrich von der Sonne und den Jahreszeiten von Schwarz zu Grau gebleicht. Sonora nahm an, daß die Pferde nur auf den Koppeln blieben, weil sie es so wollten.
Ein elektrisches Knistern lag in der Luft, wie vor einem Tornado oder bei Anbruch des Herbstes. Sonora ahnte Regen und kühle Luft ‒ eine willkommene Abwechslung zu der Hitze eines widerlichen, insektenverseuchten Sommers mit Ameisen in der Küche, Mücken in der Nacht und Silberfischchen im Badewannenabfluß.
Irgend etwas war den Pferden auf der vorderen Weide nicht geheuer und ließ sie mit hocherhobenen Köpfen und Schweifen über das spärliche Gras und die Unkrautbüschel galoppieren.
Wie hundemüde war sie noch vor einer halben Stunde gewesen, kurz vorm Zusammenbruch und voller Horror vor der langen Fahrt von Downtown Cincinnati zu den Vororten von Blue Ash, als sie ihr Bargeld zählte, um den Kindern eine Pizza mitzubringen. Die kalte Luft hatte sie wiederbelebt.
Sie sah auf ihre Uhr. Neunzehn Uhr. Ihre Kinder würden hungrig bleiben.
Kapitel 2
Ein Streifenpolizist stand vor der Bürotür, der gelangweilt, aber wachsam aussah. Sonora ließ ihren Ausweis sehen, und der Mann verließ seinen Posten und trat zu ihr. »Officer Renquist, Ma’am. Detective Delarosa bat mich, Ihnen zu sagen, daß er sich draußen am Tatort aufhält ‒«
»Haben wir eine Leiche?« fragte Sonora.
»Nein, Ma’am. Nur Blut.«
Renquist war ein älterer Mann mit roten Wangen, die auf zu hohen Blutdruck schließen ließen. Er hatte eine Menge Fältchen um die Augen, ob Lach- oder Sorgenfalten, konnte Sonora nicht sagen. Er war eher korpulent, würde aber in einem Pullover knuffig wirken. Er erinnerte Sonora an ihren Lieblingsonkel, der immer ihre Milch für sie getrunken hatte, wenn ihre Mutter nicht hinsah. Renquist sah müde, aber konzentriert aus. Es passierte nicht jeden Tag, daß er in einen Mordfall hineingeriet.
Sonora rieb sich den Nacken. »Viel Blut?«
»Eine Menge.«
Sonora blickte über ihre Schulter auf die Ansammlung von Kombis und Geländewagen, die rund um die Streifenwagen geparkt waren. »So viele Leute hier. Wer sind sie?«
»Der Vater des Mädchens ‒«
»Wie war gleich noch ihr Name?«
Der Officer schlug sein Notizbuch auf, sah aber nicht hinein. »Joelle Chauncey. Ihr Vater, ein gewisser Dixon Chauncey, kam gegen halb sechs von der Arbeit ‒ er lebt auf dem Anwesen, in einem Wohnwagen mit zwei weiteren Kindern ‒ jedenfalls, er kommt nach Hause und stellt fest, daß seine älteste Tochter Joelle ausgeritten und nicht zurückgekehrt ist. Sie haben zu suchen angefangen, aber Mädchen und Pferd waren weg.«
»Weg? Verschwunden, einfach so?«
»Wie weiß ich nicht, Ma’am. Aber das Mädchen und das Pferd sind weg, und es gibt eine Menge Blut.«
»Wo ist der Vater jetzt?«
Renquist wies mit dem Kopf in Richtung Bürotür. »Da drin, zusammen mit einigen Leuten, die hier reiten. Die Lady, die den Laden schmeißt, gibt Reitstunden und nimmt Pferde in Pflege.«
»Ist sie hier irgendwo?«
»Sie war draußen am Tatort, um mit Detective Delarosa zu sprechen, aber ich glaube, ich habe sie vor ein oder zwei Minuten im Stall gesehen. Ihr Name ist Donna Delaney.« Er hatte die Frage beantwortetet, bevor sie sie stellen konnte. Erfahrung war eine wunderbare Sache. »Lassen Sie mich eine Minute mit dem Vater sprechen.«
Die Bürotür war angelehnt, und Renquist beugte sich vor und riß sie auf. Ein Windzug strich über Sonoras Haar und ließ ein Windspiel, einen Kreis von Zinnpferdchen, das außerhalb der Tür hing, erklingen.
Der Vater war leicht zu erkennen.
Chauncey saß zurückgelehnt auf der Couch, die Knie zusammengepreßt, und sein Kinn zitterte von der Anstrengung, nicht zu weinen. Vermutlich hatte er sich am Morgen rasiert, aber er gehörte zu jenen Männern, die zweimal täglich eine Rasur benötigen, um präsentabel zu bleiben.
Er wurde von zwei Frauen flankiert, Mütter von Reitschülern, schätzte Sonora. Neben ihm sitzend, boten sie ihm den Trost ihrer Gegenwart, als Gegenleistung, daß sie, wenn auch nur am Rande, an einer zwar tragischen, aber faszinierenden Sache teilhaben durften.
Wenn sie eher Bescheid gewußt hätten, hätten sie sicherlich Backwaren und Schinken mitgebracht.
Chauncey rutschte auf der Couch nach vorn und erhob sich schnell, um Sonora die Hand zu schütteln. Er mochte vielleicht außer sich sein vor Sorge, aber seine Manieren vergaß er nicht.
»Police Specialist Blair. Sie sind Dixon Chauncey?« Sonora zeigte ihm ihre Marke, weil sie wußte, daß es ihn beruhigen würde. Sie fragte sich, warum er nicht draußen bei den Polizisten war, um seine Tochter zu suchen.
»Ja, Ma’am. Ich bin Joelles Vater.«
Seine Knie zitterten, und er stolperte vorwärts. Das beantwortete die Frage, warum er nicht draußen war.
Sonora nahm seine Hand und führte ihn zur Couch zurück. »Setzen Sie sich, Mr. Chauncey.«
Er gehorchte sofort.
Er hatte sicherlich nicht mehr als fünfzehn oder zwanzig Pfund Übergewicht, die gar nicht aufgefallen wären, wenn er sich ein bißchen vernünftiger angezogen hätte. Das hatte er aber nicht. Er trug enge Hosen, die an seinen Hüften spannten und einige Zentimeter zu kurz waren. Wahrscheinlich hatten sie vor dem ersten Waschen perfekt gesessen.
Er hätte attraktiv sein können, war es aber nicht. Das am wenigsten Gewinnende an ihm war seine Haltung, der Rücken gekrümmt, die Schultern gebeugt und abfallend, die Arme angewinkelt wie Popeye. Er trug ein kurzärmeliges, kariertes Hemd und hatte eine Packung Marlboro in der Brusttasche. Sein Haar war so schwarz wie Schuhcreme, aber matt, als hätte er es gefärbt. Es wirkte auf seinem Kopf wie eine Plastikhaube. Sonora vermutete, daß er es täglich mit Wasser glattkämmte.
»Haben Sie schon meinen Kollegen, Detective Delarosa, getroffen? Er war vor mir da. Er fährt schneller als ich.« Sonora lächelte freundlich, während sie mit ihm sprach, und fühlte, wie die Spannung im Zimmer nachließ. Die Reitermuttis schauten sie zustimmend und erleichtert an, und Chauncey brachte ein schüchternes Halblächeln zustande.
Laß ihn wissen, daß ein Mann den Fall bearbeitet, dachte Sonora, möglicherweise gehört er zu den Leuten, die Wert auf das Geschlecht der Polizisten legen. Mach den Eindruck von kompetenter Professionalität und lockere ihn mit »ich bin ein ganz normaler Typ« auf.
Vertrauen und ein bißchen Trost für ihn, etwas, woran er sich festhalten konnte, während sie die Leiche seiner Tochter fanden und entschieden, ob er etwas damit zu tun hatte. Auf jeden Fall sahen seine Tränen echt aus.
Die Tür, die in den Stall führte, wurde heftig aufgestoßen und streifte Sonora am Ellbogen. Sie hörte ein Pferd wiehern und schnauben, dann ein hämmerndes Geräusch, als ob das Pferd scharren würde.
»Schluß damit, oder du mußt raus.« Eine Frauenstimme. Schroff. Der Tonfall klang nach Chicago ‒ nach Mittlerem Westen auf jeden Fall.
Das Pferd war sofort still, ebenso wie jeder andere im Raum.
Die Frau stand im Türrahmen und starrte sie alle an. Sie erzeugte eine Atmosphäre der Wachsamkeit, so etwa wie »Paß auf, was du tust«. Ihr Kinn war spitz, ihr Gesicht fast mager und ihr Haar strohblond, weil sie es sich wert war. Sie trug nur wenig Make-up auf ihren ausgeprägten Gesichtszügen. Sie war fast hübsch, wenn man den herben Typ mochte. Ihre Augen, dunkel, flach und abschätzend, wanderten zurück zu Sonora, und sie streckte ihre Hand aus.
»Ich bin Donna Delaney. Mir gehören diese Farm und das Büro.«
Winzige Falten, halbkreisförmige Furchen wie Hufabdrücke, umgaben ihre Mundwinkel. Sie hatte dünne scharfe Lippen und trug Jeans und ein locker sitzendes Flanellhemd. Sie war schlank, und die Jeans standen ihr gut. Sie kratzte ihre Füße an der Türschwelle ab. Sie steckten, lang und schmal, in mit Schlamm, Dung und Spänen verkrusteten Gummistiefeln. Ihr Hals und ihre Schultern waren dunkelbraun, die ständige Bräune einer Frau, die, ungeachtet der Hitze, viel Zeit im Freien verbringt.
»Detective Blair«, erwiderte Sonora.
»Also sind Sie zu zweit hier. Ich habe bereits mit dem anderen, Delarosa, gesprochen.«
»Ich habe nur ein paar Fragen ‒«
»Ich habe bereits mit Ihrem Partner gesprochen.«
Sonora war sich der atemlosen Spannung der beiden Frauen auf der Couch bewußt. »Tatsächlich?« Sie lächelte träge. »Ms. Delaney, haben Sie Joelle Chauncey heute nachmittag gesehen?«
Delaneys Augen wurden schmal, dann drehte sie sich um und ging zur Tür, während sie Sonora einen Blick über die Schulter zuwarf. »Die Fütterungszeit ist bereits vorüber, und meine Pferde sind hungrig. Wollen Sie mich begleiten, während ich arbeite?«
»Ich würde Sie nicht lange aufhalten.«
Delaney zögerte.
»Ich kann sie füttern, Donna.« Chauncey erhob sich erneut, dann stützte er sich an der Wand ab. Seine Stimme war leise, traurig und tapfer.
»Du kannst ja nicht einmal stehen«, erwiderte Delaney. »Wir machen das.« Die beiden Frauen rutschten von der Couch, sahen sich an und nickten mit den Köpfen. Dies war etwas, womit sie fertig wurden. Sie waren froh, sich nützlich machen zu können.
Delaney schenkte ihnen nur einen Moment Aufmerksamkeit. »Kümmert euch nicht um die Pferde in den hinteren Boxen. Und gebt dem Pony nur ganz wenig. Es ist ohnehin so dick wie ein Schwein.« Sie wandte sich wieder Sonora zu. »Nein. Ich habe Joelle heute nicht gesehen.«
»Waren Sie hier? Wie sieht Ihr üblicher Tagesablauf aus?«
»Ich komme morgens kurz vor acht und bleibe bis ungefähr zwölf Uhr dreißig. Zurück bin ich gegen sechs. Heute ist Dienstag. Dienstagabend gebe ich gewöhnlich Privatstunden. An den anderen Tagen bin ich um vier wieder hier.«
»Ist zwischen Mittag und vier Uhr beziehungsweise sechs Uhr an den Dienstagen irgend jemand hier?«
»Nein. Wenn ich nicht gerade ein Pferd zum Verkauf vorführe oder so was, ist es hier an den Nachmittagen normalerweise völlig ruhig. Es geht erst abends mit den Reitstunden von fünf bis acht Uhr weiter, außer, wie schon gesagt, dienstags. Da sind die Privatstunden. Dann füttere ich die Pferde, versorge sie für die Nacht und gehe nach Hause. Joelle hilft mir gewöhnlich dabei.«
»War es auch eine Gewohnheit von Joelle, nachmittags allein auszureiten?«
»Ja, nach der Schule ritt sie häufig ein bißchen, bevor die Stunden anfingen. Obwohl sie nicht an den Dienstagen reiten sollte, weil dann niemand hier ist. Es ist besser, wenn jemand da ist, der alles im Auge behält. Aber eine meiner Abmachungen mit Dixon ist, daß seine Kinder reiten dürfen. Es ist seine Aufgabe, auf sie aufzupassen, ich bin nicht ihr Babysitter.«
Sonora warf Dixon einen Blick zu, um herauszufinden, wie er Delaneys Gefühllosigkeit aufnahm.
Abwehrend.
»Sie durfte nicht allein reiten«, sagte er hastig.
Sonora sah wieder Chauncey an. »Sie tat es aber trotzdem, oder?«
»Ich hätte strenger mit ihr sein müssen. Aber sie war eine gute Reiterin.«
»Sie hatte sich im Griff«, sagte Delaney. Ein hohes Lob. Joelle war erst fünfzehn, dachte Sonora. Eine Menge Dinge konnten passieren, die eine Fünfzehnjährige absolut nicht im Griff hatte.
Kapitel 3
Dixon Chauncey bestand darauf, Sonora durch den Stall zu führen, als ob sie es nicht allein durch den verdreckten Gang geschafft hätte. Die Reitermuttis zogen eine Schubkarre und schaufelten Futter durch die Gatter der Boxen. Die Pferde wieherten, während sie ungeduldig warteten, und schnaubten, wenn das Getreide in den Trögen landete.
Der Moschusdunst der Pferde mischte sich angenehm mit dem Geruch nach frisch gesägtem Zedernholz, das in einer der Boxen am entgegengesetzten Ende bis zum Stalldach gestapelt war. Sonora fand das Geräusch der kauenden Pferde beruhigend. Sie spähte durch eine der vergitterten Öffnungen.
Das Pferd, kastanienbraun und mager, hob den Kopf nicht von seinem Abendessen. Die Box war voll schwarzem Dreck und Mist, Spinnweben hingen in Strängen von den Balken.
Eine getigerte Hofkatze, so dürr, daß man ihre Rippen zählen konnte, eilte vor Dixon Chauncey davon. Sonora beugte sich abwesend herunter und erwischte ihren Schwanz, eine Handvoll Katzenpelz und Stalldreck, als sie vorübersauste.
Die Stalltore waren geöffnet. Eine Hoflampe warf einen gelblichen Schein auf den unkrautüberwucherten Trampelpfad, der zu einem kleinen Reitplatz führte. Dixon Chauncey deutete auf den erleuchteten Teil der hinteren Weide. Sonora sah die Streifenpolizisten und die Kollegen der Spurensicherung in schweren Stiefeln die Weide auf und ab laufen; einen Mann in Jeans hielt sie für Sam. Es war immer das gleiche, egal wo sie war.
»Wo steht Ihr Wohnwagen?« fragte Sonora.
Chauncey zeigte weit nach links auf die hintere Weide. Licht fiel durch winzige, quadratische Fenster, ähnlich denen des Stalles, nur kleiner.
»Mr. Chauncey, hat Joelle irgendeine Nachricht hinterlassen?«
»Nein, Ma’am, ich glaube nicht.« Er schüttelte seinen Kopf, die Augen weit geöffnet und wachsam. Dies war eine Möglichkeit, die er nicht in Betracht gezogen hatte.
Die Wohnwagentür öffnete sich, und ein kleines Mädchen trat auf die Vordertreppe. Es trug ein verblichenes rotes Sweatshirt und Shorts, obwohl es draußen frisch war. Ihre Schultern hingen herunter, und sie rieb sich die Augen, den Kopf weit zur Seite gedreht. Sonora dachte, sie weine.
»Mr. Chauncey, wie alt sind Ihre Kinder?«
»Sieben, neun und fünfzehn, wenn man Joelle mitzählt.«
Zählen wir Joelle noch mit? fragte sich Sonora. »Sind sie allein?«
Er winkte dem kleinen Mädchen zu, aber es schien ihn nicht zu bemerken. »Ja. Ich muß wirklich los und mich um sie kümmern.«
»Bleiben Sie noch, nur einen kurzen Moment.« Sonora eilte zur Vorderseite des Hofes und rief Renquist. Er lief auf sie zu, was ihn sofort außer Atem kommen ließ. »Die Presse ist im Anmarsch.«
Sonora sah die leere Zufahrt hinunter und fragte sich, woher Renquist das wußte. Ein Auto fuhr mit aufgeblendeten Scheinwerfern auf der zweispurigen Straße vorbei. Es würde bald völlig dunkel sein.
»Sie hören uns ab. Und wir erweisen ihnen den gleichen Gefallen …«
Sonora nickte. »Ich werde jemanden schicken, der die Zufahrt überwacht. Ich will nicht, daß die hier herumstreunen. Sie brauche ich.«
Renquist folgte ihr, als sie zurück um den Stall ging. »Begleiten Sie Mr. Chauncey zu seinem Wohnwagen. Offenbar hat er noch zwei weitere Kinder. Bleiben Sie bei ihm, bis ich rüberkommen kann, um Joelles Zimmer zu durchsuchen. Sagen Sie mir, falls er ihre Sachen durchsieht oder irgend etwas wegnimmt. Seien Sie wachsam. Auf eine mitfühlende Art.«
»Alles klar.«
Sonora hörte am Klang seiner Stimme, daß er verstanden hatte. Er gab ihr seine Taschenlampe, eine große schwarze Mag-Lite, Polizeiausrüstung.
»Es wird bald dunkel sein, Ma’am. Vielleicht brauchen Sie die.«
Dankbar nahm sie sie. Er hielt bestimmt nach einer Beförderung Ausschau. Die Altersdiskriminierung würde ihn ruinieren.
»Danke, Renquist. Sie kriegen sie auf jeden Fall zurück.« Dann drehte sie sich um, die starke Anziehungskraft des Tatorts spürend, und marschierte zu der hinteren Weide und zu Sam. Hinter sich hörte sie Stimmengemurmel, als Renquist sich Chauncey vorstellte, und nahm an, daß die beiden auf dem Weg zum Wohnwagen waren. Chauncey ging wie ein Lamm. Renquist bewegte sich wie einer von den Ledernacken, wahrscheinlich hatte er bei dieser Truppe gedient. Chaunceys Gang war seltsam, er ließ den Kopf hängen. Einen Fuß vorschiebend, den anderen nachschleifend, ergab das ein weiches Schlurfen, was ein geringes Selbstwertgefühl verriet.
Sonora blickte zum Wohnwagen. Das kleine Mädchen war verschwunden. Das Verandalicht, das nur noch schwach leuchtete, flackerte ein letztes Mal auf und erlosch.
Kapitel 4
Das Tor zur Koppel mußte vor etlichen Jahren einmal weiß gewesen sein. Von den durchgerosteten Riegeln hatten sich zwei gelöst; der ganze Mechanismus hing schief, eingekeilt in einen Dreckhaufen. Sonora ging hindurch und trat in kniehohe Büschel aus scharfem Riedgras, Eisenkraut und purpurköpfigen Disteln. Sie trug ihre neuen Reeboks und die Khakihosen, die so schlank machten. Sie schickte ein Stoßgebet zum Gott der Waschmittel, nicht zuzulassen, daß sich nicht zu entfernende Flecken festsetzten.
Keine Leiche, kein Geruch.
Es war ein ziemlicher Marsch zum hinteren Ende der Weide, und der Himmel wurde dunkler. Sonora holte tief Luft. Man konnte das metallische Summen in der Luft fast schmecken. Sie mußten sich beeilen ‒ es würde bald regnen.
Der Wind zauste das leuchtendgelbe Absperrband, ein loses Ende flatterte. Eines der Pferde erschrak davor und raste, die ganze Herde mit sich reißend, davon.
Etwas war durch den Zaun gebrochen und hatte dabei eine komplette, zwei Meter fünfzig lange Einheit zerstört. Abgeknickte Latten, das Holz roh und gesplittert, hingen auf jeder Seite wie übel gebrochene Knochen.
Ein Reitstiefel lag im Gras, vielleicht zwei oder drei Meter von dem durchbrochenen Zaun entfernt.
Sonora kroch unter dem Band durch und schaute sich um, bis sie Sam entdeckte. Er trug Jeans, also war er schon zu Hause gewesen. Er untersuchte die Kanten eines kaputten Zaunbretts. Er war schlanker geworden, und sie hatte es nicht bemerkt. Mußten die Jeans sein.
»Hey, Supermann. Hast du was gefunden?«
Er drehte sich um, und Sonora wurde bewußt, daß es entweder schon dunkler war, als sie gedacht hatte, oder ihre Augen schlechter wurden. Wer immer da vor ihr stand, Sam war es nicht.
Der Mann grinste. »Kennen wir uns?«
Sonora hatte seit kurzem die Angewohnheit, sich Männer anzuschauen und zu überlegen, warum sie froh sein konnte, nicht mit ihnen verheiratet zu sein. Obwohl ihr Romantik und mehr noch Sinnlichkeit abgingen. Und sie fragte sich auch, ob ihre Gefühle vielleicht durch die eine oder andere Extremsituation abgestorben waren.
Ein Blick auf diesen Typen, und sie wußte, mit ihr war noch alles in Ordnung.
Sie streckte die Hand aus. »Detective Blair. Es tut mir leid, ich dachte, Sie seien jemand anders. Wer sind Sie überhaupt?« Und was tun Sie hier?
Er hatte einen festen Händedruck und vieles mehr. Er war groß und dunkelhaarig, mit braunen Augen und breiten Schultern. Und hatte eine Menge weiterer Attribute, die Sonora gefielen.
»Hai McCarty.«
»Was genau machen Sie hier, Mr. McCarty?«
»Ich suche hier herum, Detective Blair. Sie sehen verärgert aus. Oder vielleicht sind Sie nur verlegen.«
»Schwer zu sagen, oder?«
»Ich bin ein Nachbar ‒ ich habe die Farm da hinten gepachtet.« Er zeigte mit dem Kopf nach rechts, runzelte die Stirn und senkte die Stimme. »Dixon hielt bei meinem Haus und bat mich, ihm bei der Suche nach Joelle zu helfen.«
»Um welche Zeit war das?«
»Kurz vor sechs.«
Sie hörte Schritte und drehte sich um. Sam. Immer noch in denselben zerknitterten Khakihosen und dem Sportmantel, die er schon getragen hatte, als sie sich vor nicht mehr als zwei Stunden getrennt hatten.
»Mr. McCarty, wenn Sie nach dort drüben gehen würden. Ich habe noch einige Fragen an Sie, sobald ich auf dem laufenden bin.«
»Schauen Sie, Detective ‒«
Aber sie wandte sich ab. Sie sah aus dem Augenwinkel, daß es ihm nicht besonders gefiel, weggeschickt zu werden, aber er drehte sich um und ging, wandte sich aber noch einmal zurück und warf ihr einen zweiten Blick zu, um festzustellen, ob sie ihn immer noch beobachtete.
Sie tat es.
»Wurde Zeit, daß du kommst.« Sam fuhr sich mit der Hand durch die Haare, die vom Wind in alle Richtungen gezaust wurden. Er hatte seinen Schlips gelockert.
»Das ist meine«, sagte sie, auf die Krawatte deutend.
»Du hast sie mir gegeben.«
»Hab ich nicht.«
Er nahm ihren Ellenbogen und zog sie zu einigen Leuten von der Spurensicherung ‒ zwei kannte sie.
»Was ißt du da?« fragte Sonora.
»Starbursts ‒ Kaubonbons.«
»Gib mir ein rosa Bonbon.«
»Rosa hab ich gegessen. Ich hab noch rote, Kirsch, okay? Willst du die Blutspuren sehen?«
Sie nickte. »Ja, ich will das Blut sehen, und ja, ich will einen roten.«
Er gab ihr einen Starburst. »Hier rüber.«
Sie wickelte das Bonbon aus und dachte, daß sie, was Blutflecken anbetraf, schon bessere gesehen hatte. Aber dieser war von einem fünfzehnjährigen Mädchen, seufzte Sonora tief und ging näher heran. Sie beugte sich hinunter und warf einen Blick darauf. Das dickflüssige Blut war in den Dreck gesickert und bildete eine schwarzrote, gelatineartige Pfütze von der Größe eines Fußballs. Ein abgetragener, schwarzer Reitstiefel, kniehoch, englisch, lag ungefähr anderthalb Meter entfernt.
»Hier ist noch mehr, an dem Zaun. Wir nehmen an, daß sie vom Pferd fiel, mit dem Kopf aufschlug und zu Boden stürzte.«
Sonora schritt zur Seite und besah sich den oberen Teil des Zauns. Er hatte eine Delle und war verschmiert mit Blut und Gewebeteilen und langen braunen Haaren.
»Nur um sicherzugehen. Joelle ist brünett?«
Sam zeigte mit dem Finger auf McCarty. »Er sagt es.«
»Was sagt der Vater?«
»Er saß mit einem Schock im Büro, und McCarty war zur Hand, okay?«
»Schon gut, okay. Er scheint nur ziemlich unbehelligt in meinem Bereich herumzuspazieren.«
»Es ist auch mein Bereich.«
»Klar, Sam, aber trotzdem ist das hier keine Party. Hat er den Stiefel identifiziert?«
»Nicht eindeutig. Erkennst du Schuhe?«
»Klar.«
»Gut, aber du bist eine Frau.«
Sonora sah über ihre Schulter zu dem kräftigen und gedrungenen Mickey, der ungefähr hundert Meter entfernt an der Sicherung von Abdrücken arbeitete. Reifenspuren? Sie zeigte mit dem Finger auf den Zaun, die Klümpchen aus Haar, Blut und Gewebe. »Hat die Spurensicherung Proben davon?«
»Wo denkst du hin, nein, niemand macht hier seine Arbeit, wenn du nicht da bist.«
»Prima, aber wir haben eine Spur, Sam, und ich sehe keine Schäferhunde. Hast du die Hundestaffel informiert?«
Sam legte ihr eine Hand auf die Schulter. »Sei bitte nicht gekränkt, wenn ich dir sage, daß ich mich längst darum gekümmert habe.«
»Wie lange wird es dauern, bis sie hier sind?«
»Sie kommen nicht. Die Schäferhunde suchen nach irgend etwas, das ihnen zeigt, wo die Spur verläuft. Dieser Ort ist voll von Spuren ‒ die Pferde trampeln überall herum. Unmöglich für die Hunde. Ein Hubschrauber mit Wärmesensoren und Nachtsichtgerät ist unterwegs. Vielleicht entdeckt er etwas.«
»Vielleicht auch nicht.« Sonora sah zum Himmel hoch und dachte über den Regen nach. Hektarweise Land, und die Dunkelheit brach herein. Das Kind konnte sonstwo sein. Sie hörte das Tuten eines Zuges und das ferne Geräusch der Räder auf den Gleisen.
»Wir brauchen Bella, Sam.«
»Das ist eine Superidee. Kennt Mickey deren Führerin nicht irgendwoher?«
»Sie sind verwandt, glaube ich.« Sonora blickte auf den unteren Teil des Zauns und versuchte sich den Ablauf vorzustellen. Ein junges Mädchen auf einem Pferd. Irgendein lautes Geräusch. Erschreckte das Pferd und verursachte vielleicht den Sturz. Sie blickte Sam an und neigte den Kopf. »Was meinst du, wie ist das passiert?«
Sam zuckte die Achseln. »Die Lücke ist groß genug für einen Transporter. Der Boden ist noch weich vom Regen am Wochenende, und Mickey hat Reifenspuren gesichert.«
»Ist es möglich, daß es ein Pferd war, das hier durchgebrochen ist? Ich wette, ein Pferd könnte einen Zaun niedertrampeln, wenn es das wirklich wollte und wenn es verängstigt genug ist.«
Sam sah sie an. »Angenommen, es wäre möglich, warum sind dann all die anderen Pferde immer noch hier?«
»Ich glaube trotzdem, daß ein Pferd den Zaun niederreißen kann, wenn es total in Panik ist, Sam.«
»In Ordnung, Kleines, komm und sieh selbst.« Er ging zum Zaun, und sie folgte ihm. Er drückte ihr ein anderes Starburst in die Hand. Zitrone.
»Wir haben Reifenspuren, die direkt zu der Lücke fuhren ‒ sieht so aus, als wären die Abdrücke von einem zwillingsbereiften Pick-up, hier sind zwei Reifenspuren Seite an Seite.« Er berührte einen Holzspan. »Grüne Farbstreifen, Sonora. Pferde hinterlassen so etwas eher selten. Außerdem ist das Holz an beiden Enden gesplittert.« Er hielt ein abgerissenes Brett hoch. »Der Bruch ist symmetrisch. Ähnliche Bruchkanten auf beiden Seiten, also war die Wucht des Aufpralls gleichmäßig verteilt. Ein Pferd würde das Brett nur auf einer Seite durchbrechen. Und wenn du es dir genauer anschaust, stellst du fest, daß sich keine Spur von Mähnen- oder Schweifhaaren findet, wie du sie hast, wenn ein Pferd eine Latte zerschmettert, sich durchquetscht und dabei die Bretter rausbricht.«
Sonora untersuchte mit gesenktem Kopf das Stück Holz. »Und der Bruch geht nach innen, in Richtung Weide. Also hat jemand einfach draufgehalten und ist durchgebrochen.« Sonora sah Sam an. Er kaute. Sie roch Orange.
Sie streckte sich und massierte ihr Kreuz. »Hast du dir McCarty angesehen?«
»Ich habe gemerkt, daß du es tust.«
»Seinen Ärmel, Sam. Ich finde, es sieht nach Blut aus. Ein paar Stunden alt. Überprüf es und sag mir, was du davon hältst. Ich werde mal mit Mickey reden.«
»Wegen der Spuren?«
»Wegen Bella.«
Mickey kniete mit einem Maßband neben einer Spur. »Sollte mir die auch vornehmen. Könnte sonst trocken werden.« Er sah Sonora und stand auf. »Was?«
»Was meinst du mit ›was‹?«
»Ärger mich nicht, Kindchen. Ich hab diesen Morgen eine Füllung gekriegt, und das Novocain läßt langsam nach.«
»Erzähl mir was, Mickey.«
Er legte seinen Kopf auf die Seite. »Großer alter Pick-up mit Zwillingsreifen. Vier Reifen hinten, zwei vorn. Etwas, das wie ein Flicken auf dem rechten Vorderreifen aussieht. Jemand sollte die Werkstätten in der Umgebung abklappern. Und, Sonora, paß auf. Von der Tiefe der Abdrücke her, besonders der hinteren, würde ich sagen, der Pick-up hatte etwas geladen.«
Sonora blickte ihn an. »Ladung? Wie ein … Pferdeanhänger?«
Mickey zuckte mit den Achseln. »Gibt es einen besseren Weg, ein Pferd loszuwerden?«
»Also, deiner Meinung nach fuhr ein Pick-up mit Anhänger durch den Zaun.«
»Bis morgen gebe ich dir Marke, Baujahr und Modell.«
»Wirk ein Wunder und gib mir die Daten heute nacht.«
»Spätestens morgen. Sieht so aus, als wären hier mindestens zwei Spurensätze, beide von Lastwagen. Und ich hab Lackteile. Blaugrüne. Im schlimmsten Fall können wir anhand der Farbe das Baujahr auf zwei Jahre eingrenzen. Und offensichtlich ist der Laster, der durch den Zaun gefahren ist, schwer beschädigt.«
»Du bist gut, Baby, muß ich wirklich zugeben.«
»Wenn ich für jedes Mal, daß eine Frau das zu mir sagt, einen Dollar bekäme.« Er warf ihr einen zweiten Blick zu. »Wart mal… Meine Exfrau hat genau den gleichen Tonfall, wenn sie eine Erhöhung der Unterhaltszahlungen will.«
»Bekommt sie sie?«
»Jedesmal.«
»Wußtest du schon, daß du immer erst nach unten und dann nach rechts guckst, wenn du lügst?«
»Ohne Scheiß? Das muß ich in Ordnung bringen. Normalerweise guck ich nach links.«
»Kennst du Officer Murty? Ist sie nicht eine Cousine von dir?«
»Schwiegertochter.«
»Arbeitet sie noch mit Bella?«
»Mh-mhm.« Mickey rieb sich das Kinn. Blickte über die hintere Koppel. »Du weißt, daß ein Hubschrauber kommt?«
»Ich hab davon gehört, ja.«
»Aber du willst Bella?«
»Ich brauche sie heute abend. Ich kann Crick anrufen, wenn du willst. Es macht mir nichts aus, die offiziellen Kanäle zu benutzen. Aber du kriegst sie schneller. Wenn es irgendeine Chance gibt, daß das Kind noch lebt ‒«
Er sah auf seine Uhr. »Lucy wird wissen, wo sie ist. Gib mir fünf.«
Sie wollte schon frech werden und fragen »fünf was?«, aber Teil der Kunst, ein Detective zu sein, war zu wissen, wann man den Mund hielt.
Kapitel 5
Sam stand mit McCarty beim Zaun und winkte Sonora zu sich.
Sie ging langsam, die Hände in den Taschen. Betont schaute sie auf McCartys hochgerollte Ärmel. Immer wieder wollen Mörder unbedingt an der Untersuchung teilhaben, dachte sie.
»Konnte Mr. McCarty die Blutflecken auf seinem Ärmel zu deiner Zufriedenheit erklären?«
»Doktor McCarty«, teilte ihr Sam mit. »Der Typ ist Tierarzt.«
»Das ändert natürlich alles.«
McCarty rollte seinen Ärmel herunter und hielt ihn ein Stück von seinem Arm weg, damit sie alle einen Blick darauf werfen konnten. »Es ist Blut.«
»Heut morgen beim Rasieren geschnitten?«
McCarty schaute sie schräg an. »Und Sie sahen so intelligent aus. Das ist Joelles Blut. Ich war der erste am Tatort, erinnern Sie sich?« Er sah von Sonora zu Sam. »Haben Sie ein Problem damit? Dann will ich Sie mal beruhigen. Sie können mein Haus und meinen Stall durchsuchen. Nur zu, ich habe nichts zu verbergen.«
Sonora wartete, daß er sagen würde »Vertrauen Sie mir«, aber er tat es nicht. Sie lächelte ihn an. »Der letzte, der zu mir gesagt hat, er hätte nichts zu verbergen, bewahrte einen Torso in der Tiefkühltruhe auf. Also, vielen Dank, wir werden Haus und Stall durchsuchen.«
»Meinen Sie den Bezirksstaatsanwalt?«
Sonora nickte. Es war beinah, als würden sie fachsimpeln. »In der Zwischenzeit sollten Sie eine Fahndungsmeldung herausgeben oder sogar Straßensperren zwischen hier und« ‒ er sah auf seine Uhr ‒ »einem Dreihundert-Kilometer-Radius errichten, die jeden Pferdetransporter aufhalten.«
»Das ist ein verdammt großer Radius.« Sonora legte ihren Kopf auf die Seite. »Wieso denken Sie, daß es ein Pferdelaster war?«
»Ziemlich wahrscheinlich, oder nicht? Mit einem verschwundenen Pferd? Was meint denn der Mann von der Spurensicherung?«
»Ich will Ihr Hemd«, forderte Sonora.
»In Ordnung. Wenn Sie sich zum Lasteranhalten durchringen können, fragen Sie nach dem Coggins-Test. Jeder, der Pferde transportiert, muß einen haben. Es ist sehr wahrscheinlich, daß derjenige, der hier durchgebrochen ist, keinen hat.«
»Danke für Ihre Hilfe«, sagte Sam.
Sonora starrte McCarty an. »Wir nehmen Ihr Hemd mit. Und wir nehmen Ihr Angebot an, uns herumzuführen. Durch Ihr Haus und den Stall.«
Er streckte Sonora seine Hände entgegen und lächelte sie an. »Sie können mir auch Handschellen anlegen, wenn Sie möchten.«
»Ein andermal.«
Kapitel 6
McCarty blieb vor einem kleinen, schmuddeligen Betonziegelhaus stehen, das nicht mehr als vierzig Meter von einem in Rot gehaltenen, gemauerten Stall entfernt war, der ungefähr ein Drittel der Größe von Delaneys Stall hatte.
»Es ist nicht abgeschlossen.« McCarty wies zur Eingangstür seines Hauses.
Sonora bedeutete den beiden Streifenpolizisten, die sie mitgenommen hatte, von der Veranda herunterzukommen. »Geh mit ihm rein«, befahl sie Sam.
McCarty nickte ihr zu und betrat vor Sam das Haus, ohne zurückzuschauen.
Er hatte was.
Sonora wandte sich den Streifenpolizisten zu. Beide waren jung, männlich, mit kurzgeschnittenem Haar und einer Überdosis Testosteron in den Adern. Sie wünschte, sie hätte Renquist nicht mit Dixon Chauncey weggeschickt. Sie hätte zwei oder drei von seiner Sorte gebrauchen können.
Sie begann mit ihren Namen, ließ sie sich vorstellen. Sie kannte sie nicht. Majors war der Schwarze, Hill war weiß. »Officer Majors, Officer Hill. Beginnen wir mit dem, was Sie schon wissen. Das Opfer ist weiblich, fünfzehn Jahre alt und hat braunes Haar. Sie haben das Blut gesehen. Wahrscheinlich hat sie eine schwere Kopfverletzung und Gott weiß, was noch. Dr. McCarty ist uns bei unserer Untersuchung ›behilflich‹. Diese Information behalten Sie für sich.«
Beide nickten, die Brauen gerunzelt und auf dem Sprung. »Wir haben die Erlaubnis des Eigentümers, und wir haben einen stichhaltigen Grund. Was wir nicht haben, ist ein Durchsuchungsbefehl, also machen Sie keine Unordnung, haben Sie verstanden? Aber vergewissern Sie sich, daß da drin kein fünfzehnjähriges Mädchen steckt, das Sie durch die Räume gehen hört und betet, daß Ihre Phantasie reicht, die richtige Schranktür zu öffnen oder unter der Kellertreppe nachzusehen. Haben Sie mich verstanden?«
Sie nickten, synchron, wie Marionetten.
»Dann los. Und Hill?«
»Ja, Ma’am?«
»Stecken Sie Ihre Waffe weg.«
Das Haus enttäuschte sie. So etwas hatte sie bei McCarty nicht erwartet.
Die Küche war klein und in den Sechzigern hochmodern gewesen. An dem schmalen Fenster über der mit schmutzigem Geschirr gefüllten Spüle zwischen den gelblackierten Metallschränken hing ein staubiger, rotkarierter Vorhang. Die Arbeitsflächen waren sauber, und auf einer stand ein altmodischer Mixer, dessen Anblick Sonora einen Stich gab. Es war ein großer Bobbie, weiß emailliert mit schwarzem Aufsatz. Genau den gleichen hatte ihre Mutter gehabt, als sie klein gewesen war.
McCarty wartete, mit verschränkten Armen gegen die rostfarbene Ziegelwand gelehnt, auf der Veranda. Er hatte das Jeanshemd ausgezogen und trug nun ein Sweatshirt mit der Aufschrift »Harvey-Cooke Buchhandlung«. Er wartete ohne jedes Anzeichen von Ungeduld, während sie das deprimierende Badezimmer mit den verrosteten Abflüssen und das kleine, staubige Schlafzimmer durchsuchten, das nicht mehr enthielt als ein Doppelbett in Walnußholz mit einem Chenilleüberwurf, eine kleine Kommode und einen schmalen roten Vorleger auf dem zerschrammten Holzfußboden.
Er schien nicht besorgt über die Häufigkeit, mit der sie die kurze Diele auf und ab trampelten und immer wieder durch Zimmer, Wandschränke und Flure gingen, die sie Minuten zuvor bereits durchsucht hatten. Er wartete mit unendlicher Geduld, bis die Streifenpolizisten zufrieden waren. Zog eine Augenbraue hoch, als Sonora ihnen auf die Veranda folgte.
»Hier entlang, meine Herren. Teil zwei der abendlichen Besichtigungstour. McCartys Stall.«
Der Stall war klein, acht Boxen, gut beleuchtet und sauber, mit einem frisch gekehrten Gang. Sonora atmete den Geruch von Pferden und frischem Heu ein. Drei der Boxen waren besetzt, und die Pferde wieherten leise, als Sonora und Sam hereinkamen. Die Tore waren auf beiden Seiten geöffnet, und der Windzug ließ sie frösteln.
Sie öffnete eine Tür zur Sattelkammer. Eigenartige Leder- und Seilstücke hingen an Haken von der Wand. Heugabeln und Schaufeln waren in einer Ecke zusammengestellt. Ein großer, grüner Futterbehälter hing an der Vorderwand. Sonora hob den Deckel ‒ beide Seiten waren mit einer Mischung aus Hafer, Schrot und Getreide gefüllt. Sie nahm eine Handvoll und roch daran, probierte mit der Zungenspitze.
Sam sah ihr über die Schulter. »Iß weiter, Sonora. Meine Starbursts sind alle.«
Sie rollte mit den Augen, ging zurück auf den Gang und schob langsam eine Boxentür auf, während sie um die Ecke schielte.
»Ein Pferd?« fragte Sam.
Sonora sah ihn über ihre linke Schulter an. »Hör auf, mir hinterherzurennen, und durchsuch die andere Seite.«
»Warum? Was, glaubst du, ist in dem Stall gegenüber? Ein Schwein?«
Sonora ging an ihm vorbei und schob die Tür auf.
Das in frischen Pinienspänen stehende Pferd sah sie an und wandte sich dann wieder einer Raufe mit goldbraunem Heu zu. Die Box war gemütlich und gut ausgestattet. Wasser tropfte vom Rand eines Eimers, der erst vor kurzem gefüllt worden war.
Sam öffnete die nächste Tür. »Noch ein Pferd, Sonora.«
»Bleib bei ihm, Sam. Ich gehe auf den Heuboden.«
Sie kletterte über Holzlatten hinauf, die neben der Sattelkammertür an der Wand angebracht waren. Die Leiter war für größere Menschen als Sonora gedacht. Sie mußte sich bei jeder Sprosse strecken. Langsam stieg sie hoch und dachte, daß sie möglicherweise Höhen einfach nicht mochte.
Sie riß sich zusammen und zog sich auf den hölzernen Boden. Es war dämmrig auf dem Heuboden, staubig, eine Schicht altes Heu lag auf den alten Balken. Eine Heugabel lehnte an dem rissigen Stützbalken, und Stränge orangefarbenen Bindegarns hingen von einem Nagel. Heuballen waren so an den Rand des Bodens gestapelt, daß sie einen zwanzig Zentimeter breiten Gang freiließen.
Gemütlich.
Streifen dämmrigen Halblichts fielen durch die Risse im Holz. Sonora blinzelte. Sie suchte nach zerrupften Heuballen, mit Blut verschmiert oder vollgestopft mit Leichenteilen.
»Scheiße«, bemerkte Sam unter ihr. Sie hörte ihn die Boxen betreten und verlassen. Dann erklangen Schritte im Gang.
Sonora hielt sich an einem Stützbalken fest und schaute über den Rand des Heubodens. Majors und Hill mit McCarty in der Mitte. McCarty hob die Hand und winkte. Sonora sah die Streifenpolizisten an. »Was?«
»Mickey hat gesagt, wir sollen Bescheid sagen, Ihre Kinder hätten angerufen. Es sind keine Notrationen mehr da, und sie wollen wissen, was sie wegen des Abendessens machen sollen.«
Sonora nickte. »Noch was?«
»Bella ist hier.«
Kapitel 7
Sonora hörte Bella, bevor sie sie sah ‒ hundertachtzehn Pfund rostroter Bluthund auf dem Sitz eines kleinen Mazda-Pick-ups. Die Hündin streckte ihren Kopf aus dem halbgeöffneten Fenster. Ihre Ohren reichten gerade über ihren Unterkiefer, und ihr faltiges Gesicht sah sanft und rührend aus. Speichelfäden tropften aus ihrer Schnauze und liefen am Fenster herunter.
Sie ist wunderschön, dachte Sonora.
»Sonora?« Die Fahrertür schlug zu, und eine Frau kam um das Heck des Transporters. Sie bewegte sich langsam, der Gang unsicher und unbeholfen.
»Helen?«
Helen Murty war in Uniform, auf gewisse Art und Weise, und im siebten Monat unübersehbar schwanger. Sie trug ihr schwarzes lockiges Haar kragenlang, hatte braune Augen und eine kantige Kieferpartie. Dennoch war ihr Gesicht, wenn auch nicht hübsch, so doch einprägsam und ihre Haut von einem weichen, tiefen Braun.
Sonora starrte auf ihren Bauch. »Oh, mein Gott.«
»Wenn Sie ein Mann wären, könnten Sie für diese Bemerkung belangt werden.«
»Die Arbeit mit Männern bringt mich dazu.«
Murty legte eine Hand in ihr Kreuz. »Irgendwie kann man ihnen immer die Schuld geben, stimmt’s?«
»Ich wollte natürlich herzlichen Glückwunsch sagen und auch, daß Sie großartig aussehen.« Sonora sprach mit der zwiespältigen Erleichterung einer Frau, die das durchgemacht hatte und nicht plante, es jemals zu wiederholen. Dann kam sie auf ihr Anliegen zurück. »Ich brauche Ihre Hündin, Helen, aber Sie schaffen das nicht.«
»Ich hab’s im Griff. Der Arzt sagt, Laufen ist gut für mich, es wird meine Wehen verkürzen.«
»Ja, das sagen sie immer. Ich hab zwei, also hören Sie mit diesem Machoscheiß über Schwangerschaft auf. Sind Sie mit den Einzelheiten der Situation vertraut?«
Helen winkte mit der Hand, und die Hündin sprang. Ihre Krallen kratzten über die Kopfstütze. »Sei brav, Bella.« Die Hündin setzte sich wieder, aber ihre Schnauze hing aus dem Fenster. »Ein fünfzehnjähriges Mädchen wird vermißt, keine Ausreißerin. Sie fiel von einem Pferd, und wenn sie nicht tot ist, ist sie schwer verletzt. Noch etwas?«
Sie hat zwei kleine Schwestern, dachte Sonora und blickte über die Farm. Die Dämmerung hatte sich zu vollkommener Dunkelheit verdichtet.
»Wo ist das Pferd?« fragte Helen.
»Verschwunden, zusammen mit dem Mädchen.«
Helens Mund öffnete und schloß sich. »Unheimlich.«
»Sie könnte sonstwo sein. Die Leiche steckt vielleicht Gott weiß wo in den Weiden. Jemand kann sie in einen Pferdetransporter gepackt haben und abgehauen sein. In dem Fall ‒«
»Kann Bella sie immer noch finden.« Helen hatte diesen selbstgefälligen Blick; eine Frau, die ihren Hund kennt. »Sie könnten schon auf der Interstate sein.«
»Bella kann sie trotzdem finden, sogar wenn sie in ein Auto gepackt und kilometerweit weggefahren wurde. Wir untersuchen jede Ausfahrt. Bella wird es wissen. Sie nimmt den Geruch übers Abluftsystem des Autos auf. Man kann diese Hündin nicht reinlegen.«
»Was ist mit dem Pferd? Kann sie dadurch abgeschüttelt werden?«
»Nur wenn sie es reitet, Schätzchen. Bella ist auf menschliche Gerüche abgerichtet.«
»Helen, es ist furchtbar dunkel da draußen.«
»Sonora, wie lange sind Sie schon bei der Polizei? Ich werde immer gerufen, wenn die Sonne untergeht. Vermißte Kinder und Schwerverbrecher halten sich selten an meinen Stundenplan.«
»Ich meinte Sie.«
»Das größte Problem habe ich, wenn ich mich auf die Schnauze lege.«
»Kann jemand anders den Hund führen?«
»Das wissen Sie doch. Niemand außer mir kann sie verstehen, Sonora. Hören Sie auf, sich Sorgen zu machen. Ernie wird mitgehen und mich beschützen.«
»Und wer ist Ernie?«
»Ein Schäferhund. Ich kann mir den Namen seines Führers nie merken. Aber ich habe angerufen, und sie müßten jeden Moment hier sein. Für den Fall, daß wir den Kerl finden, der das Kind hat. Bella verfolgt die Spur, und Ernie frißt jeden, der sich uns in den Weg stellt.« Helen tätschelte den Hundekopf. »Dein Freund kommt, nicht wahr, Bella?« Mit der Hand auf dem Bauch sah sie Sonora an. »Es geht um ein fünfzehnjähriges Kind, wissen Sie? Mein erstes ist fast fünfzehn. Und es wird langsam kalt. Wir werden gehen.«
»Spüren Sie schon ein Ziehen?«
»Braxton Hicks, Übungswehen. Ich habe sie schon seit Wochen. Sonora?«
»Ja?«
»Wenn es nicht klappt, ich hab einen Freund, der einen Bluthund hat, einen sehr guten für so was. Geruchsspur durch Wasser, alle diese Sachen. Man muß nur vier oder fünf Tage warten, bis es richtig gärt.«
Kapitel 8
Sonora konnte sich nicht erinnern, wo sie den Spruch aufgeschnappt hatte ‒ je faltiger das sanfte Bluthundgesicht, um so besser sei er als Fährtenschnüffler. Irgend etwas über die Hautfalten, die den Geruch aus der Luft aufnehmen.
Sie kauerte auf ihren Fersen und beobachtete die Hündin, die Helen umkreiste, während diese versuchte, ihr ein Ledergeschirr anzulegen. Bellas Schwanz wedelte, und ihr Kopf war hoch erhoben. Sie schaute Helen anbetungsvoll an. Helen blickte zu Sonora empor und grinste.
»Das Geschirr sagt ihr, daß wir mit der Arbeit anfangen. Und diese Hündin liebt ihre Arbeit.«
Helen sah einen großen schlanken Mann mit pockennarbigem Gesicht und einem mißmutigen Ausdruck. Ein deutscher Schäferhund hockte gespannt zu seinen Füßen. »Kann’s losgehen, Ernie?«
»Sicher«, sagte der Polizist, und sein Gesicht wurde weich, als er seinen Hund ansah. »Ernie ist soweit. Und ich auch.«
»Um Sie hab ich mir keine Gedanken gemacht, Officer Carl.« Helen grinste und sah zu Sonora. »Haben Sie den Reitstiefel zur Hand? Wir müssen sie auf den Geruch ansetzen.«
Sonora zeigte auf den Stiefel, der noch unberührt an der gleichen Stelle lag. Helen führte die Hündin nah heran. »Riech, Bella.«
Bella machte sich über den Stiefel her, schnüffelte, umkreiste ihn, schnüffelte erneut. Ernie saß vor Aufmerksamkeit zitternd mit hochgestellten Ohren daneben und beobachtete Bella, wie Sonora geschworen hätte, voller Neid.
Bella schnüffelte an der Blutlache, stellte sich am Zaun auf und schnüffelte an Haar, Gewebe und Blut. Sie kreiste zwischen Blutlache, Stiefel und Zaun.
»Los doch, Mädel, hol sie dir. Los doch, Mädel, auf geht’s, hol sie dir.« Helen warf einen Blick zu Sonora. »Machen Sie sich keine Sorgen. Sie ist in einer Geruchswolke. Sie wird ihren Weg eindeutig finden.«
Die Hündin warf sich plötzlich nach rechts, in Richtung des zerstörten Zauns. »Sie hat’s!« Helen schrie, ihre Stimme schwankte, als sie in halsbrecherischer Geschwindigkeit mit dem Hund losraste. »Los doch, Carl, lassen Sie Ernie laufen.«
Der Schäferhund wollte eindeutig nichts lieber, als hinter Helen und Bella herzujagen. Officer Carl gab das Kommando, und er und sein Hund verschwanden in der Dunkelheit.
Sonora beobachtete sie und fühlte sich ausgeschlossen.
Kapitel 9
Im Taurus lehnte Sonora sich zurück und schloß die Augen.
»Ich habe eine Packung Makkaroniauflauf gefunden«, teilte ihr Sohn ihr über das Handy mit. Eine klare Verbindung. Sein Ekel war laut und deutlich zu hören. »Wann gehst du einkaufen?«
»Bald«, antwortete Sonora.
»Das sagst du immer.«
»Vielleicht solltest du mal gehen.«
»Ich muß Schularbeiten machen.«
»Oh, wirst du sie tatsächlich heute abend machen?«
»Mama. Schrei mich nicht an.«
»Unter meinem Bett sind Oreokekse versteckt.«
»Nicht mehr. Also, ich warte noch auf einen Anruf. Wir werden die Makkaroni essen. Ich muß jetzt auflegen. Oh, Heather bleibt morgen länger in der Schule. Tschüs.«
Er legte auf, und sie sah Sam in Richtung Wohnwagen gehen. Sonora warf die Tür des Taurus zu und rannte hinter ihm her.
»Sam!«
Er blieb stehen und wartete. »Alles in Ordnung mit den Kindern?«
»Sie machen sich was Tiefgekühltes zum Abendbrot.«
»Die Mutter des Jahres.«
»Halt die Klappe. Ich habe sowieso schon Schuldgefühle, und du bist keine große Hilfe.«
Sie atmete tief ein. Der Mond ging auf, orange, ein Herbstmond, ein Erntemond. Sonora knipste ihre Lampe aus und sah zum Himmel. Ohne die Konkurrenz der Neonlichter und der Hektik der Stadt fielen einem die Menge Sterne auf.
»Du siehst verfroren aus.« Sam zog ihr die Jacke eng um den Hals und schloß den obersten Knopf. »Ich habe Donna Delaney mit Crick beim Telefon gelassen. Er gibt eine Fahndungsmeldung nach einem blaugrünen Zwillingsreifen-Pick-up mit oder ohne Pferdeanhänger heraus. Er hat eine Beschreibung von Joelle, aber er hätte gern eine etwas genauere als ›braun‹ für das Pferd.«
Sonora verschränkte ihre Arme und atmete tief durch, sog die kalte Luft ein. »McCartys Bemerkung wegen des Coggins-Tests klang gut.«
»Stimmt, ich habe Crick Bescheid gesagt. Er hatte nicht die leiseste Ahnung, wovon ich rede. Komm, Sonora, laß uns in Delaneys Büro warten. Wenigstens ist es da warm.«
»Wir sollten zu Chaunceys Wohnwagen gehen und uns Joelles Umgebung ansehen.« Sie knipste die Lampe an und richtete den gelben Lichtstrahl auf Sams Füße. »Wir können den Weg über die Pferdekoppel nehmen oder um den Stall herum laufen.«
»Ich kann über den Zaun klettern. Falls du es schaffst.« Sie marschierten über die Weide.
»Was hältst du von McCarty?« fragte Sam. »Halt die Lampe ruhig oder gib sie her.«
»Er ist gerissen.«
»Ich meinte das Blut auf seinem Hemd.«
»Er könnte lügen, könnte aber auch die Wahrheit sagen.«
»Da kann ich dir nicht widersprechen. Halt, Sonora!«
»Was?«
»Der Zaun.«
»Hab ich schon gesehen. Halt die Lampe, während ich rüberklettere. Ich frage mich, wo die Pferde sind.«
»Nah genug zum Streicheln.«
Das waren sie. Sie standen still, dunkle Schemen hinter dem Zaun, in Zweier- und Dreiergrüppchen. Sonora hörte ein sanftes Schnauben.
Sie kletterte den Zaun hoch und achtete dabei auf ihre Hosen. Mit ihren kurzen Beinen mußte sie von Latte zu Latte steigen, bevor sie sich über den Zaun schwingen konnte. Sie rutschte zur Seite.
»Brauchst du Hilfe?« Sam stützte sie am Arm. Die Lampe ruckte zur Seite und beleuchtete zwei nahe stehende Pferde. Sie scheuten, ihre Hufe trommelten auf dem Boden.
»Großartig, Sam. Jetzt hast du die Pferde erschreckt.«
»Sie wären noch erschrockener, wenn du vom Zaun gefallen und auf ihrem Hals gelandet wärst. Wenigstens wird so niemand verletzt.«
Sonora stieg die andere Zaunseite herunter. »Verflucht schwierig, nachts ein Pferd einzufangen, denkst du nicht? Besonders, wenn du ein ganz bestimmtes willst.«
Sam gab ihr die Taschenlampe. »Worauf willst du hinaus?«
»Ich denke nur, wenn jemand ein fünfzehnjähriges Mädchen will, wäre es einfacher, sie ohne das Pferd zu entführen. Möglicherweise wollten sie das Pferd.«
Sam sprang auf den Boden und griff nach der Lampe.»Deshalb sind sie nachmittags gekommen, wenn es hier total tot ist.«
»An einem Dienstag, wenn gewöhnlich niemand reitet.«
»Und Joelle Chauncey war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort.«
»Ein Pferd in Gefahr wird zum Kind in Gefahr.«
»Nur eine Theorie.«
Sogar im Dunkeln konnte Sonora erkennen, daß Dixon Chauncey aus seinem Besitz das Beste gemacht hatte. Die Betonstufen, die zu dem verbeulten Aluminiumeingang führten, waren weißgeschrubbt und erst kürzlich gefegt worden. Zwei Meter vom Wohnwagen entfernt begannen Unkraut und Gestrüpp zu wuchern, aber ein Rasentrimmer, an die Vordertreppe gelehnt, bewies die guten Vorsätze. Vier Fahrräder und ein Roller waren auf einer Seite in einer ordentlichen Reihe angelehnt. Drei der Räder waren alt und rostig, aber eines war brandneu ‒ silber und blau mit pinkfarbenen Plastikstreifen, die von den weißen Gummigriffen hingen.
Jemand hatte Geburtstag, dachte Sonora.
Der untere Teil der Fliegentür war ausgebeult, als wenn sich ein kleines Kind oder ein Hund gelegentlich gegen die alten Maschen lehnte. Ein Loch in der Mitte war gerade erst geflickt worden, das neue Stück war metallisch dunkel und steif.
Sam klopfte so leise an, daß Sonora nicht dachte, daß sie jemand hören würde.
Renquist mußte nach ihnen Ausschau gehalten haben. Er öffnete sofort die Tür ‒ dünnes Holz mit kleinen Fenstern, die nur wenig Licht einließen. Sonora fand sie deprimierend.
Renquist sah übernächtigt aus. Das Hemd hing ein bißchen aus der Hose, der Kragen war aufgeknöpft und die Kleidung nach einem sehr langen Tag verknautscht. Sein Gesicht hatte tiefere Falten als zuvor, und unter seinen Augen bildeten sich dunkle Ringe.
»Es gibt Kaffee«, sagte er, als sie eintraten.
Im Wohnwagen war eine gedämpft-ruhige Atmosphäre, als wenn Menschen schliefen. Sam und Sonora bewegten sich leise. Der Boden knarrte unter ihren Füßen. Der Wohnwagen hatte diese unverwechselbare Ausstrahlung von Zerbrechlichkeit und Unbeständigkeit. Dennoch war er vermutlich ziemlich gemütlich, außer bei Tornados. Der pilzbraune Teppich war neu und dem in Sonoras Haus weit überlegen. Die maskulin wirkende Wohnzimmereinrichtung bestand aus einem braunen Ledersofa mit passendem Sessel und einem Schaukelstuhl mit einem Troddelkissen auf der Sitzfläche. Der Fernseher war eines dieser modernen Heimkinos mit Soundsystem, einschließlich separater Lautsprecher, die lang und schmal neben dem Bildschirm standen. Im Bücherregal aus Eichenfurnier war eine Dreijahressammlung Reader’s-Digest-Bände. Das oberste Regalbrett blieb Pferdefiguren Vorbehalten.
Der Kaffeegeruch war durchdringend ‒ die Kanne stand wahrscheinlich seit Stunden auf der Platte. Ein Hauch von Popcorn hing in der Luft.
Chauncey kam ihnen aus der Küche entgegen. Er hinkte ein wenig, als wäre seine linke Hüfte steif und er zu hastig aufstanden. Er sah aus, als hätte er geweint ‒ Renquist hatte alle Hände voll zu tun gehabt. Die Küche war winzig und überaus ordentlich. Karten lagen auf dem Ahorntisch ‒ Chauncey und Renquist hatten zusammen Solitär gespielt. Chauncey bot die Küchenstühle an, als ob er königliche Hoheiten zu Besuch hätte.
»Mr. Chauncey, bis jetzt haben wir Ihre Tochter noch nicht gefunden, aber ‒«
Das Dröhnen eines Hubschraubers ließ sie alle aufblicken. Sam warf Sonora einen Blick zu, und sie nickte.
Sie zeigte zur Decke. »Das ist unserer. Der Pilot hat NSG ‒«
»Nachtsichtgeräte?« fragte Chauncey.
Sam nickte. »Ich kenne den Mann. Er ist gut.«
Chaunceys Augen verengten sich. »Sind das Infrarot-Geräte? Die AN-PVS 7? Die, die im Golfkrieg benutzt wurden?«
Sonora fing einen schnellen Blick von Sam auf. Keine gute Idee, den Mann zu unterschätzen. Sie wußte nicht, ob der Pilot Nachtsichtgerät oder Wärmesensoren benutzte, aber da letzteres die Suche nach einer Leiche bedeutete, entschied sie, daß es besser sei, einfach weiterzumachen. Es hatte keinen Sinn, über Wärmequellen und verwesende Leichname zu diskutieren.
»Wir lassen die Spur auch von einem Bluthund verfolgen.« Chauncey erwiderte ihren Blick. Dieser Mann hatte eindeutig mehr Vertrauen zu Hunden als zu Hubschraubern. Sie hatte nicht bemerkt, wie strahlend blau seine Augen waren. Sie besaßen eine seltsame Eigenschaft, die sie nicht richtig einordnen konnte ‒ aber sie assoziierte diesen Blick mit religiösen Gemälden und bemalten Kirchenfenstern. Sie hatte so etwas noch nie erlebt.
Sie sah weg, unfähig, seinen Blick zu ertragen.
Kapitel 10
Chauncey stand im Flur und winkte mit der Hand.
»Hier.«
Sam ging an ihm vorbei und öffnete die erste Tür. »Oh, ich glaube, das ist das falsche.«