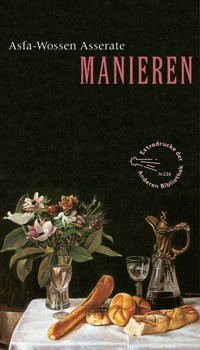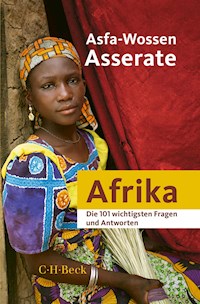16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Die Andere Bibliothek
- Sprache: Deutsch
Ein Spaziergang durch die Seelenlandschaft der Deutschen mit Bestseller-Autor Asfa-Wossen Asserate.
Als Asfa-Wossen Asserate im Sommer 1968 zum Studieren aus Addis Abeba nach Tübingen kam, geriet er mitten hinein in die Studentenbewegung. Inzwischen besitzt der äthiopische Prinz die deutsche Staatsbürgerschaft, von seinen englischen Freunden wird er liebevoll »My favourite Kraut« genannt. Nach über fünfzig Jahren in Deutschland ist es an der Zeit für ein persönliches Fazit. Im vorliegenden Buch – der Autor nennt es ein Vademecum – geht er deutschen Eigenheiten, Marotten und Klischees auf den Grund und spart dabei seine eigenen Vorlieben nicht aus. Das Alphabet erlaubt es ihm, leichtfüßig von einem Thema zum nächsten zu springen: von der Autobahn zur Bratwurst, von der Freikörperkultur zum Gartenzwerg, von der Kehrwoche zur Kuckucksuhr, von der Waldeinsamkeit bis zum Zapfenstreich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 283
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über das Buch
Ein Spaziergang durch die Seelenlandschaft der Deutschen mit Bestseller-Autor Asfa-Wossen Asserate
Als Asfa-Wossen Asserate im Sommer 1968 zum Studieren aus Addis Abeba nach Tübingen kam, geriet er mitten hinein in die Studentenbewegung. Inzwischen besitzt der äthiopische Prinz die deutsche Staatsbürgerschaft, von seinen englischen Freunden wird er liebevoll »My favourite Kraut« genannt. Nach über fünfzig Jahren in Deutschland ist es an der Zeit für ein persönliches Fazit. Im vorliegenden Buch – der Autor nennt es ein Vademecum – geht er deutschen Eigenheiten, Marotten und Klischees auf den Grund und spart dabei seine eigenen Vorlieben nicht aus. Das Alphabet erlaubt es ihm, leichtfüßig von einem Thema zum nächsten zu springen: von der Autobahn zur Bratwurst, von der Freikörperkultur zum Gartenzwerg, von der Kehrwoche zur Kuckucksuhr, von der Waldeinsamkeit zum Zapfenstreich.
Über Asfa-Wossen Asserate
Asfa-Wossen Asserate, 1948 in Addis Abeba geboren, Großneffe des letzten äthiopischen Kaisers Haile Selassie, lebt seit über fünfzig Jahren in Deutschland. Er ist Unternehmensberater für Afrika und den Mittleren Osten in Frankfurt am Main, politischer Analyst und Autor zahlreicher erfolgreicher Bücher zum Thema Deutschland und Afrika. Sein 2003 in der Anderen Bibliothek erschienenes Buch »Manieren« wurde zum gefeierten Bestseller.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Asfa-Wossen Asserate
Deutsch vom Scheitel bis zur Sohle
Ein Vademecum
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Vorwort
A
Abendbrot
Altweibersommer
Atomkraft? Nein danke
Autobahn
B
Biedermeier
Bierehre
Bismarckturm
Blümchensex
Bratwurst
C
C-Dur
Christkindlesmarkt
Corpsstudent
D
Dackel
Deutschlandgeschwindigkeit
Dienstleistungswüste
Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitän
E
Ebbelwoi
Eckkneipe
Eisenbahn
F
Feierabend
Fernweh
Festspielhaus
Filterkaffee
Freikörperkultur
G
Gartenzwerg
Gemütlichkeit
Grüß Gott
H
Habseligkeiten
Hasenfuß
Hausfrau, schwäbische
Heimweh
Helau und Alaaf
Hut ab!
I / J
Inflationsangst
Jägermeister
K
Kartoffel
Kehrwoche
Kniefall
Knorke
Kuckucksuhr
L
Lederhose
Leitz-Ordner
M
Mahlzeit
Meuchelpuffer
Misthaufen
Mohrenkopf
N
Neunter November
Nonnenfürzle
Nussschalresidenzen
O / P
Oktoberfest
Opfer
Pappenheimer
Pickelhaube
Pfarrhaus
Q / R
Querdenker
Realpolitik
Rosstäuscher
S
Sauerkraut
Schadenfreude
Stammtisch
T
Trinkfestigkeit
Turnschuh
U / V
Übermensch
Vereinsmeier
W
Waldeinsamkeit
Wein oder Bier?
Weißwurstäquator
Weltschmerz
X / Y / Z
X für ein U
Zapfenstreich
Literaturverzeichnis
Impressum
Wer von diesem E-Book begeistert ist, liest auch ...
Vorwort
Vieles, was zunächst wie eine Ansammlung von Zufällen erscheint, fügt sich im Rückblick auf das eigene Leben zu einem wohlkomponierten Gemälde, in dem jedes Detail am richtigen Platz zu sitzen scheint. So erging es mir mit Deutschland, von dem es heißt, dass es mir »in die Wiege gelegt« wurde. Meine Eltern in Addis Abeba hätten sich wahrscheinlich auch ein anderes Kindermädchen suchen können als »Tante Luise« aus Linz, der ich meine erste deutsche Fibel und die Liebe zur deutschen Küche verdanke. Sie kam auf Empfehlung einer deutschen Freundin der Familie zu uns, Vera Schumacher, die Schwester des Kaiserlichen Staatsrats David Hall, aus Schwaben gebürtig. Aus dem Mund von »Tante Vera« hatte ich die ersten Worte Deutsch gehört. Mein Vater hätte mich auch auf eine andere Schule schicken können als auf die gerade gegründete Deutsche Auslandsschule in der äthiopischen Hauptstadt, an der Deutsch Unterrichtssprache war und an der ich mein deutsches Abitur ablegte. Er hätte mir gewiss auch einen anderen Ort irgendwo auf der Welt empfehlen können, wo ich mein Studium hätte aufnehmen können, als ausgerechnet das schwäbische Tübingen. Ich hätte bestimmt auch anderswo promovieren können als in Frankfurt am Main, wo ich in dem großen Äthiopisten Professor Eike Haberland meinen Doktorvater fand. Und wenn Äthiopien im Herbst 1974 nicht in die Wirren der Revolution geraten wäre, wenn sich dort nicht eine kommunistische Militärjunta an die Macht geputscht hätte und ich infolgedessen nicht staatenlos geworden wäre, hätte ich auch nicht in Deutschland politisches Asyl beantragt – und ich wäre sicherlich nicht deutscher Staatsbürger geworden.
Aber es ist nun einmal so gekommen, und so stehe ich heute nicht ohne Verwunderung vor dem Gemälde meines Lebens, in dem Deutschland einen so großen Teil ausmacht. In den fünfundfünfzig Jahren, in denen ich nun – abgesehen von einigen kurzen Unterbrechungen – in Deutschland lebe, hat sich dieses Land so rasant verändert wie wohl niemals in der Geschichte zuvor. In den 1960er Jahren mochte es in Deutschland vielleicht ein paar Dutzend Äthiopier gegeben haben, ein fließend Deutsch Sprechender mit schwarzer Hautfarbe war ein Kuriosum. Dass die sogenannten »Gastarbeiter«, die aus Italien, der Türkei, Spanien, Portugal, Griechenland und Jugoslawien als Arbeitskräfte angeworben wurden, sich in Deutschland dauerhaft niederlassen könnten, galt als ausgeschlossen; und so hielt man es auch nicht für nötig, Anstrengungen zu deren Integration zu unternehmen. Es galt das Ius sanguinis, das Abstammungsprinzip, das festlegte: Deutscher ist derjenige, der von deutschen Vorfahren abstammt. Dagegen das Deutschland von heute: Über ein Viertel aller in Deutschland Lebenden hat einen Migrationshintergrund, das heißt dass sie selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurden. Wer Deutscher ist, bemisst sich längst nicht mehr an der Hautfarbe, das Ius sanguinis ist dem Ius soli, dem Geburtsprinzip, gewichen: Als Deutscher gilt in aller Regel, wer in Deutschland geboren wurde, mögen die Eltern auch selbst keine Deutschen sein.
Deutschland heute ist vielfältiger denn je – und wer offen durchs Leben geht und neugierig auf die Welt ist, wird dies als Bereicherung empfinden. Gleichwohl: Manch einer, der sich in diesem Land verwurzelt sieht, mag sich Sorgen machen, dass mit der Vielfalt der Menschen und Kulturen die deutsche Kultur und Tradition ins Hintertreffen geraten könnten. Ich habe eine andere Erfahrung gemacht. Die Neugier auf Deutschland, auf seine Geschichte und Traditionen, ist unter nicht wenigen, die hier in den letzten Jahrzehnten Zuflucht und Heimat gefunden haben, mindestens genauso stark ausgeprägt wie unter jenen, die ihren deutschen Stammbaum über Jahrhunderte zurückverfolgen können.
»Dieses Land gibt sich gern Rechenschaft«, wusste schon Johann Wolfgang von Goethe. Ich weiß nicht, wie oft ich in all den Jahren, in denen ich hier lebe, gefragt wurde, wie ich über Deutschland denke. Ich bin dieser Frage in einigen Büchern nachgegangen, aber je länger ich mich damit beschäftige, desto schwerer fällt mir die Antwort darauf. Die Seelenlage der Deutschen ist gewiss komplex. Right or wrong, my country – diesen Satz, der in England und den Vereinigten Staaten nahezu als selbstverständlich gilt, wird man aus dem Mund eines Deutschen kaum hören. Das Verhältnis der Deutschen zu ihrem Land ist ein gebrochenes, und dies nicht erst seit der moralischen Katastrophe des Zweiten Weltkriegs. Gibt es ein zweites Land auf der Welt, in dem die führenden Köpfe so rigoros mit ihrer Nation ins Gericht gegangen sind? Die Liste ist lang, sie reicht von Georg Christoph Lichtenberg und Immanuel Kant über Heinrich Heine, Friedrich Nietzsche und Bertolt Brecht bis hin zu Thomas Mann, der schrieb: »Der Hang zur Selbstkritik, der oft bis zum Selbstekel, zur Selbstverfluchung ging, ist kerndeutsch, aber ewig unbegreiflich wird bleiben, wie ein so zur Selbsterkenntnis angelegtes Volk zugleich den Gedanken der Weltherrschaft fassen konnte.«
Deutschland hat sich dem finstersten Kapitel seiner Geschichte gestellt, es ausgeleuchtet und aufgearbeitet – so mustergültig und akribisch, dass dabei zuweilen die hellen Seiten der deutschen Geschichte aus dem Blick geraten sind. Was Deutschland und die Deutschen ausmacht, das ließ und lässt sich nicht leicht auf einen Nenner bringen. Ein jeder von uns hat bestimmte Bilder vor Augen, wenn ihm die Frage gestellt wird, was typisch deutsch sei. Niemand wird sich von solchen Stereotypen ganz freimachen können, und in jedem Klischee steckt bekanntlich ein Körnchen Wahrheit. Im Übrigen trägt, wie Kurt Tucholsky geschrieben hat, jeder sein »Privat-Deutschland« mit sich. Das gilt gewiss auch für mich. Die Rolle des »teilnehmenden Beobachters« wage ich nicht mehr für mich in Anspruch zu nehmen, zu sehr fühle ich mich längst in dem Dschungel all dessen, was deutsch ist, mit Haut und Haaren verstrickt. Deutschland ist mir in den Jahren und Jahrzehnten lieb und teuer geworden, auch wenn sich das Gefühl der Verwunderung gelegentlich immer noch einzustellen vermag. Davon mag das vorliegende Buch Zeugnis ablegen, das keinerlei Anspruch auf Objektivität erhebt. Manchen der Stichwörter und Themen auf den folgenden Seiten bin ich an anderem Ort und in anderen Zusammenhängen bereits nachgegangen – man möge mir dies nachsehen. Nicht weniges verdankt sich den Gesprächen mit guten Bekannten und Freunden, die ich in meiner zweiten Heimat Deutschland gefunden habe. Und mindestens ebenso sehr wie durch eigene Erfahrungen und Beobachtungen haben sich mir Land und Leute durch die Lektüre der Bücher zahlreicher kluger Menschen erschlossen. Einige davon sind im Anhang aufgelistet.
Der befreundete Publizist Konrad Melchers, ein gebürtiger Tübinger, erzählte mir von dem Rechtsgelehrten Hans Dölle, der nach dem Krieg eine Professur an der dortigen Hochschule innehatte. Jeden Sonntag sah man ihn von seinem Wohnhaus in der Biesingerstraße über die Neckarhalde spazieren, mit seiner Frau Else untergehakt und seinem Sohn, auf dem Weg in die Vormittags-Vorstellung des Kinematographentheaters. Er trug Sonntagsstaat und Spazierstock, dazu schwarze Lederschuhe, die seine Gattin ihm so gewienert hatte, dass er in deren Spitze die Korrektheit seines Scheitels überprüfen konnte. Ich kam leider zu spät nach Tübingen, um Professor Dölle noch persönlich kennenzulernen, aber in meinem Kopf entstand sogleich ein Bild, wie es von Carl Spitzweg hätte gemalt sein können: Deutsch vom Scheitel bis zur Sohle.
Asfa-Wossen Asserate, im August 2023
A
Abendbrot
»Morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein König, abends wie ein Bettelmann«: An dieses deutsche Sprichwort habe ich nie recht geglaubt. Sicher stammt es aus Zeiten, in denen der Arbeitstag der allermeisten noch durch harte körperliche Arbeit geprägt war, eine ordentliche Stärkung zu Beginn des Tages konnte da sicher nicht schaden. Auch kann es seinen protestantischen Hintergrund nicht verleugnen, galt (und gilt) doch in der Katholischen Kirche das Gebot: Nur nüchtern, will heißen: ohne Frühstück, zur Eucharistie!
Im Abendbrot, mag es auch noch so karg sein, schwingt stets das heilige Abendmahl mit. Das Brot spielt hierzulande die Hauptrolle bei dieser Mahlzeit zum Abschluss des Tages. Im Zweifel genügen ein, zwei Schnitten, mit Butter bestrichen, und dazu vielleicht noch eine Scheibe Wurst. Fertig ist das Abendbrot. Es darf natürlich gerne auch etwas üppiger ausfallen, etwa als »Kalte Platte«. Neben dem Abendbrot gibt es auch noch die Brotzeit, in Bayern traditionell vor dem Mittagessen, als herzhaftes zweites Frühstück eingenommen. Zu Fontanes Zeiten war dafür noch der Begriff »Gabelfrühstück« in Gebrauch, das aus warmen und kalten Speisen bestehen konnte. Heute nennt man es neudeutsch »Brunch«. In einigen süddeutschen Gegenden wird diese Zwischenmahlzeit auch als Vesper bezeichnet, im Österreichischen als Jause. Für all das gibt es inzwischen keine festen Regeln mehr: Gegessen wird, wenn man Appetit hat.
Unser tägliches Brot gib uns heute: Über 300 Brotsorten soll es in Deutschland geben, dabei kommen neben Roggen und Weizen auch Hafer, Gerste, Hirse, Buchweizen, Dinkel, Kleie und Mais zum Einsatz. Vom Frankenlaib, Spessartkruste und Münsterländer Stuten über Altmärker, Paderborner und Oldenburger bis hin zum Schlesischen Landbrot ist für jeden etwas dabei. Dabei handelt es sich – der Tradition gemäß – ganz überwiegend um Schwarzbrot. Pane utuntur nigro: »Sie essen schwarzes Brot«, notierte der päpstliche Legat Enea Silvio Piccolomini, der spätere Papst Pius II., der Mitte des 15. Jahrhunderts Deutschland bereiste und sich von der Pracht und der Sauberkeit deutscher Städte beeindruckt zeigte. Erst Ende des 19. Jahrhunderts wurde auch Weißbrot in Deutschland allmählich populär. »Weiß und schwarz Brot ist eigentlich das Schibboleth, das Feldgeschrei zwischen Deutschen und Franzosen«, musste Goethe im denkwürdigen September 1792 feststellen, als er den Feldzug der alliierten Truppen gegen Frankreich als Kriegsberichterstatter begleitete. Die französischen Knaben, mit denen er nach der Kanonade von Valmy sein Kommissbrot teilen wollte, hatten dankend abgelehnt: Sie nähmen nur »gutes Brot, gute Suppe, gutes Fleisch und gutes Bier« zu sich.
Für einen Außenstehenden hat die deutsche Liebe zum Brot fast etwas Rührendes. Mit wie vielen liebevollen, von Region zu Region wechselnden Bezeichnungen wird im Deutschen noch des letzten Rests Brot, des harten Endstücks gedacht! Man nennt es Scherzerl, Gigele oder Gnetzla, Knust, Krüstchen oder Knorzen, Knäusperle, Riebele oder Ränftel, Timpken, Griebsch oder Mürgel. Sogar die Bezeichnung »Ärschel« ist mir schon untergekommen. Nichts vermissten unsere deutschen Lehrer an der Deutschen Schule in Addis Abeba so sehr wie das heimische Schwarzbrot. Die Gattinnen der Mitarbeiter der Deutschen Botschaft flogen regelmäßig nach Nairobi, um sich in den dortigen deutschen Bäckereien mit Brot zu versorgen. Und wenn ich heute einen meiner deutschen Freunde irgendwo im Ausland besuche und die Frage stelle, was er denn gerne als Mitbringsel hätte, lautet die Antwort meist: »Bring mir doch ein frisches Vollkornbrot mit.«
Wenn sie dann ihr Abendbrot mit mir teilen, begreife auch ich, was Friedrich Hebbel meinte, als er in sein Tagebuch notierte: »Wenn man die Menschen am Abend ihr Butterbrot essen sieht, so kann die Bemühung, das Leben zu erklären, sehr lächerlich erscheinen. Butter und Brot erklären alles.«
Altweibersommer
Es ist die vielleicht schönste Zeit des Jahres: die Tage, in denen der Sommer gemächlich ausklingt, sich das Laub zu färben beginnt, die schon tiefer stehende Sonne ihre Strahlen weit in den Wald hineinwirft und sich in die Wärme ein Duft von Feuchtigkeit mischt, der den nahenden Herbst erahnen lässt. Zu keiner Zeit ist es hierzulande angenehmer, einen Spaziergang zu unternehmen, mit offenem Hemd und ohne zu schwitzen, mit der Aussicht auf ein schönes Glas Riesling am Abend. Man sieht dann oft in Wald und Flur jene Spinnenfäden im Sonnenlicht glitzern, mit denen junge Spinnen durch die aufsteigende warme Luft segeln. Es ist die meiner Generation gemäße Jahreszeit, die Zeit des »Nachsommers«, oder – mit einem anderen schönen Wort gesprochen: »Altweibersommer«.
Die Bezeichnung »Altweibersommer« gibt es aber nicht nur im Deutschen, sondern auch im Ungarischen, im Polnischen, Tschechischen, Ukrainischen und in anderen slawischen Sprachen. Das Schweizerische kennt für das Phänomen auch den Namen »Witwesömmerli«, und im Bayerischen gibt es den »Ähnlsummer« (»Großvatersommer«). In den Nordenglandstaaten der USA und in Kanada wiederum spricht man vom »Indian Summer«. Ob der hiesige Name sich wirklich von älteren Damen ableitet, ist allerdings durchaus umstritten. Eine Fraktion von Sprachwissenschaftlern vertritt die Ansicht, dass in Wahrheit ebenjene nachsommerlichen Spinnen mit ihren Fäden Pate standen, wird doch im Althochdeutschen das Knüpfen von Spinnweben mit dem Wort »weiben« bezeichnet. Wobei einem bei diesen Spinnfäden ja auch wieder das graue Haar in den Sinn kommt.
Die Frage, ob der »Altweibersommer« möglicherweise frauen- und/oder seniorinnenfeindlich ist, beschäftigte schon vor über dreißig Jahren deutsche Gerichte. Im Jahr 1988 wies das Landgericht Darmstadt die Klage einer Dame zurück, die dem Deutschen Wetterdienst die Verwendung des Wortes untersagen wollte. Der Begriff sei, so das Gericht, weder ehrabschneidend noch beleidigend. Aber wer weiß: Ein solches Verfahren würde, in heutigen Tagen angestrengt, womöglich anders ausgehen.
Doch nicht nur wachsende Sprachsensibilität, auch der Klimawandel bedroht den »Altweibersommer«. Wenn die Klimaforscher mit ihren Prognosen recht behalten, werden die Jahreszeiten Frühling und Herbst in Mitteleuropa bald gänzlich verschwunden sein und die hochsommerlichen »Hundstage« unmittelbar vom Novembergrau abgelöst werden. Vielleicht sollten wir Älteren uns gelegentlich daran erinnern, wenn wir uns wieder einmal, im Stau stehend, über die jungen Menschen mokieren, die vor unseren Augen die Straßenkreuzung blockieren: Die »Klima-Demonstranten« streiten nicht zuletzt für den Erhalt des Altweibersommers.
Atomkraft? Nein danke
Erinnert sich noch jemand an das Hohelied auf das »friedliche Atom«? »Wie die Kettenreaktionen auf der Sonne uns Wärme, Licht und Leben bringen, so schafft die Atomenergie, in anderer Maschinerie als der der Bombe, in der blauen Atmosphäre des Friedens, aus Wüste Fruchtland, aus Eis Frühling. Einige hundert Pfund Uranium und Thorium würden ausreichen, die Sahara und die Wüste Gobi verschwinden zu lassen, Sibirien und Nordkanada, Grönland und die Antarktis zur Riviera zu verwandeln. Sie würden ausreichen, um der Menschheit die Energie, die sonst in Millionen von Arbeitsstunden gewonnen werden musste, in schmalen Büchsen, höchstkonzentriert, zum Gebrauch fertig darzubieten.« So beschwor es anno 1955 Ernst Bloch in seinem Großwerk Das Prinzip Hoffnung. Während der Koreakrieg und die Kubakrise die Welt in Atem hielten und die Furcht vor einem Atomkrieg allgemein verbreitet war, malten Wissenschaftler und Ingenieure das Goldene Zeitalter des friedlichen Atoms. Ihr Traum war es, die schrecklichste Waffe der Menschheit, die Atombombe, in den größten Segen zu verwandeln. Dass das friedliche Atomzeitalter einer sozialistischen Utopie entsprang, ist heute gemeinhin in Vergessenheit geraten.
Nicht alle Deutschen wollten folgen, als Bundeskanzler Helmut Schmidt im Angesicht von Ölpreisschock und Ölpreiskrise den Ausbau der Kernenergie verkündete. Wyhl, Brokdorf, Gorleben, Kalkar und Wackersdorf: Das waren die Orte, an denen sich die Atomkraftgegner zum Protest versammelten. Eine kleine lächelnde Sonne wurde zu ihrem Symbol. Mit Wachsmalstiften 1975 von einer dänischen Studentin aufs Papier gebracht – und, übersetzt in mehr als 45 Sprachen, in alle Welt geschickt. Keine Parole und kein Schlachtruf, nur eine Frage, freundlich-höflich abgelehnt: »Atomkraft? Nein danke.«
Bald war die Sonne überall, sah man sie auf durchgerosteten Renault 4 aufgeklebt ebenso wie auf glänzenden Mercedes-Limousinen, auf Fahnen, Stirnbändern, Ansteckern und als Cappuccino-Schablone – eine Design-Ikone wie sonst nur Coca-Cola und der Aldi-Schriftzug. Sie wurde zum Begleiter der Partei Die Grünen, die der Protest von der Straße in die Parlamente trug. 1983 zogen sie mit Strickpullis, Sonnenblumen und einer abgestorbenen Tanne in den Bundestag ein. Fünfzehn Jahre später fanden sie sich erstmals in der Regierung wieder. Am 15. April des Jahres 2023 hatten sie ihr Ziel erreicht: Das letzte Kernkraftwerk in Deutschland wurde abgeschaltet. Die Fahnen mit der roten Sonne wurden eingerollt.
Anlass zum Feiern gab es trotzdem nicht. Atomkraft? Ja bitte! Dem deutschen Sonderweg will die Welt partout nicht folgen, in vielen Ländern sind neue Kernkraftwerke geplant oder im Bau. Derweil sich die Wissenschaft den Kopf zerbricht, wie man wohl nachfolgende Generationen vor dem Müll warnt, der noch in hunderttausend Jahren strahlt. Mit menschlichem Ermessen nicht zu fassen: Vor hunderttausend Jahren hatte sich der homo sapiens noch längst nicht von Afrika in die Welt aufgemacht, scharten sich hierzulande noch die Neandertaler um das Lagerfeuer.
Autobahn
Heilig’s Blechle! Draußen vor der Tür steht es, frisch gewaschen im Sonnenlicht glänzend oder unter dem schützenden Dach der Garage: das Automobil, der Deutschen liebstes Kind und heilige Kuh. Flitzer, Schlitten, Heißer Ofen, Töfftöff, Stinker, Blechkutsche, Karre, Klapperkasten: Das Deutsche hält zahlreiche Bezeichnungen für den fahrbaren Untersatz bereit. Dass die Beziehung des Halters zu seinem Gefährt eine durchaus besondere ist, zeigt sich auch darin, dass es beim Namen genannt wird. Reich ist der Schatz an Kosenamen, der dafür zur Verfügung steht: von »Schnucki« und »Baby« über »Puschel« und »Mümmel« bis hin zu »Rocky« und »Möhre«. Nicht selten stehen erträumte oder verflossene Geliebte Pate, »Hildegard«, »Rosalinde« oder »Bea«. Die Rangliste der beliebtesten deutschen Auto-Spitznamen wird, wie eine Umfrage des ADAC aus dem Jahr 2021 ergab, von »Speedy« angeführt. Es folgen in deutlichem Abstand »Herbie«, »Flitzer«, »Bruno« und »Hugo«. Manch einer tut den Namen seines motorisierten Freundes der Welt mit einem Aufkleber am Heck kund.
Das Auto ist der Schutzraum und die zweite Haut aus Aluminium, Blech und Plastik, die sich, im Gegensatz zur sterblichen Hülle des menschlichen Körpers, stets erneuern lässt. Am Samstagnachmittag gehört Vati seinem Automobil: Dann geht es mit ihm in die Waschstraße, wird es gehätschelt und gepflegt, gewachst und poliert und innen gesaugt. Wobei die Leidenschaft fürs Auto durchaus nicht nur eine männliche ist. Man denke nur an Bertha Benz, die Ehefrau des Erfinders des Automobils. Heimlich, ohne Einwilligung ihres Gatten, setzte sie sich im August 1888 ans Steuer des Benz-Patent-Motorwagens Nummer 3 und unternahm damit die erste Auto-Überlandfahrt der Geschichte. Über hundert Kilometer führte ihr Weg von Mannheim nach Pforzheim und zurück. Als ihr unterwegs das Benzin ausging, behalf sie sich mit Ligroin, einem Reinigungsmittel, als Kraftstoff. Sie erstand es in der Stadt-Apotheke von Wiesloch, die sich folglich als erste Tankstelle der Welt rühmen darf. Zwei Mal blieb Bertha Benz mit ihrem Wagen auf der Strecke liegen, und beide Male gelang es der Pionierin des Automobils, ihn wieder flottzumachen. Als die Benzinleitung verstopfte, verschaffte sie sich mit ihrer Hutnadel Abhilfe. Und als die Zündung entzweiging, nahm sie ihr Strumpfband zu Hilfe. Wer möchte, kann heute auf der »Bertha Benz Memorial Route« die Strecke nachfahren: von Mannheim über Freudenheim und Schriesheim, Nußloch und Wiesloch, Mingolsheim und Bruchsal, Untergrombach und Kleinsteinbach nach Pforzheim; und wieder zurück über Bauschlott und Brechen, Gondelsheim und Heidelsheim, Kirrlach und Ketsch, Schwetzingen und Seckenheim nach Mannheim.
Die Zuneigung der Deutschen zum Auto ist tief verwurzelt, wie sollte es anders sein: Das Automobil ist der Inbegriff deutschen Erfindergeists und deutscher Ingenieurskunst. Es steht für deutsche Tugenden wie Ausdauer, Einfallsreichtum, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit. Und bis heute trägt es einen der wichtigsten Wirtschaftszweige. »Mir schaffe beim Daimler«, heißt es im Schwabenland; und in Niedersachsen ist VW der größte Arbeitgeber des Landes.
Zum »Volkswagen« der Deutschen wurde der VW Käfer, entwickelt im Dritten Reich als »Kraft durch Freude«-Wagen, erschwinglich für jedermann. 1938 wurde der Grundstein für das Volkswagenwerk bei Fallersleben – dem heutigen Wolfsburg – gelegt. Doch der angezettelte Krieg verhinderte, dass der Wagen in Serienproduktion ging, er wurde zum militärischen Kübelwagen umfunktioniert. Ab 1946 rollte der VW Käfer in Wolfsburg dann vom Band, eine beispiellose Erfolgsgeschichte. »Überall Kurven, Bauchiges, Schwingendes«, formulierte es Karl Markus Michel. »Als sollte die böse Zackigkeit von Hakenkreuz, Hitlergruß und SS-Rune durch die Gnade von Käfer, Muschel, Niere vergeben und vergessen werden. In diesen Formen fühlten wir uns versöhnt.« Der VW Käfer wurde zum rollenden Wirtschaftswunder und Inbegriff von Mobilität und Unabhängigkeit – nicht nur in Deutschland. Mit 21,5 Millionen avancierte der Käfer zum weltweit meistverkauften Automobil, abgelöst vom Nachfolger Golf, von dem seit 1974 über 35 Millionen gebaut wurden.
»Es war nicht alles schlecht in Deutschland zwischen 1933 und 1945 …«. Bei Sätzen, die so beginnen, ist Vorsicht geboten. Oft folgt dann der Hinweis auf den Bau der Autobahn. Dabei wurde die erste Autobahn Deutschlands zwischen Köln und Bonn bereits im August 1932 eingeweiht, und zwar vom damaligen Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer – sie trug den offiziellen Namen »Rheinische Provinzialstraße«. Das Wort »Autobahn« für eine »kreuzungsfreie Schnellstraße ohne Gegenverkehr« wurde 1929 von dem Bauingenieur Robert Otzen geprägt. Da war die erste öffentliche Autobahn der Welt, die »Autostrada dei Laghi« zwischen Mailand und Varese, bereits seit fünf Jahren in Betrieb. Die AVUS (für Automobil-Verkehrs- und Übungs-Straße) im Südwesten Berlins wurde bereits im September 1921 eröffnet – sie war aber in privater Hand und wurde als Renn- und Teststrecke genutzt.
»Autobahn«, dieses Wort versteht man in fast allen Gegenden der Welt, auch in Japan, Persien und der Türkei, dort otoban genannt. »Wir fahr’n fahr’n fahr’n / auf der Autobahn«, heißt es in einem Lied von Kraftwerk, deren Musik um die Welt ging. »Vor uns liegt ein weites Tal, / Die Sonne scheint mit Glitzerstrahl. / Die Fahrbahn ist ein graues Band, / weiße Streifen, grüner Rand …« Zu den frühen Bewunderern der deutschen Autobahn gehörte der zwanzigjährige John F. Kennedy, der 1937 mit seinem Dackel »Offie« im Cabriolet über die soeben fertiggestellten Abschnitte der Reichsautobahn rauschte. »Das sind die besten Straßen der Welt«, schwärmte er – »großartig« auch darum, weil es »keine Geschwindigkeitsbegrenzung« gab. »Freie Fahrt für freie Bürger!« Dieser Ruf kam 1974 auf dem Höhepunkt der Ölkrise auf, als Slogan einer Kampagne des Automobilclubs ADAC. Die Automobilisten protestierten damit nicht nur gegen die von der Bundesregierung verfügten »autofreien Sonntage«, sondern auch gegen den viermonatigen Tempo-100-Großversuch auf Bundesautobahnen. Mit Erfolg: Bis heute wird die »freie Fahrt« auf deutschen Autobahnen mit Zähnen und Klauen verteidigt, mögen auch alle Länder der Welt inzwischen ein Tempolimit verhängt haben und noch so viele vernünftige Gründe dafür genannt werden.
Heute erscheint die Liebe der Deutschen zum Automobil in höchstem Maße gefährdet. Der Abschied vom Verbrennermotor ist europaweit beschlossen, und groß ist die Verunsicherung darüber, welche wirtschaftlichen Verwerfungen damit einhergehen – und ob es für das Automobil überhaupt noch eine Zukunft gibt. »Heilig’s Blechle!« Ein schwäbischer Stoßseufzer, den ein jeder im Ländle kennt. Das »Blechle« muss fürs Auto stehen, der felsenfesten Überzeugung war ich jahrzehntelang. Bis man mich schließlich eines Besseren belehrte: Der Ausdruck reicht bis ins Mittelalter zurück. Da gab es im Schwabenland den »Heiligen Kasten«, eine Kasse, aus der die Armen bezahlt wurden. Und damit die städtischen Armen sich als registrierte Bettler ausweisen konnten, bekamen sie eine Blechmarke ausgehändigt, genannt »heilig’s Blechle«.
B
Biedermeier
Philister, Spießer, Biedermeier: Niemand mag es, derart gescholten zu werden. Von jenen, die sich mit Freude über sie erheben, werden sie rasch und überall im Land ausgemacht, und gern zeigt man mit dem Finger auf sie: »Schau, dort spaziert Herr Biedermeier / und seine Frau, den Sohn am Arm; / sein Tritt ist sachte wie auf Eier, / sein Wahlspruch: Weder kalt noch warm.« So schrieb es Ludwig Pfau 1846 in seinem Gedicht Herr Biedermeier nieder.
Fünfzig Jahre vor ihm hatten schon die Romantiker gegen die vermeintliche bürgerliche Kleingeistigkeit Front gemacht, verkörpert in der Figur des »Philisters«: »Ein Philister ist ein steifstelliger, steifleinerner oder auch lederner, scheinlebiger Kerl, der nicht weiß, dass er gestorben, und sich ganz unnötigerweise noch auf Erden aufhält«, heißt es bei Clemens Brentano. »Ein Philister ist ein, mit allerlei lächerlichen äußerlichen Lebenszeichen behängter, umwandelnder Leichenbitterstock seines eigenen inneren ewigen Todes … Ein Philister ist der geborene Feind aller Idee, aller Begeisterung, alles Genies und aller freien göttlichen Schöpfung. Er ist die Karikatur des Teufels in ewiger Nüchternheit.«
Mit solch einem gestürzten Luzifer möchte niemand, der noch einen Funken Leben im Leib hat, tauschen, grau und öde ist sein Tageslauf. »Wenn der Philister morgens aus seinem traumlosen Schlafe, wie ein ertrunkener Leichnam aus dem Wasser, auftaucht, so probiert er sachte mit seinen Gliedmaßen herum, ob sie auch noch alle zugegen. Hierauf bleibt er ruhig liegen. Wenn er schließlich aufgestanden, kaut er einige Wacholderbeeren, während er an das gelbe Fieber denkt. Er hält seinen Kindern eine Abhandlung vom Gebet, und wenn er sie in die Schule geschickt hat, sagt er zu seiner Frau: Man muss den äußeren Schein wahren. Das erhält einem den Kredit. Sie werden früh genug den Aberglauben einsehen. Sodann raucht er seine Pfeife; denn Tabak ist des Philisters höchste Leidenschaft, wenn er sie nicht übertrieben hasst … Zweifelsohne zieht der Philister nun alle Uhren im Hause auf. Beim Kaffee spricht er von Politik. Kränkend wäre es ihm, wenn seine Eheliebste ihm nicht ein Dutzendmal sagte: Trinke doch! Er ist so schöne warm. Trinke, ehe er kalt wird! … Sodann geht der Philister zu seinen Geschäften.« Warum sich aber die Romantiker ausgerechnet das biblische Volk der Philister ausgesucht haben, um am deutschen Spießertum ihr Mütchen zu kühlen?
Der Spießgeselle des »Philisters«, der »Spießer«, geht zurück auf den mittelalterlichen »Spießbürger«, der in der Stadt wohnte und dieselbe bei einem Angriff mit dem Spieß als Waffe verteidigte, im Gegensatz zu den wohlhabenderen Bürgern, die dafür Söldner anheuerten, die mit Hellebarden kämpften. Als im 16. Jahrhundert die modernen Feuerwaffen aufkamen, hielten die Spießbürger an ihren Spießen fest – dies hat wohl zum Vorwurf der Kleingeistigkeit geführt.
Für den »Biedermeier« wiederum stand ein schwäbischer Dorfschullehrer und Volksdichter namens Samuel Friedrich Sauter Pate, den heute keiner mehr kennt. Er inspirierte Ludwig Eichrodt und Adolf Kußmaul zu ihrer Figur des Gottlieb Biedermeier. Dieser Herr Biedermeier war ein dichtender schwäbischer Dorflehrer mit einfachem Gemüt, dem laut Eichrodt »seine kleine Stube, sein enger Garten, sein unansehnlicher Flecken und das dürftige Los eines verachteten Dorfschulmeisters zu irdischer Glückseligkeit verhelfen.«
Der Dorfschulmeister steht par excellence für all das, was die Hüter des Intellekts als hinterwäldlerisch brandmarken, er ist die Personifikation allen Spießertums. Der Spießer gilt als engstirnig, pedantisch und latent fremdenfeindlich. Er hat sich in seiner kleinen Welt eingerichtet und ist zufrieden damit. Für die Poesie hat der Spießer keine Antenne, was er für Kunst hält – Schlagermusik, Gartenzwerge auf dem penibel geschnittenen Rasen hinterm Jägerzaun et cetera –, ist nichts weiter als Kitsch (Gartenzwerg). Mag er auch in der Stadt wohnen, ist doch sein Geist durch und durch provinziell. Mit Helmut Kohl, so sahen es seine Verächter, hatte er es sogar ins Bundeskanzleramt geschafft. Als zutiefst provinziell galt der Kanzler aus dem Pfälzischen, dem es sichtlich schwerfiel, einen Satz Hochdeutsch zu sprechen, und der das heimische Oggersheim zum Mittelpunkt der Republik gemacht hatte, wo er mit übergezogener Strickjacke und in Pantoffeln Staatsgäste aus aller Welt empfing und diese zum Verzehr von Saumagen nötigte.
»Lebensplaner, Ordnungsmahner, Blumengießer / Geldsparer, Daimlerfahrer, Volksmusikgenießer« – die Liste dessen, was als spießig empfunden werden kann, ist beliebig erweiterbar. In der Berliner Republik hat man vor einiger Zeit schon den Neo-Spießer ausgemacht, der BWL studiert, gerne Pauschalreisen und Kreuzfahrten unternimmt und stets adrett gescheitelt daherkommt, mit Bundfaltenhose und Bausparvertrag. Und jüngst auch den Öko-Spießer, der sein Geld in den Bioladen trägt und seine Nachbarn maßregelt, wenn sie den Müll falsch trennen oder mit dem Flugzeug verreisen. In jedem Falle gilt: Spießer sind immer die anderen, und es werden immer wieder neue nachkommen. Das wusste auch schon der Dichter Ödön von Hórvath. »Der alte Typ des Spießers ist es nicht mehr wert, lächerlich gemacht zu werden«, heißt es ins seinem Roman Der ewige Spießer aus dem Jahr 1930, »wer ihn heute noch verhöhnt, ist bestenfalls ein Spießer der Zukunft. Ich sage ›Zukunft‹, denn der neue Typ des Spießers ist erst im Werden, er hat sich noch nicht herauskristallisiert.«
Ich kann mir nicht helfen: Mir kommt dieses andauernde rituelle Sich-Erheben der Wohlmeinenden über die anderen selbst ziemlich spießig vor. Das gilt auch für die Kritik an jener Zeit, der der Stempel »Biedermeier« aufgedrückt wurde. In den Jahren zwischen 1815 und 1848 hat sich in Deutschland ein ganz eigener künstlerischer Stil ausgebildet, den es so nirgendwo sonst auf der Welt gab. Er fand seinen Ausdruck insbesondere in der Wohnkultur jener Zeit. Die Biedermeier-Möbel zeichnen sich durch Schlichtheit und Eleganz aus. Sie wollten nicht repräsentativ, sondern vor allem zweckmäßig sein, und bei ihrer Herstellung wurde Wert auf höchste Qualität gelegt.
Was die Malerei anbetrifft, gilt Carl Spitzweg als typischer Künstler des Biedermeier. Auch ihm, in dem man nur den Maler des beschaulichen Glücks im Winkel sehen wollte, hat man Unrecht getan. Die vermeintlich braven Bürger, Sonderlinge und schrulligen Käuze, die seine Bilder bevölkern, die Zipfelmützenpoeten und Dachstubenbewohner, die Hagestolze, Hypochonder und Bücherwürmer, die Kakteenliebhaber, Sonntagsspaziergänger und Schmetterlingsjäger, die strickenden Vorposten, eingeschlafenen Nachtwächter und Hühnchen bratenden Mönche: In all diesen Sonderlingen und schrulligen Käuzen offenbart sich eine scharfe Beobachtungsgabe. Ihnen ist die Ungenügsamkeit und die Komik des menschlichen Lebens eingeschrieben. Und was mir besonders bemerkenswert erscheint: In ihnen offenbart sich ein liebenswert-menschlicher Zug, der den allermeisten Verächtern des Spießertums abgeht: die Fähigkeit zur Selbstironie.
Bierehre
Das Trinken gehört gewiss überall auf der Welt zum Studentenleben. Aber nirgendwo sonst ist mir ein derart ausgefeiltes Regelwerk dafür begegnet wie an deutschen Universitäten. Auch und gerade beim Trinken soll Ordnung und Disziplin gelten, es soll aber auch nicht bierernst zugehen. Während meiner Studienzeit in Tübingen wurde ich recht schnell mit den Regeln des studentischen »Bierverkehrs« vertraut gemacht, die im »Bier-Comment« unseres Corps festgelegt waren – und dieses Regelwerk geht zurück bis ins Jahr 1815. Am Bierverkehr durften demnach nur »bierehrliche« Personen teilnehmen, und seiner »Bierehre« konnte man als Corpsstudent auch schnell wieder verlustig gehen. Das sogenannte Zutrinken musste in jedem Falle als eine Ehre angenommen werden – und schon nahm das »Bierduell« seinen Lauf. Die Verhängung von »Bierstrafen« konnte vor allem dadurch abgewendet werden, dass man das korrekte Zeitmaß beim Trinken einhielt, das aus den sogenannten »Bierminuten« bestand.
Zur Begrüßung der »Alten Herren« auf Kommersen und Kneipen gibt es das Ritual des »Salamanders«: Dabei werden die Gläser vor und nach dem gemeinsamen Trinken auf dem Tisch gerieben. In der DEFA-Verfilmung von Heinrich Manns Der Untertan kann man sich von dieser feierlichen Form des studentischen Zutrinkens einen Eindruck verschaffen (wenn auch dessen Blick darauf nicht gerade wohlwollend ausfällt). All diese Bräuche sind, wie man mir versicherte, durchaus noch lebendig in Zeiten, wo es neben »Alten Herren« selbstverständlich auch »Alte Frauen« gibt und Frauen von der Kneipe auch nicht mehr von vornherein ausgeschlossen sind.
Nur noch in Regensburg wiederum hat sich das studentische Karnevalsspiel des »Bierstaates« erhalten. Je höher der Rang, desto größer die Mengen Bier, die man dabei zu bewältigen hat – vom Hofnarren und Polizisten über den Grafen zum Bischof bis hin zum »Bierkönig«. Recht anschaulich hat die Rangordnung bei Hofe der studentische Dichter Hermann Wollheim in seinem Lied Sind wir nicht zur Herrlichkeit geboren beschrieben:
»Ganz Europa wundert sich nicht wenig / Welch ein neues Reich entstanden ist. / Wer am meisten trinken kann, ist König, / Bischof, wer die meisten Mädchen küsst. / Wer da kneipt recht brav, heißt bei uns Herr Graf; / Wer da randaliert, wird Polizist. / Unser Arzt studiert den Katzenjammer, / Trinkgesänge schreibt der Hofpoet; / Der Hofmundschenk inspiziert die Kammer, / Wo am schwarzen Brett die Rechnung steht. / Und der Herr Finanz liquidiert mit Glanz, / Wenn man contra usum sich vergeht.«
Der Bierstaat mag untergegangen sein ebenso wie das Heilige Römische Reich Deutscher Nation und das Deutsche Kaiserreich, aber bis heute werden an deutschen Universitäten die Bierehre verteidigt und der Bier-Comment hochgehalten. Dessen meistzitierter Paragraph 11 in schönstem Latein lautet: porro bibitur! Oder, ein wenig profaner, auf Deutsch: »Es wird weitergesoffen.«
Bismarckturm
»Er hatte kühne und weise Gedanken«, schreibt Egon Friedell in seiner Kulturgeschichte der Neuzeit über Otto von Bismarck, und er »hat sie mit seinem wilden, starken Junkerblut gefüllt und gelebt, der letzte Held, den die Neuzeit erblickt hat.« »Bismarckzeit« werden die zwanzig Jahre genannt, in denen dieser als Reichskanzler die Geschicke des Landes bestimmte. Er war der »Eiserne Kanzler«, der das Deutsche Reich schmiedete, und der »ehrliche Makler«, der Europa mit einem komplizierten Bündnisgeflecht in Balance zu halten versuchte. Und als der »Brausekopf« Wilhelm II. den Reichskanzler im März 1890 entließ, titelten die Gazetten: »Der Lotse geht von Bord«.