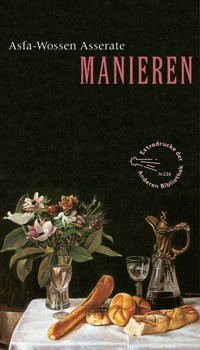9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Diese Stimme fehlte in der Rassismusdebatte Die Flüchtlingskrise hat die Ängste und Sorgen in Deutschland vor einer »Überfremdung« neu geweckt. Zugleich werden Debatten über Political Correctness und Rassismus immer heftiger geführt. Die Corona-Pandemie mit ihren Folgen – weltweite Rezession, Zunahme von Armut, Kriegen und Flucht – droht, Konflikte weiter zu verschärfen. Wie können wir vernünftig umgehen mit diesen Sorgen? Der Schlüssel für gutes Zusammenleben, davon ist Asfa-Wossen Asserate überzeugt, ist die Bereitschaft, aufeinander zuzugehen. Integration ist ein Prozess, ohne Zumutungen wird es nicht gehen – auch und besonders für jene, die sich nicht integrieren wollen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 172
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
»Black Lives Matter«: Auch in Deutschland melden sich Afrodeutsche und People of Color selbstbewusst zu Wort. Muss die »Mohrenstraße« in Berlin umbenannt, sollen vermeintlich diskriminierende Begriffe aus unserem Wortschatz getilgt werden? Und überhaupt: Darf man die Bücher des Aufklärers Immanuel Kant noch lesen, der doch in einer Schrift den »roten Indianer« als »unfähig zu aller Kultur« befunden hatte? Fest steht: Die korrekte Bezeichnung allein wird die Probleme nicht aus der Welt schaffen. Wer das Phänomen der »Fremdenfeindlichkeit « und des nach wie vor virulenten Rassismus an der Wurzel packen will, muss historische Zusammenhänge in den Blick nehmen. Nur wer die eigene koloniale Vergangenheit kennt, wird sich erlauben können, in diesen Fragen mitzureden.
Asfa-Wossen Asserate, der »Wahlheimatspezialist« (FAZ), stellt das gute Zusammenleben in einer demokratischen Gesellschaft in den Fokus und hinterfragt die aktuellen Debatten. Er spürt den Stimmungen nach, benennt die Voraussetzungen für ein gutes, respektvolles Miteinander und gibt entschieden und präzise einen Ton für eine neue, verbindliche Gesprächskultur vor.
Asfa-Wossen Asserate
Wer hat Angst vorm Schwarzen Mann?
Eine persönliche Wortmeldung
Meiner geliebten Mutter, die das Erscheinen dieses Buches leider nicht mehr erleben konnte, in Liebe gewidmet.Asfa-Wossen Asserate
»Solange nicht die Denkweise, die eine Rasse für überlegen und eine andere für minderwertig hält, endgültig diskreditiert und überholt ist; solange es Bürger erster und zweiter Klasse in irgendeiner Nation gibt; solange, bis die Hautfarbe eines Menschen nicht mehr von Bedeutung ist als die Farbe seiner Augen; bis zu dem Tag, an dem die Menschenrechte für alle gleichermaßen garantiert sind, ohne Rücksicht auf ihre Herkunft: so lange wird der Traum von dauerhaftem Frieden und Weltbürgertum eine flüchtige Illusion bleiben, der man beständig nachjagt, die aber nie erreicht wird.«
Kaiser Haile Selassie I., Rede vor der UN-Vollversammlung, New York, 4. Oktober 1963
Einleitung
Als ich im Herbst 1968 als junger Mann aus Addis Abeba zum Studieren nach Tübingen kam, war ich für viele Menschen in dem beschaulichen deutschen Universitätsstädtchen damals wahrscheinlich der erste Dunkelhäutige, den sie zu Gesicht bekamen. Ich erinnere mich noch gut an das Gefühl, in der Fußgängerzone die Blicke der Passanten auf mir zu spüren. Oft, wenn ich in der Stadt unterwegs war, hörte ich Sätze wie »Senn Sia vo auswärds?« oder »Sie senn abr ned vo hier?«. Ich kam damals gar nicht auf die Idee, hinter solchen Begrüßungen und Näherungsversuchen einen Anflug von Rassismus zu spüren – von so etwas wie »strukturellem Rassismus« oder »Mikroaggression« war damals noch nicht die Rede. Ich entwickelte aber sehr schnell ein Gespür dafür, ob mit solchen Sätzen eine gewisse Neugier verbunden war oder ob mein Gegenüber gar nicht nach einer Antwort verlangte, geschweige denn nach einem Gespräch, und damit nur eine gewisse Unsicherheit oder Verlegenheit ausdrückte.
Es kam immer wieder vor, dass ich auf dem Marktplatz in der Sonne auf der Bank saß und eine ältere Dame auf den Platz neben mir zeigte und mich mit den Worten ansprach: »Siddzt do scho äbbr?« Wenn ich dann antwortete: »Aber nein, setzen Sie sich doch bitte!«, konnte sich daraus ein Gespräch über meine Heimat Äthiopien und meinen Weg nach Deutschland entwickeln. Natürlich fiel in diesem Zusammenhang oft auch der Satz: »Sie sprechen aber gut Deutsch!«, oder auf Schwäbisch: »Sia schwäddzad abr guad deidsch!« Wenn ich dann erzählte, dass ich in Addis Abeba auf die Deutsche Schule gegangen war, ja sogar mein Zentralabitur nach den strengen Regeln der deutschen Kultusministerkonferenz absolviert hatte, erntete ich stets ungläubiges Staunen.
Ich kann sagen, dass ich in all den Jahren, die ich in Deutschland lebe – es sind nun schon mehr als fünfzig –, kaum jemals irgendeine Form der Anfeindung oder Diskriminierung erfahren habe; und auch von den wenigen meiner dunkelhäutigen Kommilitonen damals in Tübingen habe ich nichts dergleichen gehört. An der Universität, über die der Sturm der Achtundsechziger hinwegzog, waren wir schwarzen Studenten damals Exoten, kaum einer wagte es, uns jemals zu widersprechen. Auch dann nicht, wenn ich in den aufgeheizten politischen Diskussionen, die wir damals führten, leidenschaftlich gegen die Kommilitonen vom Sozialistischen Deutschen Studentenbund das Wort erhob – schließlich hatten sie sich doch die Befreiung Afrikas und der Afrikaner auf die Fahnen geschrieben.
Ich weiß aber auch, dass es vielen Schwarzen in Deutschland ganz anders erging und ergeht. Viele Afrodeutsche, Schwarze und Dunkelhäutige, mit denen ich sprach, haben mir von Anfeindungen und Zurückweisungen berichtet. Nicht wenigen von ihnen wurde schon einmal das »N-Wort« auf der Straße hinterhergerufen; manch einer wurde, wenn er bei der Suche nach einer Wohnung oder nach einer Arbeitsstelle seinen Namen nannte oder wenn es zum Besichtigungstermin oder Vorstellungsgespräch kam, brüsk zurückgewiesen. Lag es also daran, dass wir Schwarzen in den 1960er- und 1970er-Jahren damals in Deutschland so wenige waren? Das mag eine Rolle gespielt haben, aber sicher noch etwas anderes: Rassismus ist oft auch eine Frage der Klasse – im Vergleich zu den Bedingungen, in denen viele Dunkelhäutige und Afrodeutsche hierzulande lebten und leben, war (und ist) meine Lage recht privilegiert. Das gilt erst recht für die Afrikaner, die in den letzten Jahren als Migranten oder Flüchtlinge ins Land gekommen sind – oft mit nichts weiter als dem, was sie am Leibe trugen.
Ich erinnere mich noch lebhaft an eine Szene, die sich in meiner Tübinger Studentenzeit zutrug. Es war Frühling, und ich ging am Neckar spazieren, als ich auf einem Sportplatz ein paar Dutzend Kinder bei einem mich wunderlich anmutenden Spiel beobachtete. Die Kinder waren um die zwölf Jahre alt, es handelte sich offensichtlich um eine Schulklasse, ihr Lehrer war ebenfalls zugegen. Die Gruppe der Schüler stand dicht zusammen, und ihnen gegenüber im Abstand von vielleicht zwanzig Metern ein einzelner Junge, der laut in die Richtung der Menge schrie: »Wer hat Angst vorm Schwarzen Mann?« Einen kurzen Augenblick dachte ich, ich sei gemeint, aber die Spielenden beachteten mich gar nicht. »Niemand«, schallte es von gegenüber dem Jungen entgegen. »Und wenn er aber kommt?«, rief dieser zurück. »Dann laufen wir davon«, antwortete die Schar der Kinder im Chor – und lief dem Jungen entgegen. Dieser setzte sich ebenfalls in Bewegung, und es gelang ihm, ein paar der Entgegenkommenden mit der Hand abzuschlagen. Sodann formierten sich die Spielenden von Neuem in umgekehrter Aufstellung. Und der Junge – in Begleitung derjenigen, die er abgeschlagen hatte – begann von Neuem zu rufen: »Wer hat Angst vorm Schwarzen Mann?« – »Wir nicht.« – »Und wenn er aber kommt?« – »Dann laufen wir davon.« Und wieder rannten die beiden Gruppen aufeinander zu, und wieder versuchte der Junge, diesmal zusammen mit seinen hinzugewonnenen Gehilfen, so viele Spieler wie möglich anzutippen. So ging das Spiel weiter, bis schließlich alle Mitspieler abgefangen waren. Den Kindern bereitete es sichtlich Vergnügen, sie spielten mehrere Runden.
Ich überlegte, ob ich den Lehrer, der das Geschehen ungerührt von der Seite aus mitverfolgte, ansprechen sollte, was es mit diesem Spiel auf sich habe, aber ich traute mich damals nicht und ging weiter. Am nächsten Tag fragte ich an der Universität meine deutschen Kommilitonen danach. Sie alle kannten das Spiel und hatten es selbst in ihrer Kindheit oft gespielt. Niemand, versicherten sie mir, habe bei dem »Schwarzen Mann« an einen Afrikaner oder einen dunkelhäutigen Menschen gedacht: »Das hat man eben einfach so gesagt, ohne groß darüber nachzudenken.« Später erfuhr ich, dass das Spiel bereits Ende des 18. Jahrhunderts beschrieben wurde und der »Schwarze Mann« einst für den »Schwarzen Tod« – die Pest – stand: Jeder, der von der Seuche befallen – im Spiel: abgeschlagen – wird, wird dem wachsenden Heer des »Schwarzen Mannes« einverleibt.
Trotz seiner recht gut belegten Herkunft geriet das Kinderspiel in den letzten Jahren unter Rassismusverdacht. So wollten etwa besorgte Eltern im schweizerischen Wallis es per Beschluss der Schulleitung aus der Schule verbannt sehen. Die Walliser Bildungsdirektion lehnte mit Verweis auf die Herkunft des Spieles ein Verbot ab, schlug aber einen neuen Namen vor: »Wer hat Angst vor dem Wolf?«1 Was sich, soweit ich es überblicken kann, wohl nicht durchsetzen konnte.
»Wer hat Angst vorm Schwarzen Mann?« Diese Frage wurde und wird in Europa neuerdings immer öfter gestellt. Die aktuelle Flüchtlingskrise hat die Ängste und Sorgen in vielen Teilen Europas wie auch in Deutschland vor einem »Flüchtlingsstrom« aus Afrika und einer drohenden »Überfremdung« geweckt. Und auch in Deutschland erhielten Parteien und Organisationen Zulauf, die sich diese Sorge populistisch zunutze machen. Die gegenwärtige Corona-Pandemie mit ihren mittel- und langfristigen Folgen – einer weltweiten Rezession, Zunahme von Hunger und Armut, Kriegen und Flucht – droht die Konflikte weiter zu verschärfen.
Aber auch die Afrodeutschen und Menschen anderer Hautfarbe in diesem Land melden sich verstärkt zu Wort und sprechen über ihre Erfahrungen mit Diskriminierung und Rassismus. Sie sind Teil der Millionen von Deutschen und in Deutschland Lebenden »mit Migrationshintergrund«, die dieses Land in den letzten Jahrzehnten vielfältiger gemacht haben. Im Mai 2020 sorgte der Tod des Afroamerikaners George Floyd, der in Minneapolis bei einer gewaltsamen Festnahme in Polizeigewahrsam zu Tode kam, weltweit für Wut und Empörung. »Black Lives Matter!« schrieben sich die vielen Menschen auf die Fahne, die überall gegen Diskriminierung von Schwarzen auf die Straße gingen, auch in Deutschland. Denn auch hierzulande scheint das Zusammenleben der Menschen mit verschiedener Hautfarbe alles andere als selbstverständlich. Das fängt schon mit der Diskussion darüber an, wie man Menschen mit schwarzer Hautfarbe bezeichnen soll – als »Schwarze«, »Afrodeutsche«, »Farbige« oder lieber mit dem englischen Ausdruck People of Color? Jüngst wurde auch noch der Begriff BIPoC geprägt – abgekürzt für Black, Indigenous and People of Color –, als Sammelbegriff für Schwarze, Indigene und andere nichtweiße Menschen. Ob er als Eigenbezeichnung taugt? Ich jedenfalls kann mir nicht vorstellen, dass ich jemals von mir sagen werde: »Ich bin BIPoC«.
Über Rassismus wird heute mehr denn je leidenschaftlich diskutiert. Wer öffentlich des Rassismus bezichtigt wird, dessen Karriere kann ein schnelles Ende nehmen. Aber gibt es wirklich so etwas wie »systemischen Rassismus«, der unserer Gesellschaft eingeschrieben ist, und wenn ja, wie lässt sich damit umgehen? Ist ein Wort wie »Schwarzfahrer« noch tragbar? Müssen die »Mohrenstraße« in Berlin und die nach ihr benannte U-Bahn-Station umbenannt werden, ebenso wie die zahlreichen Mohren-Apotheken im ganzen Land? Soll König Melchior, der Schwarze unter den Heiligen Drei Königen, aus den Weihnachtskrippen verbannt werden, wie es die Ulmer Münstergemeinde kürzlich beschloss, weil dessen Darstellung mit dicken Lippen und bloßen Füßen rassistisch sei? Sind die Sternsinger mit einem schwarz bemalten heiligen König, die am Dreikönigstag durch die Straßen ziehen, noch tragbar? Und was ist mit dem weißen Schauspieler, der auf der Bühne, schwarz geschminkt, den Othello mimt? Sollen Kinderbücher wie Pippi Langstrumpf umgetextet werden, um aus ihnen etwa das anstößige »N-Wort« zu tilgen?
Und ganz grundsätzlich gefragt: Darf man die Bücher des größten deutschen Philosophen der Aufklärung Immanuel Kant noch lesen, der doch in einigen Schriften die »Neger« und »roten Indianer« für »unfähig zu aller Kultur« befunden hatte? Sollten Goethe und Schiller aus den Lehrplänen gestrichen werden, damit Writers of Color ihren verdienten Platz im Schulunterricht finden; müssen Bach, Beethoven und Brahms von den Konzertprogrammen weichen, damit endlich auch Composers of Color in Deutschlands Konzerthäusern zu hören sind? Auch die Museen hat die Debatte ins Mark getroffen, seitdem immer mehr ins öffentliche Bewusstsein gerät, dass eine Vielzahl ihrer ausgestellten Exponate aus den einstigen Kolonien unter dubiosen Umständen nach Europa geschafft wurden und in ihren Besitz gelangten. Was aber tun mit der »Raubkunst«? Sollen die Ausstellungshallen leergeräumt und deren Schätze an ihre wahren Eigentümer rückerstattet werden? In den Seminaren der Universitäten wird über und mit Begriffen wie Colorism, Reclaiming, Tokenism, White Supremacy,Critical Race Theory und Wokeness diskutiert, während ein erheblicher Teil der Bevölkerung, nicht nur die viel beschworenen »alten weißen Männer«, zunehmend ratlos außen vor steht, weil er die Debatten darum nicht mehr nachvollziehen kann – oder will.
Das vorliegende kleine Buch ist als eine persönliche Wortmeldung zu verstehen. Sein Autor – wenn man es so sagen will, seinerseits ein alter schwarzer Mann – maßt sich nicht an, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Es ist keine Streitschrift, sondern ein Versuch, inmitten und jenseits der mitunter verbissen geführten Debatten wieder miteinander ins Gespräch zu kommen. Ein bisschen historisches Wissen kann dabei nicht schaden – ist doch seit vielen Jahrhunderten schwarze Geschichte ein Teil deutscher Geschichte. In Zeiten wie diesen, in denen die allgemeine Erregungsbereitschaft hoch ist, bedarf es vor allem eines guten Willens von allen Seiten, einander zuzuhören und aufeinander zuzugehen.
Asfa-Wossen Asserate, Frankfurt am Main, im Juni 2021
Kapitel 1 »Schwarz und schön«
Von schwarzen Heiligen, Königinnen und Madonnen
Verschiedene menschliche »Rassen« gibt es nicht, darüber herrscht heute unter Wissenschaftlern und aufgeklärten Menschen Einmütigkeit. Wir wissen heute: Menschen jeglicher Hautfarbe und Herkunft sind im Erbgut zu mehr als 99,99 Prozent identisch. Dass Menschen unterschiedlich aussehen, ist eine Folge von Migration und der Anpassungsfähigkeit des Homo sapiens an eine neue Umwelt – und kein Ausdruck von genetischer Andersartigkeit. Menschliche »Rassen« gibt es nicht, sehr wohl aber das, was wir gemeinhin Rassismus nennen: die Diskriminierung und Abwertung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe oder ihrer ethnischen Zugehörigkeit. Hartnäckig hält sich das Vorurteil, man könne seinem Gegenüber gute oder schlechte Eigenschaften quasi an der Nasenspitze ansehen. Aber woher kommt diese Vorstellung? Wie kommt es, dass sich Weiße gegenüber Menschen mit anderer Hautfarbe überlegen fühlen? Seit wann überhaupt gibt es diese Einteilung in Schwarze, Weiße, Gelbe und Rote?
Die Entwicklung des Menschen ist über sieben Millionen Jahre alt. Wissenschaftler sind sich heute darüber einig, dass die Wiege des Menschen auf dem afrikanischen Kontinent stand. Von dort aus wanderten die Menschen vor rund 40.000 Jahren in die ganze Welt aus und gelangten auch nach Europa. »Alle Menschen auf der Erde sind aus genetischer Sicht Teil der afrikanischen Vielfalt«, erklärt Johannes Krause, Direktor am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig.2 Die Europäer sind genetisch sogar näher verwandt mit den Ostafrikanern als die Ostafrikaner mit den Westafrikanern. Und bis vor rund 7000 Jahren war die Hautfarbe der Menschen auf dem europäischen Kontinent so dunkel wie heute bei Menschen südlich der Sahara – sie waren schwarz. Dunkle Haut schützt vor starker Sonneneinstrahlung, bildet aber bei weniger Sonnenlicht nicht genug Vitamin D, das für den Menschen lebenswichtig ist. Als die Menschen begannen, Ackerbau zu betreiben, und sesshaft wurden, wurde ihre Haut mit der Zeit heller. Die helle Haut ist eine Anpassung an die Umwelt, die dem Menschen dabei hilft, Vitamin D zu produzieren.3
Bis zum Ende des ersten Jahrtausends nach Christus waren schwarze Afrikaner in Mitteleuropa nahezu unbekannt. Vereinzelt mochten im dritten Jahrhundert schwarze römische Söldner ihren Weg in die römischen Provinzen gefunden haben, Zeugnisse darüber sind kaum überliefert. Gleichwohl waren mythische Bilder von schwarzen Menschen im Umlauf, genährt von der Lektüre der Bibel und anderer antiker Schriften.
»Schwarz bin ich, aber schön«, heißt es im Hohelied des Alten Testaments, dem Liebeslied von König Salomo und seiner Geliebten Sulamith. So wird das Bekenntnis Sulamiths jedenfalls für gewöhnlich aus dem Hebräischen wiedergegeben. Der Satz kann aber genauso gut so übersetzt werden: »Schwarz bin ich und schön.« So heißt es jedenfalls in der Septuaginta, der ersten Übersetzung des Alten Testaments ins Altgriechische.4
»Schwarz und schön«: Die Bilder von Schwarzen in der Antike und im Mittelalter waren in vielen Fällen positiv besetzt. In der Ilias Homers werden die »unsträflichen Äthiopen« gepriesen, mit denen Göttervater Zeus und die anderen Himmlischen gespeist hatten.5 Für Herodot waren die Äthiopier die »größten und schönsten Menschen«, »aufrichtig« und »redlich«, und die meisten von ihnen würden »hundertzwanzig Jahre alt, einige auch noch älter«.6
Das alttestamentarische Buch der Könige berichtet von der Königin von Saba, die vom legendären König Salomo hörte und »mit Kamelen, die Balsamöle und Gold trugen in sehr großer Menge und Edelsteine« an dessen Hof in Jerusalem kam, um dem jüdischen Herrscher zu huldigen. Der König Salomo gab der Königin von Saba daraufhin »alles, was sie sich wünschte«. In der äthiopischen Überlieferung des Kebra Negest schenkte die Königin von Saba dem König Salomo einen Sohn, Menelik, der zum Stammvater des äthiopischen Königtums wurde. Die Kirchenschreiber Origenes und Isidorus beschreiben die Königin von Saba als »anmutige Heidin«, die sich aus eigenem Entschluss zum Christentum bekennt.7 In dem prächtigen Altar für das Stift Klosterneuburg, den Nikolaus von Verdun in den Jahren 1171 bis 1181 schuf, ist die Königin von Saba erstmals als Schwarze dargestellt. Und heute wird unter Forschern diskutiert, ob sich hinter der im Hohelied besungenen Geliebten Sulamith des Königs Salomo nicht die Königin von Saba verbergen könnte.
Von einer schwarzen Königin erzählt auch der Parzifal von Wolfram von Eschenbach, der um das Jahr 1200 entstand.8 Gleich zu Beginn des Epos verschlägt es den Königssohn und Ritter Gahmuret auf der Suche nach ritterlichen Abenteuern in das Königreich Zazamanc. »Finster wie die Nacht (»vinster sô diu naht«) waren die Bewohner dort und »rabenschwarz« (»nâch rabens varwe«). Eine »schwarze Mohrin« war auch ihre Königin Belakane, und obwohl sie eine »Heidin« war, war ihre Unschuld wie »reines Taufwasser« (»ir kiusche was ein reiner touf«). Es kam, wie es kommen musste: Gahmuret und die Königin verlieben sich ineinander; entwaffnet wird der Ritter »mit schwarzer Hand« (»entwâpent mit swarzer hant«) von der Königin höchstselbst in ihrer Kammer: Da lag Belakane »in süßer Minne« bei Gahmuret, »und doch war die Haut der zwei verschieden« (»ungelîch was doch ir zweier hût«).
Neun Monate später – der Ritter Gahmuret war da längst zu neuen Aventuren weitergezogen – brachte die schwarze Königin ihren gemeinsamen Sohn zur Welt: Feirefiz. An ihm, schreibt Wolfram, »wollte Gott ein Wunder wirken«: Er war von zweierlei Farbe, »weiß schien seine Haut und schwarz« (»wîz und swarzer varwe er schien«). Gott selbst also hat hier seine Hand im Spiel. Der »Mulatte« Feirefiz ist der Bruder Parzifals und wird von diesem am Ende des Epos eigenhändig getauft. Nicht nur die Verbundenheit von schwarzen und weißen Menschen ist in ihm verkörpert; Feirefiz wird zum Idealbild eines neuen edlen Rittertums, das die Tugend der Tapferkeit und Eleganz mit dem rechten Glauben vereint. Der getaufte Feirefiz nimmt die Hüterin des heiligen Grals zur Frau und zieht mit ihr nach Osten. Ihr gemeinsamer Sohn ist »priester Johan« – der legendäre Priesterkönig Johannes, Beherrscher des äthiopischen Christenreichs.
Im 11. Jahrhundert nach Christus hatte sich in Europa die Legende vom Priesterkönig verbreitet, der in Afrika über ein großes und mächtiges christliches Reich herrsche. Um das Jahr 1160 soll der Priesterkönig dem König von Byzanz einen Brief geschrieben haben: Zweiundsiebzig Könige seien ihm tributpflichtig, erklärte der »König der Könige an den Grenzen der Welt«, dessen Herrschaftsgebiet sich über die »drei Indien« erstrecke – Äthiopien, Mesopotamien und Vorderindien nach damaligem Verständnis. Sein Palast sei von einmaliger Pracht: die Wände und Fußböden aus Onyx, die Esstische aus Gold und Amethyst. In einer Ecke des Thronsaals entspringe eine Quelle, wer aus ihr regelmäßig trinke, werde dreihundert Jahre alt und sich dabei immer im besten Jugendalter befinden. Nahe dem Palast befinde sich ein riesiger Spiegel, in dem der Herrscher über »Christiani Nigri« die Geschehnisse in allen Provinzen seines Reiches verfolgen und so jegliche Verschwörung gegen den Thron schon im Keime ersticken könne. Er befehlige ein mächtiges christliches Heer, und viermal im Jahr empfange er die schönsten Frauen des Reiches, um mit ihnen stattliche Nachkommen zu zeugen. Auf europäischen Weltkarten wie der Genueser Weltkarte von 1457 wird der Priesterkönig Johannes mit schwarzer Hautfarbe dargestellt.
Zu den tugendhaften schwarzen Herrscherinnen und Herrschern in Afrika wie der Königin von Saba, der Königin Belakane und dem Priesterkönig Johannes gesellten sich im Hochmittelalter bald auch christliche Märtyrer und Heilige, die mit schwarzer Haut dargestellt wurden. Bereits im frühen Mittelalter kam in Europa die Legende auf, die biblischen Heiligen Drei Könige stünden für die drei Kontinente Europa, Asien und Afrika. In den Evangelien des Neuen Testaments ist nur von Sterndeutern oder »Magiern« die Rede, die der Stern von Bethlehem zum neugeborenen »König der Juden« führt, dem sie mit ihren dargebrachten Geschenken Gold, Weihrauch und Myrrhe huldigten. Bald aber wurden sie als Könige gedeutet, und ihnen wurden Namen zugeteilt: Caspar, Melchior und Balthasar. Als »Mohrenkönig« wurden wechselweise alle drei genannt, im späten Mittelalter wurde es üblich, einen von ihnen mit schwarzer Hautfarbe darzustellen. Zur selben Zeit wurden auch die Dreikönigsspiele populär, die sich bis heute in Deutschland und anderen Ländern im Brauch der Sternsinger am 6. Januar, dem Dreikönigstag, erhalten haben – auch wenn heute darüber eifrig diskutiert wird, ob es denn noch stattbar sei, dass sich der Darsteller des Weisen aus Afrika dazu das Gesicht schwarz färbe.