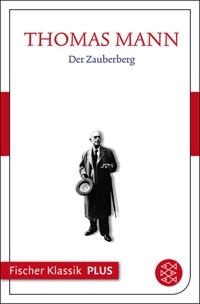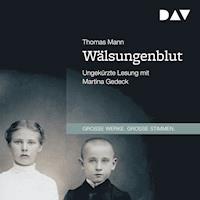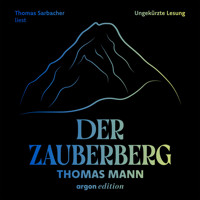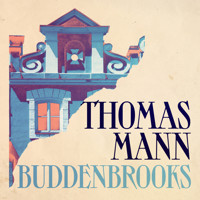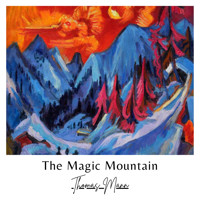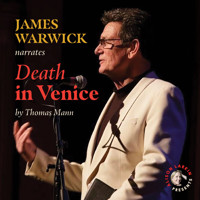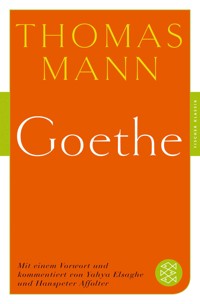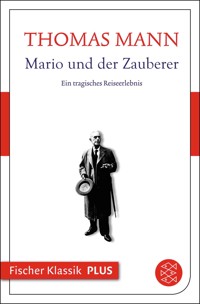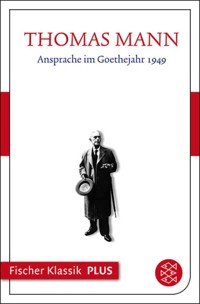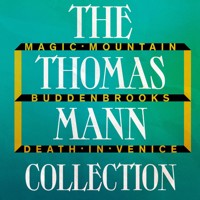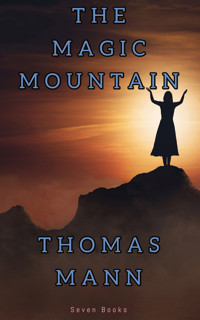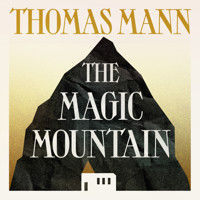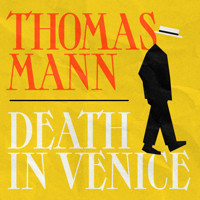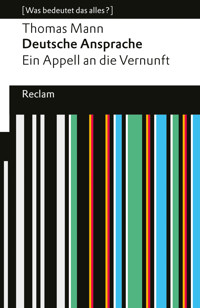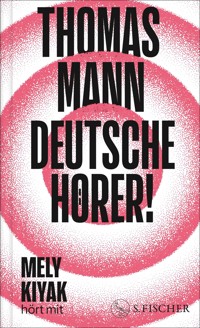
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Thomas Manns wichtigstes politisches Vermächtnis. Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten verließ Thomas Mann Deutschland und kehrte nie wieder zurück. Im Schweizer Exil verlor der deutsche Literaturnobelpreisträger 1936 seine Staatsbürgerschaft. Er emigrierte weiter nach Amerika, von wo aus er ab 1940 seine Anti-Kriegsreden sendete. In 58 verzweifelten, glühenden humanistischen Appellen redete er den deutschen Hörern bis November 1945 ins Gewissen. Seine Radioansprachen, auf abenteuerlichen Wegen von der BBC nach Europa übertragen, sind einzigartige Dokumente eines aufrechten Deutschen. »Ich kann mir nicht helfen: es tut doch wohl, Hitler so recht ins Gesicht hinein einen blödsinnigen Wüterich zu nennen.« Thomas Mann
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Thomas Mann
Deutsche Hörer!
Radiosendungen nach Deutschland Mit einem Nachwort von Mely Kiyak
Über dieses Buch
»Euer Gehorsam ist grenzenlos, und er wird, dass ich es euch nur sage, von Tag zu Tag unverzeihlicher.«
Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten verließ Thomas Mann Deutschland und kehrte nie wieder zurück. Im Schweizer Exil verlor der deutsche Literaturnobelpreisträger 1936 seine Staatsbürgerschaft. Er emigrierte weiter nach Amerika, von wo aus er ab 1940 seine Antikriegsreden sendete. In verzweifelten, glühenden humanistischen Appellen redete er den deutschen Hörern bis November 1945 ins Gewissen. Seine Radioansprachen, auf abenteuerlichen Wegen von der BBC nach Europa übertragen, sind einzigartige Dokumente eines aufrechten Deutschen. Mely Kiyak hört genau hin und weist darauf hin, wie bemerkenswert die Reden damals waren und wie viel sie uns auch heute noch zu sagen haben.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Thomas Mann (1875–1955) zählt zu den bedeutendsten Schriftstellern des 20. Jahrhunderts. Mit ihm erreichte der moderne deutsche Roman den Anschluss an die Weltliteratur. Manns vielschichtiges Werk mit Romanen wie »Buddenbrooks«, »Der Zauberberg« und »Doktor Faustus«, Erzählungen wie »Tod in Venedig« und zahlreichen politischen Essays hat eine weltweit kaum zu übertreffende positive Resonanz gefunden. Ab 1933 lebte er im Exil, zuerst in der Schweiz, dann in den USA. Erst 1952 kehrte Mann nach Europa zurück, wo er 1955 in Zürich verstarb.
Mely Kiyak, Schriftstellerin (u. a. »Frausein«, »Herr Kiyak dachte, jetzt fängt der schöne Teil des Lebens an«), war für fast zwei Jahrzehnte eine der meist beachteten Kolumnistinnen Deutschlands (u. a. »Kiyaks Deutschstunde« für ZEIT Online). Ihren letzten politischen Zeitungskommentar beendete sie mit den Worten »Es ist alles gesagt.« Kiyak wurde vielfach ausgezeichnet, u. a. Theodor-Wolff-Preis, Kurt-Tucholsky-Preis. Mit ihren kuratierten Kunstsalons ist sie derzeit am Deutschen Schauspielhaus Hamburg und am Berliner Maxim Gorki Theater zu sehen.
Inhalt
Deutsche Hörer!
Das Licht der Freiheit
Vorwort zur ersten Ausgabe
Deutsche Hörer! (Oktober 1940)
Deutsche Hörer! (November 1940)
Deutsche Hörer! (Dezember 1940)
Deutsche Hörer! (Februar 1941)
Deutsche Hörer! (März 1941)
Deutsche Hörer! (April 1941)
Deutsche Hörer! (Mai 1941)
Deutsche Hörer! (Juni 1941)
Deutsche Hörer! (Juli 1941)
Deutsche Hörer! (August 1941)
Deutsche Hörer! (August 1941, Sondersendung)
Deutsche Hörer! (September 1941)
Deutsche Hörer! (Oktober 1941)
Deutsche Hörer! (November 1941)
Deutsche Hörer! (24. Dezember 1941, Sondersendung)
Deutsche Hörer! (November 1941)
Deutsche Hörer! (Januar 1942)
Deutsche Hörer! (Februar 1942)
Deutsche Hörer! (März 1942)
Deutsche Hörer! (April 1942, Sondersendung)
Deutsche Hörer! (April 1942)
Deutsche Hörer! (Mai 1942)
Deutsche Hörer! (Juni 1942)
Deutsche Hörer! (Juli 1942)
Deutsche Hörer! (August 1942)
Deutsche Hörer! (27. September 1942)
Deutsche Hörer! (15. Oktober 1942, Ansprache an die Amerikaner deutscher Herkunft)
Deutsche Hörer! (24. Oktober 1942)
Deutsche Hörer! (29. November 1942)
Deutsche Hörer! (27. Dezember 1942)
Deutsche Hörer! (15. Januar 1943)
Deutsche Hörer! (24. Januar 1943)
Deutsche Hörer! (23. Februar 1943)
Deutsche Hörer! (28. März 1943)
Deutsche Hörer! (25. April 1943)
Deutsche Hörer! (25. Mai 1943)
Deutsche Hörer! (27. Juni 1943)
Deutsche Hörer! (27. Juli 1943)
Deutsche Hörer! (29. August 1943)
Deutsche Hörer! (29. September 1943)
Deutsche Hörer! (30. Oktober 1943)
Deutsche Hörer! (9. Dezember 1943)
Deutsche Hörer! (31. Dezember 1943)
Deutsche Hörer! (30. Januar 1944)
Deutsche Hörer! (28. Februar 1944)
Deutsche Hörer! (28. März 1944)
Deutsche Hörer! (1. Mai 1944)
Deutsche Hörer! (29. Mai 1944)
Deutsche Hörer! (1. Januar 1945)
Deutsche Hörer! (14. Januar 1945)
Deutsche Hörer! (16. Januar 1945)
Deutsche Hörer! (31. Januar 1945)
Deutsche Hörer! (16. Februar 1945)
Deutsche Hörer! (4. März 1945)
Deutsche Hörer! (20. März 1945)
Deutsche Hörer! (5. April 1945)
Deutsche Hörer! (19. April 1945)
Deutsche Hörer! (10. Mai 1945)
Deutsche Hörer! (8. November 1945)
Was bleibt?
Editorische Nachweise
Textgrundlage
Deutsche Hörer! 1942
Deutsche Hörer! 1945
Nachweise der einzelnen Reden
Vorwort zur ersten Ausgabe (15. September 1942)
Deutsche Hörer! (Oktober 1940)
Deutsche Hörer! (November 1940)
Deutsche Hörer! (Dezember 1940)
Deutsche Hörer! (Februar 1941)
Deutsche Hörer! (März 1941)
Deutsche Hörer! (April 1941)
Deutsche Hörer! (Mai 1941)
Deutsche Hörer! (Juni 1941)
Deutsche Hörer! (Juli 1941)
Deutsche Hörer! (August 1941)
Deutsche Hörer! (August 1941 – Sondersendung)
Deutsche Hörer! (September 1941)
Deutsche Hörer! (Oktober 1941)
Deutsche Hörer! (November 1941)
Deutsche Hörer! (24. Dezember 1941 – Sondersendung)
Deutsche Hörer! (Dezember 1941)
Deutsche Hörer! (Januar 1942)
Deutsche Hörer! (Februar 1942)
Deutsche Hörer! (März 1942)
Deutsche Hörer! (April 1942 – Sondersendung)
Deutsche Hörer! (April 1942)
Deutsche Hörer! (Mai 1942)
Deutsche Hörer! (Juni 1942)
Deutsche Hörer! (Juli 1942)
Deutsche Hörer! (August 1942)
Deutsche Hörer! (27. September 1942)
Deutsch-Amerikaner! (15. Oktober 1942 – Ansprache an die Amerikaner deutscher Herkunft)
Deutsche Hörer! (24. Oktober 1942)
Deutsche Hörer! (29. November 1942)
Deutsche Hörer! (27. Dezember 1942)
Deutsche Hörer! (15. Januar 1943)
Deutsche Hörer! (24. Januar 1943)
Deutsche Hörer! (23. Februar 1943)
Deutsche Hörer! (28. März 1943)
Deutsche Hörer! (25. April 1943)
Deutsche Hörer! (25. Mai 1943)
Deutsche Hörer! (27. Juni 1943)
Deutsche Hörer! (27. Juli 1943)
Deutsche Hörer! (29. August 1943)
Deutsche Hörer! (29. September 1943)
Deutsche Hörer! (30. Oktober 1943)
Deutsche Hörer! (9. Dezember 1943)
Deutsche Hörer! (31. Dezember 1943)
Deutsche Hörer! (30. Januar 1944)
Deutsche Hörer! (28. Februar 1944)
Deutsche Hörer! (28. März 1944)
Deutsche Hörer! (1. Mai 1944)
Deutsche Hörer! (29. Mai 1944)
Deutsche Hörer! (1. Januar 1945)
Deutsche Hörer! (14. Januar 1945)
Deutsche Hörer! (16. Januar 1945)
Deutsche Hörer! (31. Januar 1945)
Deutsche Hörer! (16. Februar 1945)
Deutsche Hörer! (4. März 1945)
Deutsche Hörer! (20. März 1945)
Deutsche Hörer! (5. April 1945)
Deutsche Hörer! (19. April 1945)
Deutsche Hörer! (10. Mai 1945)
Deutsche Hörer! (8. November 1945)
Vorwort von Mely Kiyak
Das Licht der Freiheit
Sehr geehrtes Publikum,
Deutsche Leserinnen und Leser!,
die meisten Leute werden mit zunehmendem Alter konservativer, träge im Denken, und rücken mit ihren Weltansichten in trübe Randgebiete vor. Da wo Grundrechte oder Respekt vor dem Anderen keine nennenswerte Rolle mehr spielen. Thomas Mann nicht. Er verweigerte sich der kolossalen Menschheitsschande namens Nationalsozialismus und wurde im Alter ein glühender Demokrat.
Der Schriftsteller und Nobelpreisträger für Literatur entwickelte sich, wie Sie auf den folgenden Seiten in seinen Rundfunkansprachen an das deutsche Volk nachlesen können, mit über 60 Jahren zu einem vitalen Widerstandkämpfer. Er wütete gegen Hitler, Göring, Himmler, gegen das ganze Regime und deren »schäbige Grausamkeit«, »Rachsucht«, ihr »unaufhörliches Hassgebrüll«, ihren »minderwertigen Fanatismus«, »ihre feige Askese«, »ihre armselige Unnatur«, ja, gegen nichts Geringeres als »ihre ganze defekte Menschlichkeit«. Wow!
Thomas Mann sprach nicht erst Jahrzehnte nach dem Dritten Reich so klar urteilend, als bereits das Ausmaß der Morde an Juden, Roma, Sinti, Linken, Oppositionellen, Homosexuellen, physisch und geistig Beeinträchtigten bekannt geworden war. Es handelte sich nicht um die Worte eines Zurückblickenden, der zu seinen Einsichten durch eine lange Periode von staatlich verordneter Aufarbeitung in kollektiver Gemeinschaftstherapie gelangte. Seine Beschreibungen und Beschimpfungen rief er 1941, mitten im Krieg und aus dem Exil heraus, den Deutschen zu. Als Thomas Mann seinen Zorn aus Amerika sendete, wusste er nicht, wie seine Zukunft und die seiner Familie aussehen würde. Er wusste nicht, ob er jemals in sein Münchener Haus in der Poschingerstraße 1 zurückkehren würde, wie lange das Regime oder der Krieg überdauern würden. Liest man die Reden, begreift man, dass es ihm absolut schnuppe war. Monat für Monat, Kriegsjahr für Kriegsjahr sagte er, was gesagt werden musste. Die oberste Naziriege hörte ganz genau hin, was Mann schrieb und sprach. Einmal reagierte Adolf Hitler sogar direkt auf die Mann’schen Ansprachen, indem er ihn bei einer Münchener Bierkellerrede brüllend und mit Schaum vorm Mund der Aufwiegelei bezichtigte. Mann reagierte darauf in gewohnter Art in seiner nächsten Rundfunkrede: »Aus diesem Munde ist so viel Unrat gekommen, dass es mir leichte Ekelgefühle erregt, meinen Namen daraus zu vernehmen.« Dabei hatte Adolf Hitler mit seinem Urteil recht, Thomas Mann versuchte die Deutschen in der Tat aufzuwiegeln, aufzuwecken, aus der Lethargie zu donnern.
Thomas Mann war 63 Jahre alt, als er die eben zitierten Worte von der defekten Menschlichkeit verwendete. Sie stammen erst aus der dritten von insgesamt 59 Rundfunkansprachen, die er noch halten würde. Man begreift, dass der Schriftsteller die Nase von den Nazis schon von Anfang an voll hatte. Er wusste immer, dass sie Verbrecher sind, bei diesem Urteil blieb er. Er verschwendete seine Zeit nicht für hochtrabende Synonyme und parfümierte Formulierungen. Jede Radiokolumne ist kraftvoll, intensiv, es ist, als würde er eimerweise eiskaltes Wasser über den Köpfen der Täter und Mitläufer auskippen.
Als Mann seine Radiokolumnen sprach, lebte er bereits seit acht Jahren im Exil. Erst in Frankreich, dann in der Schweiz und schließlich in Amerika. Er floh nicht freiwillig, oder sagen wir, nicht selbstbestimmt und vorsätzlich. Vielmehr war es so, dass er sich von einer Vortragsreise in der Schweiz 1933 nicht mehr nach Hause traute. Seine beiden ältesten Kinder Erika und Klaus beschworen ihn zu bleiben, wo er ist. Er ging, wenn man so will, als freier Mann zur Arbeit ins Ausland und wurde dort zum Flüchtling.
Er gehörte zu den ersten deutschen Schriftstellern, die von den Nationalsozialisten belästigt, bedroht und gejagt wurden. Allerdings glaube ich, dass er das Ausmaß da noch nicht wirklich begriff. Vielleicht wähnte er sich deshalb in Sicherheit, weil er der deutscheste, treueste und patriotischste unter allen Deutschen war. Ein stolzer Staatsbürger, überdies schon ein Weltstar, verehrt und gefeiert überall. Vergräbt man sich in Thomas Manns Biographie und sein sagenhaft umfangreiches Werk samt Briefen, Reden, Tagebucheinträgen, gelangt man zu der Einsicht, dass er merkwürdigerweise politisch fürchterlich naiv war, obwohl er keine Sekunde daran zweifelte, dass der radikale Nationalsozialismus und die fanatische Stimmung in Deutschland die größte anzunehmende Gefahr für sein Land waren.
Trotzdem traf er keinerlei Vorkehrungen für eine Emigration. Als Mann 1929 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde, steckte ihm ein Journalist den guten Rat, sein Preisgeld unbedingt im Ausland zu lassen. Mann verstand überhaupt nicht, warum und weshalb. Dabei hielt er nur ein Jahr später im Berliner Beethoven-Saal eine bedeutsame Rede (die noch im gleichen Jahr unter dem Titel Deutsche Ansprache – Appell an die Vernunft publiziert wurde), in der er auf das katastrophale Ergebnis der Reichstagswahlen im September 1930 reagierte. Die NSDAP hatte ihre Stimmen versiebenfacht und wurde zweitstärkste Kraft im Parlament. Er lieferte in seiner Rede Erklärungen für dieses Abstimmungsverhalten, aber er relativierte den Populismus nicht, ließ keinen der genannten Gründe als Argument gelten. Er sah die Kunst und Freiheit bedroht, übersetzte die abgegebenen Stimmen als »Abkehr vom Vernunftglauben«, sah darin eine neue Seelenlage gegen »bürgerliche Prinzipien wie Freiheit, Gerechtigkeit, Bildung, Optimismus, Fortschrittsglaube«. Er bezeichnete die Sprache der Nazis »ihre Abgeschmacktheit mit Vokabeln wie rassisch, völkisch, bündnisch, heldisch« als »verschwärmte Bildungsbarbarei, gefährlich, weltentfremdet, die Gehirne noch ärger verschwemmend und verklebend«.
Thomas Mann, der sich selbst als Schriftsteller und Künstler sehr ernst nahm, verteidigte sich bei dieser Veranstaltung als politischer Redner gegen die exzentrische Barbarei, gleichwohl er den »sozialen Aktivismus« ablehnte und keine Lust hatte, Oberlehrer (»praeceptor patriae«) zu sein. Und doch dachte er nicht im Traum daran, »unter diesen heutigen Umständen« einfach ein Romankapitel zu lesen und dann »wieder nach Hause zu fahren«.
Jedenfalls ja. Er verstand die politische und gesellschaftliche Bedrohung durch die Nazis, den Dammbruch, und war doch völlig unvorbereitet auf ein Leben außerhalb von Deutschland.
Ich denke oft darüber nach, wann ich in so einer Situation anfangen würde, konkrete Vorbereitungen zu treffen. Wie oft erlebte ich in meinem Leben Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die bedroht von Verfolgung und Haft ins Exil flohen. Wie oft erzählten sie mir, dass sie immer gewusst hatten, dass es sie aus politischen Gründen ganz bald treffen würde. Dennoch war der Moment ihrer Flucht geprägt durch jahrelange geistige Präparation, aber in praktischer Hinsicht war der Tag, an dem es geschah, fast immer ein Akt abenteuerlicher Improvisation. Kaum ein Exilant schaffte vorher Dokumente oder Geld aus seinem oder ihrem Heimatland heraus. Möglicherweise wiegen die Hoffnung und der Wunsch, ungeschoren davonzukommen und das bürgerliche Leben mit dem gewohnten Komfort weiterzuleben, stärker als alle Kenntnis und Vorahnungen. Nahezu alle Geflohenen, die ich kenne, verließen ihr Land erst, als es wirklich nicht mehr anders ging.
Auch bei Thomas Mann finden sich Überlegungen zu einer möglichen Flucht. Am 15. März 1933 notierte er fast hoffnungsfroh in sein Tagebuch, dass er eine dauerhafte Emigration vielleicht sogar gutheißen und als Chance begreifen könnte. Endlich bekäme er Gelegenheit, sein bisheriges soziales Leben mit all den lästigen Verpflichtungen abzustreifen, um fortan kontemplativ seine Arbeit auszuführen, oder wie er es beschreibt, »in voller Sammlung mit mir selbst zu leben«. Dann wieder hatte er Angst vor der Zukunft und schrieb in einem Brief an Ida Herz: »Ich bin halb krank, kann nicht essen und nicht recht schlafen, und der Gedanke eines vollständigen Umsturzes meiner Existenz, die Vorstellung, ins Exil gehen zu müssen, (…) hält mich in ununterbrochener Erregung und Erschütterung.« Ida Herz war übrigens eine befreundete Bibliothekarin, die den Manns in den 1920er Jahren half, die Bibliothek des Hauses zu ordnen. Auch später hielt sie bedingungslos zu ihm. Als das Ehepaar nicht mehr ins Haus zurückkonnte, bot sie sofort an: »Ich bin ein Niemand, ein Name aus der Masse, ich kann leichter als ein anderer Ihrer Freunde etwas für Sie unternehmen« – sie hielt ihr Versprechen. In geheimer Zusammenarbeit mit der Haushälterin der Manns, schnürte sie eilig fünf dicke Pakete mit Unterlagen, die Thomas Mann für die Fortführung seiner Arbeit an den Josephsromanen im Exil benötigte. Frau Herz transferierte alles an den Basler Rechtsanwalt Bernoulli, der ebenfalls ein Komplize war. Derweil bediente sich die SA an dem Eigentum der Manns. Sie beschlagnahmten das Auto gegen Golos aktiven Protest, der sich in dieser Angelegenheit derart mit den Nazis anlegte, dass er sich anschließend nicht mehr aufs elterliche Grundstück traute. Nur noch einmal zur Erinnerung: Das alles geschah nur wenige Wochen nach der Machtübernahme der NSDAP, das muss im Februar 1933 gewesen sein.
Die NSDAP trat nicht an, um radikal zu werden, sie war es schon und wurde deshalb gewählt. Folgerichtig bemerkte Thomas Mann in seiner Januaransprache 1942 an die deutschen Hörer, »dass am Anfang dieses Krieges, der nicht 1939, sondern 1933 begann, die Abschaffung der Menschenrechte stand«. Das sind gleich zwei ungemein scharfsinnige Betrachtungen. Erstens, die Barbarei beginnt immer mit der Abschaffung der Menschenrechte, manchmal nennt er es auch »Entmenschung«, ein Begriff, den er noch häufiger verwenden wird. Und zweitens, der Krieg begann schon 1933, als die Deutschen mit überwältigender Zustimmung – nicht mehrheitlich! – die NSDAP an die Macht wählten, die Weimarer Republik damit zum Einsturz brachten und den Weg für den »Raub-, Mord- und Lügenstaat« freimachten. Deutschland sei der »Amokläufer unter den Völkern«. So geht es Rundfunkrede für Rundfunkrede, er zürnt, er wütet, er schäumt und kämpft gegen die Demagogie und Propaganda der Nazis. Er appelliert, er bittet, er bettelt und fleht das deutsche Volk an, sich zu befreien, sich dem Krieg zu widersetzen, nicht mitzumachen. Einmal im Monat schickt er seine Ansprachen, die er später auch selber spricht, an seine Landsmänner und Landsfrauen, die immer gleich beginnen, »Deutsche Hörer!«. Von Amerika aus werden sie an die BBC nach London gekabelt und von dort gesendet, in der Hoffnung, dass möglichst viele Deutsche den Sender in ihrem Wohnzimmer einschalten und zuhören. Mann erzählt, was er über den Krieg in den amerikanischen Medien und aus Briefen erfährt, und versucht die Deutschen unaufhörlich zu motivieren, sich dem Widerstand anzuschließen.
Ich will von den Reden nicht zu viel vorwegnehmen, dazu werde ich später im Nachwort noch einiges sagen. Aber ich möchte etwas Grundsätzliches zu Thomas Mann anmerken, der über die Jahrzehnte durch zahlreiche Rezeptionen, Essays, Porträts, Literaturbetrachtungen und germanistische Sekundärbegleitung, nicht zuletzt auch durch Spielfilme, Biopics, die Erinnerungen seiner Kinder und Kindeskinder und natürlich durch seine Tagebücher (vor allem durch seine Tagebücher!) zu einer neurotischen Witzfigur karikiert und degradiert wurde. Als verklemmter Homosexueller wurde er verspottet, als hypochondrisch, wehleidig, verwöhnt, hartherzig zu seinen Kindern, bourgeois und so weiter und so fort. Man lachte sich über ihn in Deutschland kaputt, über das Foto, auf dem er mit Strumpfhaltern am Ostseestrand zur Sommerfrische im Sand saß, man lachte sich auch in New York über ihn kaputt und beschrieb ihn als verzierten Spazierstock. Er legte Wert auf seine Garderobe, seine Contenance, Prinzipien und Normen, aber das ist mir persönlich lieber als blonde, zackige Seitenscheitel in modernen SS-Uniformen. Ja, es rührt mich, wenn ich die Fotos dieses steifen älteren Herrn sehe, der in seinen Routinen und Gepflogenheiten gefangen ist – und der doch, wenn es drauf ankam, dazu fähig war, mit penibel gestutztem Schnurrbärtchen und gespreiztem Finger an der mit Goldrand umfassten Teetasse, die Nazis gehörig in den Boden zu rammen.
Dieser Schmähschund, diese Verächtlichungsprosa war besonders schlimm nach dem Krieg. Die in Deutschland gebliebenen Schriftsteller nahmen ihm sein Exil übel, ignorierend, dass man ihm bereits 1936 die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannte, als er sich im gleichen Jahr gegenüber der Preußischen Akademie der Künste einer Treueerklärung für die NSDAP verweigerte. Daraufhin beschuldigte ihn der SS-Obergruppenführer und Polizeigeneral Reinhard Heydrich persönlich als »undeutsch« und »judenfreundlich«, was einem Todesurteil glich. Heydrich verhängte Schutzhaft gegen den Schriftsteller (die dieser wegen seiner Abwesenheit glücklicherweise nicht mehr antreten musste). Die in Deutschland zurückgebliebenen Autoren, wie beispielsweise Frank Thiess, die sich ihrer »Inneren Emigration« rühmten und mehr noch – es ist so ekelhaft, man mag es kaum wiederholen –, verlautbarten dass »das Miterleben von Brand, Hunger und Bomben« sie an »Wissen und Erleben reicher gemacht« habe, als wenn sie »aus den Logen und Parterreplätzen des Auslands« zugeschaut hätten. Mit den Logenplätzen war Thomas Mann gemeint, und dies war sicher keine Einzelmeinung. Er hätte in den Augen seiner gewissenlosen Kritiker wohl bleiben, resignieren oder schweigen sollen, statt zu gehen und laut zu werden. Thomas Mann weigerte sich, sich für sein Exil zu entschuldigen (»Die innere Emigration kann mir gestohlen bleiben«). Im Gegenteil, stolz und selbstbewusst verkündete er 1938 den amerikanischen Journalisten, die ihn in Übersee erwarteten where I am, there is Germany, »Wo ich bin, ist Deutschland«. Mit dieser eher lapidaren Bemerkung machte er das ganze dumpfe, stumpfsinnige Deutschtum der freiwillig Daheimgeblieben, die wie Thiess die Machtergreifung einst als »erlösende Tat« gefeiert hatten, um mehrere Köpfe kürzer. Er blieb dabei, noch in seiner letzten Rundfunkansprache bittet er: »Man gönne mir mein Weltdeutschtum« und: »Mir hat die Fremde wohlgetan. Mein deutsches Erbe habe ich mitgenommen.« Dann nahm er die amerikanische Staatsbürgerschaft an und kam nur deshalb nach Kriegsende noch mal nach Deutschland, weil man ihm den Goethepreis verlieh, begleitet von einer hitzigen feuilletonistischen Debatte, heute würde man wohl »shit storm« sagen, kampagnenartig angefeuert von den Zeitungen.
Seit ich mich mit Thomas Mann und seinem Widerstand intensiv auseinandersetze, lande ich immer wieder bei diesem Gedanken: Für jemanden, der aus ethnischen, religiösen oder sozialen Gründen ausgegrenzt und verfolgt wird, ist der Kampf für Solidarität und der Widerstand gegen ein faschistisches Regime notwendig und irgendwie auch selbstverständlich, dient er doch vor allem zur Selbstverteidigung. Aber für jemanden wie Thomas Mann (»männlich, weiß, privilegiert« wären wohl die heutigen Schlagwörter) ist seine Beharrlichkeit und sein Aufbäumen gegen das NS-Regime zunächst einmal eine politische Entscheidung, zu der er nicht gezwungen war. Dass er in eine jüdische Familie einheiratete, spielte für die Manns keine nennenswerte Rolle, weil sie das Judentum nicht praktizierten. Thomas Mann agitierte gegen den Nationalsozialismus nicht als Ehemann einer Jüdin, sondern als deutscher, etablierter, steinreicher Künstler, der die Nazis für das verabscheute, was sie waren, Feinde der Menschlichkeit. Als er in den 1920er Jahren begann, gegen Hitler zu agitieren, konnte er noch gar nicht wissen, dass Millionen Juden ermordet werden würden. Menschen, die in den Wohlstand hinein geboren werden und auch mit Klassendünkel nicht geizen, werden für gewöhnlich nur dann politisch aktiv, wenn es ihren eigenen Interessen dient. Für jemanden wie Thomas Mann, dem einstigen privilegierten Studenten, der bequem von den Zinsen (!) seines väterlichen Erbes leben konnte, dem einst begeisterten Anhänger des Kaiserreiches, mit seiner ganzen Obsession für feine Kleider, Porzellan, schöne Autos, die Gesamtheit seines ondulierten, luxusliebenden Wesens, ist der Sprung zu einem Oppositionellen, der es mit Adolf Hitler persönlich aufnahm und mit ihm Fehde führte, gigantisch groß. Er hätte nicht opponieren müssen. Viele Millionen Deutsche taten es auch nicht. Heute wissen wir, die meisten haben geistig oder physisch mitgemacht. Ich gehöre nicht zu denen, die meinen, dass man jedem NS-Gegner und Zeitgenossen dankbar für seinen Widerstand sein müsste. Solidarität und Geschwisterlichkeit sind universell gültige Werte. Aber man darf ruhig anerkennen, wenn einer für diese Werte eintritt. Thomas Mann hatte viel zu verlieren. Sein Zuhause, seine Ruhe, seine Ordnung, die Sicherheit seiner nach der Halacha (und nationalsozialistischen »Rassenlehre«) jüdischen Kinder, auch wenn Jüdischsein im Hause Mann keine Rolle spielte, da seine Frau Katia dieses Attribut für sich ablehnte. Er hatte viel Besitz verloren. Übrigens ohne ein einziges Mal darüber öffentlich zu jammern. Wo er doch sonst so gerne jammerte.
Wann immer ich in den vergangenen Wochen erzählte, dass ich Thomas Manns Rundfunkreden, die er während des Zweiten Weltkriegs hielt, herausgeben werde, wurde ich entgeistert angeschaut: »Thomas Mann, echt jetzt?« Ja, echt jetzt. Nach der Lektüre von Deutsche Hörer! kann ich aus ganzen Herzen und ohne jede Ironie sagen, Thomas Mann war ein Held. Heldenhaft mitsamt seinen Fehlurteilen (Betrachtungen eines Unpolitischen), von denen er einige gefällt hatte, mit all seiner Wehleidigkeit (mein Güte, der Tagebucheintrag am Tag des Einmarsches der Deutschen in Paris, erst zwei Zeilen Kopfschütteln über die politische Katastrophe, dann ausgelassene Wehklage über die wackelnde Brücke in seinem Mund), mit seinem Narzissmus (kenne in der Kunst eigentlich niemanden, der oder die nicht so wäre), mit den Lästereien über seine Kinder (würde TM heute leben, würde er mit Sicherheit weder Elternzeit nehmen noch die Eingewöhnung in der Kita übernehmen), samt seinem ganzen weltlichen Wesen mit Kunst als Lebensgrundlage bei gleichzeitiger Sucht nach Komfort und Firlefanz, kurz: Er war nur ein Mensch.
Thomas Mann war ein Antifaschist. Er begegnete dem Faschismus und denen, die ihm bedingungslos folgten, mit der einzig richtigen Haltung. Er nahm ihn persönlich. Deshalb waren seine Reden groß, verehrtes Publikum. Sehr groß. Er konnte gut von böse, Recht von Unrecht unterscheiden. Manchmal schimpfte er, seine Urteile scheuerte er den Deutschen gnadenlos rechts und links in ihre Gesichter, und dann wieder schickte er überraschend zärtliche Worte über den Ozean, die er (ich kürze die Stelle etwas ab) wie eine Friedenstaube mit Zettelchen im Schnabel über den Atlantik herüberflattern ließ:
»Glaubt mir, die Freiheit ist immer noch,
unberührt von allem Geschwätz
und allen Launen der Geistesgeschichte,
was sie vor zweitausend und etlichen Jahren war: das Licht und die Seele des Abendlandes;
und die Liebe.«
Berlin im September 2024
Thomas MannDeutsche Hörer!
Vorwort zur ersten Ausgabe
Im Herbst 1940 trat die British Broadcasting Corp. mit dem Wunsche an mich heran, ich möchte über ihren Sender in regelmäßigen Abständen an meine Landsleute kurze Ansprachen richten, in denen ich die Kriegsereignisse kommentieren und eine Einwirkung auf das deutsche Publikum im Sinne meiner oft geäußerten Überzeugungen versuchen sollte.
Ich glaubte, diese Gelegenheit, hinter dem Rücken der Nazi-Regierung, die, sobald ihr die Macht dazu gegeben war, mich jeder geistigen Wirkungsmöglichkeit in Deutschland beraubt hatte, Kontakt zu nehmen – und sei es ein noch so lockerer und bedrohter Kontakt – mit deutschen Menschen und auch mit Bewohnern der unterjochten Gebiete, nicht versäumen zu dürfen – umso weniger, als meine Worte nicht von Amerika aus, auf Kurzwellen, sondern von London, auf Langwellen, gesandt werden sollten und also durch den dem deutschen Volk allein zugestandenen Empfänger-Typ würden gehört werden können. Auch war es verlockend, einmal wieder in dem Bewusstsein Deutsch zu schreiben, dass das Geschriebene in seiner angeborenen Gestalt, auf Deutsch werde wirken dürfen. Ich sagte monatliche Sendungen zu und erbat, nach ein paar Versuchen, eine Verlängerung der Sprechzeit von fünf auf acht Minuten.
Die Sendungen geschahen zunächst auf dem Wege, dass ich meine Texte nach London kabelte und ein deutschsprachiger Angestellter der BBC sie dort verlas. Auf meine Anregung bediente man sich bald einer, wenn auch umständlicheren, so doch direkteren und darum sympathischeren Methode. Ich spreche nun, was ich jeweils zu sagen habe, im Recording Department der N.B.C. von Los Angeles selbst auf eine Platte, diese wird auf dem Luftwege nach New York gesandt und ihr Inhalt durch das Telefon auf eine andere Platte in London übertragen, die dann vor dem Mikrophon abläuft. Auf diese Weise hören diejenigen, die drüben zu lauschen wagen, nicht nur meine Worte, sondern auch meine eigene Stimme.
Es lauschen mehr Menschen, als man erwarten sollte, nicht nur in der Schweiz und in Schweden, sondern auch in Holland, im tschechischen »Protektorat« und in Deutschland selbst, wie durch aufs Sonderbarste chiffrierte Rückäußerungen aus diesen Ländern belegt ist. Auf Umwegen kommen solche tatsächlich auch aus Deutschland. Offenbar gibt es in diesem besetzten Gebiet Leute, deren Hunger und Durst nach dem freien Wort so groß ist, dass er den Gefahren trotzt, die mit dem Abhören feindlicher Sendungen verbunden sind. Der schlagendste Beweis dafür, dass dies der Fall ist – ein zugleich erheiternder und degoutanter Beweis –, ist durch die Tatsache gegeben, dass mein Führer selbst in einer Bierkellerrede zu München unmissverständlich auf meine Allokutionen angespielt und mich als einen derer namhaft gemacht hat, die das deutsche Volk zur Revolution gegen ihn und sein System aufzuwiegeln versuchten. Aber diese Leute, brüllte er, täuschten sich sehr: So sei das deutsche Volk nicht, und soweit es so sei, sitze es Gott sei Dank hinter Schloss und Riegel. – Aus diesem Munde ist so viel Unrat gekommen, dass es mir leichte Ekelgefühle erregt, meinen Namen daraus zu vernehmen. Dennoch ist die Äußerung mir wertvoll, möge ihre Widersinnigkeit auch auf der Hand liegen. Der Führer hat seiner Verachtung des deutschen Volkes, seiner Überzeugtheit von der Feigheit, Unterwürfigkeit, Dummheit dieser Menschenart, ihrer grenzenlosen Fähigkeit, sich belügen zu lassen, oft Ausdruck gegeben und nur jedes Mal vergessen, eine Erklärung dafür hinzuzufügen, wie es ihm gelingt, gleichzeitig in den Deutschen eine zur Weltherrschaft bestimmte Herrenrasse zu sehen. Wie kann ein Volk, von dem psychologisch feststeht, dass es sogar gegen ihn niemals revoltieren wird, eine Herrenrasse sein? Ich bitte den Geschichtshelden, diese Frage einmal zwischen zwei Schlachtenplänen einer logischen Prüfung zu unterziehen.
Vielleicht hat er recht mit seiner Zuversicht, dass das deutsche Volk »nicht so sei« – er war immer am allerwiderwärtigsten dort, wo er recht hatte. Auch heißt, ein Volk zur Erhebung aufrufen, noch nicht an seine Fähigkeit dazu im tiefsten Herzen glauben. Woran ich unverbrüchlich glaube, das ist, dass Hitler seinen Krieg nicht gewinnen kann – es ist das weit mehr noch ein metaphysischer und moralischer als ein militärisch begründeter Glaube, und wo immer ich ihm auf den folgenden Blättern Ausdruck gebe, ist er vollkommen ungeheuchelt. Aber fern sei es von mir, damit die gefährliche Auffassung bestätigen zu wollen, als sei der Sieg der United Nations eine selbstverständlich gesicherte Sache, und als könne man sich auf diese Selbstverständlichkeit und diese Sicherheit hin nicht nur jeden Fehler, sondern auch jede Gebrochenheit des Willens, jede Halbherzigkeit, und jeden »politischen« Vorbehalt in Bezug auf seine Verbündeten und auf den zu erkämpfenden Frieden leisten. Man kann sich gar nichts leisten, nicht das Geringste mehr, nach allem, was man sich in der Vergangenheit geleistet hat. Dieser Krieg hätte ja vermieden werden können, und die Tatsache selbst, dass er kommen musste, ist eine schwere moralische Belastung für unsere Seite. Der Krieg hat eine düstere Vorgeschichte, deren bestimmende Motive keineswegs tot sind, sondern untergründig fortwirken und mit dem Frieden den Sieg gefährden. Wir werden den Krieg verlieren, wenn wir einen falschen Krieg führen und nicht den rechten, der ein Krieg der Völker für ihre Freiheit ist.
15. September 1942
Oktober 1940
Deutsche Hörer!
Ein deutscher Schriftsteller spricht zu euch, dessen Werk und Person von euren Machthabern verfemt sind, und dessen Bücher, selbst wenn sie vom Deutschesten handeln, von Goethe zum Beispiel, nur noch zu fremden, freien Völkern in ihrer Sprache reden können, während sie euch stumm und unbekannt bleiben müssen. Mein Werk wird eines Tages zu euch zurückkehren, das weiß ich, wenn auch ich selbst es nicht mehr kann. Solange ich lebe aber, und selbst als Bürger der neuen Welt, werde ich ein Deutscher sein, und leide unter dem Schicksal Deutschlands und all dem, was es nach dem Willen verbrecherischer Gewaltmenschen seit sieben Jahren, moralisch und physisch, der Welt zugefügt hat. Die unerschütterliche Überzeugung, dass dies kein gutes Ende nehmen kann, hat mir in diesen Jahren immer wieder warnende Äußerungen eingegeben, von denen einzelne, wie ich glaube, zu euch gedrungen sind. Im Kriege jetzt gibt es für das geschriebene Wort keine Möglichkeit mehr, den Wall zu durchdringen, den die Tyrannei um euch errichtet hat. Darum ergreife ich gern die Gelegenheit, die die englische Behörde mir bietet, euch von Zeit zu Zeit über das zu berichten, was ich hier sehe, in Amerika, dem großen und freien Land, in dem ich eine Heimstatt gefunden habe.
Als vor fünf Monaten deutsche Truppen in Holland einfielen und in Rotterdam in wenigen Minuten Zehntausende von Menschen durch Bomben zugrunde gingen, schrieb der Herausgeber der amerikanischen Zeitschrift Life, einer illustrierten Zeitschrift, die sonst nie zu politischen Fragen Stellung nimmt, und die jedermann liest: »Das ist die größte Herausforderung, die Amerika als ein Land der Freiheit in achtzig Jahren erfahren hat … Mächtige, ruchlose Militärvölker haben das angegriffen, was unsere amerikanische Art zu leben ist … Ob wir je mit der Waffe an der Seite Englands kämpfen müssen, wissen wir nicht; aber das wissen wir, dass der Kampf Englands zutiefst auch unser eigener ist.« So hieß es damals, nach dem zehnten Mai, und so heißt es heute noch. So denken die Arbeiter und die Geschäftsleute, die Republikaner und die Demokraten, die Anhänger Roosevelts und die Anhänger seines Gegners. Von dem alten Amerika, das glaubte, für sich leben zu können, ohne sich um die Welt jenseits des Ozeans zu kümmern, ist wenig übrig geblieben. Woher kommt diese tiefe Wandlung? Ihr wisst es ganz gut. In diesem Lande leben 130 Millionen gutwilliger, freundlicher Menschen. Sie wollen in Frieden arbeiten und bauen. An den großen Fragen, welche sie gemeinsam angehen, nehmen sie aktiv teil, so wie jeder es für recht hält. Krieg, Eroberungen fremder Länder, Allianzen, Achsen, heimliche Begegnungen, Vertragsbrüche erscheinen ihnen überflüssig und verrückt. Aber dann kommen nun ihre Zeitungen und Radioberichterstatter und erzählen ihnen, was in Europa vorgeht. Wie in Norwegen, in Holland, Belgien, Polen, Böhmen, wie überall das gleiche Bild ist, wie deutsche Truppen, die niemand gerufen hat, in diesen Ländern stehen, die ihnen nichts getan haben, und sie bedrücken und ausplündern. Und wie die als Verbrecher totgeschossen werden, die ihr Vaterland lieben und nicht für den fremden Eindringling Waffen schmieden wollen. Natürlich ist ein Amerikaner vor allem amerikanischer Bürger; aber es ist doch oft so, dass er oder sein Vater oder Großvater in Norwegen, in Holland, in Belgien, im beschützten Dänemark, im Generalgouvernement, im Protektorat geboren sind, dass er noch Verwandte in einem dieser Länder und gute Erinnerungen von ihm hat. Und selbst, wenn er das nicht hätte, und selbst dann und gerade dann, wenn seine Familie aus Deutschland stammt, so muss er doch als ein geradeaus denkender Mensch von all dem Unrecht, all der Gewalt empört sein, die er erfährt. Nein, ich habe keinen Unterschied gefunden zwischen Deutsch-Amerikanern und Anglo-Amerikanern und Italo-Amerikanern. Alle fühlen sie, dass das nicht der rechte Weg ist, Europa zu einigen, und dass so viel Verbrechen früher oder später seine Strafe finden muss.
So hat der amerikanische Bürger heute vor allem drei Hoffnungen. Die eine ist Amerika selbst, seine ungeheure wirtschaftliche Kraft, seine guten und bewährten Führer. Die zweite ist England. Es mag sein, dass früher auch die Amerikaner mit etwas Spott auf die Engländer geblickt haben. Man hielt sie für müde, für überfeinert. Heute aber, angesichts der Verteidigung Londons, gibt es nur eine Stimme der Bewunderung. England trägt das Banner der Freiheit. Es spricht und kämpft für alle die leidenden, nur