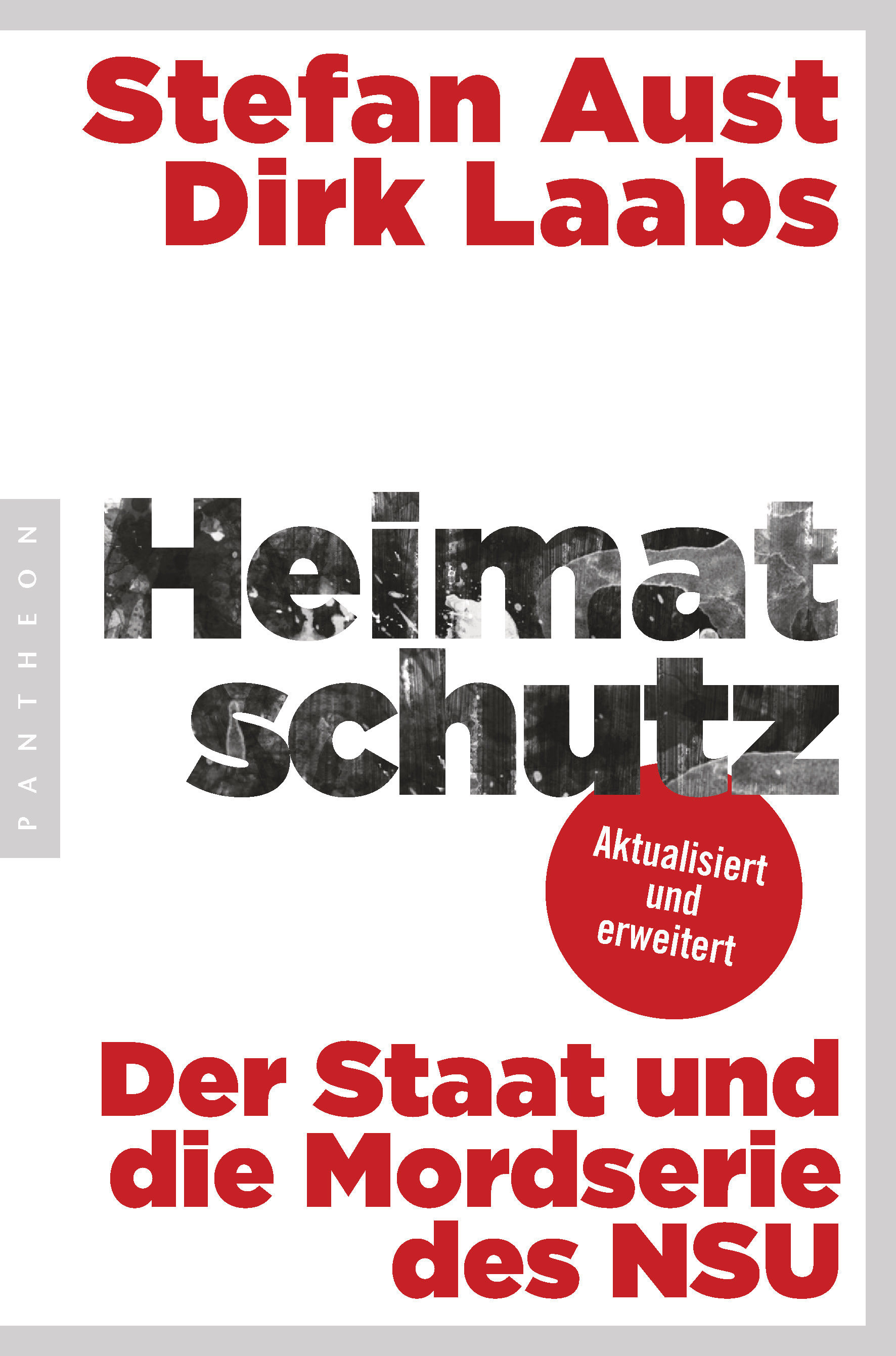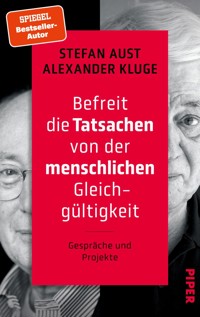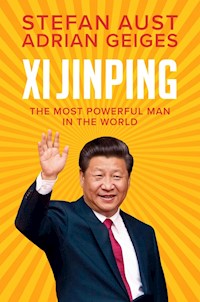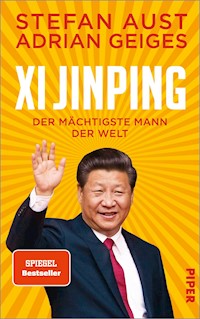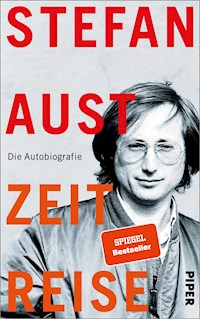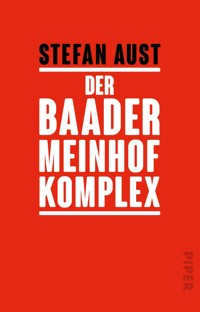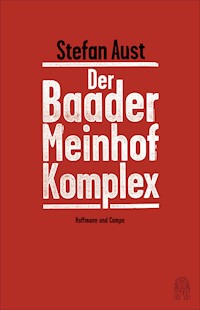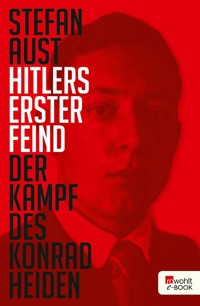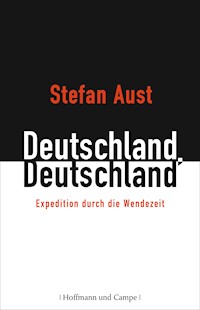
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Stefan Austs faszinierende Chronik des größten Umbruchs, den die Bundesrepublik durchlebte. Er war direkt vor Ort: beim Mauerfall und in den Wirren der Jahre nach der "zweiten Stunde null". Ein Buch im Stil einer Livereportage und eine journalistische Abenteuergeschichte, die die Ereignisse der Wendezeit unmittelbar vor Augen führt. "Das war der Tag, an dem der Zweite Weltkrieg zu Ende ging ..." So begann der Kommentar, den Stefan Aust, damals Chefredakteur von Spiegel TV, in der Nacht schrieb, als der Schlagbaum in der Bornholmer Straße aufging und die Menschen aus dem Osten ungehindert in den Westen strömten. Zwei Tage zuvor hatte er einen Reporter und ein Kamerateam nach Ostberlin geschickt, um die Mauer im Auge zu behalten, denn er ahnte, dass dort etwas passieren würde. In "Deutschland, Deutschland" erzählt er, wie er und seine Kollegen den Untergang der DDR und die Entwicklung hin zur Wiedervereinigung aus nächster Nähe miterlebten. Ein spannendes Protokoll erlebter Zeitgeschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 421
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Stefan Aust
Deutschland, Deutschland
Expedition durch die Wendezeit
Hoffmann und Campe Verlag
Vorbemerkungen
Dieses Buch ist ein subjektives Protokoll von fünfzehn Monaten erlebter Zeitgeschichte. Es ist die Geschichte der Expeditionen, die Reporter und Kamerateams von Spiegel TV durch die Wendezeit unternahmen. Insofern ist es nicht nur ein Streifzug durch die Zeit des Mauerfalls, des Untergangs der DDR und der Wiedervereinigung, sondern auch eine Erinnerung an die ersten Jahre von Spiegel TV.
Es war für mich, und sicher auch für die meisten meiner damaligen Kollegen, die journalistisch interessanteste Zeit überhaupt. Wir waren privilegierte Zeitzeugen. Eineinhalb Jahre zuvor war Spiegel TV gestartet, als Magazin am Sonntagabend auf dem neuen Privatsender RTL. Ein unabhängiges Fenster der DCTP (Development Company for Television Programs) des Schriftstellers, Filmemachers und Universalgenies Alexander Kluge garantierte uns vollkommene redaktionelle Unabhängigkeit. Die Basisfinanzierung kam aus den Werbeerlösen von RTL, Spiegel-Gründer und -Herausgeber Rudolf Augstein stellte – außer dem Namen Spiegel – den anfangs zusätzlich notwendigen Etat zur Verfügung, und der Rest lag in unseren Händen.
Es waren paradiesische Zeiten für junge Fernsehjournalisten, die bereit waren, jeden Tag und jedes Wochenende zu arbeiten, ihre Nase und das Objektiv ihrer Kamera in jede Angelegenheit zu stecken und das dokumentarische Fernsehen neu zu entdecken.
Und dann brach die politische Nachkriegsordnung über Nacht zusammen. Die scheinbar für die Ewigkeit zementierte Teilung der Welt in Ost und West, Kapitalismus und Sozialismus, löste sich vor unseren Augen auf. Und wir waren dabei, mit engagierten Reportern, die jedem Politiker und jedem Stasi-Offizier die Kamera und das Mikrophon vor die Nase halten konnten, mit Kameraleuten, die rund um die Uhr mit den neuen elektronischen Kameras die Wirklichkeit in »real time« abbildeten und mit großer Kunst auch das scheinbar Nebensächliche einfingen. Manche der Reporter waren mehr oder weniger Berufsanfänger, aber höchst talentiert, neugierig und motiviert bis in die tiefe Nacht hinein. Und zu Hause, in der Redaktion im Hamburger Chilehaus, saßen Cutter und erfahrene Fernsehredakteure, die das Material in kürzester Zeit zu Filmbeiträgen verarbeiten konnten.
Wenige Stunden, manchmal Minuten später gingen die Filme über den Sender.
Thomas Schaefer und Bernd Jacobs waren die ersten beiden Mitarbeiter, die ich vom Norddeutschen Rundfunk zu Spiegel TV holte. Mit beiden hatte ich bei Panorama und Extra 3 zusammengearbeitet. Dann kamen Georg Mascolo, Erwin Jurzschitsch, Tamara Duve, Maria Gresz, Katrin Klocke, Cassian von Salomon, Claudia Bissinger, Helmar Büchel, Christiane Meier, Gunther Latsch, Thilo Thielke, Wolfram Bortfeldt dazu. Die Produktion organisierten Suse Schäfer, vormals eine erfolgreiche Theater- und Fernsehschauspielerin, und Ute Zilberkweit, die beide rund um die Uhr im Einsatz waren. Auch die Kameraleute Dieter Herfurth, Bernd Zühlke und Rainer März kannte ich aus NDR-Zeiten. Von ihnen stammten die meisten und besten der Bilder jener Zeit. In den Schneideräumen bei Spiegel TV bauten Cutter wie Erwin Pridzuhn, Steffen Brautlecht, Sven Berg, Betina Fink, Holger Grabowski, Sabine Herres aus den Rohmaterialien die Filme zusammen, meistens unter der Leitung von Bernd Jacobs und mir. Am Sonntag tippte ich dann zumeist die Texte, dazu die Moderation, mit der wir abends auf Sendung gingen.
Wir bildeten eine verschworene Gruppe, die Tag und Nacht zusammenarbeitete, manchmal nannten wir uns eine »Wohngemeinschaft mit Sendeerlaubnis«. Und ganz sicher waren wir damals die beste Redaktion eines Fernsehmagazins in Deutschland. Die Quoten stiegen von anfangs wenigen hunderttausend auf durchschnittlich über vier Millionen.
In diesem Buch habe ich mich an den Filmen und Texten der Filme aus der Wendezeit entlang geschrieben. Besonders bedanken möchte ich mich bei dem heutigen Chefredakteur des Spiegel TV Magazins Bernd Jacobs, dass er mir dafür – in Abstimmung mit der Geschäftsführung und dem heutigen Chefredakteur des Spiegel Georg Mascolo – die Manuskripte zur Verfügung gestellt hat. In den meisten Fällen waren es ohnehin meine Texte. Aber die Recherchen, die Dreharbeiten und Interviews in den Beiträgen sind natürlich von den ausschwärmenden Reportern gemacht worden.
Im Verlauf des Buches habe ich die Kollegen jeweils in den einzelnen Episoden auftreten lassen, als handelnde, fragende, oftmals nachbohrende Journalisten. Es ist auch ihre Geschichte. Und ich bin ihnen dankbar für die Zeit, die wir zusammenarbeiten konnten.
Und dann möchte ich mich natürlich bei meiner Frau Katrin bedanken, für die ich in meinen sieben Jahren Spiegel TV so gut wie kein Wochenende Zeit hatte. Da saß ich regelmäßig im Schneideraum. Freitag bis Mitternacht, Samstag bis nach Mitternacht. Und Sonntag bis kurz vor der Sendung um 22.00 Uhr.
Es waren Expeditionen in ein unbekanntes Land. Kaum jemand von uns war in den vergangenen Jahren häufiger in der DDR gewesen. Stattdessen fuhr man in die USA, nach Frankreich, England, Italien und Spanien. Der Ostblock war grau und langweilig, unangenehm, eine politische Realität, die man zur Kenntnis nahm, aber irgendwie ausblendete.
Und selbst Besuche in der DDR gaben keinen wirklichen Einblick in die wirkliche Welt des real existierenden Sozialismus. Journalisten aus dem Westen, wenn sie überhaupt hereingelassen wurden, durften sich nur unter staatlicher Aufsicht bewegen. Der Stasi-Apparat war ein weitgehend unterschätztes Staatsgebilde für sich. Selbst bundesdeutsche Geheimdienste hatten noch nicht einmal eine Ahnung davon, über wie viele Mitarbeiter Erich Mielkes Monsterbehörde verfügte. Ich erinnere mich an den Anruf eines ehemaligen langjährigen ARD-Korrespondenten nach einer Spiegel-TV-Sendung, in der wir die Zahl der offiziellen Stasi-Mitarbeiter mit mehr als achtzigtausend angegeben hatten. Das sei ja reichlich übertrieben, meinte der Experte unter Berufung auf Informationen des Bundesnachrichtendienstes. In Wirklichkeit seien es höchstens ein Drittel oder die Hälfte. Ich hatte allerdings gerade die komplette Computerliste der festangestellten Stasi-Mitarbeiter vorliegen, inklusive Dienstnummer, Rang und Monatseinkommen, die einer unserer Reporter von der Besetzung der Stasi-Zentrale in der Ostberliner Normannenstraße mitgebracht hatte. Es waren vierundachtzigtausend.
Nach Öffnung der Mauer konnten sich Reporter und Kamerateams in der DDR plötzlich freier bewegen als im Westen. Jeder Gefängnisdirektor wollte demonstrieren, dass er die Zeichen der Zeit erkannt hatte und für die neue Pressefreiheit die Tore öffnete. Jeder VEB-Direktor erlaubte den Blick in sein heruntergekommenes Kombinat. Auf den Spuren der Bürgerrechtler vom Runden Tisch konnten Journalisten die Stasi-Gebäude inspizieren. Selbst das Neue Deutschland und das Zentralkomitee standen Rede und Antwort. Doch die neue Offenheit hielt nicht lange. Dann sollten die Tore und die Akten wieder geschlossen werden. Es begann die Zeit der Recherche. Wir wälzten Stasi-Akten, sprachen mit ehemaligen Geheimdienstlern, entlarvten aktive Politiker der Wendezeit als MfS-Agenten.
Dies ist die Geschichte der Wochen des Wendejahres 1989/90. Eine Zeitreise vom Fall der Mauer bis zur Wiedervereinigung. Und am Schluss ein Zeitsprung in die Gegenwart: zwanzig Jahre danach.
Hamburg, im August 2009
Stefan Aust
Der Fall der Mauer
November 1989
»Das war der Tag, an dem der Zweite Weltkrieg zu Ende ging …«
Es war Donnerstag, der 9. November 1989, als ich diese Zeile in meine Schreibmaschine tippte. Ich saß in einem Büro von Studio Hamburg und sollte den Abendkommentar für RTL sprechen. Im Fernsehen lief die Zusammenfassung eines Fußballspiels. Die ARD hatte den Beginn der Tagesthemen verschoben, um die Sendung nicht zu unterbrechen. Ich schaltete weiter. Im gemeinsamen Dritten Programm des Norddeutschen Rundfunks und des Senders Freies Berlin mühten sich Reporter, die undurchsichtige Lage an der Westseite der Berliner Mauer zu analysieren.
Gegen 19.00 Uhr an diesem Abend hatte Günter Schabowski, Mitglied des SED-Politbüros, am Ende einer Pressekonferenz fast beiläufig und in geübter Bürokratensprache eine weltpolitische Sensation verkündet: »Dann haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen.«
»Gilt das auch für Westberlin?«, fragte ein Journalist.
»Also, doch, doch«, antwortete der DDR-Politiker. »Ständige Ausreise kann über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD beziehungsweise Berlin-West erfolgen.«
Ständige Ausreise? Ungläubiges Staunen machte sich in den Gesichtern der westlichen Korrespondenten breit. Ein italienischer Journalist fragte, ab wann denn diese Regelung gelte.
Irritiert blickte Schabowski auf seine Vorlage. Dann stammelte er: »Das tritt nach meiner Kenntnis, äh, ist das sofort, unverzüglich.«
Die Nachricht hatte mich im Auto erreicht. Maggie Deckenbrock, stellvertretende Chefredakteurin des neuen kommerziellen Fernsehsenders RTL, rief an und fragte mich, ob ich nicht den Kommentar zur Maueröffnung sprechen wolle, der Chefredakteur des Senders sei gerade in Urlaub. Man könne ihn nicht erreichen.
»Zur was?«, fragte ich.
»Zur Maueröffnung.«
Sie haben es tatsächlich gemacht, dachte ich und willigte ein. Zum Studio Hamburg musste ich durch die ganze Stadt fahren. Während ich mich durch den stockenden Verkehr quälte, wanderten meine Gedanken zurück.
Am Montag jener Woche hatte mich abends der damalige Chefredakteur des Spiegel, Werner Funk, zu Hause besucht. Wenige Tage zuvor hatte Egon Krenz, Nachfolger des abgelösten Staats- und Parteichefs Erich Honecker, die im Oktober verhängte Visasperre für die Tschechoslowakei aufgehoben. Jetzt durften DDR-Bürger wieder nach Prag reisen – und hatten dadurch die Möglichkeit, sich von dort aus über Ungarn in den Westen abzusetzen. Funk fand das politisch höchst gefährlich.
Als er sich vor der Haustür verabschiedete, sagte er: »Der ist völlig verrückt. Die laufen ihm doch jetzt alle weg.«
»Dem bleibt nichts anderes übrig«, sagte ich. »An Stelle von Krenz würde ich jetzt die Mauer aufmachen.«
Funk lachte laut: »Du immer mit deinen Ideen …« Er lief die Treppe nach oben.
»Weißt du was«, antwortete ich. »Wenn du ein Loch in der Badewanne hast, dann ziehst du besser den Stöpsel raus. Dann läuft das Wasser durch den Abfluss und nicht in die Wohnung …«
Während ich ins Haus zurückging, schoss mir ein Gedanke durch den Kopf. Die sind auch nicht blöder als du. Die machen das.
Am nächsten Morgen, es war Dienstag, der 7. November 1989, suchte ich mir bei Spiegel TV den besten Reporter, der im Haus war. Ich stieß auf Georg Mascolo, einen Jungjournalisten, den ich ein gutes Jahr zuvor beim privaten Rundfunksender Radio FFN abgeworben hatte.
»Georg, schnapp dir ein Kamerateam und fahr nach Ostberlin«, sagte ich.
»Und welche Geschichte soll ich da machen?«, fragte Mascolo.
»Keine bestimmte«, erwiderte ich. »Bleib in der Nähe der Mauer. Da passiert irgendetwas«.
Ungläubig schüttelte er den Kopf. »Und wie stellst du dir das vor?«
»Keine Ahnung. Fahr nach Ostberlin, pass auf, was passiert, und geh dahin, wo die Menschen hingehen.«
Georg machte sich mit dem Kamerateam auf die Reise zur Beobachtung der Mauer in Berlin.
Es war eine Mauer, die zwei Weltsysteme trennte, den Ostblock und den Westen, Kapitalismus und Sozialismus, eine Grenze, die Familien auseinanderriss und die gemacht schien für die Ewigkeit. Hochgerüstete Armeen standen sich hier gegenüber, bis an die Zähne bewaffnet, ausgerüstet mit nuklearen Sprengkörpern, mit denen die Welt mehrfach hätte in die Steinzeit zurückbombardiert werden können.
Hier in Berlin war sie 44,8 Kilometer lang und vier Meter hoch.
Nach achtundzwanzig Jahren sollte sie ihren schrecklichen Sinn verlieren. Niemand schien zu merken, dass dieser Moment unmittelbar bevorstand. Vierzig Jahre und dreißig Tage waren vergangen, als Staat und Bevölkerung der DDR begannen, einen neuen Umgang miteinander zu proben.
Donnerstag, der 9. November 1989, war ein ruhiger Herbsttag. Das Kamerateam fing eine symbolträchtige Szene ein. Am Ufer der Spree wanderten ein paar Schwäne über einen Fußweg, auf den sie nicht gehörten. Zwei Volkspolizisten näherten sich mit einer volkseigenen Wolldecke und warfen sie über die Vögel. Sie wurden ergriffen und zurück ins Wasser geworfen. Es war wie ein Sinnbild der kommenden Ereignisse: Der Obrigkeitsstaat entließ seine Kinder aus der behördlich reglementierten sozialistischen Geborgenheit in die Freiheit.
Das Kamerateam war in der Nähe der Mauer geblieben, in einer Kneipe am Prenzlauer Berg. Dort lief ein Fernseher mit DDR-Programm. In den 19.30-Uhr-Nachrichten meldete die Sprecherin Angelika Unterlauf die Neuregelung der DDR-Ausreisebestimmungen: »Die zuständigen Abteilungen der Volkspolizei sind angewiesen, auch Visa zur ständigen Ausreise unverzüglich zu erteilen.« Es war der Startschuss für ein neues Zeitalter.
Das Kamerateam stürzte auf die Straße. Innerhalb weniger Minuten machte sich eine Trabikolonne auf den Weg nach Westen.
»Wie komme ich am schnellsten nach Steglitz?«, fragte ein aufgeregter junger Mann mit einem Stadtplan in der Hand die Westreporter.
»Steglitz in Westberlin?«
»Na, Mensch, na logo, wo denn sonst?«
Es begann ein Massenansturm auf den nächsten Grenzübergang, Bornholmer Straße, Prenzlauer Berg. Das Prinzip Freiheit sollte ausgetestet werden. Doch vor die Ausreise hatten die Behörden den Stempel gesetzt. Nur mit aufgedrucktem Visum sollte der spontane Ausflug in den Westen möglich sein. Der Stempel wurde zur Hälfte auf das Passfoto gesetzt, um die Drängler später identifizieren zu können und ihnen gegebenenfalls die Rückkehr zu verweigern. Die Grenzer arbeiteten zügig, die Schnecke drehte auf. Der Atem der Geschichte bestand hier aus einer Dunstwolke aus Zweitakterabgasen. Der Aufbruch in ein unbekanntes Land in derselben Stadt endete zunächst im Verkehrsstau.
Tausende versammelten sich und riefen immer wieder im Chor »Aufmachen, aufmachen« und »Wir kommen zurück, wir kommen zurück«.
Das Kamerateam war auf einen Zaun geklettert und filmte ununterbrochen, was sich hier zusammenbraute. Die Menschen standen an, um einmal im Westen ein Bier zu trinken. So viel Jubel hatte sich selten aus Warteschlangen erhoben. Doch ohne Pass und Visumstempel lief hier noch immer nichts. Ordnung musste sein im Staate DDR, immer schön der Reihe nach, im sozialistischen Gang. Binnen weniger Minuten war der Personalausweis zum Fahrschein in die Freiheit geworden. Manche spürten, dass die Republik der Genossinnen und Genossen gerade ihren Ungeist aufgab. Wozu sollte noch ein Pass gut sein? Die Freiheit braucht keine Papiere. Vor laufender Kamera zerriss ein Mann seinen DDR-Ausweis: »Wie lange wir gewartet haben, darauf, achtundzwanzig Jahre hat es gedauert. Ich lebe dafür. Ohne das.« Er ließ die Reste zu Boden fallen.
Die Masse harrte aus. Nur die Geduld kannte in der DDR keine Grenzen. Man hatte seine Bürger erzogen. Die Grenzer, viele davon Stasi-Mitglieder, verstanden die Welt nicht mehr. Hier vor ihren Augen zeigte sich, dass die Staatspartei ihre Massenbasis verloren hatte. Binnen zwei Monaten hatte sich ein Volk seiner Angst entledigt.
Die Tagesschau verkündete um 20.00 Uhr die Weltsensation, als handle es sich um eine Routinemeldung aus dem ost-westlichen Alltag: »Ausreisewillige DDR-Bürger müssen nach den Worten von SED-Politbüromitglied Schabowski nicht mehr den Umweg über die Tschechoslowakei nehmen …«
Dann sendete das Erste Deutsche Fernsehen die Live-Übertragung eines Fußballspiels. Es war das DFB-Pokal-Achtelfinale zwischen dem VfB Stuttgart und Bayern München. Als die Tagesthemen um 22.30 Uhr beginnen sollten, hatten die Bayern mit 3:0 gewonnen. Doch statt auf den Fall der Mauer umzuschalten, sendete die ARD die Zusammenfassung des Spiels Kaiserslautern gegen Köln (2:1), das gleichzeitig stattgefunden hatte. Dafür wurde der Beginn der Tagesthemen an diesem historischen Tag um elf Minuten verschoben.
In der Bornholmer Straße wurde währenddessen Geschichte gemacht. Diensthabender Offizier war der stellvertretende Leiter des Kontrollpunktes, Oberleutnant Harald Jäger. Dreiundzwanzig Jahre lang hatte er im Dienst des Ministeriums für Staatssicherheit an der Bornholmer Straße die Grenze bewacht. In dieser Nacht öffnete er den Schlagbaum, entgegen den Anweisungen seiner Vorgesetzten.
Fünf Grenzsoldaten, sechzehn bis achtzehn Zollkontrolleure und fünfzehn Mitarbeiter der Staatssicherheit waren an diesem Tag an dem Grenzübergang im Einsatz. Sie alle wussten nichts davon, dass am Morgen das Zentralkomitee der SED getagt und über eine neue Ausreiseverordnung debattiert hatte. Das Innenministerium der DDR arbeitete unter Hochdruck an den Ausführungsbestimmungen.
Gegen 19.00 Uhr hatte Oberleutnant Jäger beim Abendbrot gesessen und im Fernsehen Schabowskis Pressekonferenz verfolgt. Als der SED-Funktionär lakonisch mitteilte, dass DDR-Bürger ab sofort ausreisen dürften, horchte er auf. Jäger ließ das Essen stehen und rief von seinem Dienstzimmer aus seinen Vorgesetzten, Oberst Rudi Ziegenhorn, an.
Ziegenhorn sagte: »Haben Sie auch diesen Quatsch gehört?«
»Ja«, antwortete Jäger, »deshalb rufe ich Sie an.«
»Ist schon irgendwas bei euch unterwegs?«
»Ja. Die ersten zehn Bürger stehen schon bei uns am Kontrollpunkt.«
Oberst Ziegenhorn blieb ruhig: »Beobachten Sie die Situation und informieren Sie mich in einer halben Stunde, oder wenn sich eine konkrete Situation ergibt, noch mal.«
Währenddessen waren immer mehr DDR-Bürger zur Bornholmer Straße geströmt. Niemand erahnte, wie ratlos die DDR-Grenzer waren. Ohne Anweisungen von oben waren sie auf sich allein gestellt.
Nur wenige Dokumente sind aus dieser historischen Nacht erhalten geblieben. Es sind vor allem die Berichte der Ostberliner Volkspolizeidienststellen, die zeigen, wie unvorbereitet die DDR-Führung in diesen für sie verhängnisvollen Abend schlitterte. Kein einziger der für das Pass- und Fernmeldewesen zuständigen Beamten wurde vorab von der neuen Reiseverordnung unterrichtet.
Im Rapport Nummer 230 fanden die Reporter von Spiegel TV später ein Rundschreiben an die Dienststellen eins bis elf, in dem es hieß: »Bei Nachfragen zur Umsetzung der Reiseregelung ist den Bürgern mitzuteilen, dass ihre Anträge zu den Öffnungszeiten des Pass- und Meldewesens am 10.11. entgegengenommen werden.« Vorsichtshalber wurde laut Bericht eine Verstärkung der Schutzpolizei angefordert.
Aus seinem Dienstzimmer des Kontrollpunktes Bornholmer Straße ruft ein ratloser Oberleutnant Harald Jäger erneut seinen Vorgesetzten an, um zu erfahren, was er tun soll.
Stasi-Oberst Ziegenhorn sagt ihm, er müsse erst Rücksprache halten mit Generaloberst Gerhard Neiber, im MfS zuständig für Fragen der Grenzsicherheit. Fünf Minuten später meldet sich Ziegenhorn mit dem Befehl von ganz oben: »Die Ausreise wird den DDR-Bürgern nicht gestattet. Sie haben die Bürger zu beruhigen beziehungsweise ins Hinterland zurückzuweisen.«
Gegen 20.00 Uhr spitzt sich die Lage zu. Auch der diensthabende Offizier der Grenztruppen, Manfred Sens, fragt bei seinen Vorgesetzten an, wie er sich verhalten solle. Keine Ahnung, lautet die Antwort sinngemäß. »Die haben dann die nächsten Vorgesetzten angerufen«, sagte Sens zehn Jahre später den Spiegel-TV-Reportern, die ihn für einen Rückblick auf den Fall der Mauer interviewten. »Die wussten auch nicht, was los war. Also, es stand jeder kopflos da.«
Irgendwann an diesem Abend ist vom Dienstposten aus nicht mehr zu überblicken, wie weit die Autoschlange vor dem Schlagbaum zurück ins Stadtgebiet reicht. Sämtliche Nebenstraßen sind verstopft. Von der Spitze der Ministerien hören die Grenzer nichts. Stasi-Hauptmann Günter Weller später: »Als die Leute zum Grenzübergang strömten, da war uns klar: Irgendetwas ist hier im Gange, wo wir überhaupt nicht wissen, was da kommt.« An die Möglichkeit, den Schlagbaum zu öffnen, dachte zu dieser Stunde noch niemand.
Kurz vor 21.00 Uhr versuchte eine Funkstreife der Volkspolizei, die Menge zu vertrösten und damit ruhigzustellen. Gegen 17.00 Uhr hatte man der benachbarten Vopo-Dienststelle mitgeteilt, dass am nächsten Morgen Flugblätter mit zusätzlichen Meldezeiten der Passämter vorbereitet werden sollten. Im Viertelstundentakt hatte der Leiter des Bereitschaftsdienstes, Helmut Jüterbock, seinen Vorgesetzten telefonisch über die Lage vor Ort informiert. »Aber er selber war ja genauso von der Situation überrascht, dass kein Befehl, nichts kam.«
Ohne Anweisung von oben machte Jüterbock eine Lautsprecherdurchsage: »Liebe Bürger, ich bitte Sie im Interesse von Ordnung und Sicherheit, den Platz im Vorfeld der Grenzübergangsstelle zu verlassen und sich an die zuständigen Meldestellen zu wenden. Es ist nicht möglich, Ihnen hier und jetzt die Ausreise zu gewähren.«
Einige der Wartenden suchten daraufhin die nächste Polizeiwache auf, in der Hoffnung, dort das versprochene Visum zu erhalten. Doch auch die Volkspolizei war ratlos, und so standen sie eine Viertelstunde später wieder am Schlagbaum Bornholmer Straße. »Von da an«, erinnerte sich später der Stasi-Oberleutnant Jäger, »wurden dann die Forderungen zur Ausreise stärker. Regelrecht lautstark fordernd traten sie auf.«
Das Kamerateam von Spiegel TV filmte einen empörten Bürger, der aus der Agenturmeldung vorlas: »… angewiesen, Visa zur ständigen Ausreise unverzüglich zu erteilen …«
»Massenverarschung ist das«, rief ein anderer in die Westkamera. »Dann hätte ich auch zu Hause bleiben und pennen können, dann wäre ich jetzt nicht hier. Totale Verarschung.«
Ein besorgter Bürger machte sich schon Gedanken um die sozialistische Planwirtschaft: »Morgen geht kein Mensch aus der DDR arbeiten, weil sie sich alle die Papiere besorgen wollen. Und dann kommen wir noch mehr in die Scheiße.«
»Genau, genau«, pflichtete ihm ein anderer bei. »Genauso sieht es aus. Wir wollen doch alle nur drüben spazieren gehen, zwei Stunden. Die denken wohl, dass wir abhauen wollen oder was. Dieses Misstrauen immer!«
Doch die Lawine war losgetreten. Immer mehr Bürger nahmen die Regierungsankündigung wörtlich. Sie wollten sich nicht abweisen lassen. Zu viel Unglaubliches war in den vergangenen Wochen bereits geschehen. Der Grenzübergang Bornholmer Straße wurde zum Wartezimmer einer historischen Wende.
Oberleutnant Jäger erhielt einen Anruf und damit den ersten Befehl des Abends. »Die provokativen Bürger, also die am lautstärksten sind, werden aus den Massen herausfiltriert«, teilte ihm Ziegenhorn mit. »Ihnen ist die Ausreise zu gestatten.« Jäger später: »Die haben wir uns dann rausgeholt und gesagt, sie dürfen ausreisen. Und zur Tarnung haben wir dann noch zwei oder drei Umstehende mit zur Ausreise gelassen.«
Eintragung in die Akte der Volkspolizei um 21.26 Uhr: »Weisung an die Passkontrolleinheiten – wer an Grenzübergangsstellen auf Ausreise besteht, dem ist sie zu gestatten.«
Und so wurden die ersten DDR-Bürger nach Vorlage ihres Personalausweises in den Westen entlassen. Die Vorschriften mussten eingehalten werden im Staate DDR, auch wenn sie jeden Sinn zu verlieren begannen. Die Grenzer waren angewiesen, die Ausweise der »Provokateure« zu kennzeichnen.
Stasi-Hauptmann Günter Weller sagte später: »Es galt, dass wir einfach diesen Kontrollstempel in den Ausweis der jeweiligen Person einstempeln müssen.« Der Abdruck sollte über das Passfoto erfolgen. Er war der letzte Betrug der DDR an ihren Bürgern. Keiner der freudestrahlenden, jubelnden Freigänger, die den schmalen Durchgang in den Weste passierten, wusste, dass sein Pass gerade gezinkt, ungültig gemacht worden war. Der Stempel auf dem Lichtbild bedeutete: Diesem Bürger ist die Rückkehr in die DDR zu verweigern. Und so lief in der Bornholmer Straße die bis dahin größte Ausbürgerungsaktion der DDR-Geschichte ab.
Die ersten Ostberliner, die herausgelassen worden waren, kamen nach einer halben Stunde zurück. »Logischerweise auch welche von denen, die den Kontrollstempel auf dem Lichtbild hatten«, erinnerte sich später Oberleutnant Jäger. »Wir teilten ihnen mit, dass ihre Einreise nicht mehr möglich ist, dass sie praktisch ausgewiesen worden sind aus der DDR.« Nach langem Hin und Her wurden sie zurück in den Westen geschickt. »Einige haben dann doch geweint, dass sie zu Hause ihre Kinder haben, die sie versorgen müssen«, sagte Jäger. »Wir haben dann mit Ausnahmen noch einige reingelassen.«
Die sogenannte Ventillösung, besonders aufmüpfigen Bürgern den Durchgang zu gestatten, entspannte die Lage nicht. Niemand in der ausharrenden Menge konnte verstehen, warum manche die Grenze passieren durften und andere nicht. »Wir kommen doch alle wieder«, beteuerten etliche. »Nur eine halbe Stunde mal kucken.« – »Nun macht mal nicht so einen Blödsinn.«
Plötzlich hatten die Grenzer an zwei Fronten Druck. Auf der einen Seite drängten die Menschen Richtung Westen, auf der anderen zurück Richtung DDR.
Bis gegen 22.00 Uhr hielt die Ausreisebürokratie ihre Bremserfunktion aufrecht. Dann geriet sie in Bedrängnis. Vor dem Schlagbaum, im gelben Licht der Scheinwerfer und vor dem Objektiv der Fernsehkamera aus dem Westen, wurden die Bürger in den ersten Reihen mutiger. »Lasst uns endlich durch. Wir kommen ja zurück, wirklich.« Die Grenzer verzogen keine Miene. Und wurden doch nervös.
»Was soll man da nun machen?«, fragte sich Major Manfred Sens, ranghöchster Mann der Grenztruppen vor Ort. »Bei uns war die Hierarchie so, dass immer einer da war, der einen Befehl erteilte. Der Befehl kam immer von oben nach unten. Die Kette war völlig unterbrochen. Er war keiner mehr da, der einen Befehl erteilen konnte oder wollte. So etwas gab es nicht. Das hatten wir auch nie in irgendwelchen Planspielen trainiert. Für uns stand immer fest, die Grenze ist dicht, da kommt keiner durch. Und jetzt hat man einfach gesagt, jetzt darf jeder reisen. Nun macht mal was draus.«
Manche der Wartenden waren kurz davor, aufzugeben: »Ist doch wieder genau der gleiche alte Mist.« Andere riefen: »Tor auf! Tor auf! Tor auf!« Ein Grenzer wurde versöhnlich angesprochen: »Wir müssen doch morgen alle arbeiten. Wir wollen doch nur mal rübergehen.« – »Wir kommen wieder, wir kommen wieder«, skandierte die Menge. »Keine Gewalt! Keine Gewalt!«
Schließlich konnte die Bürokratie mit der Geschichte nicht mehr Schritt halten. Die Beamten begannen an ihrer Mission zu zweifeln. »Es gab entweder wir machen auf, oder wir werden überrannt«, sagte Stasi-Hauptmann Günter Weller. »Wir sind genauso DDR-Bürger wie die dort hinter dem Schlagbaum, die rauswollen. Warum sollten wir uns dann mit Waffengewalt oder mit sonst irgendwas wehren, wo es nichts mehr zu wehren gab? Als Soldat hat man doch einen Überblick, inwieweit die Situation heranreift und ob noch was zu retten oder nicht mehr zu retten ist. Und da gab es nichts mehr zu retten.«
Die Menschenmassen drängten mit solcher Macht auf den Grenzübergang zu, dass sich die sogenannten Hinterlandzäune verbogen. Oberleutnant Jäger hatte zuvor »stillen Alarm« ausgelöst und damit alle erreichbaren Grenzer angewiesen, zum Kontrollpunkt zu kommen. Er verfügte aber immer noch nicht über mehr als fünfzig Einsatzkräfte, die Hunderten von Bürgern gegenüberstanden. Es war zu spät.
Jäger kam es vor, als würde sich ein Druck bis zur Explosion aufbauen. Er hatte vorher noch nie erlebt, dass ihm kalter Schweiß den Rücken herunterlief. Im Bauch fühlte er ein Kribbeln. Er habe keine Angst empfunden, wohl aber gewusst: »Jetzt musst du entscheiden, spätestens jetzt musst du etwas tun. Egal, was kommt.«
Oberleutnant Harald Jäger gab den Befehl: »Jetzt Kontrollen einstellen. Alles rauslassen.«
Der Schlagbaum wurde geöffnet. Einige Grenzer versuchten noch halbherzig, ihn festzuhalten. Auf den Bildern, die Spiegel TV später zeigte, sah es aus, als wollten sie sich selbst an den Schlagbaum klammern. Dann gaben sie auf und blickten fassungslos auf das, was sich vor ihren Augen, an ihrem Grenzübergang abspielte. Unkontrolliert strömten die Ostberliner gen Westen. Der Staat hatte einen bedeutenden Teil seiner Macht aufgegeben, um sie nicht ganz zu verlieren. Der Versuch, die DDR mit einer Mauer vor dem Exodus zu bewahren, war nach achtundzwanzig Jahren gescheitert.
Jäger ging zum Leitzentrum und rief bei seinem Vorgesetzten Oberst Ziegenhorn an. »Wir konnten es nicht mehr halten. Wir haben alles aufgemacht. Wir haben die Kontrollen eingestellt.«
»Ist gut«, antwortete der Stasi-Oberst, der für den Kontrollpunkt Bornholmer Straße verantwortlich war. »Ist gut.«
Das war alles. Er gab keine Befehle mehr. Später erschoss sich Oberst Ziegenhorn mit seiner Dienstpistole.
Den DDR-Grenzern verschlug es die Sprache, als die Menschen an ihnen vorbeizuströmen begannen. »Es war so etwas wie eine Lähmung bei uns, bei jedem Einzelnen«, sagte später Hauptmann Weller, »weil nun keiner gewusst hat, was wird. Wie reagieren die Menschen? Und dafür habe ich nun sechsunddreißig Jahre die Uniform geschleppt.«
Oberleutnant Jäger, der den Befehl zur Öffnung gegeben hatte, sagte sich: »Irgendwas hast du falsch gemacht. Eigentlich solltest du ja die Grenze sichern. Es war ja unsere Aufgabe, die Staatsgrenze der DDR sicher zu halten. Das hast du nicht getan.« Er fühlte sich als Verlierer des Kalten Krieges: »Ich hatte ja verloren. Ich musste nachgeben. Ich habe also meine Kampfaufgabe nicht erfüllt.« Andererseits überlegte er, was wohl gewesen wäre, wenn er »das Ding« zugehalten hätte. »Auf eine Art kommt man sich stolz vor, freudig. Auf andere Art kommt man sich wieder erniedrigt und gedemütigt vor.«
Erst später erfuhren die Grenzer, dass sie die Ersten gewesen waren, die den Widerstand aufgegeben hatten. Zu den anderen Grenzübergangsstellen bekamen sie keinen Kontakt in dieser Nacht der Nächte.
Währenddessen saß ich im Hamburger Studio an der Schreibmaschine. Die Nachrichtenlage war dürftig, aber ich zweifelte nicht daran, dass unser Kamerateam an der richtigen Stelle sein würde. Ich studierte die Agenturmeldungen.
Do, 09. 11. 1989, 19.04DDR/Reise/Eilt!!!!
Von sofort an Ausreise über innerdeutsche Grenzstellen möglich.
Do, 09. 11. 1989, 19.13 Die DDR-Grenze zur Bundesrepublik ist von sofort an zur Ausreise offen: DDR-Bürger können jetzt ohne den Umweg über andere Länder wie Ungarn und die Tschechoslowakei in die Bundesrepublik und nach Westberlin ausreisen.
Eine entsprechende Empfehlung des SED-Politbüros wurde im Vorgriff auf das neue Reisegesetz vom Ministerrat am Donnerstag verabschiedet. Es tritt sofort in Kraft. Dies teilte das SED-Politbüromitglied Günter Schabowski am Donnerstag bei einer Pressekonferenz zur Tagung des SED-Zentralkomitees in Ostberlin mit.
Do, 09. 11. 1989, 19.21 Die sensationelle Nachricht platzte mitten in die Internationale Pressekonferenz, die Schabowski zum zweiten Mal nach Mittwoch in Ostberlin gab. Danach werden die Genehmigungen zu Ausreise und Privatreisen kurzfristig erteilt.
Das SED-Politbüromitglied sagte: »Mir ist eben mitgeteilt worden, dass eine solche Mitteilung heute schon verbreitet worden ist … Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässen und Verwandtschaftsverhältnissen beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt.«
Do, 09. 11. 1989, 20.10CDU/CSU-Fraktionsgeschäftsführer Friedrich Bohl erklärte am Donnerstagabend in Bonn, jetzt seien SED und DDR-Führung aufgefordert, auch vor dem entscheidenden Schritt, der Beseitigung der Mauer, nicht zu zögern. Sie habe ihren grausamen Zweck endgültig verloren, betonte er. »Wir fordern die Verantwortlichen in der DDR auf, sofort morgen mit dem Abriss der Mauer zu beginnen.«
Do, 09. 11. 1989, 20.13 Schabowski erklärte, ein Datum für Neuwahlen stehe noch nicht fest. Die SED sei für eine pluralistische Meinungsgesellschaft. Im neuen Reisegesetz sehe man auch die Chance, durch Legalisierung und Vereinfachung der Ausreise die Menschen aus einer »psychologischen Drucksituation« zu befreien.
Do, 09. 11. 1989, 20.38 Ostberlin (dpa) – Für die DDR-Ausreise ist nach Angaben des Innenministeriums nur ein Personalausweis nötig, um ein Visum zu erhalten.
Do, 09. 11. 1989, 21.27 Washington (dpa) – Die US-Regierung hat die Entscheidung Ostberlins über die Öffnung der Grenze zur Bundesrepublik am Donnerstag begrüßt. Außenminister James Baker sprach von einer »sehr positiven Entwicklung«. Der Sprecher des Weißen Hauses, Marlin Fitzwater, sagte, dies könnte ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu »friedlichen und evolutionären demokratischen Reformen« in der DDR sein. Der Mehrheitsführer der Demokraten im Senat, George Mitchell, meinte, jetzt sei es an der Zeit, auch die Mauer einzureißen. Der republikanische Minderheitsführer Robert Dole nannte die Vorgänge »atemberaubend«. Fitzwater bot der Bundesrepublik zugleich die Hilfe der USA angesichts des Stroms der DDR-Flüchtlinge an.
Do, 09. 11. 1989, 22.08 Kohl will Kontakt und Treffen mit Krenz und Modrow.
Do, 09. 11. 1989, 22.38US-Präsident George Bush hat die »dramatische« Entscheidung über die Öffnung der DDR-Grenze zur Bundesrepublik »begrüßt« und sich »hocherfreut« darüber geäußert. Im Weißen Haus in Washington sprach er am Donnerstag vor Journalisten von einer »dramatischen Entwicklung … in Richtung Freiheit«, die der Berliner Mauer nur noch »sehr wenig Bedeutung« auf der politischen Landkarte Europas gebe. Bush ließ die Erwartung durchblicken, dass sich DDR-Bürger, die zurzeit noch mit Ausreisegedanken spielten, vielleicht demnächst fragen könnten: »Wir können uns frei bewegen. Wäre es nicht besser, dass ich mich an den Reformen aktiv beteilige, die in meinem Land stattfinden?«
Dann begannen die Tagesthemen. Hanns Joachim Friedrichs moderierte. »Im Umgang mit Superlativen ist Vorsicht geboten«, sagte er, »sie nutzen sich leicht ab. Heute darf man einen riskieren: Dieser 9. November ist ein historischer Tag. Die DDR hat mitgeteilt, dass ihre Grenzen ab sofort für jedermann geöffnet sind. Die Tore der Mauer stehen weit offen.«
Die ARD schaltete um zu Robin Lauterbach, der vor dem Grenzübergang Invalidenstraße stand. Doch dort geschah nichts. »Gespanntes Warten hier am innerberliner Grenzübergang Invalidenstraße. Journalisten und Neugierige hoffen, hier schon heute Abend den DDR-Bürger zu treffen, der als Erster aufgrund der neuen Bestimmungen ausreisen darf. Und sei es auch nur, um am Kurfürstendamm ein Bier zu trinken.«
Nach einem kurzen Rückblick auf die Geschichte der Mauer sah Berlins Regierender Bürgermeister Momper schon die Menschenmassen aus dem Osten Westberlin überschwemmen: »Wir dürfen nicht verzagen vor der Größe der Aufgabe, die auf uns zukommt, und in dem Moment sagen: Oh, es wird schwierig werden, so viele werden kommen, der eine oder andere wird hierbleiben wollen, wie wollen wir die alle unterbringen?«
Dann schaltete der Sender zurück in die Invalidenstraße. Der Reporter sagte: »Die Lage an den innerstädtischen Grenzübergängen ist im Moment recht konfus und unübersichtlich. Hier hat sich am ganzen Abend noch nichts getan.«
Anders sei es aber an anderen Grenzübergängen, beispielsweise in der Bornholmer Straße. Er hielt einem Mann in Trainingsjacke sein Mikrophon hin, der gerade von dort kam. »Ich habe erlebt, dass um 21.25 Uhr das erste Pärchen tränenaufgelöst auf uns zugelaufen kam. Als sie die Westberliner weiße Linie erreicht hatten, sind mir beide um den Hals gefallen, und wir haben alle gemeinsam geweint.«
Jetzt war die Mauer weit geöffnet. Die Menschen strömten vom Osten in den Westen. Dafür wäre man achtundzwanzig Jahre lang erschossen worden. Bilder wie diese hatte es bis dahin nicht gegeben.
Und in diesem Moment schrieb ich jenen ersten Satz meines Kommentars: »Das war der Tag, an dem der Zweite Weltkrieg zu Ende ging …« Ich zögerte. War das nicht etwas übertrieben? Sollte jetzt wirklich die gesamte Nachkriegsordnung, die Teilung Deutschlands, die Teilung Europas zu Ende sein? Ich schränkte die Aussage etwas ein, indem ich fortfuhr: »Jedenfalls für jene sechzehn Millionen Deutschen, die unter den Folgen am längsten zu leiden hatten – die DDR-Bürger.
Aber nicht nur für sie.
Kein Zweifel: Die Öffnung der Grenzen ist das Ende eines Obrigkeitsstaates. Der Anfang der Demokratie.
In einer geschlossenen Anstalt können die Insassen herumkommandiert werden. Sobald die Tür offen ist, hat die Obrigkeit ausgespielt. Wer sich jederzeit verabschieden kann, ist kein rechtloser Untertan mehr.
Kein Zweifel: eine historische Stunde.
Die DDR-Führung hat das einzig Richtige getan: die Flucht nach vorn. Sie behebt damit einen wesentlichen Grund für die Flucht ihrer Bürger – nämlich das Eingesperrtsein. Das ist so banal, wie es grotesk war zu glauben, ein Land könnte durch eine feste Grenze stabilisiert werden.
Diese Lebenslüge, seit dem Tag des Mauerbaues in Berlin, hat verhindert, dass aus der DDR ein Staat werden konnte, in dem Menschen gern und freiwillig lebten.
Dieser Tag ändert alles. Wer seine Bürger nicht festhalten kann, muss um ihre Zustimmung werben. Das ist die Aufgabe des absoluten Machtanspruchs der SED. Falls in dieser unkalkulierbaren Zeit nicht eine Katastrophe eintritt, die auszumalen man sich besser hüten sollte, ist der Weg vorgezeichnet – freie Wahlen, ein Mehrparteiensystem.
Wie aber der zukünftige Staat DDR aussehen wird – das müssen seine Bürger entscheiden. Die dagebliebenen. Oder die wieder zurückgegangenen.
Und wenn Bürger freiwillig Bürger eines Staates sind, und nicht zwangsweise, wird sich die Frage der Staatsbürgerschaft neu stellen – Wiedervereinigungsgebot des Grundgesetzes hin oder her.«
Dass an diesem Abend auch der Weg in die Einheit begonnen hatte, konnte ich mir nicht vorstellen. Zu stark, zu mächtig erschien immer noch das Sowjetreich. Anzunehmen, dass Staats- und Parteichef Michael Gorbatschow die Satellitenstaaten, von Polen bis zur DDR, von Bulgarien bis zu den baltischen Ländern, aufgeben würde, schien unvorstellbar. Trotz Glasnost und Perestroika.
Ich schrieb weiter: »Die DDR-Führung hat mit ihrer Entscheidung, die Grenzen zu öffnen, auch ein Stück Problem an die Bundesrepublik delegiert. Bisher haben wir anklagend, manchmal mit der Hybris des Bessergestellten, auf die Mauer hingewiesen, dieses Stein gewordene Monument von Unterdrückung und Unzulänglichkeit, diesen monumentalen Offenbarungseid eines sich sozialistisch nennenden Staates. Jetzt werden Flüchtlings- oder besser gesagt Aussiedlerzahlen vorwiegend unser Problem sein.
Dreißig, vierzig Jahre hat man gerufen: Macht das Tor auf! Und jetzt, da es offen ist? Konzepte, Ideen? Wie das Wirtschaftsgefälle beseitigen – ohne, worauf einige sicher spekulieren, die DDR zu kaufen, zu kolonialisieren? Die Probleme beginnen erst richtig. Die Mauer hat auch uns geschützt – vor dem Nachdenken nämlich.
Ein historischer Tag auch noch in einem anderen Sinne: die erste gelungene deutsche Revolution. Friedlich.
Und wir waren dabei.«
Mir kamen leichte Zweifel, ob ich mich in meinen Einschätzungen nicht zu weit vorgewagt hatte. Ich sprach den Text trotzdem an diesem Abend gegen 23.00 Uhr in die Kamera. Wenige Tage und Wochen später war klar, dass ich zwar weiter gegangen war als jeder andere Kommentator in dieser Nacht, aber längst nicht weit genug. Die Wirklichkeit war schneller als alle Gedanken.
Im Bundestag wurde zu später Stunde die Nationalhymne gesungen: »Einigkeit und Recht und Freiheit«, und manche unkten schon, bald werde es wieder »Deutschland, Deutschland über alles« heißen.
In Berlin sangen die Bürger aus Ost und West die Hymne der Fußballfans: »Deutschland olé.« Wiedervereinigung als Freundschaftsspiel.
Noch vor Mitternacht hatte die Volkspolizei alle Formalitäten aufgegeben. Es war die Stunde null zwischen Vergangenheit und Zukunft.
So zerbrach die am stärksten gesicherte Grenze der Welt am Ende, weil eine Handvoll ihrer Bewacher sie nicht mehr schützen konnte gegen das Volk und nicht mehr schützen wollte. Zeitenwende. Der Fall der Mauer beendete abrupt das sozialistische Experiment DDR, das nur in einer geschlossenen Gesellschaft funktionieren oder eben nicht funktionieren konnte. Es war der Moment, in dem die DDR zerbrach, und nicht nur sie. Die gesamte Nachkriegsordnung, die Teilung der Welt in Ost und West, in zwei Systeme, löste sich in dieser Nacht auf. Es war jener historische Augenblick, der vierundvierzig Jahre nach Kriegsende das wirkliche Ende des Krieges markierte. Kaum einer, der das in dieser Nacht nicht spürte. Und kaum einer, der in dieser Herbstnacht des Jahres 1989 Zeit hatte, die wirkliche Tragweite der Ereignisse zu reflektieren. Die Vorgänge selbst waren schon überwältigend genug.
Tageswechsel: Freitag, 10. November 1989. Zwei Minuten nach Mitternacht vermerkte der Bericht der Volkspolizei: »Alle Grenzübergangsstellen geöffnet … Fahrzeugstau und erste Beschwerden der Anwohner an der Bornholmer Straße.«
Ein gutes Jahr später, nach Wende und Wiedervereinigung, leistete sich der Mann, der den Schlagbaum geöffnet hatte, eine Reise auf die Ostseeinsel Bornholm, nach der die Straße seines Grenzkontrollpunktes benannt worden war: »Wir haben damals zu Dienstzeiten rumgeflachst, man müsste mal einen Dienstausflug nach Bornholm machen. Eine Gaststätte mieten, ein Kollektivvergnügen machen. Dann, nach der Wende, habe ich zu meiner Frau gesagt, das Erste, was ich mache: Wir fahren mal zur Insel Bornholm. Die will ich sehen, die Insel. Da wollte ich meinen damaligen Traum auch mal verwirklichen.«
Stasi-Hauptmann Weller leistete sich eine Reise nach Mallorca: »Da gab es Plantagen von Mandarinen und Apfelsinen- und Zitronenbäume an den Häusern. Man kann die Zitronen abpflücken. Das hab ich noch nie gesehen, einen Zitronenbaum. Das kannte man nur aus Büchern, aber in der Natur das zu sehen, das war sehr beeindruckend.« Der Träger der Medaille für vorbildlichen Grenzdienst blickte zurück: »Das hätte man auch vorher erlauben können, zu DDR-Zeiten. Wer bleibt schon auf Mallorca?«
Doch so weit war es in dieser Nacht noch nicht. Auf einer Brücke trafen sich im Gedränge ein Mann aus dem Osten und eine Frau aus dem Westen. Zufällige Begegnung am Rande der Geschichte. »Hallo, mein Gott, Walter!« Sie fielen einander um den Hals. Tränen liefen über ihr Gesicht. »Kannst du dir vorstellen, dass das so bleibt?«
Das Kamerateam von Spiegel TV hatte die Bornholmer Straße verlassen und war zum Brandenburger Tor gefahren. In rötlichem Licht marschierten dort Einheiten der Nationalen Volksarmee auf. Die Soldaten warfen gespenstische Schatten an die Mauer. Sie sollten den »antifaschistischen Schutzwall« vor dem Volk schützen. Hier, am Symbol der Teilung, war die Nervosität am größten. Auf beiden Seiten.
In dieser Nacht war alles möglich. Auch die letzte Bastion der deutschen Teilung wurde genommen: das zugemauerte Brandenburger Tor. Zunächst erklommen die Menschen vom Westen her die Krone der Mauer, die in einem eleganten Bogen das Brandenburger Tor nach Westen hin absicherte. Obwohl die Mauer selbst zum Ostterritorium gehörte, griffen die DDR-Truppen nicht ein.
Diese Zurückhaltung wirkte wie ein Signal. Zunächst sprangen zwei Männer von der Mauer und gingen in Richtung Osten auf das Tor zu. Niemand hielt sie auf. Ein DDR-Grenzer im langen Mantel machte sogar eine einladende Handbewegung.
Das ermunterte andere. Und erst wenige, dann immer mehr, sprangen von der Mauer, nahmen den Platz vor dem Tor in Besitz, spazierten zwischen den Säulen des Symbols der Teilung durch. Und es fiel kein einziger Schuss.
Dann näherten sich die Menschen auch vom Osten her. Der Mut zur Grenzüberschreitung traf auf die strikte Anweisung der neuen DDR-Führung, jede Konfrontation zu vermeiden, auf keinen Fall zu schießen.
Man half sich gegenseitig auf die Mauer und wieder herunter. Eine Zwingburg wurde so in Besitz genommen. Das erste Graffito auf der Ostseite nahm die Zukunft vorweg: »Die Mauer ist weg.«
Das Team ging mit laufender Kamera unter dem Brandenburger Tor durch und filmte die Ostberliner, wie sie die Befestigungsanlage von innen her einnahmen. Das Bauwerk war an dieser Stelle über drei Meter breit.
Schließlich hatten sich die Grenzer von ihrem Schrecken erholt. Es nahte die Volkspolizei mit einem Lautsprecherwagen. Der Staat rief seine Bürger zurück: »Berliner, verlassen Sie das Brandenburger Tor …«
Man wollte das Grenzregime zurückerobern. Bisher hatten deutliche Aufforderungen immer gewirkt. »Bürger der Hauptstadt, verlassen Sie umgehend den Platz.«
Die Menschen fügten sich. Volkspolizisten formierten sich zu einer Kette und drängten die Menschen freundlich, aber unerbittlich zum Rückzug. »Gehen Sie bitte zurück. Sie werden aufgefordert, zurückzugehen.«
Die Bürger zeigten sich flexibel: drei Schritte vor, zwei zurück, aber dann wieder drei Schritte vor, eine Nervenprobe für beide Seiten. Dann waren Ruhe und Ordnung wiederhergestellt. Bis eine einzelne ältere Frau erschien und auf die Volkspolizisten zutrat. Man versperrte ihr den Weg. Mit Tränen in den Augen sagte sie: »Wenn ihr alle so weitermacht, kommen wir nicht dazu, und zwar überhaupt nicht mehr …«
Sie hatte das Brandenburger Tor ein paar Minuten zu spät erreicht. Einmal unter ihm durchgehen, das wollte sie, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Realität wie auf der Theaterbühne. Die Szene, eingefangen von Spiegel-TV-Kameramann Rainer März, wurde zum Symbol dieser Nacht, in der sich alles änderte.
»Lasst sie rüber«, riefen Einzelne aus der Menge der Beobachter. »Rüberlassen!«
Noch zögerten die Grenzer, sie hatten ihre Anweisungen. Doch sie wussten, dass sie hier auf verlorenem Posten standen.
»Ich geh auch wieder zurück, das schwöre ich Ihnen beim Leben meiner Kinder. Zwei Jungs sind bei der Armee, möchte ich Ihnen noch sagen. Die tun ihre Pflicht wie Sie, und zwar drei Jahre. Beide! Der eine möchte anschließend studieren. Lehrer werden will er, in dieser, unserer Republik. Ist das alles so schwer zu verstehen?«
Und sie verstanden es, die Grenzsoldaten. Die Frau wurde von einem Offizier zum Brandenburger Tor begleitet.
Wieder forderten die Volkspolizisten die Menge auf, den Platz zu räumen, freiwillig. »Hier passiert heute nichts mehr«, sagte einer von ihnen.
Diese Prognose hielt nicht lange. Dann folgte vom Westen her die nächste Besucherwelle, und auch Ostler kamen von ihrem Kurztrip in den Kapitalismus zurück. Der Ausnahmezustand nahm kein Ende. Die Grenzbewacher konnten nur noch so tun, als hielten sie die Stellung.
Eine junge Frau schilderte der Menge und den zuhörenden Uniformträgern ihre Expedition nach Westberlin. »Die ganze Stadt ist voll«, sagte sie begeistert. »Westberlin: Alle Autos hupen, alle jubeln, alle freuen sich. Ihr glaubt es nicht! Es ist alles voll. Ihr freut euch auch, bestimmt, auch wenn ihr nicht so ausseht.«
Ein junger Volkspolizist lächelte.
Reporter Georg Mascolo und Kameramann Rainer März hatten alles im Bild eingefangen. So dicht an den Ereignissen war in dieser Nacht kein anderes Team.
Spiegel TV war achtzehn Monate zuvor, am 8. Mai 1987, auf Sendung gegangen. Die erste Szene des neuen Magazins war eine Flugaufnahme vom zerbombten Berlin. Darunter der Ton einer alten Radiosendung: »Am 8. Mai, dreiundzwanzig Uhr, schweigen die Waffen …«
Und weiter im Text: »Heute vor zweiundvierzig Jahren: Kriegsende, Tag der Kapitulation, Tag der Befreiung. Der Großdeutsche Rundfunk verabschiedete sich und Großdeutschland mit der Kammermusikversion der Nationalhymne.
Am Ende wurden 55 Millionen Tote gezählt: 7,35 Millionen Deutsche, 6 Millionen Polen, 320000 Amerikaner, 537000 Franzosen, 390000 Engländer, 20 Millionen Russen, 485000 Jugoslawen, 5,7 Millionen KZ-Morde, vor allem an Juden.
570000 deutsche Luftkriegsopfer.
In zwölf Jahren, davon die Hälfte Krieg, hatten die Nationalsozialisten etwas geschafft, was deutschen Politikern bis dahin noch nie gelungen war. Ein ganzer Kontinent lag in Trümmern.«
Niemand in der Redaktion erahnte, dass knapp anderthalb Jahre später die Nachkriegszeit vorbei war, dass wir darüber berichten konnten, wie die Mauer fiel, wie die Teilung Deutschlands und der Welt zu Ende ging. Dass wir mit unseren Kamerateams im bis dahin streng abgeriegelten deutschen Osten so frei recherchieren und filmen konnten wie in keinem anderen Land der Welt.
In der Zeit zuvor hatte die junge Truppe, die aus einem guten Dutzend Reportern bestand, die Sendung aufgebaut, über Waffenschmuggel berichtet, über Drogenhandel, über Hausbesetzer, Politik und Prostitution.
Dann kam der Sommer 1989. Es rumorte im Ostblock. Der Axel Springer Verlag, der jahrzehntelang den Namen »DDR« nur in Anführungszeichen geschrieben hatte, ließ plötzlich die Gänsefüßchen weg. Das konnte nicht gutgehen.
Es wurde der letzte Sommer der DDR.
Der letzte Sommer der DDR
Rückblende
Hans-Dietrich Genscher verkündet am 30. September in Prag die Ausreiseerlaubnis für Botschaftsbesetzer. Einige tausend DDR-Flüchtlinge werden in Sonderzügen in die Bundesrepublik gebracht. Am 3. Oktober riegelt die DDR die Grenze zur Tschechoslowakei ab und setzt den pass- und visafreien Reiseverkehr aus.
(Diese Regelung wird am 1. November wieder aufgehoben.)
Ein junges Mädchen schlich hastig und hechelnd, mit geducktem Oberkörper durch ein mit hohem Schilf bewachsenes Gelände. Hinter ihr, mit laufender Videokamera, ihr Freund. »Rechts. Ganz langsam«, keuchte er. »Pass auf, wo du hingehst. Langsam, langsam, ganz langsam.« Und kurz darauf: »So … wir haben es geschafft. Siehst du? Wir sind in Österreich. Guck mal!« Die beiden fielen einander in die Arme. Die Kamera wackelte.
Wir sahen uns die Szene auf dem Schneidetisch an. Da hatten sich zwei aus der DDR abgesetzt und ihre eigene Flucht gefilmt.
Sie hatten es geschafft. Für sich selbst und für das Land, aus dem sie geflohen waren. Es wurden die letzten Sommerferien der DDR. Mehr als dreißigtausend Bürger der Deutschen Demokratischen Republik machten sich im Juli und August 1989 über die Nachbarstaaten auf und davon. Endgültige Ferien vom Sozialismus. Und bald auch für den Sozialismus.
Vor allem die Hauptstadt der Tschechoslowakei, des sozialistischen Bruderlandes der DDR, wurde zum sinnbildlichen Zwischenstopp ganzer Bevölkerungsteile auf dem Weg nach Westen. Ziel der sommerlichen Polit-Reisewelle: die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Prag. Die neue Freiheit begann hinter Gittern im Schlamm der diplomatischen Immunität. Innerhalb weniger Tage suchten hier über viertausend Flüchtlinge Asyl und damit einen Weg, endlich in den westlichen Teil der Welt ausreisen zu dürfen.
Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher reiste an, um die Genehmigung für den ersten legalen Massenexodus seit Bestehen der DDR zu verkünden. »Wir sind zu Ihnen gekommen …«, sprach er vom Balkon der Botschaft. »Ihre Ausreise …« Der Rest seiner Worte ging im Jubel der Massen im Botschaftsgarten unter.
In der Nacht zum 1. Oktober 1989 verließen die ersten sechshundert Besetzer die bundesdeutsche Botschaft Prag in Richtung Bahnhof.
Die Bahnstrecke verlief über Dresden. Gemäß einer Vereinbarung mit Erich Honecker sollte die Reise nach Westen durch das Territorium der DDR führen. Der DDR-Chef wollte noch einmal Souveränität beweisen. Ein schwerer politischer Fehler, wie sich herausstellen sollte.
Es ist gerade noch knapp sechs Wochen hin bis zum Fall der Mauer und genau ein Jahr und zwei Tage bis zur Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990. Niemand hier und niemand anderswo ahnt, welche historischen Folgen all diese Ereignisse haben werden.
Vertreter der Botschaft mahnen zur Eile. »Bitte gehen Sie weiter, steigen Sie in die Züge ein. Sie müssen doch alle mitkommen.« Ein Flüchtling erklärt dem Team von Spiegel TV, was er vorhat: »Wir nutzen die Chance, wir werden etwas tun. Das Beste, alles daraus machen.« Ein Tscheche wünscht: »Viel Glück, alles Gute!« – »Ist klar. Danke schön.« Ein Flüchtling bedankt sich artig: »Danke an die Botschaft, an das ganze Personal.«
Der Zug wird von außen verriegelt. Geschlossene Gesellschaft mit einem anderen Ziel, als es sich die SED vorgestellt hatte. So reisten in den folgenden Tagen rund siebzehntausend Menschen von Prag zum vorerst letzten Mal durch ihre alte Heimat in den Westen. Seit Ungarn im September den Stacheldrahtzaun zu Österreich durchgeschnitten hatte, war die Lebenslüge der DDR tot. Denn von dem Moment an konnte, wenn auch unter Schwierigkeiten, jeder DDR-Bürger sein Land verlassen. Die absolute Gewalt des Staates über seine Untertanen war unwiederbringlich verloren. Die Züge aus Prag sollten der DDR-Führung die Grenzen ihrer Macht demonstrieren.
In der Nacht fuhr der erste Westexpress durch die DDR. Die Flüchtlinge winkten jubelnd aus den Fenstern ihres verschlossenen Zuges.
Überall an der Bahnstrecke, in Dresden und anderswo, erwarteten DDR-Bürger die Züge aus Prag und hofften auf eine Mitfahrgelegenheit. Dresden wurde zur Festung. Volkspolizei und Armeeeinheiten versuchten, den Bahnhof abzuriegeln und Ausreisewillige abzudrängen. Doch Tausende von Jugendlichen probten den Aufstand.
Sie entfachten Feuer auf den Straßen. Die Polizei griff mit Wasserwerfern an. Amateurfilmer drehten, wie eine Frau von Volkspolizisten malträtiert wurde. Die aufgebrachte Menge stimmte die bis dahin nur im Stillen geäußerte Kampfparole gegen »Schwert und Schild der Partei« an und skandierte: »Stasi raus, Stasi raus …« Es war die erste Straßenschlacht in der DDR seit sechsunddreißig Jahren. Und der Staat traute sich nicht mehr, scharf zu schießen.
In der Morgendämmerung des 5. Oktober 1989 rollte nach elf Stunden Fahrt der erste von acht am Abend zuvor eingesetzten Sonderzügen im bayerischen Hof ein. Weitere zehntausend DDR-Bürger kehrten an diesem einzigen Tag ihrer sozialistischen Heimat den Rücken, manchmal Hals über Kopf, ohne Rücksicht auf Verluste.
»In Dresden haben sie abgeräumt auf dem Bahnhof«, sagte einer beim Verlassen des Zuges einem Reporter. »Nur Polizei. Das war Ausnahmezustand … Und meine Frau ist ja noch dort.«
Ein amerikanischer Reporter fragte die Angereisten: »Can I ask you how do you feel, now that you are here in the West?«
»We are feeling very good here. It’s a very good feeling«, antwortete ein junges Mädchen.
»Why?«
Das Mädchen blickte hilfesuchend in die Runde. »Was heißt denn Freiheit?«
»Freedom?«
»Yes!«
Im Herbst 1989 lag der Geruch der Freiheit in der Luft. Mit Glasnost und Perestroika hatte Michael Gorbatschow nicht nur in der Sowjetunion die Wende eingeleitet. Überall in der DDR begann das marode System zu bröckeln. Die Bürger spürten, dass der Staatsmacht die Macht entglitt.
Ein Spiegel-TV-Team hatte bei den Vorbereitungen zum vierzigsten Geburtstag der DDR gefilmt. Countdown zur großen Parade. Christiane Meier und Kameramann Dieter Herfurth drehten in Ostberlin, Thomas Schaefer und Rainer März in Polen, Gunther Latsch in Prag. Es wurde eine Reportage über DDR-Bürger zwischen Flucht, Resignation und Rebellion: »Deutschland – im Herbst 1989. Eine Staatsgrenze hat Geburtstag. Östlich des Zaunes leben 16,7 Millionen Bürger. Zurzeit werden es täglich weniger. Exodus zum Jubelfest.«
Am 4. Oktober begannen die Feierlichkeiten mit einem Fahnenappell der Volksarmee. Gefeiert wurde nicht nur das Jubiläum, sondern in diesem Fall speziell auch die Abkehr von Faschismus und Militarismus. »Fahnenkommando halt – Fahne sinkt«, brüllte der Offizier. Honecker salutierte. Dann wurde die Nationalhymne der DDR gespielt. Auferstanden aus Ruinen. Ständige Erinnerung an die Stunde null. Jeder Fortschritt in der DDR wurde gemessen an der Zeit bis 45.
Es war ein Weg, den von Anfang an nicht alle mitgehen wollten. Bevölkerungsrückgang seit 1946: drei Millionen.
Auf einem Festempfang hob Erich Honecker das Sektglas und rief mit brüchiger Stimme: »Auf unseren Nationalfeiertag, den vierzigsten Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik.« Die DDR – vierzig Jahre jung. Und dennoch greisenalt.
An einem Nachmittag, drei Tage vor der sozialistischen Feierinszenierung, fingen die Reporter eine Szene vor der amerikanischen Botschaft in Ostberlin ein. Achtzehn DDR-Bürger hatten sich in die US-Vertretung geflüchtet, weitere wurden abgewiesen. Ein Botschaftsangehöriger streckte seinen Kopf zur Tür heraus: »Entschuldigung, es tut mir leid, aber Sie müssen sich …« Der Rest der Worte ging im Tumult unter. Die Menge versuchte, das Gebäude zu stürmen, obwohl Volkspolizisten danebenstanden.
Torschlusspanik. Nichts wie weg, solange es noch ging. Der Respekt vor Regeln und Uniformen hatte rapide abgenommen. Und vor westlichen Fernsehkameras hielten sich die volkseigenen Beamten zurück.
Ein Volkspolizist mischte sich vorsichtig ein: »Nehmen Sie doch die Kinder hier raus.«
»Hau ab, du Vopo«, antwortete die angesprochene Frau.
Der Ordnungshüter besann sich auf seine Amtssprache: »Sie behindern die Tätigkeit der Botschaft. Deswegen sollen Sie hier weggehen.«