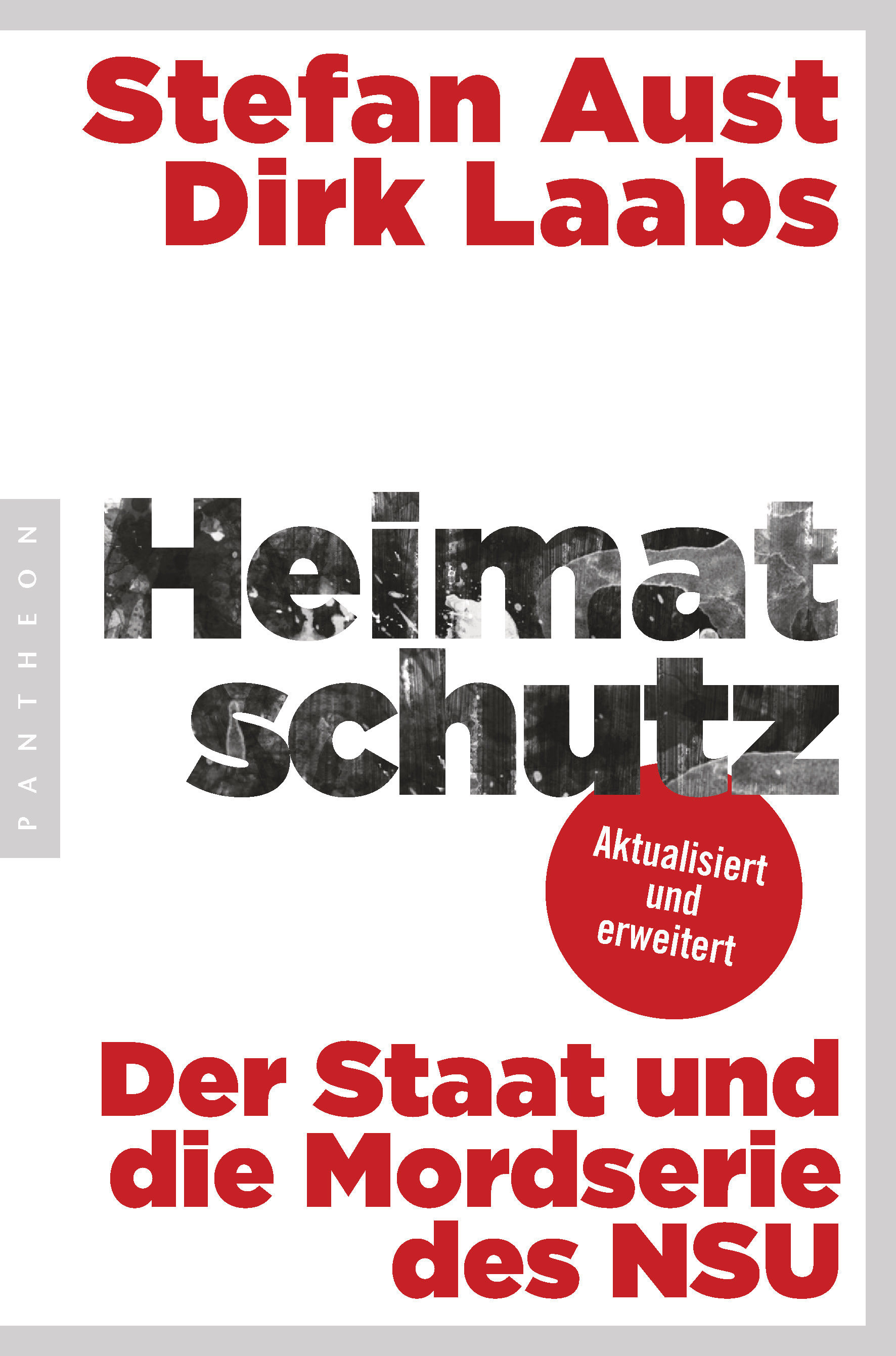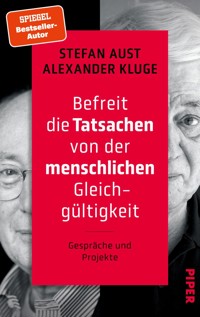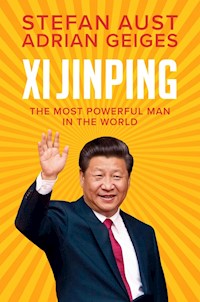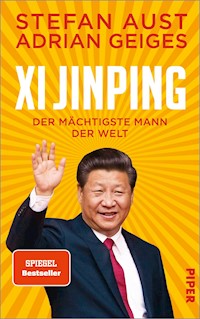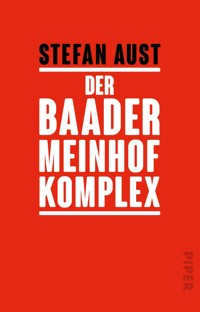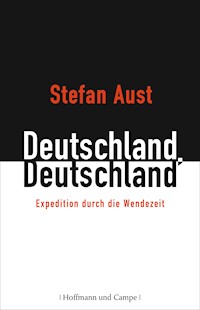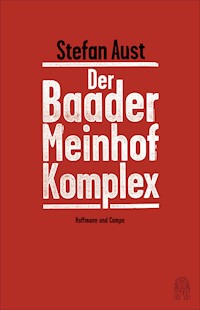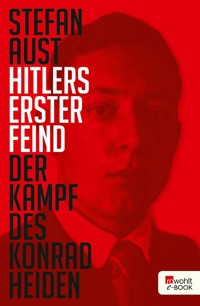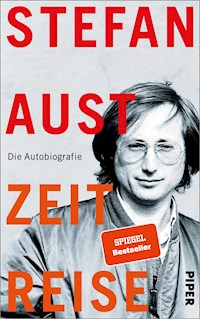
17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Berühmte Recherchen, die RAF und Zeitgeschichte aus der ersten Reihe – der große Journalist erzählt
Berühmte Recherchen, die RAF und Zeitgeschichte aus der ersten Reihe – der große Journalist erzählt
»Es wurde mir von Tag zu Tag deutlicher bewusst, welches Privileg es war, als ›so eine Art Journalist‹, wie ich immer gern gesagt hatte, am Straßenrand der Geschichte zu stehen.«
Wenige Menschen waren bei den großen zeitgeschichtlichen Ereignissen der letzten Jahrzehnte so oft mittendrin wie Stefan Aust. Seine Autobiografie ist auch ein Rückblick auf seine journalistische Arbeit, hier folgt man nicht nur den Stationen eines ereignisreichen Lebens, sondern erhält auch tiefere Einblicke in seine Recherchen. So entsteht ein Panorama bundesdeutscher und internationaler Politik; es ist zugleich Zeitzeugnis, Hintergrundbericht und die Abenteuergeschichte eines hoch spannenden Lebens.
»Ich hatte durchaus meine Positionen zu bestimmten Dingen und Ereignissen, aber ich habe mich nie mit einer Sache, auch wenn ich sie für richtig hielt, gemein gemacht. Ich war bei vielen Demonstrationen dabei, habe aber meistens ganz buchstäblich am Straßenrand gestanden, weil ich als junger Journalist – ich war ja gerade Anfang 20 – Abstand zu den politischen Aktivisten der damaligen Zeit halten wollte. Manche Meinungen, wie etwa die Kritik am Vietnamkrieg, habe ich geteilt – ohne aber mit ›Ho-Ho-Ho-Chi-Minh‹ auf den Lippen für den Sieg der nordvietnamesischen Kommunisten und ihres Vietcong Partei zu ergreifen. Und doch steckte man mittendrin, in den Ereignissen der Zeit. Ich war skeptisch. Das war meine Grundhaltung. Skeptisch gegenüber den Regierenden, aber auch skeptisch gegenüber deren Gegnern.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:www.piper.de© Stefan Aust, 2021© Piper Verlag GmbH, München 2021Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, MünchenCovermotiv: Karin RochollKonvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Cover & Impressum
Teil 1
1946 – 1979
Die Elbe
Der Unternehmer
Der Vater
Der Onkel in China
Im Krieg
Die Mutter
Kindheit am Strom
Brunshausen
Das Athenaeum
Der vergessene Atomkrieg
Das Abenteuer »Stader Schlüssel«
Pferdezeit
Die Schülerzeitung
konkret
Die Einberufung
Einfach unpolitisch
Der Schock des 2. Juni
Das Jahr 1968
Eine Reise nach Prag
Das Attentat
Springer-Demonstration
Die Radikalisierung
Die Scheidung
Apollo umkreist den Mond
Reise durch die USA
Generation Vietnam
Golden Gate
Black Power
Across the USA
Weathermen
Rückkehr
Wege in den Untergrund
Der meistgesuchte Mann des FBI
St. Pauli-Nachrichten
Der erste Film zum Baader-Meinhof-Komplex
Baader-Meinhof und andere Themen
Homann taucht auf
Eine Reise nach Sizilien
Hanna – 50 Jahre danach
Besuch von der RAF
Die Beinahefestnahme
Homann stellt sich
Beim Fernsehen
Das Forsthaus
Augstein geht in die Politik
Bei Panorama
Der Terror beginnt
»Sie auf dem Turm und wir unten drin«
Im Gefängnis und auf Hoher See
Expedition nach Nantucket und Hawaii
Unterwegs mit Schleyer
Der Prozess
Der letzte Akt der Rebellion
Jenseits der RAF
Deutschland im Herbst
Tod in Stammheim
Der Nachrichtenhändler
Der furchtbare Jurist
M – ein deutscher Agent
Teil 2
1979 – 1994
Ende des Schweigens
Eine Recherche in Sachen Strauß
Der Kandidat
DDR und RAF
Mauss gegen die RAF
Drehkreuz Ost-Berlin
Hintergrund einer Fahndungspanne
Zurück im Kampfgebiet West
Hausbesetzer
Ein Hilfeersuchen der RAF
Im Krieg
Die Hitler-Tagebücher
Besuch beim Fälscher
Carlos und die Stasi
Ein Film verschwindet
Minna von Barnhelm und der Baader-Meinhof-Komplex
Die Schimmelreiterin
Der Stand der Recherche
Stammheim – der Film
Atomkraft? Nein danke
Die Barschel-Affäre
Das Projekt Spiegel TV
Auf der anderen Straßenseite
Unser 8. Mai
Sekretärin gesucht
Die Neuen vom TV
Die Spielbankenaffäre
Der letzte Sommer der DDR
40 Jahre DDR
Der Fall der Mauer
Die Nacht, die alles veränderte
Reise nach Kaliningrad
Der Stasi-Staat
Demokratischer Aufbruch
Die erste und letzte freie Wahl der DDR
Das Kinderlager von Cighid
Die Konkurrenz
Die RAF-Seniorenresidenz
Geruchskonserven – der Schnüffelstaat
Der Tag der Einheit
Im Czerny – die Enttarnung
Die Recherche »Im Sekretär«
Putsch in Moskau
Lenins Leiche
Randale in Rostock
Rechter Häuserkampf
Die Killer von Medellín
Colonia Dignidad im Chilehaus
Eine Magisterarbeit
Operation VOX
NSU – die Vorgeschichte
Bad Kleinen
Teil 3
1994 – 2009
Im Rücken des Chefredakteurs
Probezeit
Der Hals in der Schlinge
Veränderungen
Mehr Farbe
Volkswagen, Piëch und Cousine Gaby
Das Unternehmen Spiegel TV
Mit Mauss bei der Guerilla
Gefährlich fremd
50 Jahre Spiegel-Vergangenheit
Der ewige Kanzler
Das Bernsteinzimmer-Mosaik
Auf der Suche nach der weißen Stadt
Wahljahr
Hillary und der große Lauschangriff
Kohls rot-grüne Erben
Der rechte Untergrund
Nummer eins der Wochenmagazine
Entführung auf den Philippinen
Das gefährliche Wrack der »Estonia«
Augstein, Hitler und die Paulskirche
Der eigene Sender
Pferdezeit
9/11 – Angriff auf die USA
Schröders zweite Wahl
Augsteins Tod und die Mähne des Löwen
Der angekündigte Krieg
Der Goldschatz von Eberswalde
Gute Botschaften und Sandkastenspiele
Der Windkraftwahn
Die große Welle
Allianz gegen die Rechtschreibreform
Operation Heldentod
Das BMK-Projekt
Wahl zwischen Schröder und Merkel
Suche nach Schuldigen
Flimmern und rauschen
Der Film
Der nicht vorhandene Hut
Das Sommermärchen
Der Sechzigste
Wahlkampf um die Macht im Spiegel
Das Jahr der Höhen und der Tiefen
Der KG-Komplex
Dreharbeiten BMK
Die Auktion
Seikel verlässt den Spiegel
Begegnung mit Giftschlangen
Ein kurzer Blick zurück
Die große Leinwand
Teil 4
2009 – 2021
Auf ein Neues
Die Falle 9/11
Obamas Krieg
Projekt »Die Woche«
Sender zu verkaufen
Expedition Antarktis
Die Zeiten ändern sich
NSU – das mörderische Mysterium
Vier Jahre, die Europa verändern sollten
Anruf in New York
Auf dem Weg zu Mama
Kanzlerin ohne Grenzen
Der neue Job
Die gefährlichste Spezies der Welt
Eine Sonderausgabe zum Siebzigsten
America First
Terroranschlag mit Ansage
Der Zauber des Abschieds
Einmal Kanzler, immer Kanzler
Grüne dürfen träumen
Am Straßenrand der Geschichte
Bildteil
Bildnachweis
Stichwortverzeichnis
Teil 1
1946 – 1979
Zeit, das ist der Abstand zwischen Ursache und Wirkung. In der Physik und genauso in der Geschichte. Und dazwischen liegt unser Leben, unsere persönliche Zeitreise. Manches haben wir selbst miterlebt, miterleben müssen – oder miterleben dürfen. Und manches recherchieren, aufschreiben oder filmen können. Beobachtungen am Rande der Geschichte.
Die Elbe
1091 Kilometer lang sucht sie ihren Weg in die Nordsee. Am Anfang im Riesengebirge ein Bach, am Ende in Cuxhaven ein Strom, der sich breitmacht und in die Nordsee übergeht. Dann ist die Elbe kein Fluss mehr, sondern das Meer selbst. Die Gezeiten prägen die Unterelbe, und manchmal, wenn im Herbst oder im Winter der Nordwestwind das Wasser in die Elbmündung treibt, dann tritt sie über die Ufer, bis an die Deiche heran und manchmal über diese hinweg. Wer an der Elbe aufgewachsen ist, hat sie in den Adern.
Eine der größten Schifffahrtsstraßen der Welt, jedes Jahr transportieren Tausende Schiffe rund 800 000 Kreuzfahrtpassagiere und 8,8 Millionen Standardcontainer von Cuxhaven bis Hamburg. Und wieder zurück, hinaus in die Welt nach Singapur, Shanghai, Hongkong, Sydney, New York, Rio de Janeiro. Hier wurde die Globalisierung erfunden, bevor es den Begriff überhaupt gab. Hier gilt der Blick vom Elbufer auf ein Industriegebiet wie eine Werft oder ein Containerterminal als großartige Aussicht – solange dazwischen Wasser fließt und Schiffe darauf fahren. Und die feine Adresse Elbchaussee ist in eingeweihten Kreisen nur auf der nassen Seite eine wirklich feine Adresse, denn nur die Hausnummern mit den ungeraden Zahlen haben Elbblick.
Von den Hügeln Blankeneses aus kann man dem Kapitän der »Queen Mary 2« auf Augenhöhe begegnen. Und hier findet man in manchen Gärten noch kleine Kajüten mit Steuerrad, wo Seefahrer im Ruhestand über das Wasser blickten und von ihren Reisen über die sieben Weltmeere träumten.
An schönen Tagen ist der feine Strand am Elbufer zwischen Övelgönne und Wedel voll mit Touristen, und auf dem Wasser kreuzen zwischen gigantischen Containerschiffen und den schwimmenden Hotels der Kreuzfahrtschiffe kleine und große Segeljachten und Motorboote hin und her. Ein fröhliches maritimes Durcheinander, in das die Wasserschutzpolizei in ihren blauen Schnellbooten nur eingreift, wenn Sportbootfahrer die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 22 Kilometern pro Stunde allzu auffällig überschreiten. Bis zum Tiensdahl, kurz vor Wedel, gilt die Elbe als Hafengebiet. Dann ist sie offene See – und hat damit theoretisch keine Obergrenze. Diese wird dann durch die Wellen der Schiffsgiganten definiert, die manchem Freizeitkapitän schon zum Verhängnis wurden.
Nur wer in Blankenese geboren ist, gehört wirklich dazu. Alle anderen sind Quittjes, Zugereiste. Auch auf die andere Seite der Elbe blickt der Blankeneser von seinem Treppenviertel eher herab. Nicht dass es alles Villen wären, die hier bunt gewürfelt zwischen engen Gassen eingepfercht einen Blick auf den Strom erlauben. Kapitänshäuser mit Strohdach, Jugendstilvillen und einfache Einfamilienhäuser, moderne Flachbauten und pompöse Gründerzeitpaläste liegen hier Garten an Garten. Eine gewachsene Architektur aus Gegensätzen, vereint durch den »Blankeneser Handlauf«, ein eisernes Treppengeländer, bei dem die senkrechten Stützen an der Spitze eine Öse haben, durch die der daumendicke Handlauf aus massivem Eisen verläuft, zu einer schier endlosen Schlange zusammengeschweißt.
Die andere Seite der Elbe, das ist Hamburg-Harburg mit seinen Seitenarmen der Elbe, die erst in den letzten Jahren mit attraktiven Geschäftsgebäuden aus dem nachindustriellen Dämmerzustand erweckt wurden. So wie der Freihafen, dessen Fläche der damalige Bürgermeister Henning Voscherau klammheimlich zusammenkaufte und wo die Stadt Hamburg ein wirklich visionäres Projekt errichtete, die Hafencity. Gekrönt am Ende mit der Elbphilharmonie. Damit wurde Hamburg, die »schlafende Schöne«, wie Helmut Schmidt sie einmal nannte, zum Leben erweckt.
Die andere Seite der Elbe, das ist auch Airbus. Für die Werkserweiterung wurde auf Kosten der Stadt das Mühlenberger Loch eingedeicht und zugeschüttet – während man die notwendige Fläche im Prinzip auch auf der Landseite hätte haben können. Das war aber niedersächsisches Staatsgebiet. Also wurde zu einer Zeit, als die Elbdeiche zurückverlegt wurden, um im Sturmflutfall dem »Blanken Hans« größere Überschwemmungsgebiete für die Wassermassen zur Verfügung zu stellen, hier wieder eingedeicht.
Je enger das Flussbett von Deichen eingeengt wird, umso höher steigt das Wasser, wenn der Sturmwind es von Cuxhaven in Richtung Hamburg treibt. Dabei kommt die steigende Flut auf halbem Weg an der kleinen Stadt Stade und ihrem noch kleineren Elbhafen an der Schwingemündung vorbei. Hier habe ich meine heidnische Taufe mit dem damals noch deutlich schmutzigeren Elbwasser erlebt. Wir hatten einen kleinen Hof im Außendeich und erlebten deshalb die Sturmfluten des Winters vor der Haustür und einmal auch dahinter.
Der Unternehmer
»Großpapa« war am 16. Mai 1865 im »Silbersack« auf St. Pauli geboren worden, als eines von zehn Geschwistern, sechs Brüdern und vier Schwestern. Sein Vater war »Klockenpüster«, hatte eine Uhrmacherei und war bekannt als Spezialist für das Anfertigen von Chronometern. Im selben Haus wohnten zwei Schiffszimmerleute, durch die der kleine Albert von Kind auf eine Beziehung zur Schifffahrt bekam. Zum Hafen waren es nur ein paar Hundert Meter die Davidstraße hinauf, vorbei an der Herbertstraße und einem schmalen Haus direkt daneben, in dem 1905 das italienische Restaurant Cuneo eröffnet wurde.
Der Lebensplan meines Großvaters war für ihn klar: Er wollte einmal Schiffe besitzen, Reeder sein. Albert besuchte eine Privatschule. Dann schickte sein Vater ihn für drei Jahre nach Lübeck »hinter den Ladentisch«, um dort eine Krämerlehre zu machen. In der dritten Schwadron des Schleswig-Holsteinischen Dragonerregiments Nr. 13 wurde er Soldat. Die Kaserne stand in Metz, und hier mogelte der für den Proviant Verantwortliche angeblich Butter aus dem Margarinefass in die Verpflegung. Albert monierte lautstark das magere Fett. Das galt als schwerer Verstoß gegen die Disziplin, aber der Zahlmeister hatte die Mogelei auch entdeckt und sprang dem Rekruten zur Seite. Als Albert seine Militärzeit als Unteroffizier beendete, hatte er nur acht Strafen mit elf Tagen Arrest abgesessen.
Nach seiner Militärzeit in Metz machte er sich selbstständig – als Adressenschreiber. Für 1000 Adressen – nicht etwa heruntergetippt, sondern handkalligrafiert – gab es drei Mark. Albert wusste die Taler zu sparen. Als Ansichtskarten in Mode kamen, übernahm er die Vertretung für eine Leipziger Firma und verkaufte Alben. Er druckte Postkarten, die ein kleines rundes Foto von ihm oben links in der Ecke trugen, mit Schnurrbart, Stehkragen und einer leicht nach hinten gezogenen Prinz-Heinrich-Mütze. Darunter: »Albert Aust. Reederei, Import, von Rohprodukten u. Erzen, Export von Papierw., spez. Ansichtspostkarten, Hamburg«. Im März 1898 gründete er einen kleinen Postkartenverlag, den »Verlag Albert Aust«. Er beauftragte Seeleute, aus aller Herren Länder Bilder mitzubringen, aus denen er dann Postkarten machte, die von den Seeleuten an die Ursprungsorte in aller Welt zurückgebracht und dort an Postkartenhändler verkauft wurden. Mit der Post kamen sie dann zurück nach Hamburg und anderswo. Besonders aus den damaligen Kolonialgebieten lieferte er Ansichtskarten. Noch heute sind im Museum von Swakopmund in Namibia viele Hundert dieser Karten ausgestellt.
Es war das goldene Zeitalter der Bildpostkarte, und mein Großvater verdiente damit offenbar ein kleines Vermögen – jedenfalls so viel, dass er damit seinen Lebenstraum angehen konnte. Als er erfuhr, dass die Direktion der »Stade-Altländer Dampfschiffahrts- und Rhedereigesellschaft« über einen Verkauf der Schifffahrtslinie auf der Unterelbe nachdachte, machte er ein Angebot. Er bot per Aktie 900 Mark an, zusammen 532 800 Mark – für acht Schiffe, deren Bau einmal 738 382 Mark gekostet hatte, die aber noch mit gerade 302 916 Mark zu Buche standen. Sein Angebot verwandelte die Stader Gesellschaft in einen Hexenkessel. Andere Interessenten trieben den Preis am Ende auf 592 000 gute Goldmark. Dafür konnte er im Oktober 1905 Konzessionen und einige Landungsstege sowie acht ziemlich veraltete Schiffe übernehmen. Außerdem handelte er sich 20 schwierige Jahre ein. Er kaufte Schiffe dazu, brachte den Fahrgastverkehr mit vielen neuen Ideen in Schwung und baute Anleger an den Ufern entlang der Unterelbe. Im Verlauf eines knappen Jahrzehnts wurden aus acht Schiffen zwölf, doch alle waren nicht mehr ganz jugendfrisch.
Dann begann der Erste Weltkrieg und nahm den »Stader Dampfern« die Existenzgrundlage; der Ausflugsverkehr ging massiv zurück, die Vieh- und Stückguttransporte schrumpften, Brennmaterial wurde knapp und teuer. Er musste Schiffe verchartern und gegen Ende des Krieges auch verkaufen.
Danach begann ein schwieriger Wiederaufstieg in der Zeit der Inflation – gegen die Konkurrenz einer mit Hamburger Staatsfinanzen aufgebauten neuen Reederei, der »Hafen-Dampfschiffahrt AG«, der Hadag. Großvater schlug sich anfangs noch wacker. In einem Fahrplanheft für die Jahre 1926 und 1927 finden sich Fotos seiner Schiffe, die Raddampfer »Hamburg«, »Cuxhaven« und »Wittenbergen«, »Stade«, »Concordia« und »Elbe«, die Doppelschraubendampfer »Blankenese«, »Brunshausen«, »Schwinge« und das Motorschiff »Alte Liebe«. Die weißen Dampfer mit gelbem Schornstein und blauem Ring mit weißem Petrusschlüssel, dem Wappen der Stadt Stade, fuhren von den St. Pauli-Landungsbrücken bis Cuxhaven. Rund fünf Stunden dauerte die Reise, je nachdem ob es mit der Tide oder gegen die Tide ging. Im Fahrplanheft wurde der Strom mit blumigen Worten beschrieben: »Ihr mögt den Rhein, den stolzen, preisen, ich lob dich, grünes Land am Elbestrand.«
Stade war einst so mächtig, dass es seit dem Jahre 1038 Elbzoll erhob, selbst dann noch, als es längst vom Elbufer abgedrängt war. Später wurde am Ufer, »bei des Rades brunes Huss, wo de Töllner wohnt«, der Zoll erhoben – daher der Name des Dorfes Brunshausen. Dieser Elbzoll wurde erst 1861 mit 3 Millionen Talern von Hamburg und Hannover abgelöst.
In Blankenese hatte mein Großvater im Jahre 1900 ein gerade fertiggestelltes Haus am steilen Hang des Elbufers gekauft. Das Fundament, Bollwerk genannt, war so massiv und damit teuer geraten, dass der Bauherr, ein englischer Kaufmann, mit der Fertigstellung der schlichten weißen Villa – mit Schieferdach, einem kleinen Garten und einem grandiosen Blick über die Elbe und das gesamte Blankeneser Tal – pleiteging.
Die Reederei meines Großvaters geriet in den Zwanzigerjahren ins Schlingern. Der Hamburger Staat hatte ihr mit immer neuen Schiffen der Hadag Konkurrenz gemacht. Mühsam erreichte er noch das Jahr 1929, doch auch der von ihm um Hilfe angeschriebene Altonaer Bürgermeister Max Brauer konnte ihm nicht mehr helfen. Altona und Hamburg hatten gerade ihre jahrhundertealte Rivalität begraben und im Dezember 1928 den preußisch-hamburgischen Hafen- und Unterelbevertrag unterschrieben. Und so verkaufte Albert Aust schließlich im Februar 1929 seine Reederei an die übermächtige staatliche Hadag. Zusätzlich zum Kaufpreis von 520 000 Reichsmark, mit dem er im Wesentlichen seine Kredite ablösen konnte, bekam er eine Leibrente von 6000 Reichsmark, die dann jeweils an die aktuelle Währung angepasst wurde. Davon lebte er knapp 33 Jahre – bis 1962. Das war seine Rache am Hamburger Staat.
Der Vater
Mein Vater, geboren am 21. Juli 1905, war vor dem Abitur von der Schule geflogen, weil er einen Lehrer im Streit buchstäblich am Portepee gepackt und ihm Schlips und Stehkragen aus Pappe abgerissen hatte. Er machte eine landwirtschaftliche Lehre und wanderte 1924 nach Kanada aus. Zwischen den Kriegen war er 15 Jahre lang in British Columbia, als Cowboy, Trapper und während der Weltwirtschaftskrise auch als Hilfsarbeiter. Aus dieser Zeit hat er uns Kindern nur wenig bis gar nichts erzählt. Während der großen Arbeitslosigkeit hatte er sich ein Pferd gekauft und war damit ein halbes Jahr unterwegs gewesen, von Farm zu Farm, wo er sich mit Gelegenheitsarbeiten durchschlug. Bei einem Imker hatte er hoch im Norden Kanadas die Bienenstöcke versorgt, und einmal war sein Vater aus Deutschland angereist, wie immer mit der Prinz-Heinrich-Mütze auf dem Kopf und im weißen Hemd mit Stehkragen. Sohn Reinhard ließ sich mit nach Hause nehmen, verließ Blankenese jedoch bald wieder in Richtung USA. Dort bemühte er sich einmal erfolglos um die US-amerikanische Staatsbürgerschaft, fiel jedoch beim Wissenstest durch. Er war nach der US-Hauptstadt gefragt worden und antwortete mit »Washington«. Die richtige Antwort wäre gewesen: »Washington DC, District of Columbia«. Er behielt seinen deutschen Pass und die deutsche Staatsbürgerschaft.
Am 29. November 1936 schrieb mein Vater seinen Eltern von der Woodgame Ranch in Horsefly, British Columbia: »Mir geht es, abgesehen von chronischer Schwindsucht im Geldbeutel sehr gut. Die 80 Dollar, die ich im Sommer erhielt, haben sehr geholfen, sind aber trotz größter Sparsamkeit doch alle geworden. Wir lassen trotzdem den Mut nicht sinken. Wir sind hier schon öfter ohne ein Cent Geld im Hause gewesen, aber wir haben doch immer genug zum Essen und zu viel zu tun, um dumme Gedanken zu kriegen.« Die Ranch gehöre dem »Farm Loan Board«, das mit staatlichen Krediten und billigem Geld der Landwirtschaft auf die Beine helfen wolle. Auf der Farm würden Schafe zur Hammelfleischproduktion gezüchtet. All das gefiel seinem geschäftstüchtigen und immer noch wohlhabenden Vater ganz und gar nicht. Er wollte, dass Reinhard, das schwarze Schaf der Familie, nach Deutschland zurückkehrte und nach fast 15 erfolglosen Jahren in der Fremde auf heimischem Boden wieder neu anfangen würde. Curt Müller, der Ehemann von Ilse, der jüngeren Schwester meines Vaters, die zunächst mit ihm in Guatemala lebte, hatte Kontakt zu ihm. Am 9. Februar 1939 schrieb er seiner Schwiegermutter: »Reinhard hat mir aus Canada gerade wieder geschrieben. Er bestätigt mein Paket und hat sich sehr gefreut. Ob er Arbeit hat, glaube ich kaum.« Er werde ihm umgehend einige Dollars schicken. »Er ist ein braver Kerl und hat Vertrauen zu mir, nebenbei ist er Ilses Bruder. Ich freue mich, ihm etwas behilflich sein zu können.«
Curt selbst lebte inzwischen von seiner Frau getrennt. Ilse war mit den Kindern Reinhard und Thomas nach Hamburg zurückgekehrt. Er wolle im kommenden Jahr 1940 »kurz nach drüben« kommen: »Auf alle Fälle will ich meine Übung machen.« Als Offizier des Ersten Weltkrieges drängte es ihn wieder zu den Waffen. Vorher wollte er aber noch helfen, seinen Schwager Reinhard nach Hause zu holen.
Am 27. Mai 1939 schrieb er aus Guatemala einen Brief an seinen Schwiegervater Albert nach Blankenese: »Ich kenne Reinhard ja auch persönlich nur kaum, doch möchte ich annehmen, dass Du und Ihr zu Hause ihm doch wohl ein bißchen zu wenig zutraut und daß Ihr Euch ein falsches Bild macht.« Reinhard müsse davon überzeugt werden, dass es sich für ihn in Deutschland mit Ausblick auf die Zukunft günstiger entwickeln werde. Er habe niemanden jemals um irgendeine Unterstützung gebeten. Dennoch habe er, Curt, herausgefunden, dass es seinem Schwager »in Wirklichkeit durch die augenblicklichen Zeitumstände dreckig ging«. Die Dollars wüchsen nicht mehr auf den Bäumen. »Ich kann sehr gut verstehen, dass Du mit Sorgen erfüllt bist und Dir die Zufriedenheit im hohen Alter etwas anders vorgestellt hast.« Reinhard habe sein Verantwortungsgefühl lange unter Beweis gestellt. »Sicherlich wirst Du sehr bald auch davon überzeugt sein, sobald er erstmal zu Hause bei Euch ist. Ihr müßt ihm aber auch etwas zutrauen.« Alles andere wäre großes Unrecht. Reinhard habe ihm auch einen zuversichtlichen Brief geschrieben, der klar zeige, dass er »frisch und ohne Hemmungen« sich auf Deutschland freue.
Zunächst sollte mein Vater nach Guatemala kommen, um von dort aus die Heimreise nach Deutschland anzutreten. Schwager Curt schrieb in einem Brief: »Er hat große Lust, zunächst seiner Militärpflicht zu genügen, und ich werde ihm auch zureden, daß das vernünftig von ihm ist.« Wenn er zunächst acht Wochen zur Artillerie ginge, »bekommt er wieder Bekanntschaft mit dem Geruch von Pferdemist und frischem Heu«. Er habe auch Lust, wieder in die Landwirtschaft zu gehen, und würde seine Familie jeder Sorge um Unterbringung entheben.
Am Ende schrieb er meinem Großvater noch, was ihm ein Bekannter über meinen Vater berichtet hatte, nachdem er ihn in Vancouver getroffen hatte: »Ihr Schwager ist ein ganz famoser Kerl, sehr für sich, fast etwas verstockt, doch mit einem prächtigen Charakter, der vielen Kameraden und Freunden den Beweis erbracht hat, daß man sich auf ihn verlassen kann und ein ganz verteufelter Arbeiter, der es mit jedem aufnehmen kann; nebenbei hat er Mordskräfte; er führt einen enthaltsamen Lebenswandel und hat unter den Kanadiern mit Recht das Prädikat ›He is a German‹.« Der Bekannte habe ihm nicht angemerkt, wie es ihm gehe. »Als ich ihm erzählte, daß es ihm dreckig geht, antwortete er sofort: Ja, so ist er. Er beißt sich die Zunge ab, doch helfen läßt er sich nicht.« Er würde sich riesig freuen, »wenn Reinhard bei Euch ein zu Hause findet, dafür ist es nicht notwendig, dass er bei Euch wohnt«.
Am 3. August 1939 kam mein Vater tatsächlich zurück nach Hamburg – und fand sich wenige Wochen später als Wehrmachtssoldat in Polen wieder. Zeitunglesen war offenbar nicht seine Stärke. Auch Schwager Curt kehrte zurück nach Deutschland, zog als Reserveoffizier in den Krieg – und fiel.
Der Onkel in China
Der älteste Bruder meines Vaters, Helmut, arbeitete währenddessen in Shanghai als Kaufmann und schrieb am 15. September 1939, zwei Wochen nach dem Beginn des Zweiten Weltkrieges, an seine Eltern und Geschwister: »Der Kriegsausbruch hat mich, wie wohl auch Euch vollkommen überrascht, und ich war bis zum letzten Augenblick der Meinung, daß es ohne Krieg abgehen werde, was ja nun leider nicht den Fall war. Wie der Fall aber einmal liegt, müssen wir alle das Beste tun, uns damit abzufinden und die Sache zu einem für Deutschland günstigen Abschluß zu bringen, und da wir ja im Gegensatz zu 1914 die richtigen Männer an der Spitze haben, so kann man nur das Beste erhoffen.«
Was mein Onkel in China sonst noch gemacht hatte, erfuhr ich zufällig in den Siebzigerjahren, als ich für das Goethe-Institut in Indonesien ein Dokumentarfilm-Seminar abhielt. Am Ende des Kurses sollte ich mit ein paar Studenten einen Kurzfilm drehen. Der Leiter des Institutes schlug vor, doch eine kleine Dokumentation über die »Tausend Inseln« vor Jakarta zu drehen. Auf einer kleinen Insel lebe ein pensionierter Deutscher, der kenne sich dort aus. Der ehemalige Vertreter des Hoechst-Konzerns in Asien sei ein bisschen merkwürdig, aber wir könnten ja versuchen, ihn für unseren Film zum Reden zu bekommen. Wir fuhren also mit einem winzigen Motorboot los, gerieten in ein stürmisches Gewitter, liefen auf ein Riff und übernachteten im Ferienhaus eines Chinesen. Am nächsten Morgen setzten wir die Fahrt fort und legten am Steg der Insel des Deutschen an. Kaum hatte ich das Boot verlassen, kam ein älterer Herr auf mich zu. »Entschuldigen Sie«, sagte ich, »mein Name ist Aust …«
Bevor ich weitersprechen konnte, sagte der Mann: »Aust … ich kannte mal in Shanghai einen Helmut Aust …«
»Das muss dann mein Onkel gewesen sein …«
Daraufhin durften wir die Insel betreten. In seinem Wohnhaus kramte der ehemalige Manager ein Fotoalbum heraus und zeigte uns die Bilder meines Onkels in seinem Segelboot: »Wir haben uns immer gefragt, wo der das Geld für seinen aufwendigen Lebenswandel herhatte.«
»Ja«, sagte ich, »er war auch ein guter Segler und ist wohl auch ein paarmal von Shanghai nach San Francisco gesegelt.«
Der alte Deutsche grinste: »Wir haben immer angenommen, er hatte jeweils eine Ladung Opium an Bord, das würde viel erklären.«
Das erklärte für mich auch einiges, Onkel Helmuts Sohn Jan, ein paar Jahre jünger als ich, auch er ein vortrefflicher Segler, saß gerade wegen Drogenhandels im Gefängnis. Ein paar Jahre später schrieb ich ein Buch über ihn: Der Pirat. Ich nannte ihn Jan Christopher. Das waren aber nur seine Vornamen, der Nachname war Aust, und die Geschichte spielte sich in unserem Haus ab – und später im Gefängnis. Es war die Geschichte eines Junkies, der wie so viele andere, die in den Sog der Droge geraten, Opfer und Täter zugleich war. Ich kannte Jan seit frühester, gemeinsamer Kindheit, hatte aus der Distanz über viele Jahre seinen Weg in den Untergang verfolgt, ohne mich für die schrecklichen Details zu interessieren. Wie man eben gemeinhin einen großen Bogen um jeden Drogenabhängigen macht. Doch irgendwann kreuzten sich unsere Wege wieder.
Im Krieg
Nur wenige Briefe meines Vaters an seine Eltern sind erhalten geblieben. Einen schrieb er als Soldat einer Baueinheit am 2. Juni 1940, er klingt, als wäre er im Urlaub: »Gestern war ich mit ein paar Kameraden den ganzen Tag an der Weichsel, wir haben gebadet und in der Sonne gelegen. Die meisten von uns haben den schönsten Sonnenbrand. Ich auch. Bei der Arbeit haben wir auch meist nur die Badehose an. Ich habe vor ein paar Tagen eine ganz neue Uniform bekommen, meine alte war mit der Zeit furchtbar schäbig geworden. Jetzt brauch ich mich wenigstens nicht mehr genieren, mal spazieren zu gehen. Wir liegen hier schon 13 Monate in Polen. Wenn hier noch was los wäre, dann wüßte man wenigstens wofür. Wir werden wohl den ganzen Krieg hierbleiben.«
Am 23. Oktober 1940 schrieb er wieder an seine Eltern und Geschwister: »Dieses Deblin-Irena ist der größte Fliegerhorst Polens. Wir müßen hier zur Abwechslung mal schwer arbeiten. Sogar sonntags einen halben Tag. Abends ärgert man uns mit Appellen und sonstigen Kinkerlitzchen. Hoffentlich ist der Krieg bald vorbei, daß dieser Mist aufhört … Was für Arbeit wir hier machen, dürfen wir nicht schreiben, obwohl das meiner Ansicht ganz harmlos wäre.« Dann bat er seine Familie noch, ihm ein Paket mit ein paar Äpfeln zu schicken.
Ganz selten sickerten später kleine Erinnerungen durch, wie er einmal mit dem Gewehr jüdische Frauen bewachen sollte, die mit einer kleinen Schaufel große Steine bewegen mussten. Da habe er sein Gewehr hingeworfen und den Befehl verweigert. Wo und wann das gewesen sein sollte, haben wir nie erfahren.
Weil er eineinhalb Jahrzehnte in den USA und Kanada zugebracht hatte, sprach er leidlich Englisch und wurde gegen Ende des Krieges in eine Sondereinheit versetzt. Unter der Führung des Mussolini-Befreiers Otto Skorzeny wurde eine Spezialeinheit von Soldaten aufgebaut, die nach der Ardennenoffensive mit Fallschirmen hinter der Front abgeworfen werden sollten. Verkleidet in amerikanische Uniformen, sei ihre Aufgabe dort, Brücken zu sprengen. Einmal erzählte mein Vater, dass sie trainiert worden seien, mit eisernen Drähten Soldaten die Kehle abzuschnüren. Sechs Mal war er mit dem Fallschirm abgesprungen. Zum Einsatz hinter der Front kam es nie.
Mein Vetter Reinhard, Sohn von Tante Ilse, erzählte mir Jahrzehnte später, dass mein Vater den Befehl verweigert hatte und deshalb in eine Strafkompanie versetzt worden war. Als ich meine Mutter nach dem Tod meines Vaters danach fragte, reagierte sie eher aggressiv: »Niemals!« Ich erfuhr nie, ob mein Vater meiner Mutter das verheimlicht hatte, ob sie es nicht wusste oder einfach abstritt – oder ob die Geschichte meines Vetters, der ein halbwegs Vertrauter meines Vaters war, überhaupt stimmte. Aber mein Vater hatte einen Wahlspruch, den er gelegentlich äußerte: »Besser einmal ein Feigling als das Leben lang tot.«
Tante Ilse, die mit ihrem Mann Curt vor dem Krieg gut zehn Jahre in Guatemala zugebracht hatte, führte ihren Eltern den Haushalt. Curt war im Krieg gefallen. Die beiden Söhne Reinhard und Thomas wohnten die ersten Jahre mit im Haus des Großvaters. Unterm Dach am Elbabhang von Blankenese lebte auch Tante Erika mit ihrem Sohn Peter. Sie hatte zwölf Jahre in China gelebt, dort einen Engländer geheiratet, ihn aber zu Beginn des Krieges verlassen und nie wieder gesehen. Mein Vetter Peter lernte seinen Vater erst Jahre nach dem Tod seiner Mutter kennen.
Der älteste Bruder meines Vaters, Onkel Helmut, war nach gut 20 Jahren China und der Internierung durch die Engländer in Manila nach Hamburg zurückgekehrt. Durch die Vermittlung eines britischen Besatzungssoldaten, den er aus Ostasien kannte, erhielt er einen Job beim Hamburger Flughafen Fuhlsbüttel, dazu eine Wohnung im fünften Stock mit Blick aufs Rollfeld.
Tante Ruth war Lehrerin.
Onkel Rolf hatte während des Krieges in Belgien eine »sehr nette und tüchtige Flämin« kennengelernt, »geradeaus im Charakter und prima in der Küche«, wie er am 13. Mai 1941 aus Brüssel seinem Vater schrieb. Onkel Rolf heiratete die damals 28-jährige Valerie nach Ende des Krieges und blieb in Brüssel.
Der jüngste Bruder Roland, Mitglied der Waffen-SS, war im Krieg gefallen. So musste mein Vater Reinhard, nach 15 Jahren Kanada, fünf Jahren Krieg und aus kurzzeitiger britischer Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt, den kleinen Hof in Brunshausen übernehmen, jenen Ort, an dem sein Vater nach Aufgabe der Reederei das Grundstück der ehemaligen Glashütte erworben hatte.
Die Mutter
Meine Mutter wurde am 8. Oktober 1923 als Tochter des »Betriebsbeamten« August Hartig und seiner Ehefrau Elsa, geborene John, in Hamburg-Bergedorf geboren. Sie hatte eine zehn Jahre ältere Schwester, auf die wir noch zurückkommen werden. Meine Mutter beendete die Sachsenwaldschule Ostern 1939 mit der Mittleren Reife. Statt Abitur zu machen, ging sie ins »Pflichtjahr«. Gerade mal 16 Jahre alt, musste sie auf einen Bauernhof nach Norgaardholz an der Ostsee. Irgendwann gegen Ende der Fünfzigerjahre wollte sie noch einmal zu dieser Familie zurück. Wir fuhren mit unserem kleinen Motorroller in den Schulferien dorthin. Meine Mutter hatte wenig über ihr Pflichtjahr dort erzählt, auch nicht darüber, wie sie gelitten hatte. Nach ihrem Tod fand ich ein kleines blaues Tagebuch mit ihren Aufzeichnungen als 16-Jährige von damals:
»Dienstag, 4. 4. 39
Morgens ab Hamburg. Nach Norgaardholz, im Arbeitsamt von Herrn Lassen abgeholt. Nach Norgaardholz im Auto. Schlecht geworden unterwegs. Geholfen. Abgewaschen. Hühner gefüttert. Beim Melken zugekuckt. Mit dem Lütten gespielt. Abends ich Idiot, Heimweh. Mußte bald weinen. Nach Mutti. Ein süßer kleiner Hund ist hier. Will früh ins Bett.
Donnerstag d. 6. 7. 39
Mein liebes Tagebuch!
Ach, ich muß immerzu weinen, mir ist so klöterig zumute. Habe so ein Heimweh, möchte so gerne zu Mutti … kann fast gar nichts essen … lieb ist keiner zu mir. Wenn du sprechen könntest und mich hören, liebes Tagebuch. Ich brauche so sehr eine mitfühlende Seele … Oh, liebes Tagebuch, tröste mich doch, ich bin ganz verzweifelt …«
Dann ging es zum Reichsarbeitsdienst für ganze vier Jahre, mit einer Ausbildung zur Verwalterin. Im Tagebuch findet sich die Notiz: »Ich will überwinden, wenn der Mensch nur will, er kann ja alles!«
Ende 1944 nahm meine Mutter ein Sportstudium an der Universität der Hansestadt Hamburg auf – bei der jüngeren Schwester meines Vaters. Tante Ruth, resolute Lehrerin für Sport und Geografie, brachte sie nach Kriegsende auf dem kleinen Hof ihres Vaters in Brunshausen unter. Dort lernte sie meinen 18 Jahre älteren späteren Vater kennen.
Sie war eine hochintelligente fleißige Frau, die fünf Kinder zur Welt brachte, das marode Haus bewirtschaftete, mit auf dem kleinen Bauernhof arbeitete und dafür sorgte, dass die Kinder alle Abitur machten. Sie war nicht eigentlich streng, dazu hatte sie ohnehin zu wenig Zeit. Aber ihre Autorität wurde allseits respektiert. Wenn sie meinem Vater irgendwelche Vorhaltungen machte, reagierte der meistens eher hilflos mit den Worten: »Ach Ille, sei doch nicht so …«
Körperliche Kontakte wie Küsse oder Umarmungen waren unüblich, das Thema Sex tabu. Sie war prüde und gab das auch an ihre Kinder weiter. Sie konnte tolerant und streng gleichzeitig sein. Einmal, ich musste gerade zur Schule gekommen sein, entdeckte ich auf dem Frühstückstisch ein Zehnpfennigstück. Ich deutete auf die Münze und fragte etwas undeutlich, ob ich den Groschen haben könnte. Meine Mutter antwortete ebenso undeutlich. Beim Abdecken des Tisches steckte ich den Groschen ein. Nach der Schule ging ich in den kleinen Wohnungsladen von Frau Preuss, die neben Briefmarken auch Getränke und Eis verkaufte. Für die zehn Pfennig kaufte ich ein Eis am Stiel. Aber weil ich mir nicht sicher war, ob ich den Groschen hätte einstecken dürfen, wickelte ich das Eis nicht aus. Als ich mit dem tropfenden Eis zu Hause auftauchte, sah meine Mutter mich mit strengem Blick an. Ob ich etwa den Groschen am Frühstückstisch eingesteckt hätte? Ich nickte. Da schickte meine Mutter mich zurück zu Frau Preuss. Ich musste das inzwischen geschmolzene und aus der Papierumhüllung tropfende Eis wieder abgeben. Sie gab mir den Groschen zurück, und ich lieferte ihn zu Hause wieder ab. Die peinliche Szene vergaß ich nie. Und ich habe in meinem Leben niemals irgendetwas in einem Kaufhaus oder einem Laden geklaut.
Als der Hof nicht genügend einbrachte, um die Familie zu ernähren, belegte meine Mutter an der Volkshochschule Stade einen Buchhaltungskurs und nahm eine Stelle bei einem Steuerberater und später bei einem Versandhandel an – und noch später beim Spiegel.
Kindheit am Strom
Am 1. Juli 1946 kam ich als erstes Kind meiner Eltern zur Welt, ein paar Tage zu früh, angeblich, weil die Mutter zu viele Erdbeeren gegessen hatte. Vier Kinder folgten in kurzem Abstand, immer abwechselnd: Junge, Mädchen, Junge, Mädchen, Junge. Nach mir Elisabeth, dann Christian, Sybille und Martin.
Die Söhne der Geschwister meines Vaters, die immer noch in dem Haus am Hang in Blankenese wohnten, segelten mit ihrem Piraten die Elbe auf und ab, machten Station bei uns in Stadersand – und so wie alle Segler aus Blankenese die Häfen unsicher. Wenn sie anlegten, so hieß es, holten die Anwohner die Wäsche von der Leine und sperrten die Mädchen ein, denn die Blankeneser hatten einen Ruf wie früher die Piraten. Sie klauten alles, was nicht niet- und nagelfest war, denn die Blankeneser Devise lautete: »Allens mien«, alles meins. Da waren wir in Stadersand nur zweite Elbwahl.
Wir liehen das Ruderboot eines Fischers heimlich aus und schipperten auf der Schwinge herum. Als wir eines Tages die jüngeren Geschwister mit an Bord nahmen und sie erst nach Stunden zurückbrachten, gab es heftige Prügel vom Vater mit dessen Ledergürtel, der aus einem russischen Gewehrriemen mit amerikanischem Army-Schloss bestand.
Irgendwann hatten wir auch ein altes Ruderboot, mit dem wir die Elbe – und vor allem uns selbst – unsicher machten. Es war ein altes Rettungsboot, das aus seiner Winde aufs Deck des Küstenfrachters gekracht war. Dabei waren ein paar Planken zerborsten, und wir bekamen das Boot geschenkt. Mein Vater baute neue Planken ein, und es schwamm wieder. Wir statteten es mit einem Mast aus und nähten aus einer alten Plane Segel. Zumeist reichte der Wind von achtern nur aus, um mit der Tide zu segeln. Zurück gegen die Strömung wurde es dann schwierig.
Schwinge und Elbe waren unser Revier. Da konnte uns auch die erbärmliche Wasserqualität nicht davon abhalten, baden zu gehen. Bevor wir in die braune Flut stiegen, wurde uns allerdings eindringlich klargemacht, dass wir am Strand nur bei auflaufendem Wasser in die Elbe dürften. Der sogenannte Hund, eine Tonne elbaufwärts vom Badestrand, markierte nämlich die Stelle, an der die Abwässer der Stadt Stade ungeklärt in die Elbe liefen. Bei ablaufendem Wasser hatte man dann den Dreck am Hals. Aber auch bei Flut galt die Devise: Nie beim Schwimmen Wasser schlucken. Auf jeden Fall waren wir abgehärtet gegen so ziemlich alle Krankheitserreger, die zwischen Dresden und Cuxhaven in die Elbe gelassen wurden.
Der Strand war schön wie in der Karibik, die Wellen der Schiffe hoch wie die Dünung an der Nordsee und die Partys auch nicht schlechter als bei Buhne 16 auf Sylt. An unserer Elbe, dem schönsten Fluss der Welt. Unser Haus und unser Hof in Brunshausen, dem winzigen Dorf an der Schwinge, einem Nebenfluss der Elbe, gehörte wie gesagt meinem Großvater und war gerade mal 15 Hektar groß. Der lehmige Boden war seit Jahrzehnten von den umliegenden Ziegeleien abgebaut worden. Nach dem Krieg wurde das tief liegende Gelände im Außendeich, das bei jeder Sturmflut unter Wasser lag, wieder aufgespült, mit dem Matsch, der bei den verschiedenen Elbvertiefungen ausgebaggert worden war.
Wir hatten zwei Pferde zum Mähen, Pflügen und für den Ackerwagen. Es waren Belgische Kaltblüter, die während des Krieges Kanonen geschleppt hatten. Als eines der beiden einging, bekamen wir ein neues Pferd, einen schwarzen Hannoveraner-Wallach, der ziemlich wild war und das Gespann nicht selten zum Durchgehen brachte. Einmal überfuhr es einen parkenden Volkswagen und wurden deshalb abgeschafft. Dafür kaufte mein Vater einen winzigen Trecker, einen Holder Diesel mit 15 PS und einer Antriebskurbel, die zu bedienen nicht einfach war. Mit kaum acht Jahren steuerte ich den Trecker gern mit Vollgas über den Hof und setzte ihn einmal mit der rechten Radnabe gegen eine Hausecke, was die Eisenachse verbog.
Zum Grundstück meines Großvaters gehörte eine heruntergekommene Villa, in der einmal der Direktor der Glashütte gewohnt hatte, die dort bis etwa zum Ersten Weltkrieg betrieben worden war. In mehreren nicht minder baufälligen Mietskasernen wohnten 93 Mieter in kleinen Wohnungen ohne fließend Wasser, Toiletten und Heizung. Aus zwei Wasserstellen mussten die Bewohner in Eimern ihr Wasser holen und in die Häuser schleppen. In einem Toilettenbau mit sogenannten Plumpsklos stand jeweils zwei Mietparteien ein abschließbares Klo zur Verfügung. Alle paar Monate musste die stinkende Kloake mit Eimern, die an einem langen Stiel befestigt waren, ausgeschöpft und in einen Jauchewagen umgefüllt werden. Das – und die wöchentliche Müllabfuhr mit einem Einachsanhänger – gehörte zu den Aufgaben meines Vaters auf dem Hof. Und als wir alt genug waren, den Trecker zu fahren, also mit zehn oder zwölf Jahren, halfen wir, den Abfall an das Ufer der Schwinge zu fahren und dort in den Zwischenraum zu den neu angelegten Uferbefestigungen aus kleingesprengten Betonklötzen der Stader Wehrmachtsbunker zu schütten. So hatten die Ratten immer genügend zu fressen.
Wir teilten uns die ursprünglich einmal elegante Villa im klassizistischen Stil mit drei anderen Familien, die in dieser frühen Nachkriegszeit dort vom Wohnungsamt eingewiesen worden waren. Die Nachbarn mussten sich ein paar Plumpsklos neben der Scheune teilen. Wir waren im Vergleich dazu privilegiert, hatten wir doch ein eigenes Badezimmer mit Badewanne und Heizofen. Einmal in der Woche wurde der Badeofen angeheizt, dann wurden wir Kinder jeweils zu zweit gebadet. Als größten Luxus hatten wir eine Spültoilette, deren Abflussrohr in einen Graben führte, der zur Schwinge ablief. Durch das Rohr kletterten nicht selten Ratten bis in unser Badezimmer und knabberten den hölzernen Toilettendeckel von innen an. Wir hatten strikte Anweisung, den Deckel immer geschlossen zu halten, damit die Ratten nicht ins Badezimmer springen konnten. Nicht jeder achtete immer darauf, wenn er die Toilette benutzt hatte. Einmal öffnete ich die Tür zum Bad, schaltete das Licht an und sah, wie eine dicke Ratte ins Klo sprang und durch den Abfluss wegtauchte. Ich spülte nach. Und immer, wenn ich später zum Klo musste, zog ich vorher und hinterher den Abzugshebel, der jeweils zehn Liter Wasser aus dem Bottich ins Klo spülen ließ. Diese Erfahrung prägte bei mir eine lebenslange Abneigung gegen Ratten und Mäuse. Irgendwie wollte ich später mal anders wohnen und anders arbeiten als meine Eltern. Aber am besten immer noch an der Elbe.
Brunshausen
Am Wochenende fuhren wir regelmäßig mit der Fähre von Stadersand aus nach Blankenese, um »Großpapa« und »Großmama« sowie den sonst noch im weißen Haus am Elbabhang wohnenden Geschwistern meines Vaters einen Besuch abzustatten. Vom Verkauf seiner Reederei an die Hadag in den Zwanzigerjahren hatte mein Großvater noch seine Leibrente – und freie Fahrt auf den Elbfähren für alle Familienangehörigen.
In der Grundschule – damals Volksschule genannt – saßen bei uns in Brunshausen vier Jahrgänge in einem Klassenraum. Ich war ein ganz passabler Schüler mit lauter Zweien im Zeugnis. Einsen gab es grundsätzlich nicht. Manche Unterrichtsstunden wurden für die vier Jahrgänge gemeinsam geführt, bei anderen setzte sich der Lehrer mit der jeweiligen Altersklasse zusammen und unterrichtete sie, während die übrigen Schüler irgendwelche Aufgaben allein erledigen mussten.
Der Lehrer in dieser »Zwergschule« war zuvor im Krieg Oberst gewesen – und jüngster Ritterkreuzträger der Wehrmacht. Als wir im Religionsunterricht die Kreuzigung Jesu durchnahmen, sagte er, dass die Juden für diese Untat später ja schwer bestraft worden seien. Auf meine schnelle Frage nach der Strafe antwortete er: »Das wirst du schon noch früh genug erfahren.«
Irgendwann in der vierten Klasse, kurz vor den Sommerferien, lag ich bei den Rechenaufgaben etwas zurück. Mein Lehrer setzte sich links neben mich in die Bankreihe und ärgerte mich, da stieß ich ihn erst mit dem Ellbogen an, und als er nicht aufhörte, holte ich aus und gab ihm eine knallende Backpfeife. Ich glaube, ich war der einzige Neunjährige, der jemals einen Ritterkreuzträger geohrfeigt hat. Meine Backpfeife wurde zum Dorfgespräch, und irgendwann erfuhr das auch meine Mutter. Sie hielt mir eine Standpauke und verlangte, dass ich mich bei Lehrer Ebeling entschuldigte. Das war ausgerechnet am Anfang der großen Ferien, was mir den Sommer ziemlich verhagelte. Als die Schule wieder losging, war mein Lehrer wie immer. Er beauftragte mich, die Gruppen der Erstklässler zu betreuen, und erweckte den Eindruck, er habe den Vorgang längst vergessen. Doch jedes Mal, wenn ich aus der Schule nach Hause kam, fragte mich meine Mutter streng: »Hast du dich entschuldigt?«
Also blieb mir nichts anderes übrig, als nach der letzten Stunde Herrn Ebeling bei der Verabschiedung auf der Treppe leise und undeutlich zu sagen: »Würden Sie bitte entschuld…« Dann rannte ich die Treppenstufen nach unten. »Was hast du gesagt?«, rief er mir nach, und ich musste die Stufen wieder nach oben gehen. Ich wiederholte den Satz, diesmal verständlich. Da lachte der Lehrer, und ich konnte erleichtert nach Hause gehen. Ich verschwieg die peinliche Angelegenheit, so gut es ging. Erst in den rebellischen späten Sechzigerjahren konnte ich meinen Mangel an revolutionärer Entschlossenheit mit dem Hinweis auf diese spontane Handgreiflichkeit gegenüber einem Wehrmachtsoffizier, der inzwischen General der Bundeswehr war, kompensieren.
Als mein alter Grundschullehrer Ebeling 90 wurde, schrieb mir die Enkelin des von mir gut 50 Jahre zuvor geohrfeigten Ritterkreuzträgers und fragte, ob ich ihrem Großvater nicht zum Geburtstag einen Gruß schreiben könnte. Er spreche gelegentlich über seinen Schüler S., der es inzwischen zum Chefredakteur des Spiegel gebracht hatte. In ihrem Brief stand seine Telefonnummer. Ich rief ihn spontan an. Er weinte und bot mir das Du an.
Wenige Wochen später starb meine Mutter. General Ebeling, Jahrzehnte zuvor von Verteidigungsminister Helmut Schmidt zusammen mit den anderen übrig gebliebenen Wehrmachtsgenerälen in den Ruhestand geschickt, ließ es sich nicht nehmen, als 90-Jähriger am Steuer seines Autos zur Trauerfeier zu fahren. Dort sah ich ihn zum ersten Mal seit einem halben Jahrhundert wieder. Bei Kaffee und Butterkuchen kamen wir auf die Schulzeit in Brunshausen zu sprechen – und auf die peinliche Ohrfeige. Diesmal entschuldigte er sich: »Ich hätte dich nicht dazu provozieren dürfen.« Damit war das Thema endlich erledigt.
Das Athenaeum
Nach der Grundschule und der Aufnahmeprüfung ging ich zum Athenaeum nach Stade. Viele der Lehrer waren alte Nazis, der Lateinlehrer ehemaliger Wehrmachtsgeneral. Wir nannten ihn Cato Senex, den alten Cato. Latein war nicht meine Stärke, obwohl ich nur durch den Lateinunterricht deutsche Grammatik lernte. Und einmal musste ich als Strafarbeit ein ganzes Kapitel aus dem Lateinbuch auswendig lernen. Das blieb hängen, sodass ich in späteren Jahren immer mit meinem fließenden Latein Eindruck machen konnte.
Ich fuhr mit dem Fahrrad nach Stade zur Schule, jeweils gut sieben Kilometer hin und zurück, im Sommer wie im Winter, bei Regen, Wind und Schnee. Wenn im Herbst die Elbe über die Ufer trat und die Straße bis zum dann geschlossenen eisernen Tor, der »Deichluke«, unter Wasser stand, konnten wir die Schule schwänzen. Politik erlebten wir nur am Rande mit.
Es war im Februar 1962, als wir gegen Mitternacht von unserem Vater geweckt wurden. Zwar hatte der Wetterbericht eine Sturmflut gemeldet, aber nicht so eine. Für uns war ein »Hochwasser« immer willkommen, auf der überfluteten Straße nach Stade ging es nicht mit dem Fahrrad, und es fuhr kein Bus. Manchmal, wenn das Wasser nicht allzu hoch war und etwa eine Klassenarbeit anstand, nahmen wir den Trecker. In dieser Nacht war alles anders. Mein Vater rief die Polizei in Stade an und meldete »Land unter«. Wir wussten, wenn bei einer Sturmflut das Wasser in unser Haus laufen würde, das auf einer hohen Warf lag, dann würde es auch über den Deich laufen – und bei uns damit nicht weiter steigen. Die Polizei war ahnungslos. Kurz darauf wurde der Deich überflutet, und die Sturzbäche höhlten ihn von der Innenseite her aus. Dann brach er – an vielen Stellen entlang der Elbe. An der Unterelbe war man Sturmfluten minderer Gewalt gewohnt. In den eingedeichten Siedlungsgebieten an den Hamburger Elbarmen in Wilhelmsburg aber war wirklich Land unter. Die Menschen versuchten, sich auf die Hausdächer zu retten, und wurden dort mit Schlauchbooten und von Helikoptern der Bundeswehr, die damals noch flugfähig waren, gerettet. 315 Menschen aber fanden den Tod.
Bei uns traf es sechs Kühe, die angekettet im Stall standen. Mein Vater, alter Cowboy, der er war, stapfte mit langen Gummistiefeln in die Scheune, um sie zu befreien. Eine Kuh schaffte er, die anderen ertranken. Der Hund kletterte auf einen Haufen Gerümpel und überlebte. Wir retteten uns ins obere Stockwerk des Hauses, dessen Bausubstanz am Ende den Fluten aber nicht gewachsen war.
Nach der Sturmflutkatastrophe zogen wir bis zum Abtrocknen unserer Wohnung im Erdgeschoss, wo das Wasser 60 Zentimeter hoch gestanden hatte, in den ersten Stock zu den Nachbarn. Die hatten einen Fernseher. Als wir die Bilder von der Besetzung des Pressehauses in Hamburg und der Verhaftung des Spiegel-Herausgebers Rudolf Augstein sahen, sagte mein Vater: »Sollen sie das Scheißblatt doch endlich verbieten!« Er war regelmäßiger Leser des Magazins, das bei uns gemeinsam mit anderen Zeitschriften als Lesezirkel-Ausgabe mit mehrwöchiger Verspätung ins Haus geliefert wurde. Zum Glück blieb ihm erspart mitzuerleben, dass sein Sohn gut 32 Jahre später Chefredakteur dieses »Scheißblattes« wurde.
Im Unterricht wurde nicht viel über die Kubakrise und noch weniger über die Spiegel-Affäre gesprochen. Aber jedem war klar, dass ein möglicher Atomkrieg wie ein gigantisches Damoklesschwert über Deutschland und der Welt schwebte. Es war die Zeit des Kalten Krieges und der Wiedereinführung der Wehrpflicht in Deutschland. Die Amerikaner probten den Atomkrieg in der Südsee. Das Schlachtfeld wollte ich mir 60 Jahre später einmal ansehen.
Der vergessene Atomkrieg
Verstrahlt, verbrannt, verlassen: 70 Jahre nach den ersten Bombentests ist das Bikini-Atoll noch immer unbewohnbar. Detlev Konnerth und ich flogen über San Francisco und Hawaii nach Majuro, der Hauptstadt der Marshallinseln, um einen Film über ein verstrahltes Paradies zu machen, in dem das nukleare Zeitalter noch nicht vergangen ist.
Vom gleichnamigen Atoll Majuro bis zu den Atollen am Rande der Marshallinseln Bikini und Eniwetok sind es gut 1000 Kilometer. Eine abgelegene Inselwelt, die sich nach Ansicht der Amerikaner bestens für Atomwaffenversuche eignete, zwölf Jahre lang. Von den Schäden hat sie sich bis heute nicht erholt.
Majuro ist wegen seiner besonderen Lage zwischen den Kontinenten ein beliebter Anlaufpunkt für Weltumsegler aller Herren Länder. Für Reisende auch eine Chance, gleichsam als Anhalter mitgenommen zu werden. Wir charterten eine moderne Jacht, gesteuert von einem holländischen Weltenbummler, und nahmen als Helfer noch ein junges Pärchen mit an Bord. Die beiden waren mit einem winzigen Segelboot von San Francisco aus in die Südsee gesegelt.
Gut 1000 Kilometer mussten wir von Majuro nach Eniwetok zurücklegen, einem der Atolle, die von den Amerikanern bombardiert worden waren. Um die Insel wieder bewohnbar zu machen, hatten die USA in den Siebzigerjahren hier den Schutt und die oberste Erdschicht abgetragen und auf der Insel Runit im Osten des Eniwetok-Atolls im Explosionskrater einer Wasserstoffbombe versenkt. Darüber schütteten sie einen gewaltigen flachrunden Betondeckel. Dieses Denkmal des nuklearen Wahnsinns wollten wir uns ansehen und packten zur Sicherheit auch einen Geigerzähler ein. Dann segelten wir bei heftigem Wind und hohen Wellen los. Kollege Detlev, dem ich die kleine Kajüte in der Mitte des Bootes abgetreten hatte, kotzte drei Tage lang im Quadrat.
Ich legte mich nachts in die Koje im Bug und wurde durch den heftigen Wellengang permanent an die Decke katapultiert. Seekrank wurde ich nicht. Vielleicht hat die Kindheit an der Elbe dazu geführt, dass ich mich weder beim Fliegen im Segelflugzeug noch bei halsbrecherischen Loopings in der Kunstflugmaschine »Extra 300« noch beim heftigen Sturm während der ersten Überquerung des Atlantiks übergeben musste. Selbst beim Parabelflug im umgebauten Airbus überstand ich den Steilflug, den anschließenden Sturzflug und die damit verbundene Schwerelosigkeit ohne Magenverstimmung.
Langsam besserte sich auf der Segeltour zum atomaren Testgebiet das Wetter. Weit und breit nichts als offenes Meer. Doch dann ein überraschender Funkspruch eines amerikanischen Kriegsschiffes, das irgendwo in der Nähe sein musste: »Sie befinden sich im Bereich des Kwajalein-Atolls. Hier wird eine militärische Operation durchgeführt.«
Unser Skipper fragte: »Können Sie uns ein Zeitfenster nennen?«
»Laut Ansage auf Frequenz 2716 beginnt die Operation heute Abend um sieben Uhr und dauert bis ein Uhr nachts. Aber wir glauben, alles läuft nach Plan, und wir melden uns wieder um neun Uhr«, lautete die Antwort über Funk.
»Vielen Dank.«
Der Skipper, der mit seiner Jacht die Welt schon ein paarmal umrundet hatte, war besorgt: »Der Weg zurück und dann wieder hierher wird uns jeweils rund acht bis zehn Stunden kosten. Insgesamt fast 24 Stunden.«
Dann meldete sich die US-Marine noch einmal: »Sie haben ein schönes Boot. Ich bin selbst Segler. Blicken Sie die nächsten 20 Minuten nach Nordwest. Und bleiben Sie auf jeden Fall, wo Sie sind.«
Offenbar wurde hier 70 Jahre nach den verheerenden Atomtests weiter scharf geschossen.
Dann erschienen sie am Himmel: Langstreckenraketen, abgeschossen vom 10 000 Kilometer entfernten Vandenberg in Kalifornien. Hier wurde getestet, wie man einen Raketenangriff aus Nordkorea abwehren kann. Star Wars in der Südsee.
Schließlich, nach fünf Tagen auf hoher See: Land in Sicht und die ersten Zeichen eines nie erklärten Krieges.
Das Bikini-Atoll lag im Zentrum des Infernos. Tausende Kilometer von allen großen Kontinenten entfernt. Weißer Sandstrand, warmes, glasklares Wasser, Kokospalmen. Doch was heute wieder aussieht wie ein Urlaubsparadies, ist eine strahlende Hölle. Die Inselgruppe ist radioaktiv verseucht und damit auf Dauer unbewohnbar. Diesen entlegenen und so idyllischen Ort hatten die USA gewählt, um Atombomben zu testen. Um die gewaltige Kraft der neuen Waffentechnologie auszuprobieren, aber auch, um ihre Macht und Überlegenheit der ganzen Welt zu zeigen, versenkten die Militärs hier unter anderem eine ganze Armada von Kriegsschiffen. Das war am 1. Juli 1946, dem Tag meiner Geburt.
Auch das etwa 500 Kilometer entfernte Eniwetok war nukleares Testgebiet – das Atoll ist bis heute davon gezeichnet. Eniwetok umfasst über 40 Inseln, deren Gesamtfläche nicht größer ist als die von zehn Fußballfeldern. Die vom Atoll umschlossene Lagune misst dagegen über 1000 Quadratkilometer. Vor den Atombombenversuchen lebten hier über 1000 Einwohner. Sie waren autark, lebten nur von dem, was der Ozean und der fruchtbare Boden hergaben.
Der Bürgermeister fuhr uns auf der Ladefläche eines Pick-ups über die gleichnamige Hauptinsel: »Als hier noch Kokosnüsse und Brotfrucht wuchsen, war alles gut. Aber nachdem sie die Atombomben auf Eniwetok geworfen hatten, hat sich alles geändert.«
Und so ist es bis heute, obwohl das Atoll wie gesagt in den Siebzigerjahren mit großem Aufwand gereinigt wurde. Der strahlende Unrat landete auf der Insel Runit, keine Bootsstunde von der Hauptinsel Eniwetok entfernt – unter einer gigantischen Betonkuppel. Ähnlich wie der Sarkophag in Tschernobyl oder das Kraftwerk von Fukushima ist der sogenannte Runit Dome ein Mahnmal des ungebremsten Atomwahns.
Wir fuhren mit einem wackeligen Motorboot, dessen Außenborder gelegentlich stehen blieb, zu dem Betonhügel, um ihn zu filmen. Wir kletterten auf den gigantischen Deckel über dem strahlenden Müll, ließen eine Drohne mit einer Kamera aufsteigen und blickten in die Runde. Überall blaues Wasser, Strände und Palmen. Und dazwischen der Betonhügel: surreal. Aber Radioaktivität konnte unser Geigerzähler nicht feststellen. Noch hält der Deckel.
Das Abenteuer »Stader Schlüssel«
Wir wohnten damals noch in unserer immer mehr verfallenden Villa in Brunshausen. Die Sturmflut hatte dem Haus und der Scheune den Rest gegeben. Mein Vater hatte alles aus dem Stall herausräumen lassen, was sich dort im Lauf der Jahrzehnte an funktionsunfähigen Gerätschaften, Kisten, Werkbänken und Gerümpel angesammelt hatte. Nun stand es verdreckt und verstaubt auf dem Hof – und niemand wusste, wohin damit. Die Apfelkisten wurden vor dem Wohnhaus gestapelt. Ein paar alte Autowracks standen herum, die Obstbäume hatten noch immer das Treibgut der Sturmflut im Geäst. Die Milchkühe waren in der Abdeckerei gelandet. Und auch an Partys in unserem mit Fischernetzen und Twen-Fotos ausstaffierten Keller war nicht mehr zu denken.
Aber mein Großvater, der mit fast 98 Jahren gestorben war und seine Frau Martha um gut 20 Jahre überlebt hatte, hatte ein immer noch ordentliches Vermögen vererbt: das Haus in Blankenese, ein paar Immobilien am Schäferkamp in Hamburg, den Hof und die Mietskasernen in Brunshausen, dazu ein ehemaliges Fährhaus auf dem Deich am Hafen von Stadersand. Alles ging an eine Erbengemeinschaft, bestehend aus Onkel Helmut, meinem Vater, Tante Ilse, Tante Ruth und Onkel Rolf.
Alle waren sich in einer Hinsicht einig, Großpapas Devise »Nichts verkaufen!« war mit ihm in der Urne beerdigt worden. Alle Nachkommen meines Großvaters waren am Rande des Rentenalters und wollten endlich mal das Geld sehen, auf das sie ihr Leben lang gewartet hatten. Am schnellsten war das Grundstück zu verkaufen, auf dem mein Vater seit nunmehr fast 20 Jahren den Obsthof bewirtschaftete.
Die Stadt Stade brauchte Land für die Industrieansiedlung an der Elbe. Der Hof war nicht in die niedersächsische Höferolle eingetragen, was dazu geführt hätte, dass er nur an eine natürliche Person zu vererben gewesen wäre. Als derjenige, der den Hof seit langer Zeit betrieb, wäre mein Vater, obwohl nicht der Erstgeborene, rechtmäßiger Erbe gewesen. Der Erbschaftsstreit begann. Am Ende hatten sich alle mit meinem Vater überworfen. Der Hof wurde verkauft, wir zogen um in das Haus auf dem Deich in Stadersand, das meinem Vater übertragen worden war. Dazu hatte er einiges Geld geerbt.
Und dann kam er auf den wahnwitzigen Gedanken, dort ein Hotel mit Gaststättenbetrieb zu eröffnen. Name: »Stader Schlüssel« – so wie das Symbol auf dem Wappen der Schifffahrtslinie seines Vaters, gut 40 Jahre nach deren Untergang. Am Ende der aufwendigen Bauarbeiten hatte er genauso viele Schulden, wie er vorher an Kapital geerbt hatte. Es war abzusehen, dass das nicht gut gehen konnte. Ich wagte Widerspruch und flog um ein Haar zu Hause raus.
Damals begann auch unsere Pferdegeschichte. Sie wurde lang und teuer, mal mehr, mal weniger erfolgreich. Aber immer aufregend.
Pferdezeit
Am Anfang stand eine Anzeige im Stader Tageblatt: drei junge Stuten zu verkaufen. Das Geld aus der Erbschaft meines Großvaters hielt nicht lange vor. Aber die Pferde blieben, sozusagen als segensreicher, aber arm machender Fluch meines Großvaters.
Das war 1962. Der Trecker, der ein paar Jahre zuvor die Wagenpferde abgelöst hatte, sprang, nachdem wir das Dieselöl einmal durchgesiebt hatten, wieder an. Die Scheune war noch baufälliger als zuvor, die Apfelbäume mussten vom Reet, das von der Flut in die Kronen getragen worden war, befreit werden. Fünf unserer Kühe waren bei der großen Sturmflut ertrunken, die Weiden erholten sich schnell. Da brauchte man etwas zum Grasen. Zunächst bekamen wir von einem Stader Augenarzt zwei Ponys, die wir als Ausgleich für die Fütterung reiten durften. Wir galoppierten am Elbstrand entlang und drängten unseren Vater, uns endlich auch Pferde zu kaufen. Er sträubte sich monatelang, vermutlich ahnte er, was sonst auf ihn und uns zukommen würde.
Es war nichts Tolles, was mein Vater eingekauft hatte, eine dreijährige, eine zweijährige und eine einjährige Stute, Vorbuchstuten. Vater mittelmäßig, Mutterlinie eher unklar. Wir zogen sie auf, ritten sie in Wildwestmanier ein, schließlich war mein Vater ja vor dem Krieg 15 Jahre in Kanada gewesen, als Farmer, Trapper und Cowboy. An der Weide in Stadersand, wo wir die Pferde im Sommer anritten, bildeten sich manchmal lange Schlangen von Autos, deren Insassen beeindruckt beobachteten, wie wir serienweise in Rodeomanier von buckelnden Pferden abgeworfen wurden. Darin hatten wir später eine ziemliche Übung, ein Pferd musste sich schon ziemlich viel Mühe geben, uns, meine Brüder und mich, loszuwerden.
Die Schülerzeitung
Der Krieg und das Dritte Reich lagen bei meiner Einschulung sieben Jahre und bei meinem Abitur gerade mal 21 Jahre zurück. Zu Hause wurde nicht darüber gesprochen und in der Schule auch nicht – denn die meisten Lehrer hatten ja zu diesem epochalen politischen und moralischen Desaster beigetragen.
Am Athenaeum gab es eine Schülerzeitung mit dem Namen Wir, bei der ich mich bereits in der achten Klasse engagierte. Als Journalist – auch bei der Schülerzeitung – konnte man alles kritisieren, konnte seine Nase überall hineinstecken. Man war zudem irgendwie wichtig, was schon daraus ersichtlich war, dass die Schulleitung Zensurmaßnahmen einführen wollte. Am Widerstand konnte man wachsen.
Ein großer Schreiber war ich nie, also fing ich an, die Finanzen der Schülerzeitung zu betreuen. Ich ging in Buchhandlungen und Geschäfte in Stade und warb Anzeigen für die Zeitung ein. Als meine Mutter davon erfuhr, war sie bass erstaunt. Ich sei doch normalerweise zu schüchtern, um im Laden irgendetwas Gekauftes zurückzugeben. Und jetzt würde ich die Inhaber von Geschäften dazu überreden, uns Anzeigen zu geben? Die Erklärung war relativ simpel: Als Vertreter der Schülerzeitung war ich in einer Funktion tätig, das nahm mir die Schüchternheit.
Es lag etwas in der Luft, ein Hauch von Aufklärung und Rebellion. Man war nicht eigentlich links, eher ein wenig anarcho-liberal, kritisch nach allen Seiten. In unserem Dezemberheft 1964 stellten wir unser Motto sogar auf die Titelseite: »Als Sprachrohr der Jugend veröffentlicht WIR frank und frei die Beobachtungen und Gedanken junger Menschen. Alle Artikel geben die persönliche Meinung ihrer Verfasser wieder. Sie sind keinesfalls mit den Ansichten aller Schüler oder gar der Schule gleichzusetzen.« Das gefiel nicht allen, vor allem unserem Schuldirektor Dr. Bartels nicht. Irgendeine eher nebensächliche Geschichte nahm er zum Anlass, die Vorzensur der Zeitung zu verfügen. Wir dürften einen Lehrer unseres Vertrauens aussuchen, der jeden Artikel vor der Veröffentlichung lesen und dann freigeben sollte. Dem wollte und konnte ich mich nicht fügen. Ich erklärte dem Direktor, dass wir das Heft dann außerhalb der Schule verkaufen würden. Das gefiel dem Direktor nicht besonders, und als dann das Hamburger Sonntagsblatt über unsere Differenzen mit der Schulleitung berichtete und einige Zeit danach sogar das Fernsehmagazin Panorama, war ziemlich dicke Luft.
Wir verkauften das neue Heft auf der Straße direkt vor dem Athenaeum, was manche Studienräte zum Anlass nahmen, den Schülern dringend vom Kauf des Blattes abzuraten. Mitglieder des Lehrerkollegiums suchten sogar die Stader Buchhandlungen auf und drückten ihr Missfallen darüber aus, dass die Wir dort zum Verkauf auslag.
Dafür kam uns damals Panorama zur Hilfe, und Joachim Fest moderierte am 29. November 1964 einen Beitrag, der sich mit Schülerzeitungen und deren Schwierigkeiten mit der Schulleitung beschäftigte. Dabei wurde ausführlich auf das Beispiel der Wir eingegangen, die, um keiner Zensur zu unterliegen, inzwischen außerhalb der Schule erschien.
Es gab einen ziemlichen Aufruhr am Athenaeum, als das Kamerateam von Panorama anrückte und von der Straße her die aus dem Fester lehnenden Lehrer filmte. Im klapprigen DKW-Kombi meiner Eltern, beklebt mit dem Titel der neuen Wir-Ausgabe, bog ich mit meiner Freundin Marlies auf dem Beifahrersitz eilig um die Ecken, um die Zeitung bei den zwei Buchhandlungen in Stade auszuliefern. Darunter der Song »Down around the corner in a little school« und der Text des Redakteurs Christian Herrendörfer: »Was diese Schüler tun, sehen viele Lehrer nicht gern. Sie geben in Stade eine eigene unabhängige Zeitung heraus, und das alle sechs Wochen in über 1000 Exemplaren. Den Lieferwagen für den Vertrieb stellte der Vater des Chefredakteurs. Die Zeitung kostet 50 Pfennig, ihre Herstellung über das Doppelte, die Differenz wird durch Anzeigen gedeckt.« Dann sah man, wie wir die Stufen zum Keller meiner Großmutter Elsa, der Mutter meiner Mutter, hinunterliefen. »Aus der Schülerzeitung ist eine jugendeigene Zeitung geworden, im Asyl, das die Großmutter des Chefredakteurs in ihrem Keller gewährte.«
Ich hatte extra meinen Freund Rolf Heuer aus der Heide anreisen lassen. Er konnte für seine 18 Jahre nicht nur unglaublich schreiben, sondern auch formulieren: »Eine Schülerzeitschrift hat schon genug mit dem Desinteresse der Schüler zu kämpfen, als daß es für sie opportun wäre, jetzt in eine Zweifrontenstellung auch noch gegen die Lehrer gedrängt zu werden.«
Der Reporter wandte sich an mich: »Wie kommt denn Ihre Schülerzeitung bei der Lehrerschaft an?«
»Es hört sich paradox an, aber ich glaube, im Augenblick kommt unsere Zeitung bei den meisten Lehrern besser an, als sie es vor dem Auszug aus der Schule tat. Unsere Zeitung ist eben interessanter geworden.«
Rolf, der seinen Namen später auf meinen Vorschlag in Rolv änderte, übernahm wieder die Interpretation: »Der Lehrer ist in seinem beschränkten Radius eingefroren, und er versucht, die Schüler in die Lähmung mit einzubeziehen.«
38 Jahre später wurde das Video in einer Sendung von 3 nach 9 noch einmal gezeigt. Darauf schrieb mir Marlies einen kleinen Brief: »Wir waren so streng und ernst. Ich habe das Gefühl, dass wir uns die ganze Verantwortung und Sprachlosigkeit der Generation unserer Eltern auf unsere schmächtigen Schultern gepackt haben.«