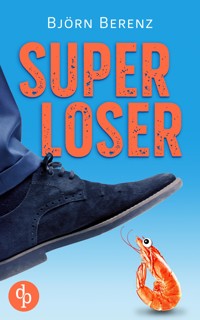4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dp DIGITAL PUBLISHERS GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was man(n) nicht alles für die Liebe tut …
Der humorvolle Roman von Björn Berenz für Fans skurriler Abenteuer
Simon Berger, 38 Jahre alt, hat im Zoo eine schicksalhafte Begegnung – mit einem Nilpferd! Die sonst eher aggressive Nilpferddame Daisy ist in Simons Gegenwart sanft und zahm. Als er schließlich erfährt, dass Daisy am selben Tag geboren ist, an dem seine Frau starb, ist für ihn eines ganz klar: in dieser Nilpferddame wohnt die Seele seiner geliebten Sandra! Zufall ausgeschlossen! Allerdings soll Daisy aufgrund ihrer aggressiven Art schon bald an andere Tiere des Zoos verfüttert werden und das kann Simon auf keinen Fall zulassen. Er fasst mit Spediteurin Eva und dem buddhistisch angehauchten Tierpfleger Hagen den Entschluss Daisy zu retten und eine wahnwitzige Reise durch Europa beginnt. Blöd nur, dass neben der Polizei auch eine rumänische Diebesbande und die Mafia hinter ihnen her sind …
Dies ist eine überarbeitete Neuausgabe des bereits erschienenen Titels Ach du dickes Ding.
Erste Leser:innenstimmen
„Ich habe mich totgelacht – geniale Komödie für Fans von Jonas Jonasson!“
„skurril, tierisch, witzig“
„Der flüssige Schreibstil, die absolut sympathischen Charaktere und das lustige Abenteuer machen einfach Spaß zu lesen!“
„Humorvoller Roman mit vielen witzigen Überraschungen und Wendungen. Pure Leseunterhaltung!“
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 487
Veröffentlichungsjahr: 2023