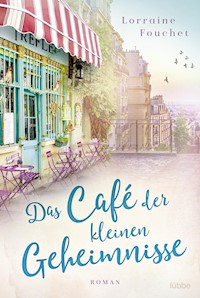9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atlantik
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Bei Fouchets Schreibstil kann man die Salzluft und den bretonischen Butterkuchen schmecken.« Brigitte Auf der Suche nach ihrem unbekannten Vater reist Chiara aus Rom in die stürmische Bretagne. Sie ist bei ihrer Mutter in dem Glauben aufgewachsen, ihr Vater sei vor ihrer Geburt gestorben, bis sie eines Tages erfährt, dass sie womöglich die Tochter eines bretonischen Matrosen ist. Doch wie soll sie ihn auf der Insel Groix fnden, wenn sie nicht einmal seinen Namen kennt? Als ihr eine Stelle als Inselbriefträgerin angeboten wird, hat sie einen perfekten Vorwand für ihre Nachforschungen. Auf Groix kommen die Überraschungen nämlich mit dem Postschiff , und die Briefkästen haben ihre eigenen Geheimnisse. Hier findet Chiara eine zweite Familie. Und sie lernt den undurchschaubaren Schriftsteller Gabin kennen. Aber wird Chiara auch erfahren, wer ihr Vater ist?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 319
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Lorraine Fouchet
Die 48 Briefkästen meines Vaters
Roman
Aus dem Französischen von Katrin Segerer
Atlantik
»Und was ich da lernte, kann ich in drei, vier Worten sagen:
Der Tag, an dem dich jemand liebt, ist ein schöner Tag.
Ich kann’s nicht besser sagen, es ist ein sehr schöner Tag.«
(Ich weiß von Heinz Rühmann, nach Maintenant je sais
von Jean Gabin)
Für alle Postbotinnen und Postboten.
Für lebensverändernde Bücher –
hoffentlich entdeckt ihr auch das eure.
Für die Tonnerres von der Île de Groix und anderswo:
Danke, dass ich mir euren schönen Namen
für meine fiktiven Helden ausleihen durfte.
Für dich, Papa.
Rom, Piazza del Popolo
Sechsundzwanzig Jahre früher
Sie sitzt draußen auf dem Platz vor dem Caffè Rosati, allein mit einem espresso, und es wird Sommer, obwohl erst April ist. Seitdem er sie kennt, schläft er nicht mehr gern, denn im Traum ist er von ihr getrennt. Sie hat sein Herz gekapert. Heute trägt sie ein Kleid in Orange, ihrer Lieblingsfarbe – er sieht das Leben nur noch durch die orangefarbene Brille. Sie umfasst die Tasse so sinnlich, dass er das Porzellan beneidet.
Alle Tische sind besetzt, aber die anderen Gäste verschwimmen vor seinen Augen, verblassen vor ihrer Schönheit. Sie hat die langen Beine übereinandergeschlagen, ihr Haar ist zerzaust. Was für ein unerhörtes Glück er doch hat, dass sie ihn liebt. Er war so kühn, um ihre Hand anzuhalten, das Glück mit ihr zu wagen. Letzte Woche haben sie geheiratet, es sind noch nicht einmal die Geschenke ausgepackt. Sie müssen sich bei zio Peppe für die hässliche Lampe bedanken und bei zia Maria für das schreckliche Bild; er darf nicht vergessen, es aufzuhängen, wenn sie zu Besuch kommt. Von jetzt an wird er jeden Morgen neben ihr aufwachen. Wie soll er es nur schaffen, sich aus ihren Armen zu winden, um zur Arbeit zu gehen?
Er steht vor der Chiesa degli Artisti, der Kirche der Künstler. Sie hebt den Kopf, entdeckt ihn, und ihr Lächeln wärmt ihm das Herz. Er hat Schmetterlinge im Bauch, fühlt sich, als würde er sich am Strand des Mastino in Fregene rekeln. Ihr gesamtes gemeinsames Leben wird voll Sonne und Glück sein – ein Wunder, weil sie seine Frau ist. Weil sie einen Ring mit ihrer beider Initialen am Finger trägt.
Sie winkt, und der Ring glänzt im Licht. Noch drei Meter, und er kann sie endlich an sich ziehen. Es ist zu früh für Prosecco, das holen sie später nach. Sie hat heute Geburtstag. Hoffentlich gefällt ihr die Überraschung, die er für sie vorbereitet hat. Sie treffen sich mit Freunden zum Abendessen, obwohl er lieber allein mit ihr in die Tiefen der Laken abtauchen würde.
Ein Lied von Paolo Conte schwirrt ihm durch den Kopf: Via con me. Seine Hände fühlen schon ihren weichen Körper. Er sehnt sich nach ihrem Duft, ist verrückt nach ihr. Leise singt er vor sich hin, it’s wonderful, it’s wonderful, it’s wonderful, I dream of you. Die gelbe Vespa bemerkt er gar nicht.
Plötzlich verzerrt sich das Gesicht der Frau, die er liebt, wird beinahe hässlich. Sie springt auf, wirft die Tasse um. Der espresso ergießt sich über den Tisch, tropft zu Boden. Für den Bruchteil einer Sekunde nimmt er jedes Detail ganz deutlich wahr. Dann erfasst ihn die Vespa, und er stürzt auf das Kopfsteinpflaster der ewigen Stadt.
Er spürt keinen Schmerz, keine Angst, keine Kälte, nichts mehr. Er hört weder das Ächzen des fallenden Fahrers noch das Knirschen des Blechs, als die Vespa gegen ein Auto prallt, nicht einmal den Schrei seiner jungen Frau. Er bekommt nicht mit, wie sie zu ihm stürmt, sein Gesicht packt. Er sieht nicht, wie ihr Ehering glitzert, schmeckt nicht ihre Tränen, hat das Geburtstagsgeschenk vergessen. In seinem hoffnungslos zerschmetterten Kopf läuft nur der letzte Teil des Liedes in Endlosschleife, it’s wonderful, I dream of you …
Schließlich herrscht Stille, unerbittlich, ungerührt von der schluchzenden hübschen Frau, die sich jäh im eisigsten Winter wiederfindet.
Rom, am Ufer des Tibers
Ich heiße Chiara Ferrari und bin fünfundzwanzig Jahre alt. Meine Familie besteht aus vier Personen, von denen nur zwei noch am Leben sind: meiner Mutter Livia, die ich beim Vornamen nenne, meinem Vater, der bei einem tragischen Unfall gestorben ist, meiner Großmutter nonna Ornella, die ihrem Sohn vor einem Jahr nachgefolgt ist, und meiner Taufpatin Viola, einer Kindheitsfreundin meiner Mutter. Bei uns zu Hause wird nie gelacht, das wäre respektlos dem Großen Fehlenden gegenüber, meinem Vater, der sich aus dem Staub gemacht hat, bevor ich mich überhaupt ankündigen konnte.
Was nützt einem ein Vater? Ich habe meinen nicht verloren, weil ich ihn nie hatte. Aufgewachsen bin ich in Rom, mit einem jungen, sportlichen, witzigen, charmanten Papa, der mir in allen Zimmern aus einem Bilderrahmen entgegenlächelte. Zu Beginn jedes neuen Schuljahrs, wenn nach seinem Beruf gefragt wurde, erfand ich etwas anderes: Carabiniere, Feuerwehrmann, Anwalt, Taucher, Bombenentschärfer oder sogar Schweizergardist, was gar keinen Sinn ergibt, weil die ja unverheiratet sein müssen. Wenn meine Eltern etwas unterschreiben sollten, konnte ich immer nur mit dem eleganten Schriftzug meiner Mutter aufwarten. Irgendwann hatte ich es satt, mit einem Geist als Vater zu leben. Ich habe behauptet, er würde mich allein erziehen, weil Livia tot sei, was nicht vollkommen falsch war. Das Ganze endete in einem Rieseneklat, meine Mutter wurde zur Schulleiterin bestellt. Dabei hatte ich doch nur dem Kaiser geben wollen, was dem Kaiser gebührt, und meinem Vater in aller Öffentlichkeit beweisen, wie viel er mir bedeutet.
Mein bester Freund hat mich gerettet. Alessio ist warmherzig und immer für mich da. Er wurde von einer liebevollen Mutter großgezogen und hat ebenfalls keinen Vater mehr, das hat uns zusammengeschweißt.
Ehrlich gesagt wäre es mir lieber gewesen, im Heim aufzuwachsen. Livia hat mich nie in den Arm genommen, weil sie auch ihren Ehemann nicht mehr umschlingen konnte. Sie gab mir die Hand, wenn wir die Straße überquerten, und ließ mich los, sobald wir den gegenüberliegenden Bürgersteig erreicht hatten. Wollte jemand sie küssen, wich sie zurück, als hätte sie Angst vor einem Stromschlag. Wir waren eher Mitbewohner als Mutter und Tochter. Sie betrank sich mit Grappa, bevor sie – allein – schlafen ging. Und ich in meinem unbestimmten Schuldbewusstsein hielt mein Herz an und wartete darauf, endlich erwachsen zu werden, um ihr zu entkommen und mich am Leben zu betrinken.
Livia warf mir vor, nicht traurig genug über den Tod meines Vaters zu sein. Aber wie sollte ich? Ich hatte ihn ja nicht lebendig gekannt. »Du bist eine schlechte Tochter«, sagte sie einmal zu mir, als ich an seinem Geburtstag eine Kerze anzündete und fröhlich »Buon compleanno a te!« rief. Dabei hatte ich mir nichts Böses dabei gedacht, ich hatte ihn niemals reden hören, sich bewegen sehen, war nur mit seinem stummen Lachen, seinen weißen Zähnen auf dem glänzenden Fotopapier vertraut. Sein Tod bedeutete keine Abwesenheit, sondern eine diffuse und melancholische Dauerpräsenz. »Wenn ich die Wahl hätte, würde ich ihn nehmen, nicht dich«, fügte sie hinzu. Damit hatte sie recht, es war logisch. Ein Ehemann macht Urlaub mit einem, parkt das Auto, bringt Blumen mit, wenn er von der Arbeit nach Hause kommt. Er ist viel nützlicher als eine kleine Tochter, die man zur Schule, zum Kinderarzt, zum Zahnarzt fahren muss und der man bei den Hausaufgaben helfen soll. Im Grunde verstand ich sie. Auch ich hätte ihn bevorzugt. Er imponierte mir: Ein Kerl, der bis in den Himmel klettert, nachdem er auf der Piazza del Popolo von einer Vespa überfahren wurde, das war nicht ohne. Eine Sportskanone, die eine Woche nach der Hochzeit mit einem Satz ins Paradies springt, was für eine Leistung! Er hatte alle Rekorde gebrochen, ich konnte stolz auf ihn sein.
Im Land der herzlichen Familien geboren zu werden und dann eine Mutter zu haben, die einen nicht anrührt, ist schlimmer, als keine Pasta mit Tomatensoße zu mögen, es ist eine unverzeihliche Geschmacksverirrung. Außer meinen Klassenfotos gab es keinen einzigen Schnappschuss von mir als Kind, denn für Livia verdienten nur die Bilder ihres Ehemanns einen Platz an der Wand. Ich war überflüssig, ganz einfach, kein Grund, ein großes Trara zu machen.
Heute Abend, sechsundzwanzig Jahre und einen Tag nach dem Tod meines Vaters, feiern wir Livias fünfzigsten Geburtstag am Ufer des Tibers, in einer der Lieblingsosterien meiner Patin Viola. Der Große Fehlende wird auch da sein, unsichtbar und doch nicht zu übersehen, zwischen den Gläsern und Tellern, zwischen der Vorspeise und der torta mit den fünf Kerzen darauf.
Eigentlich war Livias Geburtstag schon gestern, aber seit dem Unglück existiert dieser Tag für sie nicht mehr. Sie hat ihn aus dem Kalender gestrichen. An diesem schicksalhaften Datum ist man bloß ein Schatten, zieht den Kopf ein, bläst Trübsal. Erst danach kehren Alltag und Pflicht wieder ein.
Wir trinken einen Spritz als Aperitif, anschließend einen Prosecco. Livia bläst die Kerzen aus, Viola klatscht Beifall. Mattia, Violas Liebhaber, ein verheirateter Familienvater, ruft an, um zu gratulieren. Die Augen meiner Mutter und meiner Patin glänzen, die beiden sind ziemlich angeheitert. In einer Viertelstunde kann ich mich ruhigen Gewissens verabschieden.
Plötzlich erhebt Viola ihr Glas, fixiert meine Mutter wie einen Schmetterling auf einer Korkplatte und verkündet: »So ist es besser für alle.«
Niemand versteht, worauf sie anspielt, also setzt sie noch einen drauf.
»So ist es besser für alle. Das hast du vor sechsundzwanzig Jahren beschlossen, Livia, weißt du noch?«
Meine Mutter runzelt die Stirn. Ihr Blick wird messerscharf.
Viola dreht sich zu mir.
»Livia lügt dich an, und zwar seit deiner Geburt. Sie ist nicht die perfekte, untröstliche Witwe, die alle Welt bedauert. Sie hat keine Ahnung, wer dein Vater ist.«
Ich lache unsicher.
»Hör nicht auf sie, Chiara«, zischt Livia.
»Von wegen! Du bist vielleicht die Tochter eines Franzosen«, fährt Viola unerbittlich fort. »Livia hat damals beschlossen, dass es besser für alle wäre, wenn ihr verstorbener Ehemann dein Vater ist. In Wahrheit stehen die Chancen fünfzig zu fünfzig.«
Nachdem meine sonst so gutherzige Patin ihre Bombe hat platzen lassen, grinst sie hämisch. Livia krümmt sich unter der Wucht der Explosion, ich schwanke. Innerhalb einer Sekunde liegen unsere beiden Leben in Scherben.
Mein Vater, ein Franzose? Wie erstarrt wiederhole ich Violas Worte einmal, zweimal, dreimal im Kopf. Genau diesen Moment wählt der Kellner, um an unseren Tisch zu kommen und zu fragen, ob wir noch eine Flasche möchten. Niemand antwortet ihm. Livia funkelt ihre Freundin wütend an. Violas Gesicht hat sich zu einer boshaften Grimasse verzogen, ich erkenne sie kaum wieder. Der Hass ist beinahe greifbar.
»Du bist betrunken«, faucht Livia.
»Genau wie du in der Nacht, als du diesen Bretonen getroffen hast«, gibt Viola zurück. »Chiara ist entweder ein Kind der Liebe oder des Limoncellos.«
»Schämst du dich nicht, so etwas vor ihr zu sagen?«
»Schämst du dich nicht, deine eigene Tochter anzulügen?«
»Warum heute?«, fragt Livia mit erstickter Stimme. Sie ist nicht länger meine Mutter, sondern ein verratenes, verletztes Kind. Zum allerersten Mal bröckelt ihre Fassade.
»Aus Rache«, antwortet Viola. »Du hast Mattia geraten, mit mir Schluss zu machen. Er hat es mir erzählt, aber ich wollte ihm nicht glauben. Als du eben mit ihm telefoniert hast, habe ich dich angeschaut und erkannt, dass es die Wahrheit ist.«
Ich halte den Atem an. Gleich wache ich aus diesem Albtraum auf, und mein Vater lächelt unbeschadet aus seinem Bilderrahmen auf mich herab, Livia und Viola sind ein Herz und eine Seele, Alessio ist mein bester Freund und Vertrauter. Jeder ist wieder an seinem richtigen, angestammten Platz, niemand schert aus.
»Mattia wird seine Frau niemals verlassen«, sagt Livia langsam.
»Du Hexe«, keift Viola. »Strega! Puttana!«
»Er tut dir nicht gut, er hat dich nicht verdient. Ich will nur dein Bestes, und du fällst mir in den Rücken. Ich habe dir vertraut! Chiara, ich kann dir das erklären …«
»Nicht nötig«, unterbreche ich sie knapp.
Die Auseinandersetzung dieser beiden vom Leben gebeutelten Frauen, die mich aufgezogen haben, macht mich fassungslos.
»Viola lügt«, stößt Livia hervor und packt mich am Arm. »Glaub ihr kein Wort! Dein Vater war ein wunderbarer Mensch, und du bist ihm sehr ähnlich.«
Meine Mutter hat mich gerade freiwillig berührt. Zum ersten Mal seit Jahren. Das ist mindestens genauso verblüffend wie die Information, dass mein sagenumwobener Vater vielleicht nicht mein biologischer Erzeuger ist.
»Livia ist die Lügnerin!« Viola packt mich am anderen Arm. »Ich habe den Brief aufgehoben, in dem sie schreibt, dass es so besser für alle sei. Dieser Franzose kam von einer Insel in der Bretagne und hieß wie irgendein Wetterphänomen. Éclair?«
»Das verzeihe ich dir nie!« Livia wendet sich an mich, blickt mir fest in die Augen, um mich zu überzeugen. »Dein Vater hatte einen Unfall, als er die Piazza del Popolo überquert hat. Auf dem Weg zu mir. Es war meine Schuld. Ich bin verantwortlich für seinen Tod. Mit dieser Bürde muss ich jeden Tag leben.«
Sie schließt die Lider, sieht mich nicht mehr, ist woanders, an diesem unerträglichen Ort, an dem sie allmorgendlich aufwacht.
»Deinetwegen will Mattia mich in den Wind schießen«, schreit Viola zornig. »Ti odio! Glaub mir, Chiara, es ist gut möglich, dass dein richtiger Vater noch lebt.«
Livia springt auf und rennt aus der Osteria. Ich bin zu erschüttert, um sie aufzuhalten.
Ich schaue meine Patin an. Die Fundamente meines Lebens werden rissig.
»Warum ausgerechnet an ihrem Geburtstag?«, frage ich.
»Der war gestern, nicht heute. Außerdem bin ich auch fünfzig. Deine Mutter hat ihren Mann verloren, aber dafür die Achtung aller Idioten gewonnen, die meinen, eine anständige Frau müsse verheiratet sein und Kinder kriegen. Ich habe weder einen Ring am Finger noch bambini, ich hatte nur Mattia, an jedem zweiten Nachmittag. Dieses kleine Glück hat sie mir genommen. Ich habe es ihr mit gleicher Münze heimgezahlt.«
»Und ich zahle die Zeche.«
»Du bist bloß Kollateralschaden. Sie hätte es dir längst sagen müssen. Sie hat sich eingeredet, dass es keinen Zweifel an der Vaterschaft gibt, bis sie es selbst geglaubt hat. Und die Wahrheit hat sie unter den Teppich gekehrt.«
»Was ist damals passiert? Hat der Franzose sie vergewaltigt?«, frage ich lauter als beabsichtigt in meiner Verwirrung.
Zwei Priester am Nachbartisch, deutlich erkennbar an ihren Kragen und den Kreuzen am Revers, zucken hinter ihrem Berg risotto alla parmigiana vor Schreck zusammen.
»Ihr Mann war gerade gestorben, sie war völlig lethargisch«, antwortet Viola. »Ich habe sie für ein Wochenende mit in die Toskana geschleift, zu meiner Cousine auf die Insel Elba. Deine Mutter war bildschön, musst du wissen, alle Männer lagen ihr zu Füßen. Mich haben sie nicht einmal angesehen, sie hatten nur Augen für sie …«
Mir kommt ein Foto in den Sinn, auf dem die Freundinnen am Strand von Ostia entlangspazieren. Damals waren sie ungefähr so alt wie ich heute. Livia wirkt betörend, Viola nett. Sie haben nie in derselben Liga gespielt.
»Deine Mutter trug als Einzige Schwarz. Sie konnte nicht tanzen, weil sie in Trauer war. Stattdessen hat sie Limoncellogläser geschwenkt. Am Vortag hatten ein paar französische Fischer, die vom Hafen kamen, meiner Cousine beim Reifenwechseln geholfen – sie war mit ihrem Panda über einen Nagel gefahren –, deshalb hat sie sie zum Dank eingeladen. Einer von ihnen hat mit deiner Mutter geredet. Sie ist in Tränen ausgebrochen. Ich dachte, es würde ihr guttun, wenn sie ihre Trauer zeigt, wenn sie sich gehen lässt, statt sich im Haus zu vergraben, als wäre sie selbst gestorben.«
»Und er hat sie von den Toten auferweckt?«, frage ich wütend.
»Ich habe mich amüsiert und mich nicht um sie gekümmert. Wir haben uns erst am nächsten Morgen getroffen, um nach Rom zurückzukehren. Sie hat mir nichts erzählt. Sie war wieder nüchtern und hat sich geschämt. Die trauernde Witwe, die das Andenken ihres Mannes verrät – die Leute hätten sich den Mund zerrissen! Als sie bemerkt hat, dass sie schwanger ist, hat sie sich niemandem außer mir anvertraut, nicht einmal ihrem Frauenarzt. Der Franzose hat deinem Vater sehr ähnlich gesehen. Du bist zu früh zur Welt gekommen, also hat auch das die Zweifel nicht ausgeräumt. Beide könnten dein Vater sein.«
Ich traue meinen Ohren nicht. Livia, die untadelige Witwe, hat sich unmittelbar nach dem Unfall einen Fehltritt mit einer Zufallsbekanntschaft erlaubt.
»Nur ich kenne ihr Geheimnis, seit sechsundzwanzig Jahren«, schließt Viola.
»Und du hast es soeben gelüftet«, sage ich angewidert.
»Immerhin habe ich gewartet, bis deine Großmutter von uns gegangen ist.«
Nonna Ornella hat in jeder meiner Bewegungen ihren Sohn gesucht. Wenn mein Vater gar nicht mein Vater war, dann war sie auch nicht meine Großmutter. Dabei habe ich sie mehr geliebt als Livia. Ich seufze.
»Offenbar genießt man Rache tatsächlich am besten kalt. Bist du jetzt zufrieden?«
Viola schüttelt den Kopf. Sie kann mir nicht länger in die Augen schauen. Ich stehe auf und gehe zur Tür. Ich habe guten Willen gezeigt und bin zu diesem Geburtstagsessen gekommen, jetzt verlasse ich es gebrochener und einsamer als je zuvor. Der Riss in meinem Inneren ist zu einem gähnenden Abgrund geworden. Tausend Fragen schwirren mir durch den Kopf. Draußen auf der Straße atme ich tief aus, um das Unglück zu vertreiben. Irgendetwas nagt an mir, und ich kehre wieder um. Viola ist noch da, sie bezahlt gerade.
»Er hieß wie ein Wetterphänomen, aber von welcher Insel kam er genau?«
Flughafen Fiumicino
Roter Briefkasten
Der rote Briefkasten hat zwei Schlitze, einen per Roma e provincia di Roma, den anderen per tutte le altre destinazioni. Eine junge Frau schiebt drei Umschläge in den linken. Der Briefkasten ist einiges gewohnt, schließlich bekommt er ständig Scheidungspapiere, Abschiedsbriefe, Anschuldigungen zu Gesicht – Flughäfen bringen die Emotionen zum Überkochen. Besser gefallen ihm allerdings die Liebesbriefe, die in den Bäuchen der Flugzeuge davongetragen werden. Er erkennt die menschlichen Gefühle – Wut, Zärtlichkeit, Verlangen, Verzweiflung – daran, wie die Adressen geschrieben sind.
Die ersten öffentlichen Briefkästen waren im vierzehnten Jahrhundert in Rom, Venedig und Genua die sogenannten Löwenmäuler, in die man anonyme Denunziationen an die Regierung stecken konnte. Später war monogrammiertes Briefpapier ein Vorrecht des Adels. Heute kommunizieren die Menschen über E-Mail, SMS oder die sozialen Netzwerke. Die Frau, die gerade drei Briefe an Adressen in Rom eingeworfen hat, weiß, dass sie zwei Tage bis zu ihren Empfängern, zwei Frauen und einem Mann, brauchen werden.
Hätte der Briefkasten Arme, würde er die Umschläge gegen das Licht halten und den genauen Inhalt der Schreiben entziffern oder die Lasche mit Wasserdampf lösen und sie auseinanderfalten. Aber das ist unmöglich, also begnügt er sich damit, seiner blühenden Phantasie freien Lauf zu lassen.
Die junge Frau heißt Chiara Ferrari, das steht auf der Rückseite der Umschläge. Die Empfänger heißen Livia, Viola und Marco. Die Handschrift neigt sich nach rechts und ist so unruhig, dass sie sich an mehreren Stellen durchs Papier gedrückt hat.
Flughafen Beauvais
Als das Flugzeug auf französischem Boden aufsetzt, klatschen nur die italienischen Passagiere. Ich bin völlig benommen, ich habe heute Nacht keine drei Stunden geschlafen.
Die Insel heißt Groix. Viola hat den Namen ausgesprochen, wie er geschrieben wird: Gro-Ix. Kaum zu Hause, habe ich mir ein Flugticket nach Paris gekauft, nur den Hinflug, weil ich noch nicht weiß, wie lange ich bleibe. Ich habe Alessio alles erzählt, er hat mich unterstützt, mich in meiner Entscheidung bestärkt.
Ich muss den Bus bis Porte Maillot nehmen, anschließend die Métro zur Gare Montparnasse, von wo aus ich mit dem Zug in die Bretagne fahre, nach Lorient im Département Morbihan. Dann brauche ich bloß noch die Fähre zu besteigen.
Ich habe die Rollen gewechselt. Bis vor Kurzem war ich die Heldin einer Corneille’schen Tragödie, die Tochter einer gebrochenen Witwe und eines ruhelosen Toten. Jetzt befinde ich mich plötzlich mitten in einer Posse.
Überfahrt von Lorient nach Groix
Ich habe die Sprache Molières von Nonnen gelernt, in der französischen Schule in Rom, auf die Livia mich unbedingt schicken wollte – jetzt weiß ich, warum. Allerdings kann ich kein Bretonisch. Die Schilder hier sind zweisprachig. Ich besteige die Fähre in Lorient, An Orient, und fahre auf die Insel Groix, Enez Groe. Ich bin zum ersten Mal in Frankreich.
Auf der Karte ähnelt das Land einem Menschen im Profil, dessen Zinken bis ins Finistère ragt und dessen Nasenloch im Morbihan erzittert. Offenbar haben die Bretonen ein Näschen für Dinge, einen guten Riecher, Charakter. Ich suche einen Inselbewohner, einen Groixer. Ich bete, dass er noch lebt, dass er nicht den Anker gelichtet hat und anderswohin geschippert ist. Und dass ich ihn nicht enttäusche. Du hast mich nie enttäuscht, Alessio, und das trifft hoffentlich auch umgekehrt zu. Ich schätze mal, ich bin die einzige Passagierin, auf die niemand wartet und die noch keinen Schimmer hat, wo sie heute Nacht schläft.
Italiener, die Französisch sprechen, erkennt man an den us und ois. Sie sagen nicht ü sondern u. Und nicht ua, sondern o-i. Ich trete an den Schalter im Fährhafen in der Rue Gilles-Gahinet.
»Einmal nach Gro-Ix, bitte.«
»Wohin?«
Ich deute auf das Faltblatt Île de Groix – Lorient mit den Zeiten und Preisen der Fährverbindungen. Die junge Frau lächelt.
»Einfache Fahrt oder den Zwei-Insel-Pass mit zwei Hin- und Rückfahrten?«
Mein Magen verkrampft sich. Seit dem panino um fünf Uhr früh habe ich nichts mehr gegessen.
»Einfache Fahrt.«
Es ist viel los an diesem langen Frühlingswochenende. Die Passagiere auf der Fähre – Reisegruppen, Familien, Paare – verströmen Lebenslust. Du fehlst mir, Alessio. Du weißt, dass mir der Anblick von glücklichen Familien einen Stich versetzt. Livia hat mir pizze und pasta aufgetischt, bis ich wie ein Michelin-Männchen aussah. Die Kilos zu viel und meine Illusionen verlor ich ab dem Tag, als ich sie Viola zuflüstern hörte: »Ohne Chiara hätte ich noch einmal neu anfangen und glücklich werden können.« Unser Familienkokon – il papà, la mamma, la bambina – war für sie ein Gefängnis. Auf Italienisch setzt man einen Akzent über das zweite a in papà. Il papa ohne Akzent ist der Papst. Der ist mir vertrauter als mein Vater. Zumindest ist er am Leben und empfängt seine Kinder mit offenen Armen.
»Guck mal, Papa!«
Ich mag die Papas anderer. Egal ob groß, klein, dick, dünn, kahl, behaart, bärtig, glatt rasiert, mondän oder bodenständig. Hauptsache da. Selbst ein ramponierter, verbeulter, kaputter Papa wäre mir lieber gewesen als ein toter. Ich hätte ihn durch meine Liebe repariert.
Auf dem Oberdeck tummeln sich die Leute mit Koffern, Sandwiches, Hunden, Katzen, Gitarren, Sonnenbrillen, Kopfhörern, breitem Lächeln: das reine Glück, wohin man auch schaut. Ich sitze mit meinem Seesack einer Vorzeigefamilie gegenüber. Der Vater, eine Bohnenstange mit Surfervisage, blonden Locken und hellen Augen, trägt eine blaue Jeans, einen ausgeleierten groben Strickpulli und rote New-Balance-Sneaker. Die Mutter ist eine sexy Brünette in grasgrüner Steppjacke, Jeans und schwarzen Boots. Kurz beneide ich das Paar, die beiden sind schön, unbekümmert, und zu ihren Füßen spielen fröhliche kleine Zwillinge in Latzhosen, die eine rot, die andere blau. Ich male mir kuschelige Sonntagvormittage im Bett aus, eine lichtdurchflutete Küche, einen geschmückten Weihnachtsbaum. Die Eltern haben das gleiche Perlenarmband um, wahrscheinlich ein Souvenir von einer noch vor der Geburt der Jungen unternommenen Reise. Sie sind in meinem Alter, aber nicht so einsam wie ich. Ich hatte schon die verschiedensten Berufe, habe auf dem Flohmarkt an der Porta Portese gearbeitet, als Kellnerin im Caffè delle Arti und als Verkäuferin in der Via Veneto. Gerade arbeite ich in einer Buchhandlung mitten in der Stadt. Als ich Rom heute Morgen verlassen habe, habe ich weder Livia noch Viola, weder meinem Freund Marco noch meinem Chef Bescheid gegeben. Nach dem gestrigen Abend habe ich Hals über Kopf alles hingeschmissen. Es war die Geburtstagsfeier meiner Mutter, aber ich habe den Springteufel ausgepackt.
Ich wohne nicht mit Marco zusammen, ich habe zu viel Angst davor, mich zu binden, jemanden an mich ranzulassen, wegen eines Mannes zu leiden. Ich bin für nichts und niemanden verantwortlich. Ich habe weder Kinder noch Goldfisch. Keine Kaffeemaschine, meinen espresso trinke ich in der Nuclear Bar unten in meinem Haus. Kein Auto, ich fahre einen Scarabeo von Piaggio, bloß keine Vespa. Und auch meine Zweizimmerwohnung in Monte Mario ist nur gemietet.
»Nolan, nicht auf dem Boden rumwälzen. Evan, hoch mit dir!«
Die Latzhosen-Jungs hören nicht auf ihre Mutter. Ihr Vater tippt auf seinem Handy herum. Das Handy der Mutter klingelt, sie dreht sich weg und hebt ab. Dabei schließt sie eine Sekunde lang die Augen.
Genau in diesem Moment kommt eine Frau mit einem faltigen kleinen Shar-Pei vorbei, den die Zwillinge mit offenem Mund anstarren. Sie nutzen die Unachtsamkeit ihrer Mutter, um dem Welpen nachzulaufen, und stolpern über ihre eigenen Beinchen, weil die Fähre schaukelt. Plötzlich geht alles ganz schnell. Die Frau nimmt den Hund hoch und steigt die Leiter zum Unterdeck hinunter. Die beiden Jungen bleiben enttäuscht stehen. Der mit der roten Latzhose ist drauf und dran, Frau und Hund hinterherzuklettern und sich dabei den Hals zu brechen. Der mit der blauen Latzhose tapst auf die Reling zu, die die Passagiere vom Wasser trennt, und will darunter hindurchkriechen. Die Eltern haben nichts mitbekommen.
Instinktiv trete ich dem Vater gegens Schienbein. Er schreckt auf und schaut mich an, als wäre ich verrückt. Keine Zeit für Erklärungen, ich gestikuliere hektisch in Richtung der Kinder, und wir stürzen jeder auf einen Zwilling zu. Ich packe den mit der blauen Latzhose am Bein, kurz bevor er von Bord rutscht. Die Angst verleiht mir ungeahnte Kräfte, er wehrt sich, klammert sich an der Reling fest, aber ich zerre ihn wieder an Deck, in Sicherheit, weg von den dunklen Wellen, die gegen den Schiffsrumpf schlagen. Dann wende ich mich schnaufend um. Der Vater presst den mit der roten Latzhose an sich, der Junge windet sich, ist jedoch gesund und munter.
»Er hat eine Sprosse verfehlt, ich habe ihn gerade noch am Hosenträger zu fassen gekriegt. Das war der Schreck meines Lebens.«
»Mamaaaaan«, heult Nolan und versucht, seinem Vater zu entwischen.
»Mamaaaaan«, stimmt Evan mit ein und zieht an meinem Arm.
Die Mutter dreht sich um und runzelt die Stirn.
»Was machen Sie da? Lassen Sie sofort meine Kinder los!«
Die Wut erstickt mich fast.
»Ohne mich wäre eins ins Meer und das andere die Leiter runtergefallen. Sie sollten mir danken, statt mich anzuschreien.«
Sie wird blass, steckt ihr Handy ein und eilt zu ihren Bengeln. Die beiden flüchten sich in den Schutz ihrer mütterlichen Fittiche. Der Vater reicht mir die Hand.
»Ich heiße Gabin, wie der Schauspieler.«
»Ich heiße Chiara, wie meine Mutter mit zweitem Vornamen. Welcher Schauspieler?«
»Ich weiß, dass man niemals alles wissen wird / Über das Leben, die Liebe, das Geld, die Freunde und die Rosen. / Nichts weiß man, nichts, das ist alles, was ich weiß, und das weiß ich.«
»Wie bitte?«
»Jean Gabin! Soll ich Halbmast flaggen? Nein? Wenn alle Menschen immer die Wahrheit sagten, wäre das die Hölle auf Erden. Auch nicht? Sie mögen wohl keine Filme.«
»Ich kenne bloß die italienischen Schauspieler besser als die französischen.«
»Ihr Dummköpfe«, schreit unterdessen die Mutter und rüttelt und schüttelt die Zwillinge. »Euch hätte sonst was passieren können!«
»Alles in Ordnung. Es ist noch einmal gut gegangen«, sagt Gabin ruhig, anstatt seine Frau in den Arm zu nehmen.
»Nichts ist in Ordnung«, schluchzt sie. »Wenn ich ohne die beiden ankäme, müsste ich vor Kummer sterben. Und meine Eltern würden mich anschließend gleich noch mal umbringen.«
»Jetzt sind sie ja in Sicherheit«, sage ich.
Dann wende ich mich dem Vater zu.
»Muss man bei den Rabauken immer so aufpassen?«
»Keine Ahnung, ich habe keine Kinder«, antwortet er.
Ich reiße die Augen auf.
»Sie sind gar nicht ihr Vater?«
»Ich sehe sie heute zum ersten Mal. Als ich gemerkt habe, dass die Jungs in Gefahr sind, bin ich einfach losgelaufen. Sie haben einen ordentlichen Tritt drauf, ich humpele bestimmt tagelang.«
»Ihr Vater ist nach Nepal abgehauen«, flüstert die Mutter, »der Mistkerl hat mich sitzenlassen, um Joints zu rauchen.«
»Aber Sie haben das gleiche Armband!« Ich deute auf ihre Handgelenke.
Reiner Zufall. Die Perlen an Gabins Arm glänzen rötlich, sind aber eigentlich schwarz, die am Arm der Mutter sind dunkelrot.
»Mein Ex hat es mir gegeben, als ich schwanger war. Anscheinend beschützen Achate ungeborene Kinder. Ich behalte es nur aus Aberglauben«, erklärt sie.
»Und Granate sind heilige Steine für die amerikanischen Ureinwohner. Mein Armband war auch ein Geschenk«, fügt Gabin-wie-der-Schauspieler hinzu.
Ich lächele, weil niemand gestorben ist und die Zwillinge noch ihr ganzes Leben haben, um Dummheiten zu machen. Weil die Vorzeigefamilie gar keine ist und man bloß das Gras auf der anderen Seite immer für grüner hält. Weil du, Alessio, sofort geahnt hättest, dass Gabin nicht der Vater der Jungen ist. Du hättest mich darauf hingewiesen, dass die beiden bloß ihre Mutter anschauen, nicht den Mann daneben. Ich fühle mich einsam, die Leere überrollt mich, als das Signalhorn der Fähre ertönt. Wir fahren in den Hafen ein. Familien, Freunde, Hunde warten ungeduldig auf die Ankunft ihrer Lieben. Ich dagegen suche einen Mann, der wie ein Wetterphänomen heißt. Bald wird es dunkel, und ich weiß noch nicht, wo ich schlafen soll. Die Insel ist winzig, gerade acht mal vier Kilometer groß. Was tue ich, wenn alle Hotels ausgebucht sind?
Die Fähre legt an. Die Mutter der Zwillinge holt eine Leine aus der Handtasche und befestigt sie an den Trägern der Latzhosen. Dann schüttelt sie Gabin und mir die Hand. Sie ist immer noch kalkweiß vor Angst.
»Ich kann Ihnen gar nicht genug danken …«
Die Gefühle überwältigen sie.
»Ach, wollen wir uns nicht duzen? Ich heiße Urielle, nach dem Erzengel. Ich stamme von der Insel.«
»God save the Queen«, sagt Gabin, um sie aufzuheitern.
Sie lächelt schwach, ohne die Leine loszulassen.
»Nicht aus England. Ich bin Groixerin. Man nennt uns auch Greks, nach dem bretonischen Wort für die Kaffeekanne, mit der sich die Seefahrer auf Thunfischfang warm gehalten haben. Ich bin hier geboren, wohne aber in Paris, ganz in der Nähe vom Bataclan. Ich besuche meine Eltern übers Wochenende.«
Das Bataclan ist für das verwundete Paris mittlerweile ein ähnlich wichtiges Wahrzeichen wie der Eiffelturm oder der Louvre. Urielle deutet auf Gabin und mich.
»Seid ihr zusammen?«
Ich muss lachen, trotz der Panik, die mir seit gestern Abend die Brust zuschnürt. Sie glaubt, Gabin und ich wären ein Paar, ich dachte dasselbe von ihm und ihr.
»Ehrlich gesagt kennen wir uns gar nicht. Ich heiße Chiara Ferrari, wie die Automarke, und ich komme aus Rom.«
»Und ich Gabin Aragon, wie der Dichter, aber weder verwandt noch verschwägert. Ich bin Korse. Und Schriftsteller. Ich schreibe ein Buch über die Île de Groix und muss recherchieren.«
Die anderen Passagiere packen ihre Sachen zusammen. Kinder quäken, Hunde bellen, es wird Zeit.
»Habt ihr Freunde hier oder übernachtet ihr im Hotel?«, fragt Urielle.
»Ich habe noch nichts gebucht«, gestehe ich. »Ich wollte mich gleich bei der Touristeninformation erkundigen.«
»Meine Eltern haben ein riesiges Haus, du kommst mit zu uns!«
»Vermieten sie denn Zimmer?«
»Nein, aber sie möchten sich bestimmt bei der Retterin ihrer Enkel bedanken. Bitte sag ja, sonst bin ich beleidigt.« Sie dreht sich zu Gabin. »Und du?«
»Ich mach’s wie die Schnecken, ich trage mein Haus auf dem Rücken«, antwortet er scherzhaft und zeigt auf seinen Rucksack. »Ich habe einen Bungalow auf dem Campingplatz Les Sables Rouges gemietet, damit ich ein paar Schauplätze erkunden und alle Leute interviewen kann, die mit mir reden wollen.«
»Dann wirst du zum Abendessen nach Port-Lay eingeladen, wir helfen dir. Ich hole dich gegen acht mit dem Auto ab, okay? Ohne dich hätte Nolan sterben können.«
Sie beißt sich auf die Unterlippe. Ihre Hände zittern.
»Ich hatte sowieso vor, mir ein Rad zu mieten«, wendet Gabin ein.
»Damit schaffst du es nach den Köstlichkeiten meiner Mutter nicht zurück, die Strecke ist ganz schön bergig. Bitte nimm mein Angebot an.«
Er kapituliert, und sie verabreden sich vor dem Bed and Breakfast Sémaphore de la Croix.
Île de Groix, Port-Tudy
Wir gehen von Bord. Gabin verschwindet in Richtung Coconuts, einem Fahrradverleih. Urielle reicht die Leine der Zwillinge einer Frau, die ihr sehr ähnlich sieht, allerdings gut dreißig Jahre älter ist, und umarmt einen Mann in einem ausgewaschenen rosafarbenen Segelhemd. Ich halte mich etwas im Hintergrund. Vielleicht befindet sich der, den ich suche, gerade auch auf diesem überfüllten Kai und begrüßt seine Familie, die keinen Schimmer von meiner Existenz hat.
»Herzlich willkommen auf unserem Kieselstein, meine Kobolde«, sagt Urielles Mutter lächelnd zu ihren Enkelkindern.
»Ich habe die Leine während der Überfahrt abgemacht, und prompt hat die Agentur angerufen. Ich hätte niemals rangehen dürfen. Die beiden sind mir entwischt, das hätte böse enden können«, berichtet Urielle, noch völlig unter Schock. »Chiara hat Evan gerettet. Ich habe sie eingeladen, bei uns zu übernachten.«
»Aïe, toui! Gütiger Himmel, haben Sie vielen Dank«, ruft ihre Mutter und presst die sich windenden Zwillinge an sich. »Ich heiße Rozenn, und das ist mein Mann Dider.«
»Ich habe sie bloß eine Sekunde lang aus den Augen gelassen!«
»Das reicht schon, wie wir nur allzu gut wissen«, murmelt Rozenn sehr ernst. »Wir sollten in Le Bourg eine Kerze anzünden, um dem Herrn zu danken.«
Nonna Ornella hat in Rom auch immer Kerzen angezündet, bis die Wachskerzen durch elektrische ersetzt wurden. Daraufhin hat sie sich mit dem Pfarrer zerstritten und verkündet, dass sie keine Lira mehr für die Kollekte geben würde. Stattdessen hat sie jeden Monat heimlich einen Umschlag in den Briefkasten des Pfarramts geschoben.
Wir zwängen uns in ein kleines französisches Auto, das nach nassem Hund riecht. Urielles Eltern sitzen vorn, ich habe meinen Seesack und Evan auf dem Schoß, Urielle ihren Laptop und Nolan. Während das Auto sich einen Hang hinaufquält, beugt sie sich zu mir.
»Gleich lernst du meine große Schwester Oanelle kennen. Noch vor meiner Geburt, als sie drei Jahre alt war, hat sie sich zu weit aus dem Fenster im ersten Stock gelehnt. Meine Mutter war im Garten, mein Vater hat an irgendetwas herumgebastelt. Damals haben sie in Méné gewohnt. Sie ist gefallen. Ihre Zukunft ist auf dem Boden der Terrasse zerschellt, zusammen mit ihrem Kinderköpfchen. Seitdem ist sie weder glücklich noch unglücklich, sondern emotionslos, gehorsam, abhängig, kindlich. Sie spricht nicht mehr, sie singt, und sie ist eine meisterhafte Stimmenimitatorin. Sie kann keine Noten lesen, hat aber ein absolutes Gehör. Liedtexte sind ihre einzige Möglichkeit, sich auszudrücken. Hör auf zu zappeln, Nolan, du tust mir weh!«
Der Junge prustet los und steckt auch seinen Bruder damit an, der auf meinem Knie herumrutscht. Das Auto hält auf einem Platz vor einem Kriegerdenkmal, in der Nähe eines Kinderkarussells, eines Geschenkartikelladens namens Bleu Thé und der Buchhandlung L’Écume.
Urielle zeigt mir den Kirchturm, auf dem sich statt eines Wetterhahns ein lebensgroßer Thunfisch dreht, und erklärt mir beim Betreten der Kirche, die Insel sei bis 1940 der wichtigste Fischereihafen für weißen Thunfisch in ganz Frankreich gewesen. Die Zwillinge tapsen auf den Altar und die brennenden Kerzen zu.
»Nicht anfassen«, ruft Rozenn.
Sie bleiben folgsam stehen und bekommen je eine Münze, die sie in den Opferstock schieben dürfen. Die Kerzen aber zündet Rozenn selbst an.
»Trugaré man doui, danke für meine Kobolde«, sagt sie mit Inbrunst.
Eine Votivgabe in Form eines Schiffes schaukelt über unseren Köpfen. Der Mann, den ich suche, war bestimmt schon einmal hier, für eine Taufe, eine Hochzeit, eine Beerdigung. Wenn er die Insel verlassen hat, bin ich umsonst hergekommen.
»Jetzt habe ich den Brief vergessen«, meint Rozenn. »Wirfst du ihn schnell für mich ein, mein Schatz? Ich passe auf die Jungs auf.«
Ich begleite Urielle zum Briefkasten hinunter. Er ist groß und gelb und hat zwei Schlitze: links, auf der Seite des Herzens, Morbihan 56, rechts Andere Départements und Ausland.
»In Rom sind die Briefkästen rot«, bemerke ich überrascht.
»Die französischen sind seit den Sechzigern gelb, davor waren sie blau. Sie werden in der Bretagne produziert, in Nantes. Das weiß ich, weil meine Mutter bei der Post arbeitet. Jedes Land hat seine eigene Farbe: In Deutschland sind sie auch gelb, in China grün, in den USA blau, in England rot wie bei euch.«
Der Brief fällt hinein.
Île de Groix, Port-Lay
Urielles Vater parkt vor ihrem Haus, direkt über einem kleinen Hafen, in dem die Fischerboote tanzen. Ich steige aus, erleichtert, einen Platz zum Schlafen gefunden zu haben. Nach dem explosiven Geburtstagsgeschenk meiner Taufpatin bin ich erst spät zur Ruhe gekommen. Meine Augenlider flattern.
»Oanelle, wir sind wieder da«, ruft Rozenn fröhlich.
Eine anmutige Frau mit ausdruckslosem Gesicht öffnet die Tür. Urielle stellt uns einander vor und erklärt, dass ich aus Rom sei. Oanelle macht auf dem Absatz kehrt und verschwindet im Haus. Eine männliche Stimme dringt aus dem Wohnzimmer. »Ich bin’s, der Italiener, ich komme von weit her, der Weg war lang und schwer. Mach doch auf, öffne mir die Türe, io non ne posso proprio più.«
»Das ist Oanelle«, flüstert Urielle mir zu. »Sie imitiert Serge Reggiani für dich, das ist ihre Art, dich willkommen zu heißen. Meine Eltern waren große Fans, sie sind jedes Mal aufs Festland gefahren, wenn er ein Konzert gegeben hat, und haben meine Schwester mitgenommen.«
Die blasse junge Frau singt weiter: »Heute kehr ich zurück, ich kenn jedes Metier, Komödiant, Akrobat, Offizier der Armee, Pianist und Pirat, Kaiser, Ritter des Glücks.« Ich denke wieder an die erfundenen Berufe für den Vater, der von den vielen Fotos auf mich herabgelächelt hat. Ich sehe ihm nicht ähnlich. Er war schön, ich bin Durchschnitt. Er war blond, ich bin braunhaarig. Er war groß und kräftig, ich bin schmal. Er hatte karamellfarbene Augen, meine sind schokoladig mit einem seltsamen blauen Fleck in der Mitte des rechten. Urielle hingegen ähnelt Dider sehr. Beide haben mandelförmige Augen, einen geschwungenen Mund, das gleiche Lächeln. Oanelle kommt eher nach ihrer Mutter Rozenn. Wäre ich Livias Ehemann wie aus dem Gesicht geschnitten, hätte sie mich dann geliebt? Und ähnele ich dem Seefahrer von der Île de Groix?
Mein Blick fällt auf einen blau-roten Briefkasten in Form eines Schiffes mit einer kleinen runden Tür, die mit einem Riegel verschlossen ist. Ein Schildchen verkündet in eleganten Buchstaben den Namen der Bewohner: Tonnerre. Donner. Mein Herz setzt aus und rast anschließend los, um die verpassten Schläge aufzuholen. Der Mann, den ich suche, heißt wie ein Wetterphänomen. Ich starre Dider an, der gerade das Gepäck seiner Tochter ins Haus trägt. Er heißt Tonnerre. Mir wird schwindelig. Was würdest du wohl davon halten, Alessio? Ist das ein glücklicher Zufall? Bin ich direkt in der Höhle des Löwen gelandet? Violas Satz von gestern will mir nicht aus dem Kopf. »So ist es besser für alle.« Das Atmen fällt mir schwer, als würde mir ein wütender Riese den Brustkorb zerquetschen. Es wäre besser für alle, wenn es mich gar nicht gäbe.
Île de Groix, Port-Lay
Blau-roter Briefkasten
D