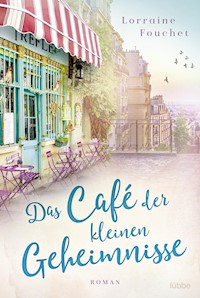10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atlantik
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Warum man manchmal ans Ende der Welt reisen muss, um seinen Platz darin zu finden: Ein Pariser Wohnhaus, in dem alle Bewohner einer weitverzweigten bretonischen Familie angehören: Hier lebt Dom mit seinem Vater, die Mutter hat sie vor Jahren verlassen. Als sein Vater an einem Herzinfarkt stirbt, wird Dom nicht nur von Trauer überwältigt, sondern auch mit zahlreichen Rätseln konfrontiert. Wer war die blonde Frau, in deren Armen sein Vater laut Aussage des Notarztes gestorben ist? Und warum ist in einem Kondolenzbrief aus Argentinien von der Tochter seiner Eltern die Rede, wo Dom doch Einzelkind ist? So viele Geheimnisse in einer Familie! Dom macht sich auf den Weg nach Patagonien, um zu erfahren, wer seine Eltern waren. Ein Roman, so herzerwärmend wie humorvoll, über das Glück, eine Familie zu haben – und sich neue Familienmitglieder selbst zu wählen, sodass man auch in den traurigsten Momenten nicht allein ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 263
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Lorraine Fouchet
Pinguine bringen Glück
Roman
Aus dem Französischen von Katrin Segerer
Atlantik
»Ich landete an einem milden Abend. Punta Arenas!«
Antoine de Saint-Exupéry, Die Erde der Menschen
»Wir sterben, weil wir leben.«
Françoise Dolto, Die ersten fünf Jahre
»Wir sterben, ganz einfach weil wir gelebt haben.«
Jean d’Ormesson, Un hosanna sans fin
Für meine Mutter, Colette Christian Fouchet. Ich war dabei, als ihr Herz am 6. März 2018 stehen blieb, kurz nach meiner Rückkehr vom Kap Hoorn, und meinen Computer abstürzen ließ.
Für den jungen Unbekannten, dem ich bei einem nächtlichen Einsatz als Notärztin in Paris begegnete. Ich versuchte gerade, einen Mann zu reanimieren, der in den Armen seiner Frau einen Herzinfarkt erlitten hatte. Der halbwüchsige Sohn der beiden kam ins Schlafzimmer und sah seinen nackten Vater, der an Liebe gestorben war. Diesen Blick werde ich niemals vergessen. Er war meine Inspiration für diese Geschichte.
Tag 1
Ich bin fünfzehn und wohne im 14. Arrondissement von Paris – logisch, als Bretone. Mit Nachnamen heiße ich Le Goff, aber bei uns sagt man Ar Gov. Ich trage eine Triskele am Handgelenk, an einem marineblauen Band. In einem Monat sind Osterferien, da fahren wir auf die Île de Groix, wo unsere Familie ursprünglich herkommt. Bis dahin muss ich noch zur Schule. Jetzt ist es gerade Mitternacht. Papa glaubt, dass ich schlafe, aber ich spiele ein Computerspiel. Mit dem Kopfhörer auf den Ohren kämpfe ich mich durch eine keltische Sage und entschlüssele Runen. Mein Avatar hat vor gar nichts Angst, er zuckt nicht mal mit der Wimper, wenn ihn etwas Unsichtbares berührt. So ein Mann wäre ich auch gerne, und ich hätte es vielleicht sogar werden können, wenn Claire nicht vor fünf Jahren dorthin abgehauen wäre, wo der Pfeffer wächst. Seitdem habe ich das Gefühl, bei mir läuft alles verkehrt herum, wie bei diesen Rückwärtsmarathons oder den Lachsen, die gegen den Strom schwimmen.
Papas Schlafzimmer liegt am anderen Ende des Flurs, deswegen ist die Gefahr, dass er mich erwischt, relativ gering. Mein Avatar überspringt einen Dämon, der mit den brennenden Kerzenfingern wackelt, um den verirrten Wanderer in der Heide zu verwirren. Plötzlich verschwindet das Spiel vom Bildschirm. Also, eigentlich gar nicht plötzlich, sondern stückchenweise, es ist unerklärlich, infernalisch unglaublich. Das Wort »infernalisch« habe ich in einem Buch entdeckt. Ich mag Wörter, Menschen, Ereignisse, die anders sind, untypisch, außergewöhnlich. Und ich hasse verlieren, aber das passiert, wenn mein Computer abschmiert. Nein, nein, nein, nicht so kurz vor dem nächsten Level! Die Figuren lösen sich auf, Pixel für Pixel, der Hintergrund zersetzt sich, mein Bildschirm wird schwarz. Ich darf nicht rumschreien, sonst wecke ich Papa auf. Ich hämmere auf die Tasten ein, checke, ob der Stecker rausgerutscht ist. Was ist hier los?
Ich unterdrücke die Erinnerung an Claire, wie sie Claude Nougaro singt, »Auf wacher Nächte schwarzer Leinwand ersinne ich mir Film um Film« verbiete mir, an sie zu denken, damit ich nicht losheule. Ich nehme den Kopfhörer ab und hänge ihn mir um den Hals wie eine Kette. Dann fahre ich mir durch die zerzausten Haare, schließe die Augen, massiere mir die müden Lider.
Kurz darauf hebe ich den Kopf. Was ist das für ein Lärm im Treppenhaus? Träume ich, oder hat da gerade wer geklingelt? Im Spiel kann es nicht sein, mein Computer hat sich verabschiedet.
Papa hat anscheinend aufgemacht, ich höre Stimmen. Wer könnte mitten in der Nacht bei uns vor der Tür stehen? Ich komme nicht dagegen an, mein erster Gedanke ist natürlich Claire, die ich nicht mehr Maman nenne, seit sie uns wie zwei Idioten hat sitzenlassen. Ist sie endlich zurück? Hat sie sich genug um die Kinder anderer gekümmert, werden wir wieder eine Familie, unbeschwert und glücklich? Muss ich nicht länger von ihr träumen, nur um sie beim Aufwachen aus meinem Kopf zu vertreiben? Tut nicht mehr jeder neue Tag weh?
Ich stoße meinen Stuhl zurück und vergesse dabei völlig den Kopfhörer um meinen Hals, der Stecker leidet, als ich ihn rausreiße, aber das ist mir scheißegal. Ich renne auf den Flur. Die Wohnungstür steht sperrangelweit offen, das Treppenhaus dahinter ist dunkel. Die Stimmen kommen aus Papas Schlafzimmer. Ich sprinte los. Es sind drei, zwei Männer und eine Frau, ganz in Weiß, bis auf das blaue RETTUNGSDIENST auf dem Rücken. Claire ist nicht dabei. Die Fremden beugen sich über Papa, der nackt auf dem Bett liegt. Seine Augen sind offen, aber er sieht mich nicht. Auf seinem Oberkörper kleben Elektroden, die mit einem Defibrillator verbunden sind. Ich kenne die Dinger, wir hatten einen Kurs in der Schule. Im Pausensaal und in der Turnhalle hängt einer. Wie im Fernsehen ruft die Frau: »Und weg!« Die beiden Männer heben die Hände, um zu zeigen, dass sie Papa nicht berühren. Die Frau drückt einen Knopf, Papa zuckt zusammen, die Linie auf dem Bildschirm schlägt aus, dann wird sie wieder flach.
Ich muss wohl irgendein Geräusch gemacht haben, denn die Frau dreht sich um und bemerkt mich. Sie gibt dem schlanken Mann mit den blauen Kulleraugen ein Zeichen. Der kommt auf mich zu und schiebt mich zurück auf den Flur. Ich protestiere:
»Das ist mein Vater, ich will bleiben!«
»Wie alt bist du?«
»Fünfzehn.«
Ich wirke älter, weil ich so groß bin, ich hätte schwindeln sollen. Der Mann lächelt mich an. Sein Name steht auf seinem Kittel: Dr. T. Serfaty.
»Ich heiße Thierry. Zu wievielt wohnt ihr hier?«
»Zu zweit.«
»Nur du und dein Vater?«
»Ja, Herr Lord.«
Das ist mir einfach rausgerutscht. Ja, Herr Lord, so wie Louis de Funès es ständig in Fantomas bedroht die Welt sagt. Papa hat mir alle seine Filme geschenkt, ich kenne sie auswendig.
Durch die geschlossene Schlafzimmertür höre ich: »Ist das Adrenalin drin? Dann probieren wir’s noch mal. Und weg!«
»Könnte ich vielleicht ein Glas Wasser haben?«, fragt Dr. Thierry.
Das kann ich ihm schlecht abschlagen. Er folgt mir in die Küche.
»Wir warten besser hier, dann sind wir aus dem Weg«, meint er.
Wir setzen uns an den Tisch. Er ist schon fürs Frühstück gedeckt: die Schale mit Miraculix und seinem Zaubertrank für Papa, die mit Enez Groe – Île de Groix auf Bretonisch – für mich.
Das alles passiert gar nicht wirklich. Gleich kommt Papa rein und schimpft mich aus, weil ich nicht im Bett liege, lässt mich bis zu den Ferien für die Schule schuften, bis zu dem magischen Tag, an dem wir auf der Breizh Nevez zur Insel schippern.
Ich greife nach meinem Kopfhörer, er ist nirgendwo eingestöpselt, aber ich setze ihn trotzdem auf, um mich von der Welt abzuschotten. So bleiben wir sitzen, Dr. Thierry und ich, und schweigen uns an. Irgendwann gesellt sich die Frau zu uns. Dr. D. Valbone laut ihrem Kittel. Sie ist hübsch und erschöpft, die blonden Haare kleben ihr an der Stirn, und unter den hellen Augen prangen dunkle Ringe. Papa mag Blondinen, er ist ganz bestimmt aufgewacht, um sie anzuschauen. Sie bedeutet mir, den Kopfhörer abzusetzen, ich gehorche.
»Wo ist deine Maman?«
Sie hat das verbotene Wort benutzt.
»Wir haben keine Ahnung, aber wir brauchen sie nicht, wir kommen sehr gut alleine klar!«
Sie wechselt einen Blick mit Dr. Thierry, der den Kopf schüttelt. Ich erkläre:
»Meine Mutter ist orthopädische Chirurgin. Sie ist vor fünf Jahren zu einer humanitären Hilfsmission aufgebrochen, sie kommt zurück, wenn sie damit fertig ist. Fragen Sie doch meinen Vater! Muss er ins Krankenhaus?«
Sie beugt sich vor und zertrümmert mit sanfter Stimme mein Leben.
»Es tut mir leid. Wir haben getan, was wir konnten, aber es war zu spät. Wir haben versucht, ihn wiederzubeleben, aber sein Herz hat nicht reagiert. Er war einfach zu krank.«
Ich glaube ihr kein Wort. Sie redet von jemand anderem.
»Mein Vater ist kerngesund!«
»Er war bei einem Kardiologen in Behandlung, es gab schon erste Warnzeichen.«
»Nein, Sie müssen sich irren.«
Dr. Valbone legt die Hände flach auf den Küchentisch. Dabei kippt die Miraculix-Schale um und rollt los. Ich fange sie wieder ein und stelle sie in sicherer Entfernung ab. Papa würde Frau Doktor umbringen, wenn die Schüssel kaputtgeht, sie ist ein Geschenk von Claire.
»Wie heißt du?«, fragt Dr. Valbone.
»Dom.«
»Ich heiße auch Dominique. Dein Vater war in Behandlung, vielleicht wollte er dich nicht beunruhigen. Wir können nichts mehr für ihn tun.«
Ich habe nicht die Kraft, ihr zu sagen, dass Dom nicht die Abkürzung für Dominique ist. Meine Lebenslust zerbirst in spitze Scherben, die sich in mein Herz bohren. Ich brülle:
»Machen Sie weiter! Sie dürfen keine Zeit verlieren!«
»Wir haben alles gegeben. Es ist vorbei. Es tut mir wirklich leid.«
Das ist unmöglich, undenkbar. In Wahrheit schlafe ich bestimmt, und das Ganze ist nur ein Albtraum. Dr. Dominique schaut mich mit ihren hübschen Augen eindringlich an.
»Dein Vater ist tot, Dom.«
Alles in mir zerfällt. Papa ist »in den suet gegangen«, wie man auf der Île de Groix sagt, in den Südosten, wo der von den Seefahrern gefürchtete Wind weht, wo der Nebel hängt. Er hat die Taue gekappt. Ich bin fünfzehn, Claire ist abgehauen, Papa hat eben seine letzte Reise angetreten. Jetzt bin ich ganz allein.
»Wo ist die Frau, die uns aufgemacht hat?«, fragt Dr. Dominique.
»Welche Frau?«, frage ich zurück. »Es gibt nur Papa und mich.«
»Als das Herz deines Vaters versagt hat, war er mit einer Frau zusammen. Sie hat den Notruf gewählt, uns reingelassen und ins Schlafzimmer geführt. Dann ist sie verschwunden.«
Ich reiße die Augen auf. Sie dachte, diese Frau wäre meine Mutter. Und ich war so naiv zu glauben, Papa hätte niemanden außer mir.
»Kennst du sie nicht, Dom?«
Ich schüttele den Kopf. Die Wohnung ist nicht besonders groß, wir suchen sie, finden aber keine Spur von ihr, sie hat sich in Luft aufgelöst, wie mein Computerspiel.
»Hat sein Herz ihretwegen versagt?«
Dr. Dominique weicht der Frage aus.
»Es hätte jederzeit passieren können, beim Gehen, Schlafen, Fernsehen.«
Er war nackt im Bett mit einer Fremden, die haben bestimmt nicht Monopoly gespielt. Ich hatte auch schon Freundinnen, eine Schwedin in den letzten Sommerferien und eine aus meiner Klasse Anfang des Schuljahrs, aber wir haben Weihnachten wieder Schluss gemacht. Und ich bin mit keiner der beiden so weit gegangen. Heute lerne ich zwei Dinge: Liebe tötet, und Papas Herzstillstand hat meinen Computer abstürzen lassen. Denn genau so war es. Es ist eine Tatsache, klar wie das Wasser der Quellen auf dem kleinen Kieselstein namens Groix. Ein Computer geht nicht ohne Grund aus. Das hier ist kein Science-Fiction-Film, sondern die Realität. So etwas Ähnliches ist auch vor achtzehn Jahren passiert, vor meiner Geburt, als Papas Bruder Onkel Yannig vor der Küste unserer Insel ein paar Touristen gerettet hat, die trotz des Sturms rausgefahren waren, und dabei ums Leben gekommen ist. Damals hat sich das Radio in Tante Tifenns Küche von ganz allein eingeschaltet, während sie gerade Kaffee getrunken hat. Es gibt eine unerklärliche Verbindung zwischen Menschen und Dingen.
»Ich muss mit jemandem aus deiner Familie sprechen«, sagt Dr. Dominique jetzt.
»Wir wohnen alle hier im Haus. Onkel Gaston, Tante Tifenn, Tante Désir und die perfekten Cousins, Papa und ich.«
»In welchem Stock?«
Sie schreibt es sich auf und lässt mich mit Dr. Thierry allein. Der dritte Doktor bleibt bei Papa. Ich denke an Groix, um nicht zusammenzubrechen. Wenn das RoRo, das große Schiff aus Lorient, das die Alten »Dampfer« und die Touristen »Fähre« nennen, im Hafen einläuft, lässt es einmal sein Horn ertönen. Wenn es wieder ablegt, dreimal. Das hört man auf der ganzen Insel, es gliedert den Tag. Papa kann nicht in See gestochen sein, ich habe das Horn seines Schiffs nicht gehört.
Onkel Gaston, Papas älterer Bruder und das Familienoberhaupt, wohnt zwei Stockwerke höher. Tante Tifenn wohnt direkt über, Tante Désir direkt unter uns. Mein Großvater hat das Haus gekauft, mit dem Geld, das er für die Erfindung eines Deckausrüstungsteils für die Schiffe bekommen hat. Vorher war er nicht gerade reich, damit hat er ein Vermögen verdient und seinen besten Freund verloren, das hat ihm das Leben vermiest.
Zwischen den Treppenabsätzen in unserem Haus liegen jeweils fünfzehn Stufen. Als ich klein war, haben meine Eltern ein albernes Spiel mit mir gespielt: An meinem Geburtstag nahmen sie mich links und rechts an der Hand, und ich durfte für jedes Lebensjahr eine Stufe überspringen, eine am ersten, zwei am zweiten, drei am dritten. An meinem fünften Geburtstag ließ ich Claires Hand los, als Papa mir gerade Schwung gab. Ich knallte mit dem Kopf gegen die Wand, und meine Eltern stritten sich, weil sie Angst hatten. »Warum hast du ihn nicht festgehalten?« »Er hat seine Hand weggezogen!« Danach spielten wir das Spiel nie wieder. Im Medizinstudium an der Uni in Rennes hatte Claire gelernt, dass ein Kind trocken wird, sobald es auf einen Schemel steigen kann. Monatelang stellte sie mich vor den blauen Küchentritt, er wurde mein Kuscheltier, andere Kinder hatten Teddys oder Häschen, ich hatte einen Küchentritt, ohne den im Zimmer ich nicht einschlafen konnte. Als Claire verschwand, war ich zehn, ich hörte auf, sie Maman zu nennen, um sie zu bestrafen, ich bat Papa, meinen Kuscheltritt in den Keller zu bringen. Und ich sitze seitdem auf der zehnten Stufe fest.
Früher habe ich »ich« gesagt, wenn ich von mir gesprochen habe. Nachdem Claire abgehauen war, habe ich »wir« gesagt, für Papa und mich, um die Lücke zu füllen, die sie hinterlassen hatte. Jetzt muss ich wieder »ich« werden. Heute Nacht habe ich auch die zweite Hand verloren, die mich gehalten hat. Die Treppe hat sich in einen Abgrund verwandelt.
Mein Mann ist tot. Du bist tot. Ich habe mit angesehen, wie du durch den Spiegel gegangen bist. Wie ist das möglich?
Wir lagen uns in den Armen, trieben in diesem Niemandsland zwischen Schlafen und Wachen. Eben waren wir noch geflogen, hatten die Sterne gestreift. Ich habe dich betrachtet, dein Gesicht, deine so vertrauten Züge. Auf einmal hast du aufgehört zu atmen. Völlig lautlos. Du hast nicht gezuckt, du bist gegangen, ohne dich ans Leben zu klammern. Es wirkte so einfach, so friedlich, du warst wahrscheinlich die lässigste Leiche auf dem gesamten Planeten. Ich habe dich geschüttelt, geohrfeigt, auf deine Brust eingehämmert, rhythmisch auf die Stelle über deinem Herzen gedrückt, um es wieder zum Schlagen zu bringen, alles umsonst. Du warst nicht mehr da. Also habe ich die 15 gewählt, den Mann am anderen Ende der Leitung angefleht. Er würde einen Einsatz eröffnen, so hat er es genannt. Vielleicht auch eine Tür zum Jenseits.
Ich habe mich wieder neben dich gelegt, die Hände auf deine noch warmen Wangen gepresst, ich bekam plötzlich ein absurdes Verlangen nach dem Champagner, dessen feuchter Hals aus dem Eiskübel ragte. Ich wartete jahrelang, bis ich alt und grau war, bis dein Bart so lang wurde wie der eines Cromagnonmenschen. In Wahrheit ertönten die Sirenen schon nach fünf Minuten. Der Krankenwagen kommt aus dem Hôpital Necker zwei Straßen weiter. Während die Notärzte die Treppe hochrannten, holte ich die EKGs aus der Schublade, in der du sie versteckt hattest. Dann zog ich mich rasch an und machte ihnen die Tür auf.
Die gesamte Zeit über habe ich keinen einzigen Gedanken an den Jungen verschwendet. Ich hätte eine miese Mutter abgegeben. Ich habe nur an dich und mich gedacht. Ich habe zugesehen, wie du in See gestochen bist, an Bord der bag noz, der Barke der Nacht, deren Rudergänger der letzte Ertrunkene des vorherigen Jahres ist und mit der der Ankou, der Diener des Todes in der Bretagne, die Seelen der Verstorbenen transportiert. Aber an den Jungen habe ich keinen Gedanken verschwendet. Danach hat er allen Raum eingenommen, er ist mein Erbe.
Mir war sofort klar, dass die Ärzte dich nicht zurückholen können. Die hellen Augen der hübschen Blonden hätten dir gefallen. Ich habe ihr die leere Hülle, deinen leblosen Körper, überlassen und bin verschwunden, bevor der Junge aufgewacht ist. Ich wohne auch hier im Haus, das hat die Sache vereinfacht. Er darf das mit uns nicht erfahren. Deine Familie darf es nicht erfahren. Wir verheimlichen unsere Liebe schon seit zwei Jahren.
Mein Onkel und meine Tanten treffen ein, in Schlafanzug und Morgenmantel, zerzaust, verblüfft, bestürzt. Das Rettungsteam bricht wieder auf, ohne Papa. Onkel Gaston verteilt die Aufgaben. Tante Tifenn ist ganz benommen. Tante Désir betet, meine perfekten Cousins schlafen ein Stockwerk tiefer, sie können mich nicht leiden und ich sie noch weniger. Als sie mir einmal an den Kopf geworfen haben: »Deine Mutter hatte die Schnauze voll von deinem Vater und dir, sie kommt nicht zurück, da könnt ihr warten, bis ihr schwarz werdet, frag Maman«, ist mir die Sicherung durchgebrannt, und ich habe dem Großen eine mit rechts und dem Kleinen eine mit links gepfeffert. Natürlich haben sie sich bei ihrer Mutter ausgeheult, die hat gemeint, der Apfel würde eben nicht weit vom Stamm fallen.
Ich flüchte mich in mein Zimmer, setze den Kopfhörer auf und drehe die Musik auf volle Lautstärke. Onkel Gaston gesellt sich zu mir, aber ich weigere mich, mit ihm zu reden. Tante Désir reißt mir den Kopfhörer mit Gewalt runter und will wissen, wo das Stammbuch liegt, das bräuchten sie für den Transport zum Bestatter. Ich schreie sie an, sie haut wieder ab. Tante Tifenn bringt mir ein Glas Milch und Kekse, ich verrate ihr, wo die wichtigen Unterlagen sind. Wie konnte ich nicht bemerken, dass Papa krank war? Aber das alles ist nicht nur meine Schuld. Umgebracht hat ihn diese Frau, die bei ihm war!
Ich schleiche auf Zehenspitzen aus meinem Zimmer und öffne die Wohnzimmertür einen Spalt. Mein Onkel und meine Tanten haben keine Ahnung, dass ich lausche.
»Zu Tode gevögelt, während sein Sohn nebenan schläft, was für ein Skandal!«
Tante Désirs Stimme.
»Der Körper muss jubilieren, das wusste schon Brel, meine Gute.«
Onkel Gaston.
»Yrieix’ Privatleben geht uns nichts an.«
Tante Tifenn.
»Hast du gewusst, dass er eine Neue hatte?«
Für Papa war Désir immer »die alte Tratschtante«.
Ich habe es nicht gewusst. Vielleicht hatte er sie eben erst kennengelernt und wollte sie mir beim Frühstück vorstellen? Wir hätten eine dritte Schale für sie rausgeholt. Nicht die von Claire, die mit dem Hochzeitsbild von William und Kate drauf, die steht noch im Schrank, damit sie sie bei ihrer Rückkehr gleich wiederfindet. Nach ihrer Abreise habe ich Harrys und Meghans Hochzeit auf Onkel Gastons großem Fernseher geschaut, zusammen mit Papa und Tante Tifenn. Wir haben Scones mit Sahne und Orangenmarmelade gegessen, und ich habe gehofft, dass Claire dort, wo der Pfeffer wächst, gerade die gleichen Bilder sieht und an uns denkt.
Die Frau, die Papas Körper zum Jubilieren gebracht hat, ist mitten in der Nacht abgehauen. Warum? Ist sie verheiratet und ihr Ehemann auf Geschäftsreise? Papa hat sie bestimmt vorgewarnt, dass Claire irgendwann zurückkommt. Dr. Thierry hat mir »eine blonde Frau in Jeans und T-Shirt« beschrieben. Also quasi Dr. Dominique, Tante Désir, Tante Tifenn, meine Mathelehrerin, meine Sportlehrerin, die Buchhändlerin von nebenan, die Mutter meiner besten Freundin auf Groix, Mathilde, meine Kinderärztin Dr. Clapot, unsere deutsche Concierge Kerstin und die Bretonin Noalig aus dem obersten Stock. Wer ist diese Blondine? Geliebte oder Mörderin?
»Was machen wir mit dem Jungen?«
Wieder Tante Désir.
»Ihn noch mehr lieben als vorher«, antwortet Tante Tifenn.
»Er hat niemanden mehr«, sagt Désir.
»Er hat uns!«, protestiert Onkel Gaston.
»Du bist eingefleischter Junggeselle, du kannst nicht einmal ein Ei kochen«, gibt Désir zurück. »Tifenn, die tapfere Witwe des heldenhaften Seemanns, lebt in der Vergangenheit bei Yannig. Und ich habe schon genug zu tun mit meinen eigenen Söhnen und dem armen Georges.«
Tante Désirs Mann ist praktisch unsichtbar. Er ist nicht arm, auch wenn jeder seinem Vornamen dieses Adjektiv voranstellt. Seinem Vater, der gleichzeitig auch sein Chef ist, gehört ein Luxushotel in der Nähe der Champs-Élysées. Tante Désir bildet sich was darauf ein, dass sie als Einzige von den Geschwistern eine gute Partie gemacht hat. Gaston war schon immer allein. Yannig, der zehn Monate älter war als Papa, hat Tifenn geheiratet, deren Eltern in Côtes-d’Armor wohnen und Lehrer sind. Papa hat Claire geheiratet, die aus einer kleinen Bar-Tabac in Finistère-Sud stammt. Das Nesthäkchen Désir hat den Jackpot geholt. Der arme Georges ist Einzelkind, heißt, das Luxushotel gehört irgendwann einmal ihm, also ihnen, also ihr.
»Wir teilen uns den Sommer auf, jeder nimmt Domnin für drei Wochen, und danach schicken wir ihn aufs Internat«, beschließt Désir.
Na, vielen Dank, Tantchen.
»Das hätte Yrieix ganz sicher nicht für seinen Sohn gewollt«, ruft Tifenn.
Gaston schaltet sich wieder ein. »Yrieix hat alle Vorkehrungen getroffen. Die Herzprobleme haben schon letztes Jahr angefangen. Er hat einen Vormund bestimmt und ein Testament beim Notar in der Nachbarstraße hinterlegt.«
Also hatte Dr. Dominique recht, Papa war wirklich krank. Und ich werde zu einem Fremden abgeschoben, der über mein Leben entscheidet? Mein Herz pocht so heftig, dass mein gesamter Körper vibriert und der Boden unter meinen Füßen erzittert.
»Damit wäre das Problem gelöst«, meint Désir. »Keine schlechte Idee von Yrieix, vielleicht war er am Ende doch ein ganz guter Vater.«
»Ein hervorragender«, erwidert Gaston. »Doms Vormund bin nämlich ich. Ich kann zwar kein Ei kochen, aber ihn mit zu Gwenou ins Bistro gegenüber nehmen. Er bleibt in seiner vertrauten Umgebung, muss nicht die Schule wechseln und verliert nicht alle seine Freunde.«
»Die Familie hält zusammen«, bekräftigt Désir. »Und da Domnin ab jetzt ja oben bei dir wohnt, kannst du mir Yrieix’ Wohnung vermieten, zum Freundschaftspreis natürlich. Ein kleiner Durchbruch nach unten, und wir haben eine Maisonettewohnung.«
Papas Tod kommt seiner Schwester gelegen.
»Du überraschst mich immer wieder«, sagt Gaston seufzend. »Es gibt erst einmal Wichtigeres zu tun. Wir müssen Familie und Freunde benachrichtigen, die Bestattung organisieren. Und Dom beistehen.«
»Glaubt ihr, Claire taucht wieder auf?«, fragt Désir besorgt. »Hoffentlich denkt sie nicht, sie kann sich hier wieder breitmachen. Weggegangen, Platz gefangen.«
»Du bist unmöglich«, meint Tifenn.
Ich schleiche zurück in mein Zimmer, ohne das Parkett zum Knarzen zu bringen, lege mich ins Bett und schlafe sofort ein, wie ein Roboter, dem man den Saft abdreht.
Tag 2
Mein Onkel und meine Tanten wecken mich zum Frühstück. Papas Schale steht nicht mehr auf dem Tisch.
»Wir müssen einen Bestatter suchen, der deinen Vater abtransportiert«, verkündet Désir.
Sie verbessert mich immer liebend gern. Ausnahmsweise einmal hat sie sich einen Schnitzer geleistet, die Gelegenheit lasse ich mir nicht entgehen.
»Du meinst wohl ›abholt‹.«
»Nein«, erwidert sie.
Ihr toter Bruder ist zu einem Ding geworden.
»Du gehst gleich in die Schule«, fährt sie fort. »Ich gebe deinem Direktor Bescheid.«
»Auf keinen Fall!«
»Wir fragen dich nicht nach deiner Meinung. Oder, Gaston?«
»Natürlich fragen wir ihn nach seiner Meinung, was glaubst du denn? Heute ist kein stinknormaler Tag, man verliert seinen Vater nur einmal. Hast du schon vergessen, wie das war? Alle fanden dich unheimlich tapfer, die arme Kleine. Dabei hat es dich nicht die Bohne interessiert. Du liebst nur dich selbst, andere existieren für dich gar nicht. Du hast kein Herz, als Gott die Organe verteilt hat, hat er einen Fehler gemacht, er hat dir zwei Lebern gegeben, deswegen spuckst du auch ständig Gift und Galle.«
Das Müsli in meiner Schale verklumpt, ich kriege nichts runter.
»Willst du uns begleiten, Dom?«, fragt Tante Tifenn.
Ich nicke. Ich werde Papa nicht den Klauen seiner Schwester ausliefern, keine Chance.
Jeden Morgen auf dem Schulweg komme ich an zwei Bestattungsunternehmen vorbei, aber ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich je dort anhalten muss. Jetzt stehen wir hier auf dem Bürgersteig.
Tante Désir tritt an das erste Schaufenster. Eine Frau mit Adlernase erspäht uns und stürzt heraus, ein falsches Lächeln auf dem Gesicht. Ich nähere mich dem zweiten. Ein Mann mit schwarzem Anzug und dicken Ringen an den Fingern raucht davor. Er schielt und wirkt nett.
»Rauchen kann tödlich sein«, sage ich. »Mein Vater hat aufgehört, ist aber trotzdem gestorben.«
Der Mann tut nicht so, als wäre er traurig. Das falsche Lächeln der Frau nebenan schmilzt wie Salzbutter in der bretonischen Sonne. Wir folgen dem Mann in seinen Laden. Er klappt einen Ordner auf, fragt nach Papas Namen, notiert ihn respektvoll.
»Wissen Sie, die Toten sind auch nur Menschen. Ich wollte schon immer Bestatter werden.«
Er macht einen vertrauenswürdigen Eindruck. Ist es nur ein Zufall, dass sich Bestatter auf Gevatter reimt? Gestatten, Gevatter Tod. Ich werfe einen Blick unter den Tisch. Papas Gevatter ist ein Rocker: Er trägt spitze Cowboystiefel aus Krokoleder wie Johnny Hallyday. Gerade zählt er die verschiedenen Leistungen auf: hygienische Grundversorgung – dabei ist Papa bestimmt nicht schmutzig, er hat jeden Morgen geduscht –, Zeitungsanzeigen. Der Sarg: »Eiche massiv, zweifarbig, seidenmatt lackiert, Seiten gewölbt mit Zierleisten, flacher Deckel, dreifache Höhe«. Das Modell heißt Tuileries, wie der Park in der Nähe der Comédie-Française, wo ich mit Papa mal ein Stück von Molière gesehen habe. In den Lucky-Luke-Comics misst der Totengräber die Leute immer schon aus, wenn sie noch leben, um ihren Sarg im Voraus zu zimmern. Papa kannte die kleine Anzeige in der Nugget Gulch Gazette auswendig: »Luke Mallow zog seine Stiefel nie aus und starb auch darin. Die Person, die sie ihm bei der Totenwache versehentlich entwendet hat, wird gebeten, sie ihm für die Beisetzung zurückzubringen.« Alles ist durchgeplant. In vier Tagen muss ich nicht zur Schule, da ist die Bestattung. Anscheinend hat Papa Gaston genau erklärt, was er will: eine Messe mit allen und eine Einäscherung ohne alle. Weder Familie noch Freunde sind zum Grillfest eingeladen. Danach streuen wir seine Asche ins Meer. Ich kann nicht einmal weinen, ich bin wie vor den Kopf geschlagen.
Wir gehen nicht direkt nach Hause. Onkel Gaston will noch mit mir in den Buchladen. Dort unterhält er sich mit der Besitzerin, während ich Comics durchblättere. Ist sie die geheimnisvolle Blondine? Ich habe keine Ahnung, was ich hier soll, Gaston braucht mich offensichtlich nicht. Warum hat er darauf bestanden, dass ich mitkomme? Als wir schließlich unser Haus erreichen, ist die Antwort klar. Gevatter Cowboystiefel steigt gerade in ein langes schwarzes Auto. Dessen Türen schließen sich wie die des Gefängnisses, das Johnny in Le Pénitencier besingt. Die Toten sind zwar auch nur Menschen, aber sie fahren in besonderen Autos.
Unsere Freundin Kerstin, die Concierge, steht draußen auf dem Bürgersteig. Sie wirkt völlig aufgelöst. Sie war oft zum Abendessen bei uns. Ihre Familie lebt in Deutschland. Sie ist nach Paris gekommen, um Krankenpflegerin zu werden. Désir, die älter und hässlicher ist, schaut gern auf sie herab. Der arme Georges schaut sie gern an. Hat sie Papa getötet?
Ich stürme die Treppe hinauf und in Papas Schlafzimmer. Das Bett ist abgezogen worden, auf dem Kaminsims thronen noch zwei Champagnergläser. Daneben liegt ein kleines Pferd mit Flügeln und einem goldenen Schweif, das jemand aus dem Draht und der Folie um Korken und Flaschenhals gebastelt hat. War es die blonde Frau? Am liebsten würde ich das hübsche, filigrane Tierchen zerquetschen. Ich schenke mir ein Glas ein. Der Champagner ist warm und schal. Ich verschlucke mich, und die Flüssigkeit läuft mir übers Kinn. Claire hat immer gesagt, wenn man aus dem Glas eines anderen trinkt, kann man seine Gedanken lesen. Plötzlich geht die Tür auf, mein Onkel und meine Tanten stehen im Rahmen.
»Was treibst du da, du Lümmel?«, kreischt Désir. »Besäufst du dich etwa? Mit fünfzehn?«
»Champagner trinkt man kalt«, meint Gaston und nimmt mir die Flasche aus der Hand.
»Es gibt andere Mittel und Wege, um sich zu berauschen«, fügt Tifenn hinzu. »Mir hat die Musik geholfen, als Yannig fortgegangen ist.«
Ihr Satz schmettert mich nieder. Bis jetzt war ich in einem Computerspiel, habe Quests erledigt. Papa konnte jederzeit wieder aus dem Leichenwagen springen. Aber Yannigs Fortgang macht Yrieix’ Rückkehr unmöglich.
Ich stopfe mir das geflügelte Pferd in die Tasche. Erst dachte ich, es wäre Pegasus, aber in Wahrheit ist es ein Thestral aus Harry Potter, ein Drachenpferd mit schwarzen Flügeln, das man nur wahrnimmt, wenn man jemanden hat sterben sehen. Ich habe Papa zwar nicht sterben gesehen, aber es durch meinen Computer gespürt.
Die letzte Nacht war glaz. Das hat Papa gesagt, als Claire gegangen ist. Es ist ein unübersetzbares bretonisches Wort, das die Farbe des Meeres beschreibt, zwischen Blau und Grün, die Farbe ihrer Augen. So hat er den Schmerz ausgedrückt, von seiner Insel und der Frau, die er liebt, getrennt zu sein. Jetzt bin ich glaz. Die lebendigen Farben sind mit Papa gestorben. Es bleiben nur die kalten, dunklen, bleichen, herzzerreißenden.
Tag 5
Heute bestatten wir dich. Das ist ein schlechter Witz, ein Albtraum. Ich bin sehr früh dran, nur die Kränze und Blumengebinde sind schon da. Deine Familie dürfte erst in einer guten halben Stunde eintreffen. In der Kirche ist es kühl, du kannst mir deine Jacke nicht leihen. Du wartest links in der kleinen Kapelle. Ausnahmsweise einmal bist du nicht zu spät. Das hier wird unser letztes Date. Danach bin ich allein.
Dein Sarg ist schlicht, edles Holz, goldene Griffe. Ich streichle ihn sanft, so wie ich deinen Körper gestreichelt habe. An unserem letzten Abend kam ich erst spät, damit der Junge auch sicher schlief. Ich hatte eine Flasche Mercier Blanc de Noirs dabei, den Champagner unserer ersten gemeinsamen Nacht. Du hast ein Album von Dan Ar Braz aufgelegt, Douar Nevez, das vom schwarzen Pferd der bretonischen Legenden erzählt. Meine Finger haben den Drahtkorb gebändigt und dir ein geflügeltes Pferd gebastelt. Wir haben ein Glas getrunken und uns umschlungen, sind zitternd und lachend vor Lust und Freude auf den Wellen geritten. Bis das dunkle Ross dich weiter getragen hat, als ich dir folgen konnte.
Gestern Nacht konnte ich nicht schlafen. Ich habe mir eine Flasche Sekt aufgemacht, nur wegen des Drahtkorbs. Ich habe zwei Gläser getrunken und dann meine Hände sprechen lassen. So ist eine kleine Märchenfigur entstanden. Die Folie um den Flaschenhals hat sich in goldenes Haar, einen fliegenden Schal, einen Stern und eine Rose verwandelt. Ich habe die Figur auf den Korken gesteckt. Sie ist in meiner Tasche, ich will sie später zwischen deine Blumen schmuggeln. Du warst mein Prinz.
Dein Sarg ist verschlossen, verschraubt, vernietet, ich war weder bei deiner Einsargung noch bei deiner Aussegnung, ich wollte dich lebendig in Erinnerung behalten, ungeschminkt. Es fällt mir schwer zu beten, du bist mir entrissen worden, du wirst Dom nicht aufwachsen sehen, deinen Sohn mit Claire, auf die du endlich nicht mehr gewartet hast. Yrieix, ich schwöre dir bei allem, was mir lieb ist, dass ich mich um ihn kümmern werde, im Verborgenen. Er wird zu einem starken, unabhängigen und leidenschaftlichen jungen Mann heranwachsen. Der Schmerz wird ihn nicht niederdrücken oder seine Flügel stutzen. Dom Ar Gov wird frei und glücklich sein, das verspreche ich dir.
Ich wirke bestimmt, als würde ich etwas im Schilde führen, wie ich so vor deinem stummen, tauben Sarg stehe. Ich schaue auf die Uhr. Die Zeit drängt. Schritte nähern sich. Ein Priester, nicht mehr der Jüngste, kommt durch das Querschiff und wirft mir einen Blick aus dem Augenwinkel zu, bevor er in der Sakristei verschwindet. Er wird uns nicht stören. Bleiben wir noch ein bisschen beisammen. Ich finde nicht die richtigen Worte, um mit dir zu sprechen, deshalb weiche ich auf Lieder aus. Sag warum, ein alter Schlager aus den fünfziger oder sechziger Jahren, will mir nicht mehr aus dem Kopf. Warum, warum du?
Der Organist oben auf der Empore spielt ein paar Akkorde. Der Chor wärmt sich auf, stimmt die Sunrise Mass von Ola Gjeilo an, dem jungen norwegischen Komponisten, den du bei einem Konzert des Vereins Musique à Groix in der Kirche in Le Bourg für dich entdeckt hast. Bald wird man uns trennen. Ich zermartere mir das Hirn nach originellen Abschiedsworten, ich will nicht mit bejammernswerten Banalitäten Lebewohl sagen. Serge Reggiani rettet mich: »Dies ist, soweit es mir gewahr, das erste Leid, das du mir tatst. Kämst du zurück in meinen Arm, ich freute mich aufs nächste Mal.« Der Priester, der inzwischen sein Messgewand trägt, steuert wieder auf mich zu, die Stirn in Falten.