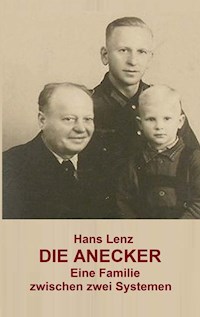
7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Drei Generationen Anecker leben im Berliner Umland und ecken immer wieder an, bei Menschen ihrer Umgebung und bei den wechselnden "Obrigkeiten". Der Opa baut ein Häuschen und eröffnet 1935 einen Laden, 1945 wird er darin ermordet. Der Vater, Angestellter in Berlin, wird Soldat und desertiert. Er kehrt nicht in die Heimat zurück und erfriert 1953 obdachlos in Paris. Die Mutter, kaufmännische Angestellte, flieht mit dem 1938 geborenen Kind vor dem Bombenhagel zum Opa. Nach dessen Tod führt sie den Laden in den Nachkriegswirren weiter, krebskrank stirbt sie 1962. Der Sohn besucht die Schule einer Kleinstadt, verlässt vierzehnjährig das Elterhaus und erlernt einen handwerklichen Beruf, arbeitet einige Zeit und besucht eine Ingenieurschule. Er hat das Kriegsende, die Nachkriegsjahre, den Kalten Krieg im Spannungsfeld der Einflüsse aus Westberlin und der DDR-Erziehung durchlebt. Sein schwieriger, doch letztlich erfolgreicher Lebensweg steht im Mittelpunkt der Handlung. Nach dem Bau der Mauer passt er sich an, gelangt zum Hochschul-Fernstudium. Dann kann er nicht auf höherwertigen Arbeitsplätzen eingesetzt werden, ihm fehlt die Geheimnis-Verpflichtung durch die Staatssicherheit. Ränke und Intrigen überschatten seine Arbeitswelt, doch beharrlich macht er sich durch Spezialkenntnisse unverzichtbar. Im vereinten Deutschland kann er nahtlos im Beruf weiterarbeiten. Auch hier, unter den ungewohnten neuen Rahmenbedingungen, eckt er weiter an. Nach Erreichen des Rentenalters widmet er sich einem neuen Interessengebiet und krönt sein Streben nach unabhängiger geistiger Tätigkeit mit einem Beitrag zur Wissenschaftsgeschichte, einem erfolgreichen Sachbuch. Im Text greifen Zeitgeschichte und persönliches Erleben abwechslungsreich ineinander. Episoden aus Berufstätigkeit, Freizeit und Privatleben werden aufgelockert durch Streiflichter aus dem Leben von Nachbarn und Bekannten, Anekdoten und witzige Szenen. Die detailreiche Darstellung des Alltags wird ergänzt und für jüngere Leser verständlich gemacht durch gewissenhaft recherchierte Erläuterungen der jeweils aktuellen politischen und wirtschaftlichen Situation.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 298
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Erinnerungen
Die Großeltern
Die Eltern
Frühe Kindheit
Bekannte und Verwandte
Ein großer Junge
In der Schule
Kleidersorgen
Der Laden
Haus- und andere Tiere
Auf Reisen
Mehr vom Laden
Freizeitvergnügen
Ein Feinschmecker
Mitten im Kalten Krieg
Schwere Entscheidungen
Der Einzelgänger
Jugendjahre
Familienverhältnisse
Der Facharbeiter
Hörfunk und Fernsehen
Paule wird Chef
Mädchen
Studentenleben
Leipziger Damen
Der Jungingenieur
Abteilungsleiter und Fernstudent
Pauls persönliches Umfeld
In der Planwirtschaft
Zurück bei den Ingenieuren
Das Messemännchen
Neuerer, Betrüger, Kontrolleure
Im Kollektiv der Sozialistischen Arbeit
Der Sonderbeauftragte
Frauen
Ein Volk steht auf
Wendejahre
Westliche Verhältnisse
Paul im Job
Der Rentner
Erinnerungen
Paule sitzt vor seinem etwas altmodischen Computer, den er wegen des großen Bildschirms und der breiten Tasten so liebt. Er hat nun mehr als achtzig Lebensjahre vollendet, sitzt einfach so da und erinnert sich längst vergangener Zeiten. In Gedanken ist er an entfernten Plätzen und redet mit Menschen, die seit langem aus seinem Gesichtskreis verschwunden sind. Die meisten von ihnen leben nicht mehr. Er möchte seine Erlebnisse und das Geschehen in seiner Umgebung festhalten, den Alltag in diesen ereignisreichen Jahrzehnten beschreiben, nur so für sich und vielleicht für den einen oder anderen aus nachwachsenden Generationen.
Paul vertraut dabei seinen Erinnerungen – schließlich war er ja dabei. Andererseits bemerkt er selbst seine zunehmende Vergesslichkeit. Aber er weiß auch um die wichtige Rolle des Vergessens im Leben der Menschen. Vor über 10 Jahren schrieb er in einem anderen Manuskript:
„Die Vergangenheit kann der Mensch prinzipiell kennen. In ihr beging er seine Taten und Missetaten, erlebte er seine Erfolge und Misserfolge, Täuschungen und Ent-täuschungen. Deshalb werden große Teile der Vergangenheit (auch im kollektiven Gedächtnis der Völker) gerne vergessen.“
Und er ist sich des Zusammenhangs mit der Frage nach der Wahrheit bewusst. Wahrheit ist relativ. Jeder Zeuge eines Geschehens erinnert sich an andere Details, an einen anderen zeitlichen Ablauf und vermutet andere Gründe dafür. Im Lauf der Zeit erfährt er mehr darüber, sei es von anderen Beteiligten, sei es aus Berichten in den Medien. Nach und nach vermischen sich diese Informationen unbemerkt im Gedächtnis, und daraus entsteht eine neue „persönliche Wahrheit“.
Besonders kritisch zu betrachten sind in diesem Zusammenhang die „Erinnerungen aus zweiter Hand“. Was Opa der Schwiegertochter oder diese dem Paulchen erzählte, war zwangsläufig gefiltert durch die Brille eigener Erinnerungen an frühere glückliche Tage, überschattet von Enttäuschungen, Frustrationen, Schuldzuweisungen.
Paul neigt zur Nachdenklichkeit. Schon zu dem Zwölfjährigen sagte die humorvolle Mutti öfter: „Na, grübelst du wieder über die Unsterblichkeit der Maikäfer in Amerika?“ Nachdenken braucht Zeit. Folgerichtig bescheinigt ein Zeugnis aus seiner Lehrzeit: „Paul arbeitet langsam aber genau.“
Die Menschen seiner Umgebung sehen ihn heute als eher wortkargen Eigenbrötler. Die Kunst des small talk, der beiläufigen Unterhaltung zur Pflege sozialer Kontakte, hat er nie erlernt. Freilich kann er auch anders. Gestern ein Anruf bei der Ärztin, am Telefon die Schwester: „Wie war ihr Name?“ – „Die Mutti sagte Paulchen“ – „Und heute?“ – „Paul Anecker“ – „Ja also, Herr Anecker, ihre Blutprobe – nichts Neues vom Labor, Tabletten weiter einnehmen wie gehabt.“
Aber fangen wir von vorne an.
Die Großeltern
Die überlieferte Familiengeschichte beginnt um das Jahr 1900. In der Familie eines preußischen Zollbeamten am Hafen von Stettin aufgewachsen, beendet Pauls Opa Friedrich Paul Anecker (der Ältere, 1879 geboren) die Schule. Was ihn durch sein ganzes Leben begleiten wird, ist eine leidenschaftliche Liebe zum Angeln. Aber bald fühlt er sich in der provinziellen Atmosphäre eingeengt. Ausgerüstet mit einem echt pommerschen Dickschädel verlässt er das Elternhaus – ohne väterlichen Segen, dafür mit umso mehr Selbstvertrauen – und folgt dem Lockruf der nahen Großstadt Berlin. Hier erlernt er den Beruf eines Bierbrauers und geht, wie damals noch viele Handwerksburschen, auf die Walz. Doch seine Wanderjahre als Geselle finden ein schnelles Ende. In Aschersleben im Harzvorland verliebt er sich in Anna, die siebzehnjährige Tochter eines Geschirrführers (er lenkte Pferdegespanne in der Landwirtschaft). Als Anna schwanger wird, muss geheiratet werden. 1902 wird Friedrich Paul Anecker der Jüngere (Paules Vater) geboren und die junge Familie zieht nach Berlin.
Opa Friedrich bringt es in einer großen Brauerei schnell zu einer angesehenen Stellung. Zeugnis seiner Leistungen ist ein Kaiserliches Patent auf eine Vorrichtung zum Verhindern der Biertrübung in Druckleitungen. Ein kleinbürgerlich gediegener Haushalt wird eingerichtet, den Bücherschrank zieren Ausgaben der deutschen Klassiker und ein zweibändiges Brockhaus-Lexikon. Der Sohn erhält Klavierunterricht und besucht ein Gymnasium.
Nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs wird Opa zum Militär eingezogen. Er steht als Soldat am südöstlichen Rand Europas russischen Truppen gegenüber, kauft ein russisches Wörterbuch, und bei Kriegsende 1919 ist er weder in Gefangenschaft geraten noch mit seiner militärischen Einheit zurückgekehrt. Erst nach mehr als einem Jahr trifft er wieder in Berlin ein, trägt seine Militärstiefel, bringt eine Parabellum-Pistole und einen türkischen Fez mit. Kurz vor seinem Tode soll er geäußert haben, dies sei die schönste Zeit in seinem Leben gewesen. Einzelheiten blieben sein Geheimnis, und nicht das einzige. Es gibt ein Foto aus dem Jahre 1904, das stolze Gruppenbild zeigt drei Generationen Anecker. Neben ihnen steht ein vierter Erwachsener, nicht identifiziert, es könnte Opas älterer Bruder sein. Er hat ihn Mutti gegenüber nur einmal erwähnt und kam nie wieder darauf zurück.
In den 1920er Jahren eröffnet Opa im Berliner Arbeiterviertel Wedding einen kleinen Kolonialwarenladen. Der Begriff stammt aus der Zeit Kaiser Wilhelms, als Deutschland Kolonien in Übersee besaß. Hier konnte man außer dem alltäglichen Bedarf auch Bohnenkaffee, Kakao oder Rosinen erwerben. Eine etwas gehässige Redensart aus dieser Zeit sagt: „Und ist der Laden noch so klein, er bringt doch mehr als Arbeit ein“. Der Volksmund nannte die kleinen Geschäfte später „Tante-Emma-Läden“, denn meist bediente dort die Ehefrau des Inhabers die Kunden aus der nahen Umgebung. Auch Oma Anna residierte hier stolz als geschäftsführende (weil einzige) Verkäuferin.
Im Nebenhaus hatte Schuster Wilhelm seine kleine Werkstatt. Mit Gleichgesinnten fuhr er sonntags per Bahn zum Angeln in die fischreiche Gegend um Ketzin im Havelland. Hier gründeten sie einen Anglerverein, pachteten gemeinsam Land, parzellierten es und bauten darauf kleine primitive Lauben, in denen oft auch ihre Familien die freien Tage verbrachten. Opa verstand sich gut mit Wilhelm, fuhr gelegentlich mit, und da es ihm gefiel, gehörte er bald dazu.
Das Terrain war durch einen Ziegeleikanal von der Kleinstadt getrennt, über den eine Zugbrücke führte. Auf der Stadtseite erbaute jemand ein kleines Gasthaus mit Pächterwohnung und zwei Fremdenzimmern, er nannte es „Zum Brückenkopf“. Der Name ging auf die Laubenkolonie über. Heute gehört die gesamte Umgebung zu einem Landschaftsschutzgebiet. Sie ist geprägt durch zahlreiche Teiche und Kanäle, die aus ehemaligen Tongruben entstanden sind.
Schon bald bemerkte Opa, woran es der kleinen Ansiedlung mangelte, und sorgte für Abhilfe. Er eröffnete einen Handel mit dem, was Angler am dringendsten brauchen: Tabakwaren, Flaschenbier, Angelhaken und dergleichen. Bald kamen Salz, Öl und Mehl hinzu, nun konnten die Fische fangfrisch zubereitet werden. Alles fand ein Plätzchen in der winzigen Laube. Und Opa gewann einen wunderbaren Vorwand, sich ganze Sommermonate aus dem Herrschaftsbereich von Oma Anna zu entfernen.
Etwas später pachteten der Sohn und die Schwiegertochter Lisa ebenfalls hier eine Laube. Anfang der 1930er Jahre entdeckten dann neben den Anglern auch wohlhabende Berliner die idyllische Gegend. Unweit der Anglerkolonie entstand eine Siedlung massiver Häuschen, die größtenteils vom Frühjahr bis zum Herbst bewohnt wurden. Nun musste ein richtiger Laden her, potenzielle Kundschaft war in Sicht. Opa kaufte ein Stück Wiese, das mit allerlei Schutt und Erdreich aufgefüllt wurde. Das Material kam mit Lastkähnen, die am nahe gelegenen Havelufer anlegten. Opa, Sohn und Schwiegertochter beförderten es auf einer Schubkarre mit eisernem Rad und planierten das Grundstück mit der Harke.
1934 errichtete ein kleiner Baubetrieb ein Häuschen nach Opas Vorstellungen. Auf ganzen acht mal acht Metern Grundfläche, ohne Keller mit flachem Dach aus Teerpappe, Dielenfußboden und hölzernen Fensterläden, wurden Wohn- und Schlafzimmer, Küche und ein Ladenraum untergebracht. Den Blickfang im Verkaufsraum bildeten zwei große kupferne Zylinder, die rohe und geröstete Kaffeebohnen enthielten. Unten konnten sie durch eine Tülle entnommen werden. Eine elektrische Kaffeemühle stand auf einer Konsole an der Wand. Diese Prunkstücke stammten aus dem Inventar des Berliner Ladens. Über allem, gleich unter der Decke, thronte ein spannenlanges Kerlchen, geformt aus Backpflaumen, die ein Drahtskelett zusammenhielt. Als Kopf diente eine bemalte Walnuss und die aus Draht geformte Hand hielt eine kleine Angelrute mit einem winzigen Zelluloidfisch am Haken.
Vor dem Ladeneingang wurde ein Brunnen für Trinkwasser gebohrt; die grüne gusseiserne Pumpe mit dem langen Schwengel durfte auch von den Kunden benutzt werden. Hinter dem Haus versteckte sich das Plumpsklo – immerhin gemauert mit einer Senkgrube, die nur einmal im Jahr von Hand ausgeschöpft werden musste. Daneben das alte Häuschen mit dem ausgesägten Herz in der Tür, umgesetzt aus der Laubenkolonie, es beherbergte nun die Gartengeräte. Ein kleiner Schuppen für Holz und Kohlen vervollständigte das Anwesen. Einen Zaun aus Maschendraht gab es nur an der kurzen Frontseite zum Weg hin, der mit Schlacke einigermaßen befestigt über etliche hundert Meter zur Chaussee führte. An einer der langen Seiten des Grundstücks wucherte eine Art Hecke aus Weiden- und Erlengesträuch. Zwei andere Seiten grenzten an einen teilweise verlandeten Teich, der aus einem ehemaligen Tonstich entstanden war. Hier wollten Opa und Oma Anna ihren Lebensabend geruhsam verbringen.
Vorerst aber kam Opa Anecker auf seine Vergangenheit als Bierbrauer zurück, erwarb eine Lizenz für den Ausschank in einem „Gartenlokal“ und eckte damit gewaltig beim Wirt des Lokals „Zum Brückenkopf“ an. Neben dem Häuschen zimmerte er eigenhändig einen Bretterschuppen. Statt Fenstern gab es nach oben aufklappbare Läden, für den Fußboden genügte festgestampfte Schlacke. Als Schanktisch diente eine Platte aus fein gewelltem Blech auf hölzernen Böcken. Hier konnten die im Eimer gespülten Gläser abtropfen. Der Zapfhahn wurde direkt in das Fass getrieben, meist aber im Wassereimer gekühltes Flaschenbier verkauft. Das Mobiliar lieferte eine Brauerei: Einfache klappbare Gartentische und Stühle, Bier- und Schnapsgläser. Zwei Vierertische fanden innen Platz, bei schönem Wetter wurden sie ins Freie gestellt, wo ein Nussbäumchen zum Schattenspender heranwachsen sollte. Mit Kriegsbeginn blieben die Kneipengänger aus, das hölzerne Bierfass wich einer Metalltonne, versehen mit einer kleinen Handpumpe – eine Tankstelle für Petroleum. Das wurde für Lampen und transportable Öfchen gebraucht; alle Lauben und einige der Wochenendhäuser besaßen keinen Stromanschluss.
Um 1936 bauten Friedrich junior und Lisa im hinteren Teil des gleichen Grundstücks ein hölzernes Wochenendhaus mit Zementfußboden. Unter dem Flachdach entstand ein Zimmer, davor eine zweiseitig offene Veranda, eine Waschküche und mit separatem Eingang die „Rollstube“. Darin stand auf Wunsch Oma Annas ein monströser Apparat: Zwei mit einer mächtigen Handkurbel drehbare Rollen, die von einer großen, mit Feldsteinen gefüllten Kiste zusammengepresst wurden. Zwischen diesen Rollen wurde Haushaltswäsche geglättet. Aber die Geschäftsidee bewährte sich nicht, die Benutzung blieb wohl auf den Eigenbedarf beschränkt und der Raum diente überwiegend als Abstellkammer und Warenlager. Apropos Glätten der Wäsche: Oma Anna fürchtete sich vor elektrischem Strom und benutzte bis an ihr Lebensende ein altehrwürdiges Bügeleisen. Dazu musste sie einen schweren eisernen Keil im Herdfeuer bis zur Rotglut erhitzen und mit dem Feuerhaken in den Apparat hinein balancieren. Nicht selten zeugte dann eine Brandblase an der Hand von ihrer Mühe. Und sobald ein Gewitter heraufzog, wurde keinerlei Metall mehr angefasst, selbst das Besteck legte sie aus der Hand, falls Blitz und Donner sie beim Essen überraschten.
Anna, in jungen Jahren eine hübsche dralle Person, neigte mit den Jahren zu bemerkenswerter körperlicher Fülle. Ein Foto aus dem Jahre 1938 zeigt sie vor dem Ladeneingang neben einem Bierfass sitzend, dessen Umfang von dem ihres Körpers deutlich übertroffen wird. Sie galt – rund heraus gesagt – als gefräßig. Aber es war nicht nur das, eine Wucherung in ihrem Leib breitete sich immer mehr aus. Im April 1944 starb sie im Krankenhaus. Bei ihrer Beerdigung kam es zu einem eigenartigen Zwischenfall. Es war eine Grabstelle für das Ehepaar gewählt, und die Friedhofsarbeiter verwechselten die beiden Plätze. So ward die Grube für den Opa ausgehoben, und die Trauergemeinde musste den Heimweg antreten, ohne die traditionell erforderliche Handvoll Erde auf den Sarg geworfen zu haben. Unter ihnen waren einige ehrwürdige ältere Herren, Geschäftsleute aus der Stadt, die den seinerzeit noch bei solchen Anlässen üblichen Zylinder auf dem Kopfe trugen. Im Laden trösteten gute Kundinnen Opa mit dem alten Aberglauben, dass derjenige, dessen Grab zu früh geschaufelt wird, hundert Jahre alt werde.
Indessen brauchte Opa keinen Trost. Das Verhältnis zwischen den Eheleuten war seit langem getrübt, Oma führte das Kommando im Haus. Auch mochten sie und die Schwiegertochter einander partout nicht leiden, während sich diese mit dem Opa gut verstand. Am ersten August 1944 feierte Opa seinen 65. Geburtstag. Er hatte dazu etwa zehn Frauen aus dem Kreis der Kunden eingeladen, deren Männer sämtlich im Kriege waren. Da ging es hoch her und nach einigen Gläschen sagte Opa: „Also eigentlich feiern wir hier das Ende des dreißigjährigen Krieges.“ Er meinte seine Ehe. Viele Jahre später sagte eine, die dabei gewesen ist, man habe es auch als Anspielung auf das erhoffte nahe Ende des Zweiten Weltkriegs verstanden.
Seit dieser Krieg 1939 begonnen hatte, war es mit den Wochenendbesuchen der Angler aus Berlin vorbei. Zunächst blieben hauptsächlich die Rentner in den Lauben. Mit Beginn der Luftangriffe flohen dann viele der Anglerfrauen vor dem Bombenhagel aus Berlin und richteten sich hier ein. Als Kunden gab es außerdem die Bewohner der kasernenähnlichen Mietshäuser, die in der Umgebung für Ziegeleiarbeiter errichtet worden waren. Die letzte der früher hier zahlreichen Ziegeleien stellte schließlich aus Mangel an Arbeitskräften den Betrieb ein.
In ihrem Ringofen richtete die Luftwaffe ein Materiallager ein, das stand wohl in Zusammenhang mit dem geheimnisvollen Betonturm auf dem Thyrowberg bei Tremmen. Niemand ahnte damals, dass dort schon 1940 das weltweit erste Radar-Rundsuchgerät installiert wurde. Sein Bild wurde zur Fliegerabwehr-Leitstelle in Berlin übertragen. Das war möglich, weil sich im Dorf unweit des Turms ein Verstärkeramt befand, welches zu einem 1938 verlegten Fernsehkabel Berlin-Hamburg gehörte. Von Paules Schulweg aus konnte man den Turm sehen, und dass sich sein Oberteil bei Fliegeralarm drehte. Auf den Gleisen am Bahnhof standen flache Güterwagen, auf denen Scheinwerfer der Luftabwehr montiert waren. Sie wurden von Zeit zu Zeit bewegt, um einem Beschuss zu entgehen. Nach Kriegsende spielte Paule mit Schulkameraden auf den Drehgestellen mit der Handkurbel „Karussell fahren“, und in Tremmen erhielt die Dorfjugend ihren Abenteuerspielplatz, als Sowjetsoldaten 1946 Turm und Verstärkeramt sprengten, nachdem die Technik sorgfältig demontiert war.
In einem massiven Speicher an der Ziegelei war ein geheimes Konservenlager eingerichtet worden. Nach Abzug der Wehrmacht und vor Eintreffen der Roten Armee versorgte sich hier die Bevölkerung hauptsächlich mit portugiesischen Ölsardinen. Auch Paule half mit und schleppte auf seiner Kinderschubkarre einige Büchsen nach Hause, die aus zerbrochenen Kisten gefallen waren. Der Opa nahm vorausschauend auch eine gewaltige Rolle dicken verzinkten Stahldrahts mit. Damit umwand er einige Kisten und versenkte sie im Teich, das Ende im Ufergebüsch versteckt. Andere vergruben sie in den Gärten, doch bald erschienen Sowjetsoldaten, stocherten im Boden und requirierten das Gefundene. Bei Opa entdeckten sie nichts, und aus der Drahtrolle wurde später ein Zaun.
Außerdem hatte der kluge Geschäftsmann rechtzeitig vor dem absehbaren Kriegsende große Vorräte von Lebensmitteln angelegt. Gegen Ende April startete er unter dem Motto „dem Feind darf nichts in die Hände fallen“ einen Ausverkauf. Stammkunden waren durch Abgabe eines bestimmten Abschnitts der Lebensmittelkarte registriert und bekamen nun markenfrei pro Person eine bestimmte Menge an Mehl, Nudeln, Zucker, Salz, Margarine usw. Alle diese Produkte wurden damals noch nicht industriell verpackt, sondern lose verkauft, vom Einzelhändler in Tüten abgefüllt. Im Kriege war auch das Verpackungsmaterial Mangelware. Zum festgesetzten Termin versammelte sich nun die Kundschaft, ausgerüstet mit Taschen, Eimern, Beuteln bis hin zu Kopfkissenbezügen. Als zu erkennen war, wie viele noch vor Einbruch der Dunkelheit bedient werden konnten, bestimmte Opa eine Grenze in der Schlange. Die Zurückbleibenden erhielten Wartenummern und konnten am nächsten Morgen geordnet und in Ruhe wiederkommen. So ging alles reibungslos vonstatten. Die Zettelchen hatte Paule mit dem Stempel des Ladens versehen, nummeriert und ausgeteilt – schließlich war er damals schon Schulkind. In der Rollstube aber hatte Opa bereits im Vorjahr eine gut getarnte Zwischenwand eingezogen. In der schmalen Lücke waren langlebige Güter für den Eigenbedarf versteckt: Kerzen, Seife, Streichhölzer, Zucker, Zwieback, Reis, Nudeln und ähnliches.
Um diese Zeit gruben Hitlerjungen an einer Wegbiegung dicht beim Grundstück ein Schützenloch und bezogen Stellung mit einer Panzerfaust. Das neugierige Paulchen durfte eine hölzerne Übungshandgranate werfen. Wie die meisten Jungen in dieser Zeit war er ja selbst auch bestens gerüstet – mit einem vom Opa gebastelten Holzgewehr. Wenn man seine Kurbel drehte, ließ ein geschnitztes Zahnrad ein Brettchen knattern.
Am 24. April 1945 schloss die Rote Armee den militärischen Ring um Berlin. Bei Ketzin trafen sich Vorkommandos der 1. Belorussischen und der 1. Ukrainischen Front. Von Norden kam die 47. Armee Marschall Schukows, auf dem südlichen Havelufer die 4. Garde-Panzerarmee Konews. Schon der erste seiner Panzer versenkte die Fähre allein durch sein großes Gewicht. Die Kämpfe in der Umgebung dauerten bis zum vierten Mai, als beim nahen Dorf Etzin eine Einheit der Waffen-SS eingekesselt und aufgerieben wurde.
Die erste Begegnung der Familie mit der Roten Armee verlief am 23. oder 24. April höchst unspektakulär. Vor dem Laden hielt ein einachsiges Wägelchen mit einem munteren kleinen Steppenpferd, einem kutschierenden Soldaten und einem Offizier. Es waren wohl Aufklärer. Opa konnte sich mit ihnen notdürftig verständigen, zeigte mit Papier und Stift, wohin die Straßen führten (die Wegweiser waren damals entfernt oder verdreht worden), und wo im Ort eine Panzersperre sei. Zu guter Letzt wurde Paulchen eingeladen, ein Stück mitzufahren. Er war begeistert.
Am nächsten Tag erschienen drei andere Sowjetsoldaten, durchsuchten Haus und Grundstück nach Waffen oder versteckten SS-Leuten, fragten nach Alkohol, der nicht mehr vorhanden war, raubten nichts und zogen weiter. Während der ganzen Zeit mussten Opa, Lisa und der Siebenjährige an der Wand stehen, ihnen gegenüber einer der drei Fremden mit der Maschinenpistole im Anschlag. Als später immer mehr Sowjetsoldaten in die Stadt kamen, versteckte sich Lisa aus Angst vor Vergewaltigung mit Paulchen in einer Laube auf der abgelegenen Halbinsel „Klein Venedig“, Opa blieb im Hause. Vereinzelt fielen Schüsse in der Gegend, ein verirrtes Projektil durchschlug die Bretterwand der Laube, wo Paulchen schlief. Es blieb in der Matratze stecken.
Eines Morgens in den ersten Maitagen hörte man eine MPi-Salve aus der Richtung des Ladens. Als Lisa nach einiger Zeit ängstlich nachschaute, fand sie den Opa tot mit durchschossenem Unterleib und halb abgetrenntem Daumen in der Rollstube. Er hatte wohl versucht, die mit dem Bajonett gespickte Waffe zum Boden abzulenken. Freunde aus der Kolonie eilten zu Hilfe. Sie suchten Bretter zusammen, nagelten daraus eine sargähnliche Kiste, schwärzten sie mit Teer und begruben Opa im Garten. Ein Transport zum Friedhof am entgegengesetzten Ende der Stadt war erst nach über einer Woche möglich.
Die Bewohner der Laubenkolonie stammten überwiegend aus einfachen Verhältnissen und hatten mit den Nazis nichts im Sinn. Sie gehörten zum Arbeiter-Anglerverein „Rotauge“, dessen Abzeichen zierte ein leuchtend roter Punkt in der Mitte. Der Name war freilich eine Anspielung auf die Gesinnung der Mitglieder, andererseits als Name eines häufigen Havelfischs unverfänglich. Abseits des Vereinslebens stand einzig ein hagerer, bärbeißiger Alter, der seine Laube zu Feiertagen mit der Hakenkreuzfahne schmückte. Wünschte ihm ein Kind unterwegs höflich „Guten Tag“ (das war damals auch Fremden gegenüber noch allgemein üblich), so hielt er ihm eine Standpauke und forderte den „Deutschen Gruß“. Ängstlich-brav murmelte also jeder, der ihm nicht aus dem Weg gehen konnte, sein „Heil Hitler“. Er starb einsam im kalten Winter 1945/46. Sein von Ratten zernagter Leichnam wurde erst in der Laube entdeckt, als sich bei einsetzendem Tauwetter der Geruch in die Nachbargärten ausbreitete.
Opa umging das Fahnenproblem anfangs dadurch, dass seit seinem Einzug in die Kolonie eine Flagge mit dem Berliner Bären seine Laube schmückte. Nach dem Umzug auf das eigene Grundstück wurde dafür ein ordentlicher Mast aufgestellt. Als später eine Amtsperson nachdrücklich auf das Unhaltbare dieses Zustands hinwies, verschwand der Bär. Wieder war Opa kräftig angeeckt. Trotzdem flatterte auch keine andere Fahne vor dem Laden: In kürzester Frist kippte der Mast vom verfaulten Ständer und blieb jahrelang zur Ansicht als Beweis des guten Willens liegen, „sie wissen ja, der Krieg, das Holz ist knapp“.
Opa interessierte sich lebhaft für das Kriegsgeschehen. Mit Besorgnis verfolgte er die fortschreitende Unterwerfung der Nachbarländer und versuchte, sich unbeeinflusst von der Propaganda der Nazis im Radio einen Überblick über den Verlauf der Fronten zu verschaffen. Schon im September 1939 war eine Verordnung in Kraft getreten, die das Abhören ausländischer Sender verbot und bei Zuwiderhandlung mit Zuchthausstrafe drohte. Ungeachtet dessen hörte er abends heimlich die deutschsprachigen Sendungen der britischen BBC. Eingeleitet wurden diese mit vier Paukenschlägen, dreimal kurz und einmal lang. Das entsprach dem Morsezeichen für den Buchstaben „V“, der im Englischen für „Victory“ (Sieg) steht. Zugleich erinnerten die Pauken nicht ohne Ironie an das Werk eines deutschen Komponisten: Das eindringliche „Schicksalsmotiv“, mit dem Beethovens Fünfte Symphonie beginnt.
Einmal geschah es, dass der Sechsjährige den Opa am Radio überraschte, als das markante „bum bum bum bomm“ ertönte, gefolgt von der Ansage „Hier spricht England“. Nachdrücklich wurde er von Opa und Mutti über die Notwendigkeit belehrt, darüber absolutes Stillschweigen zu bewahren. Seine Erinnerung daran wurde jedes Mal beim Schulweg aufgefrischt, wenn er die großen Plakate an den Litfaßsäulen sah. Sie zeigten Alltagsszenen, überlagert vom riesigen dunklen Schatten eines Mannes, und darunter den Text „Pst! Feind hört mit!“ Gemeint waren ausländische Spione und antifaschistische Widerstandskämpfer. Aber man konnte den Text auch ganz anders interpretieren: Der Feind vieler aufrechter Mitbürger waren die Spitzel der Nazis, die Denunzianten.
Gegen Kriegsende stellten sich neue Nachbarn am Brückenkopf ein, die hier ihr Schäfchen ins Trockene brachten: Ein Hauptmann der Luftwaffe, der mit dem erwähnten Materiallager zu tun hatte, ließ „seine“ Soldaten mauern und „seine“ Lkw die Steine heranbringen. 1945 verschwand er westwärts, im Haus blieben Frau und Tochter und lebten noch Jahrzehnte zum großen Teil von Westpaketen. Neben ihm ließ ein SS-Mann bauen, er ward nicht mehr gesehen, im Haus lebte dann seine alte Mutter. Der dritte im Bunde war ein ominöser Zivilist, der in den ersten Nachkriegsjahren als Schieber mit einem klapprigen Vorkriegs-PKW in Erscheinung trat. Er starb bald und ließ eine lustige Witwe zurück.
Der Laden war stets auch Umschlagplatz für den neuesten Klatsch und Tratsch. So erfuhr die Kundschaft mit lebhaftem Interesse, die Dame habe öfter Besuch von Herren aus der näheren Umgebung. An einem Winterabend, als die Havel weitgehend zugefroren war, schlich jemand übers Eis auf das Grundstück und sah durchs Fenster, was da vor sich ging. Wenn es mit solchen Geschichten oder anzüglichen Witzen losging, erscholl regelmäßig der Ruf „Paule, jeh ma raus!“ Er hielt sich ja oft für kleine Handreichungen im Laden auf. Aber dann bezog der höchstens Zwölfjährige seinen speziellen Horchposten in einer eigentümlichen Nische des Wohnzimmers, die nur durch eine dünne Bretterwand vom Laden getrennt war. Und da viele Kundinnen schon etwas schwerhörig waren, war auch er ausführlichst informiert – im konkreten Fall über die Details beim Vollzug der „französischen Liebe“.
Andere Bewohner der Siedlung waren weitaus unangenehmer. Ein gewisser Peinlich, in brauner Uniform, Reitpeitsche im Stiefelschaft, ließ 1943 für seine Familie die Garage am Haus seines Schwiegervaters ausbauen. Sein Sohn Karli und Paule waren gleichaltrig, und manchmal holte Mutter Peinlich die beiden von der Schule ab. Dann hockten sie miteinander auf der Ladefläche ihres dreirädrigen Lastenfahrrads. Als Dienstmädchen für Reinigung, Wäsche und Gartenarbeit wurde Vera beschäftigt, eine junge ukrainische Zwangsarbeiterin, die etwas Deutsch verstand. Auch zum Einkaufen wurde sie mit Korb und Einkaufszettel geschickt. Verhärmt und abgemagert stand sie da, und ihre intime Bekanntschaft mit der Peitsche war nicht zu übersehen. Wenn niemand sonst in der Nähe war, steckte ihr Opa etwas Nahrhaftes zu, was sich schnell und heimlich verschlingen ließ, und wohl auch etwas Hoffnung auf baldige Befreiung. Als ihr Dienstherr im April 1945 verschwand, machte sie sich auf den Weg in die Heimat. Sie verabschiedete sich dankbar von Opa und hinterließ einen Zettel, der ihn als ihren heimlichen Helfer auswies. Dieses Papier wurde nach seinem Tode nie gefunden. Ebenso fehlte sein Russisch-Wörterbuch sowie ein in der Rollstube aufbewahrtes Koffergrammophon mit Federantrieb zum Aufziehen. Waren der oder die Mörder marodierende Russen? Oder umherziehende Verschleppte aus Osteuropa? Es könnten auch verstreute SS-Leute gewesen sein – an der Gartentür wehte zuvor ein weißes und ein rotes Fähnchen.
Seinen anderen Opa, Muttis Vater, hat Paul nie kennengelernt. Der Maschinenschlosser Gustav Eisermann siedelte 1915 mit seiner Frau und drei Kindern aus dem vogtländischen Plauen nach Berlin um. Bei einem Arbeitsunfall verlor er erst sein Augenlicht und kam danach bei einem Verkehrsunfall ums Leben, ein von Pferden gezogener Brauereiwagen überrollte ihn. Seine Frau Helene – Paul hat keinerlei Erinnerung an sie – starb kurz vor Kriegsende im Mai 1945. Zusammen mit vielen anderen stand sie an einer Straßenecke im Wedding vor einer Pumpe, um Trinkwasser zu holen, als eine Bombe mit Zeitzünder explodierte. Die Reste wurden in einem Massengrab bestattet.
Die Eltern
Pauls Vater Friedrich Paul Anecker junior, geboren 1902, wuchs in der elterlichen Wohnung in Berlin behütet und streng erzogen auf. Er besuchte ein Gymnasium, mit besonderem Interesse lernte er Englisch, Französisch sowie im Privatunterricht das Klavierspiel. Sonntags genoss er in väterlicher Begleitung allerlei großstädtische Attraktionen wie die Vorführung von Stummfilmen oder die Versuche der Flugpioniere auf dem Tempelhofer Feld.
Zwischen 1914 und 1920 musste Opa dann zum Militär und Oma war allein für die Erziehung des Jungen verantwortlich. Der interessierte sich zwar sehr für Literatur, Musik und alles Mögliche, hingegen nicht sonderlich für die Schulaufgaben und brachte entsprechend schlechte Zeugnisse nach Hause. 1947 schrieb er in einem Lebenslauf: „Ich besuchte in Berlin ein Gymnasium, um dort mein Abitur zu machen.“ Allerdings blieb es bei der Absicht – er hat es nie bestanden.
Pauls Mutter Lisa Eisermann, 1907 in Plauen im Vogtland geboren, kam 1915 mit ihren Eltern nach Berlin. Hier stellte sich beim ersten Schulbesuch heraus, dass weder sie die Lehrer noch diese das Mädchen richtig verstanden. Schuld war ihr eigentümlicher heimatlicher Dialekt. Sie wurde für ein Jahr zurückgestellt, in dessen Verlauf sie vorwiegend von Nachbarskindern die ortsübliche Umgangssprache lernte. Das aber war nun auch nicht eben erwünscht. Erst nach und nach gewöhnte sie sich daran, richtiges Hochdeutsch zu sprechen. Von ihren Erfahrungen profitierte später Paul, der von Anfang an mit Nachdruck zu korrektem Sprechen angehalten wurde.
Es war gegen Ende der 1920er Jahre in Berlin. „Golden“ nannten diese Jahre nur Leute, die das nötige Kleingeld für Tanzlokale, Barbesuche und ähnliches besaßen. Die anderen vergnügten sich am Feierabend bei gutem Wetter in den Geschäftsstraßen beim Schaufensterbummel. Hier begegnete Friedrich junior der blonden, groß und schlank gewachsenen Lisa. Kurzerhand sprach er sie an, und bald waren sie ein Paar.
Friedrich besaß ein Paddelboot, und darin genossen beide sonntags und im Urlaub die Schönheiten der Natur entlang der Havel, meist flussabwärts bis hin zur Stadt Brandenburg. Ein Name für das Boot wurde diskutiert, Lisa war's egal – und so wurde „Schnurz“ in weißen Lettern auf das dunkle Holz gepinselt. Damals fuhr man nicht zum Camping, sondern zum Zelten. Dazu genügte ein winziges dreieckiges Zelt, dessen Spitze von den hochgestellten Paddeln aufrecht gehalten wurde. Eine Luftmatratze, eine Decke, eine kleine Angelrute, ein Spirituskocher – fertig. Einmal fand Lisa auf einer Wiese am Ufer Pilze, die sie aus ihrer Kindheit kannte. Sie musste erst einmal alleine zur Probe essen, ehe Friedrich seine Angst vor einer Vergiftung überwand.
Viel zu schnell meldete sich Nachwuchs an, eine Katastrophe für den schmalen Geldbeutel der jungen Leute. Und es fand sich jemand, der ungeachtet der drohenden Strafe für Abhilfe sorgte. Leider sorgte er wohl auch dafür, dass sich der später einstellende Kinderwunsch lange Zeit nicht erfüllte. Nach mehreren Fehlgeburten wurde erst 1938 ein Junge geboren, ein heiß ersehntes Kind der Liebe. In Anlehnung an die zweiten Vornamen des Vaters und Großvaters wurde er Paul genannt. Nun sollte der Kleine, wie es Brauch war, evangelisch getauft werden. Aber beide Eltern waren einige Jahre zuvor aus der Kirche ausgetreten. Jetzt erfuhren sie vom Pfarrer, dass mindestens einer von beiden wieder Mitglied der christlichen Gemeinschaft werden müsse. Friedrich reagierte prompt: „Es geht ihnen also um die Kirchensteuer, nicht um die Seele eines Menschen“. Gewaltig angeeckt, natürlich. Beide gingen und Paul blieb ein „Heide“.
Lisa hatte die Handelsschule (eine Art kaufmännischer Berufsschule) besucht, Stenografie, Maschineschreiben und etwas Buchführung gelernt und arbeitete in einem kleinen Betrieb. Friedrich schlug sich in der Zeit der großen Arbeitslosigkeit mehr oder weniger mit Gelegenheitsbeschäftigungen durch. Einige Wochen leerte er, als Aushilfe bei der Post, Briefkästen und fuhr dazu ein Motorrad mit Beiwagen. Dann wieder ging er als lebender Werbeträger in einer der großen Einkaufsstraßen umher: Durch Schnüre über den Schultern befestigt, hingen vor Brust und Rücken bis fast zum Boden hinab zwei Papptafeln. Und wenn er etwas Geld in der Tasche hatte und in der Nähe war, ging er Mittagessen bei Aschinger. Das war eine beliebte Großgaststätte, in der man beim Kauf einer Terrine Erbsen- oder Kartoffelsuppe (ohne Bockwurst) gratis so viele Brötchen verzehren durfte, wie man mochte.
Um 1930 fand er endlich eine feste Anstellung als Buchhalter bei der Reichsbank. Nun wurde geheiratet und eine Wohnung, ebenfalls im Wedding, eingerichtet. An die Stelle der üblichen Wohnzimmermöbel trat ein sogenanntes Herrenzimmer: Ein moderner Schreibtisch ohne Aufbauten, Schreibtischsessel mit Armlehnen, ein großer Bücherschrank und ein runder Ausziehtisch mit einfachen Polsterstühlen, dazu ein Klavier. Nun genoss das junge Paar die Annehmlichkeiten der Großstadt: Theaterbesuche und vor allem Opernaufführungen – Friedrich spielte selbst klassische Musik auf dem Klavier, und Lisa war von Wagner begeistert. Zusammen haben sie den ganzen „Ring“ gehört. Zwei große Reisen wurden unternommen, beginnend mit einer Dampferfahrt auf dem Rhein, weiter über Rothenburg, Heidelberg, Ansbach und später nach Dresden, ins Elbsandsteingebirge und in Lisas Geburtsort Plauen. Hier zeigte sich, dass sie den heimatlichen Dialekt kaum noch verstehen konnte.
Schließlich mieteten beide in der Ketziner Anglerkolonie eine Laube für die Wochenenden. Als 1935/36 das Grundstück gekauft war und Opas Hausbau begann, waren sie tatkräftig dabei und errichteten hier ihr eigenes hölzernes Häuschen. Nach der Geburt des Kindes gab Lisa ihre Arbeit auf, und Paulchen wuchs in den Sommermonaten in der grünen Umgebung auf. In einer Waschwanne, deren Wasser die Sonne erwärmte, konnte er nach Herzenslust planschen, in einem Beet wurde gebuddelt und Modderpampe gemacht. Eines schönen Tages saß Friedrich mit der Angel am Rande des angrenzenden Teichs und Paulchen auf seinem Schoß. Als der eine vorüberschwirrende Libelle fangen wollte, plumpste er ins Wasser und Vati musste hinterher.
Alles änderte sich, als am 1. September 1939 Hitler den Zweiten Weltkrieg vom Zaun brach. Friedrich wurde als Soldat eingezogen. Während seiner Grundausbildung im Winter konnte ihn Lisa mit Paulchen einige Tage in Windischleuba in der Nähe des thüringischen Altenburg besuchen. An das Dörfchen hat Paul eine seiner frühesten Kindheitserinnerungen. Die Straße entlang zog sich ein wassergefüllter Graben, über den zu jedem einzelnen Haus ein schmaler Steg führte. Und beim Bäcker gab es „Zeilen“, das waren kleine weiße Brötchen, zu viert in einer Reihe aneinanderhängend gebacken, die der Kleine sehr liebte.
In Frankreich war der Krieg am 25. Juni 1940 mit einem Waffenstillstand vorerst beendet. Das Land wurde in ein unbesetztes Gebiet und in eine deutsche Besatzungszone geteilt. In diese, nach Bordeaux, wurde Friedrichs Einheit verlegt. Erst jetzt erfuhren die Männer, dass sie von nun an dem berüchtigten SD, dem „Sicherheitsdienst“, zugeteilt waren. Der gehörte zum Machtbereich des SS- und Polizeiführers Himmler und war für das Aufrechterhalten dessen, was die Nazis unter Ordnung verstanden, für die Sammlung von Nachrichten sowie für die Erfassung und Deportation von Juden zuständig. Friedrich Anecker, früher Buchhalter bei der Reichsbank, war nun Unteroffizier und führte Buch über von den Nazis geraubte Vermögen. Er hütete sich vor jedem möglichen Anecken bei den Vorgesetzten und war peinlich bemüht, seine antifaschistische Einstellung zu verbergen.
Bordeaux war zu dieser Zeit ein Einkaufsparadies, Händler- und Kulturmetropole. Es gab auch ein Soldatenkino, eine Frontbuchhandlung, und an schönen Tagen ging die Truppe im Seebad schwimmen. Ungeachtet dessen, dass persönliche Kontakte zwischen den Besatzern und der Zivilbevölkerung von beiden Seiten ungern gesehen wurden, entwickelte sich zwischen Friedrich und der jungen Büroangestellten Janine ein mehr als freundschaftliches Verhältnis. 1944 bekam sie ein Kind, in der Geburtsurkunde des Jungen steht „Vater unbekannt“. Bei Friedrichs Tod 1953 fand man in seiner Brieftasche diese Urkunde sowie das Foto eines Kindes im entsprechenden Alter. Mehr weiß man nicht.
Ab und an hatte Friedrich in dieser Zeit seinem Vater per Feldpost eine Kiste günstig gekauften Rotweins aus Bordeaux geschickt. Eine vergoldete Taschenuhr brachte er bei seinem letzten Heimaturlaub mit, die habe ihm jemand als Dank für seine heimliche Hilfe in einer Notlage geschenkt. Paulchen wurde mit einer südfranzösischen Spezialität bedacht, mit einem polierten elastischen Stab aus der Blattrippe einer Palme zur Verwendung entsprechend dem preußischen Rohrstock. Aber Mutti hat nie davon Gebrauch gemacht, der aus Weidenzweigen geflochtene Teppichklopfer genügte ihr.
Im April 1944 starb Oma Anna und Friedrich bekam Sonderurlaub. Er traf gegen Mittag in Nauen ein und wartete dort an einem abgelegenen Platz, bis spät am Abend der letzte Zug nach Ketzin fuhr. Er trug ja die verhasste Uniform mit dem Totenkopf an der Mütze und kein Bekannter sollte ihn damit sehen. Zur Beerdigung ging er dann unerlaubt in Zivil.
Nach der Landung der Alliierten in der Normandie im Juni 1944 machte er sich schließlich im Alleingang auf den Weg zur Front, lief zu den Amerikanern über und wurde schnell in die USA überführt. Im Gefangenenlager war er nicht als Deserteur erkennbar. Das konnte überlebenswichtig sein, denn im Lager herrschte eine Selbstverwaltung und das Sagen hatten Nazioffiziere, die zum Teil noch ihre Pistolen besaßen. Friedrich arbeitete an der Lagerzeitung mit, er übersetzte amerikanische Kurzgeschichten ins Deutsche.
Bei den deutschen Behörden galt er zunächst als vermisst. Die Familie erfuhr davon, als die Gestapo vor der Tür stand und eine Haussuchung vornahm. Die Existenz seiner alten Parabellum unter der elektrischen Kochplatte kommentierte Opa trocken: „Schließlich müssen alle Volksgenossen gewappnet sein, das Vaterland zu verteidigen“. Verdächtiges wurde nicht gefunden. Das ist einem antifaschistisch gesinnten Ortspolizisten zu verdanken, dem Herrn Ehrlicher. Er war schon am Vortag zur Mitwirkung als Ortskundiger befohlen worden und hatte Opa gewarnt. Anfang Mai 1945 wurde ausgerechnet dieser aufrechte Mann (vermutlich von den Sowjets) erschossen. Wurde er als Polizist denunziert? Oder hatte er einfach zu spät seine Uniform ausgezogen?
Opa und Lisa machten sich nach der Warnung daran, die verbotenen Bücher (Heinrich Heine, Kurt Tucholsky, Erich Kästner und andere) sorgfältig zu verstecken. Kurz zuvor waren Ziegelsteine auf dem Hof gestapelt worden, mit denen die Veranda des Sommerhäuschens verschlossen werden sollte. Die wurden nun umgeschichtet und im Inneren verschwanden die Bücher.
Frühe Kindheit
Zunächst wuchs Paulchen in der elterlichen Berliner Wohnung auf. Seine wohl älteste Erinnerung reicht in diese Zeit zurück und ist durch ein Gefühl von Angst und Gefahr geprägt: Der Vater hob ihn im Obergeschoss über das Treppengeländer und lachte den schreienden Kleinen aus.
Zur Sommerzeit bewohnte die Mutti mit ihm das Ketziner Häuschen, er spielte im Garten, planschte in der Wanne, pflückte Blümchen und naschte Obst von den Sträuchern. Als Vater Soldat wurde, löste man die Stadtwohnung auf, das Mobiliar wurde größtenteils in einem Speicher eingelagert.
Mutter und Kind lebten nun, neben den Großeltern, ganzjährig auf dem Grundstück. Paule lernte den Pumpenschwengel zu bedienen, die Hühner und Kaninchen zu füttern – und natürlich mancherlei Unfug zu treiben. Wies man ihn zurecht, wurde er schnell bockig, strampelte und schrie. Und er lernte, seinen Dickkopf durchzusetzen. Eines Abends ging Mutti mit ihm zum Havelufer, wo Opa angelte. Sie wollte ihn abholen und beim Tragen der Gerätschaften – mehrere Ruten, Kescher, Fischeimer, Würmerbüchse – helfen. Paulchen wollte auch eine Rute tragen, durfte das aber nicht; auf dem Weg unter Bäumen konnte sich leicht die Angelschnur im Geäst verfangen. Der Bengel trotzte so lange, bis die Erwachsenen die Geduld verloren und nachgaben. Gleich darauf trat das Befürchtete ein. Opa war stocksauer, und Mutti kam bei ähnlichen Gelegenheiten mehrmals darauf zurück: „Weißt du noch, damals...“. Später, nach Opas Tod hieß es dann „Du mit deinem pommerschen Dickschädel, den hast du von Opa geerbt“. Aber Paule merkte sich: Beharrlichkeit führt zum Ziel.





























