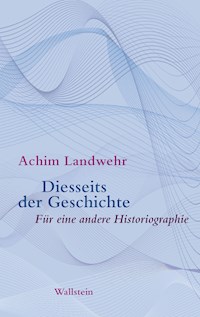14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Was ist Geschichte, und woher wissen wir, wie die Vergangenheit beschaffen war? Der Historiker Achim Landwehr präsentiert mit seinem neuen Buch ›Die anwesende Abwesenheit der Vergangenheit‹ ein Grundlagenwerk der Geschichtstheorie. In einer klugen geschichtsphilosophischen Wendung zeigt er, wie wir unsere Vergangenheit selbst erschaffen. Denn was Historiker als »Quellen« bezeichnen, die Zeugnisse vergangener Welten, sind bloß Ausschnitte, Schnipsel, die interpretiert sein wollen. Für alle, die wissen wollen, was es mit der Geschichte jenseits der Ereignisse auf sich hat, erklärt Achim Landwehr, warum die Wirklichkeit unfassbar ist und wir der Historie nicht entkommen können. Nicht zuletzt entwickelt er ein neues Zeitmodell des Historischen. Dabei setzt er ungewöhnliche Akzente – und macht deutlich, dass auch in der Geschichte »alles fließt«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 486
Ähnliche
Achim Landwehr
Die anwesende Abwesenheit der Vergangenheit
Essay zur Geschichtstheorie
FISCHER E-Books
Inhalt
Gottersatz
Herkunft, Lebensablauf – Unsinn!
Gottfried Benn[1]
Ich müsste nicht mit einer Zeitreise beginnen. Ich könnte auch durchaus anders einsetzen, mit der einen oder anderen Begriffsdefinition beispielsweise oder mit einer näheren Beschreibung des Themas. Ich könnte versuchen, im Allgemeinen wie im Besonderen die Probleme des Gegenstands zu diskutieren, könnte die Schwierigkeiten andeuten, die sich mit dem ehrfurchtgebietenden Ausdruck ›Geschichte‹ verbinden. Aber dann würde ich so tun, als sei das, worum es hier gehen soll, bereits klar. Und das ist es nicht.
Die Zeitreise scheint mir – so befremdlich das zunächst klingen mag – der einfachere Weg. Sie wird notwendig sein zum Verständnis all der folgenden Verwicklungen. Zugegeben, man könnte das eine oder andere Argument finden, um ausgerechnet die Zeitreise für einen weniger gelungenen Einstieg zu halten. Aber anfangen muss man ja. Das ist einer der vielen Punkte im Umgang mit vergangenen Zeiten, die sich als Fluch und Segen zugleich herausstellen: gezwungen zu sein, irgendwo und irgendwie anfangen zu müssen, um im Anschluss genau diese Anfänge wieder historisch zu unterspülen.[2] Bekanntlich wartet vor jedem Anfang ja schon ein anderer, früherer Anfang, der dem ersten vorausgeht. So kann man sich die Zeitleiter hinunterhangeln, bis man beim ›ersten Menschen‹ oder beim ›Urknall‹ angelangt ist: nichts anderes als mehr oder minder fiktive Modelle der Ursprünglichkeit. Wenn man einen Anfang hat, hat man ein Problem.
Was letztlich für die Zeitreise spricht, ist ein Ausschlusskriterium. Wie sollte man ansonsten den Weg hineinfinden in einen Gegenstand, der eine alles überragende Totalität darstellt? Schließlich bezeichnet dieses so selbstverständlich und unproblematisch erscheinende Wort ›Geschichte‹ nichts weniger als die Gesamtheit alles Geschehenen (in einem sinnvollen Zusammenhang), mithin alles, was wir potentiell wissen können. Wie soll man damit halbwegs angemessen umgehen? Sich der Tatsache bewusst zu sein, dass diese Totalität der Geschichte nicht zu erfassen ist, macht die Sache eigentlich nur noch schlimmer. Denn wie sollte man ein alles überwölbendes Etwas, das schlussendlich alles den Menschen Betreffende in sich fasst und das gerade deswegen unfassbar bleibt, anders bezeichnen denn als göttlich? Geschichte als Gottersatz – und Geschichtsschreibung als Ersatzreligion. Gibt es noch irgendetwas, von dem es keine Geschichte geben kann? Nicht nur alles Lebende, Materielle, Immaterielle oder Ideelle ist der totalen Historisierung unterworfen worden, auch von der Geschichte selbst gibt es eine Geschichte. Und vom Nichts. Wenn eine Beschreibungsform bereits sich selbst und die eigene Negation enthält, wie kann man sie dann noch angemessenerweise bezeichnen? Was für ein Monster haben wir da gezüchtet, wenn zwar die einzelnen Ergebnisse historischer Arbeit bezweifelt werden können, aber nicht mehr die Idee einer ›Geschichte‹ in ihrer Gesamtheit?[3]
Geschichte als Gottersatz zu begreifen, ist nicht gar so weit hergeholt, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag. Denn sowohl die Geschichtsphilosophie jüngerer Prägung als auch die akademisch installierte Geschichtswissenschaft haben ihre Geburtsstunde in der Zeit des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts – also in genau jenem Zeitraum, der nicht selten als Beginn der ›Moderne‹ apostrophiert wird und der sich entscheidend von den traditionellen Weltbildern und religiösen Erklärungsmustern der sogenannten ›Vormoderne‹ verabschiedet haben soll.
Dass solche Erklärungsmuster nicht selten säkularisiert gewandelte Varianten vormals religiöser Deutungen sind, kann man am Beispiel der Geschichtsphilosophie ablesen. Sie betrat zu einer Zeit die Bühne, als religiöse Erklärungsmodelle und heilsgeschichtliche Deutungen allmählich verblassten. Bis dahin dominierende Antworten auf die Fragen, woher wir kommen und wohin wir gehen, verloren merklich und nachhaltig an Überzeugungskraft. Die Frage nach dem Sinn, der hinter all den Veränderungen steckte, konnte nicht mehr überzeugend durch den Verweis auf die göttliche Vorsehung beantwortet werden. Abgang Religion, Auftritt Geschichtsphilosophie, wie sie nicht zuletzt durch Georg Friedrich Wilhelm Hegel wesentlich geprägt wurde. An die Stelle Gottes war nun ›die Geschichte‹ getreten, die aufgrund der ihr inhärenten Sinnhaftigkeit und Zielstrebigkeit einen Prozess abspulen ließ, der – wenn auch unter Irrungen und Wirrungen – einen sinnhaften Ablauf nachvollziehbar machte. Das säkulare Unternehmen der Geschichtsphilosophie machte es möglich, Transzendenz und Heilsversprechen von der Vertikalen in die Horizontale zu kippen. Die Aussicht auf das Heil wurde nicht zum Verschwinden gebracht, sondern in die Geschichte verlegt.[4]
Die Geschichtsphilosophie und in ihrem Gefolge die sich als eigene Universitätsdisziplin etablierende Geschichtswissenschaft schienen für einen Moment in der Lage zu sein, die Bedeutung des Weltgeschehens erklären zu können – ihre eigene Historizität dabei geflissentlich übersehend. Dass beide zu dieser Verantwortung aufsteigen konnten, lag nicht zuletzt in dem Versprechen, etwas diesseitig überblicken zu können, dessen man bis dahin nur jenseitig ansichtig werden konnte: die zusammenhängende Bewegung der Menschheit durch die Zeit. Um derartige Abläufe in ihrer Gesamtheit nicht nur erkennen, sondern auch anschaulich machen zu können, brauchte es wahrlich eine göttliche Perspektive.
Und man darf Zweifel daran hegen, ob sich die Auffassungen des frühen 21. Jahrhunderts von ›der Geschichte‹ tatsächlich gänzlich frei gemacht haben von solchen quasi-göttlichen Perspektiven. Selbst als Jean-François Lyotard in seinem Plädoyer für das postmoderne Wissen aus dem Jahr 1979 das Ende der großen Erzählungen verkündet hat, also das Verblassen der Fortschrittsgeschichten von Liberalismus und Marxismus, spielten sich diese Erzählungen immer noch in einem historischen Rahmen ab. Die größte aller großen Erzählungen blieb von Lyotard ausgeklammert: die Geschichte selbst.[5] Robert Menasse konnte daher mit Recht davon sprechen, dass es sich bei ›der Geschichte‹ um den größten historischen Irrtum handele: »Wenn es einen ›Misthaufen der Geschichte‹ gibt, dann ist das, was am dringendsten auf diesen Misthaufen gehört, unser Begriff von Geschichte selbst.«[6]
Mit einer Zeitreise zu beginnen, ist also möglicherweise nicht der offensichtliche Weg. Aber wenn es stimmt, dass Umwege die Ortskenntnisse erweitern, dann könnte das auch für die Zeitkenntnisse zutreffen.
Das scheint nicht zuletzt die Hoffnung vieler zu sein, die sich auf Vergangenheit und ›Geschichte‹ einlassen: nicht nur die Zeitkenntnisse zu erhöhen, sondern auch Möglichkeiten zu finden, Reisen in diese vergangenen Zeiten anzutreten. Die Rede von der »Reise in die Vergangenheit« bleibt dabei zwar metaphorisch, so dass man gemeinhin nicht davon ausgeht, einen solchen Ausflug physisch tatsächlich antreten zu können; allerdings machen die zahlreich vorhandenen fiktionalen Beschreibungen solcher Zeitreisen deutlich, wie groß die Sehnsucht ist, einmal die eigene Gegenwart verlassen zu dürfen.[7]
Das Faszinosum des Temporaltourismus bleibt aber nicht auf den Bereich des Fiktionalen beschränkt, sondern findet sich als (zumindest vage) Hoffnung auch in der Begegnung mit historischen Gegenständen. Möglich werden soll die unmittelbare Teilhabe an der Aura des Vergangenen durch den Besuch historischer Stätten, durch die Begegnung mit bestimmten Menschen (der bekannte Klassentreffen- beziehungsweise Zeitzeugen-Effekt) oder durch den Kontakt mit historischen Dokumenten. Jemandem eine mittelalterliche Urkunde nicht nur hinter Glas im Museum vorzuführen, sondern tatsächlich in die Hand zu geben, setzt nicht nur bestimmte intellektuelle Vorgänge frei, sondern führt auch zu gewissen körperlichen Reaktionen: Die Ausstrahlung des Originals und die Ehrfurcht vor dem jahrhundertealten Schriftstück, wie sie sich in Archiven und Bibliotheken bei entsprechenden Situationen regelmäßig beobachten lassen (und die in abgeschwächter, weil sicherheitsglasgeschützter Form auch im Museum eintritt), haben nicht nur etwas mit dem objektiven materiellen Wert des seltenen Objekts zu tun. Sie funktionieren auch bei minderwertigen Schriftstücken aus der Massenproduktion – und zwar weil dieses Material bereits mehrere Jahrhunderte Zeitreise hinter sich gebracht hat. Zumindest unterschwellig scheint hier die Vorstellung vorzuherrschen, es sei möglich, mittels eines solchen Dokuments den Weg zurück anzutreten: nicht auf dem Papier haltzumachen, sondern gewissermaßen durch das Papier hindurch in die Vergangenheit zu schreiten – und wie Alice hinter den Spiegel zu treten.
Der niederländische Kulturhistoriker Johan Huizinga, der insbesondere durch sein 1919 erschienenes Buch »Herbst des Mittelalters« bekannt geblieben ist, hat für dieses Überschreiten historischer Distanzen eigens den Begriff der ›historischen Empfindung‹ geprägt. Es war die vage Ahnung historischer Unmittelbarkeit, die sich ihm in der Arbeit mit dem Material aus der Vergangenheit erschloss: »Es kann sein, daß solch ein historisches Detail, in einem Bild, aber es könnte ebenso gut in einer Notariatsakte sein, während es mir als solches unwichtig ist, mir auf einmal das Gefühl eines unmittelbaren Kontaktes mit der Vergangenheit gibt, eine Erregung ebenso intensiv wie der reinste Kunstgenuß, eine (lache nicht) beinahe ekstatische Empfindung des Nicht-mehr-ich-selbst-Seins, des Überfließens in die Außenwelt, der Berührung mit dem Wesen der Dinge, des Erlebens der Wahrheit durch die Geschichte.«[8]
Der Geschichtstheoretiker und -philosoph Frank R. Ankersmit baut explizit auf Huizinga auf, wenn er in einem erstmals 1993 erschienenen Beitrag ebenfalls die historische Erfahrung als eine Form des unmittelbaren Kontakts mit der Vergangenheit hervorhebt. Diese Erfahrung sei zu verstehen als »das Ergebnis einer flüchtigen Aufhebung der Zeitdimension« und »führt uns damit in eine vor-erkenntnistheoretische Denkwelt zurück, innerhalb derer die Frage, ob man sich in Sachen historischer Erfahrung irre oder nicht, ein ›Kategorienfehler‹ ist«.[9]
Hier kommt er also zum Ausdruck, der Wunsch nach Authentizität in historischen Angelegenheiten. Fragen nach ›wahr‹ oder ›falsch‹ stellen sich nicht mehr, weil die Unmittelbarkeit des nachträglichen Sichhineinversetzens (anstatt des unmittelbaren Dabeigewesenseins) jegliche Infragestellung ad absurdum führt. Kritische Nachfragen müssen bei einem solchen Verständnis historischer Erfahrung oder Empfindung außen vor bleiben – damit aber auch jede methodische Kontrolle oder wissenschaftliche Reflexion.
Der Wunsch nach geschichtlicher Unmittelbarkeit rückt die historisch Arbeitenden unweigerlich in die Nähe von Genies, denn über eine solche Form der Einfühlung in die Vergangenheit zu verfügen kann nicht jedem gegeben sein. Sind Historikerinnen[10] also Mitglieder einer verschworenen Gemeinschaft, eingeweiht in die Geheimnisse des Überwindens temporaler Hindernisse und in der Lage, aus einem schnöden, jahrhundertealten Dokument vergangene Welten wiederauferstehen zu lassen? Gelingt ihnen aufgrund besonderer, in der Gegenwart erworbener Qualitäten der Sprung in ein weit zurückliegendes Gestern? Populäre Darstellungen der historischen Praxis evozieren zumindest regelmäßig solche Bilder einer detektivischen Forschungsarbeit, an deren Ende vergangenes Leben wiederaufersteht. Und selbst in so unschuldig anmutenden Formulierungen wie der ›Rekonstruktion der Vergangenheit‹ offenbaren sich noch solche Wünsche. Denn rekonstruieren kann man strenggenommen nur, was einstmals existierte, in trümmerhafter Form noch vorhanden und des Wiederaufbaus fähig ist. Es ist genau diese historische Gretchenfrage, wie wir es nämlich mit der Bedeutung der Geschichte in unserem Leben halten wollen, die historistisch anmutende Bauprojekte wie die Wiedererrichtung längst zerstörter Schlösser oder den Neubau untergegangener Altstädte immer wieder so umstritten macht.
Dass Zeitreisen möglich sind, wurde empirisch schon längst bewiesen. Einstein hatte im Rahmen der Speziellen Relativitätstheorie bereits vorausgesagt, dass ein Astronaut, der mit nahezu Lichtgeschwindigkeit den Weltraum durchquert, nach seiner Rückkehr auf die Erde deutlich weniger gealtert sein müsste als sein daheimgebliebener Zwillingsbruder. Er würde sich nicht nur durch den Raum, sondern auch in die Zukunft bewegen. 1971 haben die amerikanischen Physiker Joseph Hafele und Richard Keating den empirischen Beleg für diese These erbracht, und zwar ohne großen technischen Aufwand. Sie reisten in Begleitung einer Atomuhr auf einem Linienflug Richtung Osten einmal um die ganze Erde, während eine weitere Atomuhr als Vergleichsmaßstab an ihrem Ausgangs- beziehungsweise Zielpunkt zurückblieb. Nach Beendigung des Flugs stellten sie fest, tatsächlich in die Zukunft gereist zu sein – wenn auch nur um 60 Nanosekunden. Hafele und Keating hatten damit den Jungbrunnen entdeckt, der in der menschlichen Phantasie eine so herausragende Rolle spielt, auch wenn dieser nun nicht mehr im Wasser, sondern in der Luft lag. Alterung lässt sich seither auch ohne plastische Chirurgie verlangsamen, wenn man nur beständig ostwärts die Erde in einem hinreichend schnellen Flugzeug umrundet. Allerdings, so die Physiker, würde dieser Gewinn an Lebenszeit wohl wieder durch die Verpflegung zunichtegemacht, die man bei solchen Flügen serviert bekäme.[11]
Zeitreisen sind also möglich. Allerdings gelingt das nur in eine, in die zukünftige Richtung. Gegen Vergangenheitsreisen sprechen zwei gravierende Gründe logischer und physikalischer Art. Das logische Problem ist jeder Zuschauerin von Filmen und jedem Leser von Romanen bekannt, in denen Zeitreisen unternommen werden: Welche Auswirkungen hat es auf eine Gegenwart, wenn man in deren Vergangenheit reist, um sie zu beeinflussen? Dadurch entstehen verschiedene Unvereinbarkeiten, die in der Logik zum Beispiel unter dem Stichwort des Großvater-Paradoxons diskutiert werden: Wenn man in die Vergangenheit reist, um den eigenen Großvater zu töten, damit dieser den eigenen Vater nicht zeugen kann (weil dieser beispielsweise eine mörderische Diktatur errichtet), dann kann sich logischerweise auch der Zeitreisende selbst gar nicht mehr auf den Weg machen, weil er niemals geboren wurde. Reist er aber nicht in die Vergangenheit, kann er auch nicht verhindern, dass sein Vater geboren wird.[12]
Paradoxien dieser Art versucht man dadurch einzudämmen, dass man Reisen in die Vergangenheit an bestimmte Konsistenzbedingungen knüpft, gewissermaßen eine freiwillige Selbstverpflichtung für Vergangenheitsreisende entwirft, die nicht nur den Passus enthält, dass man den eigenen Großvater nicht töten soll, sondern dass man sich in der Vergangenheit überhaupt nur als passive Zuschauerin aufhalten darf, die keinerlei Veränderungen vornimmt.
Bevor ein solcher Kodex zum Einsatz kommt, muss aber das nicht unerhebliche physikalische Problem gelöst werden, wie man denn überhaupt dorthin gelangen kann, wo man hinmöchte. Das ist schwierig, weil hierbei die Gravitation der Raumzeit von Belang ist, man deshalb von der Speziellen zur Allgemeinen Relativitätstheorie wechseln muss. Könnte man nämlich die Gravitation der Raumzeit hinreichend beeinflussen, dann wäre es möglich, diese Raumzeit so weit zu krümmen, dass sie möglicherweise an ihren Ausgangspunkt zurückkehrte, dass also geschlossene kausale Kurven erzeugt werden könnten, mit denen ein Weg in die Vergangenheit tatsächlich eröffnet wäre. Dafür müsste man zwar einige abenteuerliche Gedankensprünge vollführen, aber theoretisch wäre es möglich. Man darf diese Experimente aber getrost im Bereich der Theorie belassen, denn ganz praktisch wäre dazu die Erzeugung einer so astronomisch großen Energiemenge vonnöten, dass wir auf absehbare Zeit auf den Gedanken verzichten können, tatsächlich in die Vergangenheit zu reisen. Und man kann sogar mit einiger Berechtigung die absolute praktische Unmöglichkeit von Vergangenheitsreisen annehmen: Oder haben Sie schon einmal Touristen aus der Zukunft gesehen?[13]
Auch wenn solche Reisen physisch nicht zu bewerkstelligen sind, will man zumindest auf die Möglichkeit des gedanklichen Unterwegsseins ins Gestern nicht verzichten. Man betrachte nur die eindrücklich große Zahl an Menschen, die sich in sogenannten Reenactments engagieren, die also den Versuch einer Wiedererlebbarkeit von Geschichte unternehmen, indem teilweise mit tausenden Teilnehmenden römische Feldlager, mittelalterliche Märkte, Wikingerraubzüge und vor allem Schlachten aus diversen Kriegen der Weltgeschichte möglichst detailgetreu nachgestellt werden. Ganz praktisch kann es den Historiker in mir nur freuen, wenn durch solche Formen der Wissenspopularisierung (und dieser Begriff sei hier mit ausdrücklich positiver Konnotation verwendet) das Interesse und das Bewusstsein für historische Vorgänge geweckt werden. Denn Formen des Reenactments, die teils große Zuschauermengen anlocken, sind in wesentlich höherem Maß als akademische Verlautbarungen dazu in der Lage, historischen Themen in breiten Bevölkerungskreisen zur Aufmerksamkeit zu verhelfen. Der Geschichtstheoretiker in mir kann jedoch nicht umhin, den Wunsch, Vergangenes in der Gegenwart wieder lebendig werden zu lassen, zweifelnd zu betrachten. Das betrifft noch nicht einmal den naheliegenden Verdacht des Anachronismus, dass man also spätestens dann, wenn beim nachgestellten Wikingerüberfall auf die lauschig gelegene Dorfkirche das Mobiltelefon klingelt, weiß, in welcher Zeit man sich tatsächlich befindet. Nein, es sind viel eher die vermeintliche Eindeutigkeit vergangener Zustände, die Eindimensionalität des Zeitmodells und die einseitigen Verbindungen zwischen Gegenwart und Vergangenheit, die ausschließlich vom Heute dominiert werden, die an solchen Veranstaltungen Kritik aufkommen lassen müssen.
Ähnlich wie bei Reisen durch wenig bis gar nicht bekannte Räume sollte man sich also auch beim Aufbruch in andere Zeiten bei der Reisevorbereitung einige Fragen hinsichtlich der grundsätzlichen Erkenntnismöglichkeiten stellen. Denn selbst wenn sich das Problem der physischen Zeitreise lösen ließe, bliebe die Frage unbeantwortet, was man vorfände, wäre man erst einmal dort angekommen, wo man hinmöchte (abgesehen von der Frage, was in diesem Fall ›dort‹ genau heißen soll).
Jede Zeitreise, jede Entdeckungsfahrt in Richtung des großen Kontinents ›Vergangenheit‹ hat daher mit einem unüberwindlichen Paradox zu kämpfen: Anscheinend muss man immer schon wissen, was man dort vorfindet, noch bevor man sich aufmacht. Man muss ›die Geschichte‹ immer schon kennen (zumindest in ihren allergröbsten Bestandteilen), um zu wissen, was man eigentlich sucht. Neue Erkenntnisse sind dadurch nicht ausgeschlossen, bewegen sich aber eher im homöopathischen Bereich. Es geht dem Zeitreisenden so wie Christoph Kolumbus. Auch er wusste schon vor seiner Reise, wo er an ihrem Ende anlanden würde – an der Westküste Japans, um dort den großen Khan zu treffen.[14] Da jede Reise in die Vergangenheit mit einer Frage beginnt, jeder Ahnenforscher, jede Schülerin im Geschichtsunterricht, alle Menschen, die sich für die Geschichte ihrer Stadt interessieren, immer schon ein bestimmtes Problem als das ihrige benannt haben, kann (und muss) man ebenso die Frage stellen, woher sie eigentlich diese Frage haben. Wir stehen also in der Gefahr einer rückläufigen Hermeneutik, bei der die möglicherweise irritierenden Entdeckungen im Reich des Gewesenen immer an die bereits bestehenden Vorerwartungen angepasst werden.[15]
Wovon reden wir eigentlich, wenn wir von ›Geschichte‹ reden? Wenn wir uns im Zusammenhang mit dem Historischen von Gott und Gottähnlichem verabschieden wollen (und das wollen wir doch, oder?), worüber lässt sich dann mit Blick auf ›die Geschichte‹ überhaupt noch sprechen?
Wenn die Rede über ›Geschichte‹ ähnlich problematisch ist wie die Rede über ›Gott‹, dann könnte eine Geschichtskritik möglicherweise etwas von der Religionskritik lernen. David Hume – Schotte, Aufklärer und erfolgreicher Historiker – hat in seinen religionsphilosophischen Schriften (insbesondere in den »Dialogen über die natürliche Religion«) festgestellt, dass man kaum etwas halbwegs Verlässliches über Gott aussagen könne, unter anderem weil der Mensch grundsätzlich nicht dazu in der Lage sei, alle Rätsel der Welt zu lösen.[16] Und ›Gott‹ gehört nun sicherlich zu den größten Rätseln. Worüber man etwas halbwegs Verlässliches aussagen könne, so Hume, seien die konkreten Behauptungen, die im Lauf der Zeit über Gott (oder über Götter) aufgestellt wurden. Humes Taktik, nicht über Gott, sondern über die Beschreibungen Gottes zu sprechen und dadurch das Unfassbare fassbar zu machen, lässt sich auf ›die Geschichte‹ übertragen. Allerdings gelingt das nur mit der Einschränkung, nicht allzu voreilig einer Idee Humes zu folgen: Er verlegt das Problem nämlich auf die zeitliche Schiene und setzt damit eine ›Geschichte‹ voraus, die ja überhaupt erst befragt werden soll.
Auch ich muss also einen Anfang setzen, irgendwo, irgendwie, und wenn ich dabei dieses Einen-Anfang-Setzen selbst zum Problem mache, ist das kein Vorteil, schon gar keine Lösung, sondern höchstens das Eingeständnis der eigenen Unzulänglichkeit. Ich hätte mit Definitionen von ›Geschichte‹ beginnen können, mit elaborierten Auslassungen zum Historischen an und für sich und mit den standardisierten Thesen gängiger Geschichtstheorien. Dem Ratschlag Humes folgend, ist es aber wohl besser, die Totalität der ›Geschichte‹ nicht als gegeben vorauszusetzen, sondern dieses Historische (was immer es auch sein mag) indirekt anzugehen, nicht den Weg in das Zentrum, sondern den Weg über die Ränder einzuschlagen.
Wie redet man also von ›Geschichte‹, wenn vom Historischen die Rede ist? Oder ist es überhaupt zutreffend, von ›Geschichte‹ nur zu reden und zu schreiben? Sollte man ›Geschichte‹ nicht besser machen? Kann man Geschichte vergessen? Kann man sie möglicherweise anfassen, sehen, begreifen? Zuweilen wird ja auch die Frage aufgeworfen: Was ist Geschichte?[17] Vielleicht müsste diese Frage aber zutreffender lauten: Ist Geschichte überhaupt? Vielleicht wäre nicht die Frage von Interesse, was Geschichte ist, sondern wie wir Geschichte haben?
Was ich hier vorzulegen versuche, ist keine Geschichtstheorie, kein singularisiertes Nomen, das mit einem herrischen Großbuchstaben dahergeschritten kommt. Ich bin der Überzeugung, dass sich eine solche Geschichtstheorie nicht formulieren lässt. Was ich hier versuchen möchte, ist viel eher, einen Versuch zu unternehmen. Es handelt sich – im eigentlichen Wortsinn – um einen Essay, der sich auf den schwankenden Planken eines Diskussionszusammenhangs bewegt, der unter der Fahne der Geschichtstheorie segelt. Und eine der Voraussetzungen dieses Versuchs besteht in der These, dass es keine Theorie der Geschichte geben kann, auf jeden Fall nicht in diesem verdoppelten Singular: die Theorie der Geschichte. Denn so etwas anzustreben würde bedeuten, dem Gottersatz ›Geschichte‹ einen abstrahierten Überbau zu geben und der Religionsgemeinschaft eine reflektierte Theologie als Krone aufzusetzen. Eine Geschichtstheorie halte ich deswegen für wenig erstrebenswert, weil sie zunächst einmal ihren Gegenstand substantialisieren muss, bevor sie ihn behandeln kann. Sie muss zunächst davon ausgehen, dass es so etwas wie ›die Geschichte‹ gibt, bevor diese zum Gegenstand einer entsprechenden Theorie gemacht werden kann. Und vor eine solche Feststellung würde ich zunächst die Frage schieben wollen, womit wir es denn zu tun haben, wenn wir von ›Geschichte‹ reden. Jede Form der Geschichtstheorie hat mit dem Grundsatzproblem zu kämpfen, dass sie etwas zu fixieren versucht, das sich per definitionem nicht fixieren lässt.[18] Denn wenn wir etwas über das Historische zu wissen vermeinen, dann dass es sich durch Dynamik auszeichnet und ständig in Bewegung ist. Eigentlich müsste man sagen, dass alle Formen dynamischer Differenz durch und durch historisch sind, wie Jacques Derrida festgestellt hat, wenn nicht ausgerechnet dieses Wort ›Geschichte‹ für die endgültige Unterdrückung genau dieser Differenzen sorgen würde.[19] Eine singularische Theorie von ›Geschichte‹ müsste die Dinge einfrieren, um sie theoretisierbar zu machen, müsste also versuchen, den sprichwörtlichen Pudding an die Wand zu nageln. Ich aber habe keine Theorie, ich habe nur Probleme. Deshalb kann ich mich dankbar an Nietzsche anlehnen, wenn er sagt: »definirbar [sic!] ist nur Das, was keine Geschichte hat.«[20] Sich solcherart dem Vorhaben einer Geschichtstheorie zu verweigern, bedeutet aber nicht, dass man sich überhaupt nicht theoretisch zu dem Bereich äußern kann, den wir üblicherweise als ›Geschichte‹ bezeichnen. Es bestehen ausreichend Möglichkeiten zur Abstraktion, auch wenn sich diese schlussendlich nicht zu einem hübschen Paket verschnüren lassen, dessen Inhalt die systematische Antwort auf die Frage zu geben vermag, was ›die Geschichte‹ ist.
Aber es ist genau diese voraussetzungslose Voraussetzung von ›Geschichte‹, die immer wieder zum Vorschein kommt, wenn man sich an hinreichend qualifizierter und auskunftsfreudiger Stelle darüber zu informieren versucht, was denn ›die Geschichte‹ sein soll. (Und das, obwohl man doch unter anderem bei dem Philosophen Josef Mitterer lernen kann: »Am Anfang der Philosophie stehen nicht Probleme, sondern nicht-problematisierte Voraussetzungen.«)[21] Gerade in Lexika und Einführungen zu Geschichte und Geschichtswissenschaft wird beispielsweise das überwölbende Begriffsdach der ›Geschichte‹ oft gar nicht erst erwähnt. ›Geschichte‹ ist hier schon immer das Vorausgesetzte, das eigentlich zu erläutern wäre – und muss daher scheinbar nicht mehr in sich selbst vorkommen.[22] Eine andere Strategie läuft auf ein tautologisches Vorgehen hinaus, indem Geschichte mit sich selbst erklärt und mithin eine Geschichtsgeschichte vorgelegt wird.[23] Ein dritter Ansatz geht mit dem Eigentlichkeitsargument vor, identifiziert also ein bestimmtes Aufgaben- oder Themenfeld (beispielsweise ›die Politik‹ oder ›das Ereignis‹) als das eigentliche, dem sich ›die Geschichte‹ zu widmen habe.[24] Ebenfalls naheliegend scheint es zu sein, Vergangenheit und Geschichte als Ausdrücke für ein und dieselbe Sache zu verstehen. Der Historiker Volker Sellin formulierte in seiner erstmals 1995 erschienenen »Einführung in die Geschichtswissenschaft«: »Die Geschichtswissenschaft, so kann man sagen, dient der Erforschung der Vergangenheit. Die Vergangenheit ist ein wirklich abgelaufenes Geschehen, das sich ohne unser Zutun vollzogen hat, ein Meer von Tatsachen, die sich teils gleichzeitig, teils nacheinander ereignet haben. Die Ermittlung von Tatsachen erscheint demnach als eine vordringliche, vielleicht als die zentrale Aufgabe der Geschichtswissenschaft.«[25] Man könnte hieran anschließend die Frage stellen, wo sich denn das zu untersuchende, wirklich abgelaufene Geschehen befindet und wie man der zu erforschenden Tatsachen habhaft werden kann. Vor allem aber drängt sich die Frage auf: Wie kann die Geschichtswissenschaft die Vergangenheit erforschen, wenn diese vergangen und mithin nicht mehr existent ist?[26]
Gerade angesichts solcher voraussetzungslosen Voraussetzungen lohnt der Hinweis darauf, dass es alles andere als selbstverständlich ist, überhaupt eine oder genau diese Form von ›Geschichte‹ zu haben. Gemeinsam und gleichzeitig mit uns leben andere Kollektive, die sehr gut auf diejenige historische Infrastruktur verzichten können, die sich europäisch-westliche Gesellschaften leisten. Vorstellungen von zeitlichen Abläufen können sehr präsentisch ausgerichtet sein, können zwar durchaus eine Zeit vor der eigenen Zeit oder auch eine Schöpfungsgeschichte imaginieren, müssen diese aber nicht allzu weit in die Vergangenheit verlegen. Auch über die eigenen Vorfahren muss nicht viel bekannt sein, so dass man unter Umständen die eigenen Großeltern nicht mehr kennt. Aber auch wenn in anderen kulturellen Kontexten Modelle einer wie auch immer gearteten ›Geschichte‹ vorhanden sind, sollte man vorsichtig sein, diese allzu voreilig mit den eigenen Prinzipien zu identifizieren.[27]
›Geschichte‹ zu haben, ist also alles andere als selbstverständlich, ist vielmehr das eher unwahrscheinliche und kontingente Ergebnis von … was eigentlich? Würde ich die naheliegende Antwort geben und das westliche Modell von ›Geschichte‹ als Ergebnis historischer Prozesse erklären, würde ich das Entstehen von ›Geschichte‹ mit ebendieser ›Geschichte‹ begründen: Tautologie, ick hör’ dir trapsen.
»Er hat mir gesagt, daß ich falsch begonnen hätte, dass man anders hätte beginnen müssen. Meinetwegen. Ich hätte beim Anfang angefangen, stellen Sie sich das vor, wie ein altes Rindvieh. Hier ist also mein eigener Anfang. Sie werden ihn trotzdem behalten, wenn ich recht verstanden habe. Ich habe mir Mühe gegeben. Hier ist er. Er hat mich viel Mühe gekostet. Es war der Anfang, verstehen Sie. Während ich jetzt beinahe am Ende angelangt bin. Ob das, was ich jetzt mache, besser ist? Ich weiß es nicht. Darum handelt es sich auch nicht. Hier ist also mein eigener Anfang. Das muß etwas zu bedeuten haben, da sie ihn behalten. Hier ist er.«[28]
Wenn man nicht mit einer Zeitreise beginnen kann, könnte es naheliegend sein, mit dem Anfang anfangen zu wollen – nur um sich damit die Probleme einzuhandeln, die wir den Worten Samuel Becketts entnehmen können. Denn am Anfang war bekanntermaßen nicht nur das Wort. Am Anfang war auch die Zeit. Um den Anfang anfangen lassen zu können, und um dann von diesem Anfang erzählen zu können und eine Erzählung von diesem Anfang ausgehen lassen zu können, benötigt man Zeit. Und durch die Erzählung bringt man zugleich Zeit hervor. Und wenn man von diesem Anfang erzählt, dann scheint die Frage durchaus naheliegend zu sein, was die Ursuppe alles Historischen ist: Warum sind, von diesem Anfang ausgehend, die Dinge so gekommen, wie sie gekommen sind? Dass sie sich verändern, kann man anhand des alltäglichen Werdens und Vergehens plausibel nachvollziehen – aber warum so und nicht anders? Wenn man einen solchen Anfang setzt, was war dann davor? Gab es vor dem ersten Schöpfungstag oder vor dem Urknall keinen Gott, keine Materie, keinen Raum, keine Zeit? Ein anfangsloser Anfang?
Einen Anfang zu setzen, hilft einem anzufangen. Aber weil jeder Anfang eine Setzung ist, ist er auch ein Problem. Das gilt nicht nur für das Schöpfen von Welten, das gilt auch für das Erzählen von Geschichten. Indem ich anfange, habe ich bereits bestimmt, was in meiner Erzählung wesentlich sein soll. Ich habe also (m)ein Problem benannt. Und das ist ein Problem, denn durch diesen Beginn und diese Benennung habe ich ebenfalls eine endlose Anzahl anderer möglicher Anfänge und Probleme ausgeschlossen.
Mit diesem immer schon angefangenen Anfang begibt man sich hinein in das Feld der vielen Paradoxien, das den Umgang mit dem Historischen kennzeichnet.[29] Denn nicht nur für den virtuellen Zeitreisenden ergeben sich Widersprüche, die kaum aufzulösen sind. Auch für die Möchtegernzeitreisende, die ihrer Tätigkeit am Schreibtisch nachgeht, eröffnet sich ein ganzes Feld an paradoxalen Umständen, das für die Beschäftigung mit und Herstellung von Historischem möglicherweise bedeutsamer ist als die Hinweise auf die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Solche Widersprüche zeigen sich nicht nur dann, wenn wir im Historischen Antworten suchen, die gleich schon wieder historisch unterlaufen werden, oder wenn wir ›Geschichte‹ für bedeutsam erachten, auch wenn nicht mehr ganz klar ist, was sie bedeuten soll. Vielmehr sieht sich jede Auseinandersetzung mit Vergangenheit durch Paradoxien des Historischen herausgefordert, wie sie den Umgang mit abwesenden Zeiten allgemein kennzeichnen.
Nun werden Paradoxien üblicherweise als Störungen empfunden, als unzulässige Spannungen, als Hinterfragungen von Gewissheiten – und gelten genau deswegen als Probleme, die es zunächst einmal zu lösen gilt. Paradoxien scheinen üblicherweise dazu herauszufordern, den Regeln der Logik wieder zu ihrem Recht zu verhelfen.[30] Ich kann mich aber des Eindrucks kaum erwehren, dass man damit den Eigenheiten von Paradoxien nicht ganz gerecht wird. Man mag durchaus versuchen, all den Widersprüchen, Gegensätzen und Unvereinbarkeiten, von denen wir umgeben sind, mit den Mitteln der Wissenschaften beizukommen, um eine konsistente, harmonische und glatte Weltversion zu erlangen und somit zu den paradiesischen Urzuständen zurückzukehren. Man kann sich aber auch zu der Einsicht durchringen, dass Paradoxien eine ebenso allzu menschliche Angelegenheit sind wie die Mittel, mit denen man sie aufzulösen versucht. Die ersehnte Widerspruchsfreiheit würde sich dann nicht als ein Gewinn, sondern als eine Mangelerscheinung herausstellen, wenn nicht sogar als Widerspruch in sich.[31]
Gerade in Belangen, welche die Zeitlichkeit in ihren unterschiedlichen Ausformungen betreffen, wissen wir spätestens seit dem 11. Buch der »Bekenntnisse« des Augustinus, dass wir den Paradoxien nicht entkommen können; und sei es nur, weil die vermeintlich überzeitliche Lösung einer paradoxalen Situation sich ja selbst schon wieder in einem zeitlichen Zusammenhang befindet. In dem Moment, in dem wir versuchen, ›in der Geschichte‹ Antworten auf bestimmte Fragen zu finden, werden diese Antworten durch ebenjene ›Geschichte‹ nicht nur schon wieder in Frage gestellt, sondern die gesamte historisch-fragende Vorgehensweise sieht sich in Zweifel gezogen. Sehen wir genau hin, dann sind die Paradoxa, die uns das Feld des Historischen präsentiert, dazu in der Lage, unser logisch-rationales Selbstverständnis zu destabilisieren. Genau deswegen, weil sie Zweiwertigkeiten in Frage stellen und zwischen der Wirklichkeit und der Unmöglichkeit oszillieren, sind Paradoxien keine Probleme, die es, wenn möglich, zu vermeiden oder zumindest aufzulösen gilt, sondern hilfreiche Mittel, um die glatt wirkende, weil nicht hinreichend bedachte Oberfläche in Frage zu stellen, die wir üblicherweise ›Wirklichkeit‹ zu nennen pflegen.[32]
Solche Paradoxien des Historischen sollen dabei helfen, einen roten Faden durch dieses Buch zu weben und eine essayistische Argumentation zusammenzuhalten, die den Gang über die Ränder hinein in das Zentrum der Probleme wagt. Dabei steht am Beginn die Frage, wie man etwas behandeln kann, das überhaupt nicht existiert: Wie soll man eine Vergangenheit zum Thema machen, die sich vornehmlich dadurch auszeichnet, vergangen zu sein? Dass dies auf recht überzeugende Weise gelingt, wird man kaum bestreiten können. Schließlich betrachten wir mit Fug und Recht dasjenige, was wir mit dem Namen ›Geschichte‹ belegen, nicht als Märchen, sondern als Geschehen, das tatsächlich stattgefunden hat. Obwohl es wenig Anlass gibt, an der Tatsächlichkeit des Geschehenen zu zweifeln, lässt sich das gleichzeitige Vorhandensein und Nichtvorhandensein von Vergangenheit nicht so einfach wegerklären. Es ist diese anwesende Abwesenheit des Vergangenen, die den Ausgangspunkt dieses Essays markiert – also die Einsicht, dass das Historische nicht durch das vielzitierte Gespräch mit den Toten geprägt ist, sondern eher durch ein Gespräch mit Totenmasken.
Weil jede Form des Historischen notwendigerweise immer schon in sich selbst vorkommen muss, bekommt man es auch schwer zu greifen, ist es immer durch seinen eigenen Entzug gekennzeichnet, so dass jede Form der Geschichtstheorie von einer Negation bestimmt ist: Es lässt sich vor allem sagen, was das Historische nicht ist. Vom vergangenen Geschehen können wir nur mit Sicherheit sagen, dass es sich exakt nicht so abgespielt hat, wie wir es heute zur Darstellung bringen. Dessen immerhin können wir sicher sein. Ein möglicher Verweis auf das historische Material, also auf die gemeinhin und etwas missverständlich so bezeichneten ›Quellen‹, hilft in diesem Dilemma kaum weiter, zumindest nicht, wenn man dieses Material in die dichotomische Entgegensetzung von Gegenwart und Vergangenheit einspannt. Vielmehr gilt es, die Materialität des Historischen zu betonen, also die materielle Ermöglichung einer Geschichte, die wir dem Übriggebliebenen nur zu entnehmen meinen. Das führt uns zu einem weiteren Paradox, dass nämlich dieses Material zwar der Vergangenheit entstammt, aber weder diese Vergangenheit ist noch den Weg dorthin weist. Es ist vielmehr auf vielfältige und aktive Weise an den komplexen Relationen beteiligt, die zwischen anwesenden und abwesenden Zeiten geknüpft werden. Damit rückt der mediale Charakter des historischen Materials in den Vordergrund. Diese Medialität reduziert sich nicht auf eine Vermittlung zwischen Vergangenheit und Gegenwart, sondern muss erfasst werden als Konstitution eines Historischen, bei dem sich die Medien erfolgreich darum bemühen, unsichtbar zu bleiben.
Mit Blick auf den nicht ganz unproblematischen Wirklichkeitsstatus des Historischen spielen Medien und Materialien eine wesentliche Rolle. Sie sind nämlich nicht nur verantwortlich für die Erzeugung einer historischen Wirklichkeit, die ihren Produktcharakter erfolgreich zu verbergen vermag. Unser Umgang mit dem aus der Vergangenheit Übriggebliebenem erzeugt auch ein Möbiusband der historischen Wirklichkeit: Wir sind permanent damit beschäftigt, unsere eigene Wirklichkeit zu historisieren, um nicht zuletzt zu der Einsicht zu gelangen, dass Historisierung ein wesentlicher Faktor unserer Wirklichkeitsproduktion ist.
Nun könnte man versucht sein, den bisher genannten und allen weiteren Paradoxien dadurch zu entkommen, dass man sie argumentativ so lange bereinigt, bis nur noch ein ›eigentliches‹ Element, gar ein Fundament übrig bleibt. Ich möchte hingegen die Bedeutung von Relationen hervorheben, mit denen man nicht nur dualisierenden Argumentationsweisen entkommen kann, sondern mit denen sich vor allem die konstitutive Bedeutung solcher Bezugnahmen (nicht nur, aber gerade auch) im Bereich des Historischen verdeutlichen lässt. Als Kernstück meiner Argumentation hebe ich daher die Chronoferenz als diejenige Relationierung hervor, mit der anwesende und abwesende Zeiten gekoppelt, Vergangenheiten und Zukünfte mit Gegenwarten verknüpft werden können.
Mit Hilfe solcher Chronoferenzen lassen sich die Paradoxien des Historischen nicht zum Verschwinden bringen, sie werden jedoch verständlich und behandelbar, vor allem werden sie in ihrer ganzen Produktivität sichtbar. So konstituiert sich das Ereignis als historische Grundlagenkategorie – nicht minder paradox – immer erst im Nachhinein. Es kann immer erst zum Ereignis werden, nachdem es sich ereignet hat – und mithin eigentlich schon ein Nicht-Ereignis ist. Eingebettet in Chronoferenzen erweist sich das Ereignis aber vor allem als Zeit-Ort, an dem das Verhältnis von anwesenden und abwesenden Zeiten verhandelt und auch immer verändert werden kann. Auch das Archiv ist auf seine Weise ein solcher Zeit-Ort. Hier wird entschieden, welche ›Ereignisse‹ in den langfristigen Überlieferungskreislauf eingespeist werden, und hier wird auch zum Zweck kultureller Gedächtnissicherungen Material in erheblichem Umfang aussortiert und vernichtet. Das Archiv erweist sich daher als ein Ort, an dem Chronoferenzen konkret werden. Hier wird nicht nur jeweils entschieden, welche dokumentierte Vergangenheit wir zukünftig noch besitzen werden, sondern diese Entscheidung ist für jede Gegenwart zu früheren Zeiten immer schon getroffen worden.
Dass historisches Arbeiten ganz generell ein Problem mit dem eigenen Wahrheitsanspruch hat, machen die zahlreichen und kaum einmal verebbenden Diskussionen um die historische Wahrheit deutlich. Mit einem korrespondenztheoretischen Wahrheitsmodell ist im Fall der Vergangenheit auch kaum weiterzukommen, die sich wesentlich dadurch auszeichnet, vergangen zu sein. Muss man also die Wahrheit aufgeben? Wohl kaum. Vielleicht genügt ja der Anspruch, wahre Geschichten vorzulegen, die in der Relationierung von anwesenden und abwesenden Zeiten Bedeutungsknoten fixieren und damit einen Stand der Dinge präsentieren können, der sich gegenwärtig noch nicht verändern lässt. Diese Wahrheiten fallen aber weder vom Himmel noch wachsen sie aus dem Boden. Sie sind gerade angesichts der anwesenden Abwesenheit von Vergangenheit das Ergebnis einer Beschreibung. Eingezwängt in eine unauflösliche Paradoxie von Fakten und Fiktionen, in das anregend-schillernde und ambivalente Spiel einer Darstellung vergangener Ereignisse, Verhältnisse und Vorgänge, bei der nur eines unumstößlich feststeht, dass diese Vergangenheit sich nämlich mit Sicherheit nicht so abgespielt hat, wie wir sie heute beschreiben – eingezwängt also in dieses begrüßenswerte Dilemma erweist sich die historische Beschreibung als Mittel, um eine vergangene Wirklichkeit erstmals zu ver-wirklichen, die immer schon wirklich war. Viel realistischer können historische Darstellungen auch kaum werden, weil der unausgesprochene Wunschtraum der vollständigen geschichtswissenschaftlichen Erfassung einer vergangenen Situation nichts anderes wäre als der Höhepunkt der Fiktionalisierung.
Zudem wäre historisches Arbeiten eindeutig missverstanden, wollte man es allein auf die eine und einzige Wirklichkeit verpflichten. Das würde die latenten Möglichkeiten unberücksichtigt lassen, die im Historischen schlummern und die uns immer wieder Geschichten bereitstellen, von denen wir heute noch gar nicht ahnen, dass sie morgen schon Teil unserer Vergangenheit sein können. Weil Vergangenheit damit ähnlich unvorhersehbar wird wie die Zukunft, eröffnen sich auch Möglichkeiten der Kritik. Dieses kritische historische Verständnis kann sich aber nicht darauf beziehen, der Vergangenheit in der Richterrobe gegenüberzutreten und ihr vorzuhalten, wie sie besser hätte sein sollen. Kritik kann sich aber auf die Chronoferenzen beziehen, die jeweils zwischen anwesenden und abwesenden Zeiten etabliert werden – vor allem in der jeweils eigenen Gegenwart.
Mit der Konstitution von und Kritik an Chronoferenzen gehen erhebliche Verantwortungen einher, tritt also eine Ethik des Historischen in Erscheinung. Denn Chronoferenzen zu etablieren bedeutet, für die Konsequenzen, die sich aus bestimmten Bezugnahmen zwischen anwesenden und abwesenden Zeiten ergeben, auch Rechenschaft zu übernehmen. Es heißt aber zugleich, die abwesenden Zeiten nicht weniger komplex zu behandeln, als man selbst behandelt werden will. Um diese Komplexität im Verhältnis der Zeiten mit all ihren Verzeitungen beschreibbar zu machen, schlage ich den Begriff der Zeitschaft vor. Zeitschaft bezeichnet das Konglomerat der vielfältigen Chronoferenzen, das in einem bestimmten kulturhistorischen Zusammenhang vorhanden ist, verweist auf die grundsätzliche Ungleichzeitigkeit einer Gegenwart mit sich selbst und soll nicht zuletzt eine Alternative darstellen zu immer noch dominierenden linearen Zeitvorstellungen. Mit der Zeitschaft könnten wir uns tatsächlich verabschieden von einer ›Geschichte‹ als Gottersatz.
Vergangenheit
Wir brauchen die Vergangenheit nicht zu zerstören: sie ist fort; jeden Augenblick könnte sie wiederkehren, Gegenwart scheinen und sein. Wäre es eine Wiederholung? Nur wenn wir dächten, wir besäßen sie, aber da wir’s nicht tun, ist sie frei und wir ebenso.
John Cage[1]
Beschreibungen astronomischer Phänomene in weit entfernten Galaxien folgen einer ganz eigenen Rhetorik. Seit es für Weltraumteleskope möglich ist, Aufnahmen von bisher unbekannter Qualität aus den entferntesten Ecken des Universums zur Erde zu übermitteln, erreicht die Poetik der Beschreibungen von planetarischen Nebeln, Supernovas oder Exoplaneten eine neue Qualität. Das Schwärmen in Farben, die im wörtlichen Sinn nicht von dieser Welt sind, die Häufung metaphorischer Beschreibungen (Weiße Löcher, Blaue Riesen, Dunkle Materie), die Bezeichnung von Sternenkonstellationen, die teils der antiken Mythologie, teils einem nüchternen Katalogisierungssystem entstammen – all das hat eine ganz eigene Textgattung hervorgebracht.
Ein wesentlicher Bestandteil dieser Astropoetik sind die schier endlosen zeitlichen Dimensionen, die nur noch in Millionen und Milliarden von Lichtjahren beziffert werden können und die jede menschliche Vorstellungskraft übersteigen. Frappierend sind diese Zeitangaben, weil alles, was wir hier auf Erden von den Sternen sehen können und was uns von den Weltraumteleskopen übermittelt wird, bekanntermaßen nichts ist als Licht – sehr altes Licht, das einen sehr langen Weg und damit auch sehr viel Zeit hinter sich gebracht hat.[2]
Auch wenn wir es mit Zeitdimensionen gänzlich anderer Größenordnung zu tun haben, so scheint es doch die eine oder andere Parallele zwischen Astronomie und Geschichtsschreibung zu geben. Auch Sternengucker haben es offensichtlich nicht mit aktuellen, sondern mit teils unfassbar alten Zuständen zu tun. Die Gegebenheiten im Universum, die uns hier und heute als gegenwärtig erscheinen, gehören einer Vergangenheit an, die in dieser Form nicht mehr existiert. Astronomie und Geschichtswissenschaft beschäftigen sich also mit Phänomenen, die in der Gegenwart wahrgenommen werden, aber in der Vergangenheit geschehen sind. Das bietet nun insbesondere für Zeitreisende ungeahnte Möglichkeiten. Schon ein Blick ins All könnte genügen, um sie dort tatsächlich zu sehen: die Vergangenheit! Das Universum könnte der einzige, dafür aber unendlich große Raum sein, in dem wir dieser Vergangenheit tatsächlich ansichtig werden können: die Reise in outer space als Bewegung back in time.
Jede Beschreibung unserer eigenen oder einer der unzählbar vielen anderen Galaxien müsste daher konsequent in der Vergangenheitsform gehalten sein. Was dort jeweils durch bildgebende Verfahren zum Vorschein gebracht wird, ist nicht, sondern war einmal. Ebenso konsequent müsste jede Beschreibung ihre eigene Standortgebundenheit zum Thema machen, müsste also immer unterstreichen, dass sie von einer staubkorngroßen Erde unter bestimmten perspektivischen Voraussetzungen vorgenommen wird. Wir sehen also nicht das Weltall von irgendwo anders her, sondern wir erstellen Modellierungen des Universums, die unserem irdischen Kenntnisstand entsprechen. Betrachtet man den Duktus astronomischer Beschreibungen, funktionieren diese aber durchaus anders. Sie sind zumeist im Präsens gehalten und nehmen nicht selten eine Art gottgleicher Perspektive ein, die ›von außen‹ auf die Zustände schaut. Aber wo sollte dieses Außen sein? Und wann ist das Jetzt, von dem da beständig die Rede ist?
Den Blick in den Abendhimmel als Reise in die Vergangenheit zu verstehen, stellt sich letztlich als eine anthropozentrische Sicht der Dinge dar, bei der man sich eigentlich auf die kleinen menschlichen Fingerchen klopfen müsste, weil mal wieder alles und jedes auf den Homo sapiens mit all seinen Unzulänglichkeiten gebündelt wird. Was soll denn beispielsweise eine Reise ins Weltall bewirken – wo wir doch schon längst da sind und auf unserer blauen Murmel in diesem Universum herumschwirren? Und was soll es heißen, dass wir beim nächtlichen Blick an den Himmel in die Tiefen der Vergangenheit sehen können? Sehen wir tatsächlich den vergangenen Zustand erloschener Sterne – oder erblicken wir nicht vielmehr das Licht als Medium, das den Raum durchquert hat und nun in unserer Gegenwart für uns eine bestimmte Bedeutung gewinnt? Sehen wir also tatsächlich in die Vergangenheit hinein? Oder sehen wir, wie die Vergangenheit zu uns kommt?[3]
Nicht nur Außenstehende, sondern auch manche Angehörigeder historischen Zunft sollen ja tatsächlich zu der Ansicht neigen, der Gegenstand der Geschichtsschreibung sei die Vergangenheit. Das ist natürlich Unsinn. Ohne Zweifel richtet sich das historische Interesse auf Geschehnisse der Vergangenheit, auf die Beschaffenheit früherer Gesellschaften oder auf das Leben untergegangener Kulturen. Aber eigentliche Gegenstände der historischen Forschung können diese und viele andere Aspekte nicht sein – einfach deswegen, weil sie nicht mehr existieren. Wenn sich die Geschichtsschreibung daher nicht mit der Vergangenheit beschäftigen kann, weil diese nun einmal unweigerlich vergangen ist, dann unterscheidet sich die historische Forschung von allen anderen Wissenschaften dadurch, dass sie sich mit dem beschäftigt, was es nicht (mehr) gibt.[4]
Um dieses Dilemma zu umgehen, werden Hilfsmittel benutzt, die es ermöglichen sollen, die nicht mehr vorhandene Vergangenheit zu vergegenwärtigen. Es sind Hilfsmittel wie Texte, Bilder, Gebäude, Zeitzeugen oder Dinge, die den eigentlichen Gegenstand historischer Arbeit bilden.[5] Es sind diese Krücken, mit denen Historiker mehr oder weniger geschickt versuchen, in die Vergangenheit zu humpeln – um dann immer wieder festzustellen, dass das Material ihnen unüberwindbare Grenzen auferlegt, dass sie nicht weiter kommen als bis in die Räumlichkeiten von Archiven, Bibliotheken und Museen oder bis zu den Aussagen von Überlebenden. Die Vergangenheit mag für manche ein Sehnsuchtsort sein. Zu erreichen ist er nicht.
Historisches Arbeiten, unabhängig davon, ob es sich in akademischen oder anderen Kontexten bewegt, hat es demnach nicht mit einer ›Vergangenheit als Vergangenheit‹ zu tun, sondern mit einer gegenwärtigen beziehungsweise vergegenwärtigten Vergangenheit.[6] Damit handelt es sich bei dieser Vergangenheit um etwas entscheidend anderes als das, was einst tatsächlich geschehen ist.
Schlechte Karten also für alle Möchtegern-Zeitreisenden, denn der Weg ist versperrt: Wie soll man auch an ein Ziel gelangen, das es nicht mehr gibt? Diese Einsicht hat aber auch ihr Gutes, weil sie einer potentiellen Gefahr und einem gerne kolportierten Vorurteil entgegenwirkt, dass sich nämlich alle historisch Interessierten in der Vergangenheit verlieren könnten: Lauter Don Quijotes, die sich in ein idealeres Gestern hineinphantasieren. Nun kann man sich aber schwerlich in etwas verlieren, das nicht mehr vorhanden ist. Man müsste im Gegenteil davon sprechen, dass das Interesse am Gestern nicht nur einem spezifischen Interesse am Heute entspringt, sondern insgesamt ein sehr gegenwärtiges ist – dass es sich bei der Geschichtswissenschaft also um eine Gleichzeitigkeitswissenschaft handelt. Don Quijote ist nicht nur deswegen eine sehr gegenwärtige Figur, weil er unter seinen Zeitgenossen große Aufmerksamkeit erregte und zu erheblicher Bekanntheit gelangte, sondern weil er seine ›Zeitgenossen‹ auf ihre ›Zeitverhältnisse‹ aufmerksam machte. Er führte ihnen vor Augen, wie sie sich in ihrer Gegenwart zur Vergangenheit verhielten (indem sie beispielsweise Ritterromane in gesundheitsgefährdender Zahl konsumierten).
›Geschichte‹ zu haben, ›Geschichte‹ zu betreiben, ›Geschichte‹ zu machen und ›Geschichte‹ zu erforschen kommt nicht der Reise in einer Zeitmaschine gleich, eben weil der Gegenstand all dieser Praktiken nicht die Vergangenheit ist. Das wird auch deutlich anhand der historischen (nicht physikalischen) Wurmlöcher, die wir zu bohren versuchen, um in einer anderen Zeit anzukommen. Das Bohren kann man dabei durchaus wortwörtlich nehmen. Wenn beispielsweise die Tiefen der Gletscher oder des arktisch-antarktischen Eises daraufhin untersucht werden, wann sich welche klimatischen Veränderungen vollzogen haben; wenn die Entdeckung von Dinosaurierskeletten, die Millionen von Jahren alt sind, nicht nur die Erkenntnisse über die Geschichte des Lebens auf unserem Planeten verändert, sondern auch unmittelbar zu verlebendigenden Rekonstruktionen im Naturkundemuseum führen; wenn der als Ötzi bekannten Gletschermumie aus der Jungsteinzeit eine ganze Biographie zugeschrieben werden kann – dann müssen wir doch den berechtigten Eindruck haben, hier einen zumindest ausschnitthaften Blick in die Vergangenheit erhaschen zu können. Aber ebenso wie beim Sternenlicht, das endlose Lichtjahre unterwegs war, um uns vom vergangenen Zustand des Universums zu künden, dürfen wir weder die Bewegungsrichtung noch unsere eigene Beobachtungsposition übersehen. Es sind nicht nur wir, die wir uns früheren Zeiten interessiert zuwenden, sondern es sind ebenso die Überbleibsel aus früheren Zeiten, die auf uns zukommen. Und diese Überbleibsel kommen abgetrennt von ihrem ursprünglichen Zusammenhang auf uns zu – um durch uns in einen neuen Zusammenhang gestellt zu werden. Insofern ist die Frage nicht nur, was uns das aus der Vergangenheit Überkommene über diese Vergangenheit sagen kann, sondern ebenso, wie wir dieses Überkommene in unserem Hier und Jetzt einsortieren und mit Bedeutung versehen.
Nicht anders verhält es sich mit der sehr alltäglichen und sehr individuellen Form der Geschichtsschreibung, die wir alle beständig betreiben und die üblicherweise unter dem Stichwort ›Erinnerung‹ firmiert. Dass das menschliche Gedächtnis kein Speicher ist, in dem bestimmte Vorgänge einfach abgelegt werden, müssen nicht erst Neurobiologie und Neurophysiologie wissenschaftlich belegen. Jede und jeder kann das im tagtäglichen Selbstversuch feststellen. Eine konkrete und vor allem auch zuverlässige Assoziation einer Erinnerung mit einem vergangenen Zustand durch unser Gedächtnis ist keineswegs selbstverständlich. Vielmehr hat die Gedächtnisforschung gezeigt, dass Erinnerungen deshalb mit Zuständen oder Vorkommnissen der Vergangenheit in Zusammenhang gebracht werden, weil sie gleiche oder ähnliche Qualitäten haben wie diejenigen Bewusstseinsinhalte, in denen bereits vollendete Handlungen noch gegenwärtig sind. Das Verhältnis von Vergangenheit und Erinnerung lässt sich geradezu umkehren: »Nicht Erinnerungen entstammen der Vergangenheit, sondern die Vergangenheit (als Wirklichkeitsbereich eigener Art) verdankt sich der Erinnerung und Erinnerungselaboration.«[7] Geschichtsschreibung hat also eigentlich nichts mit Erinnerung zu tun (oder wie will man sich an Karl den Großen oder an die Französische Revolution erinnern?). Sie hat nur etwas zu tun mit der Auseinandersetzung mit überliefertem Material – zu dem wiederum Erinnerungen gehören können.
Was aber kann die Vergangenheit dann für die historische Beschäftigung sein? Welchen Stellenwert kann eine Vergangenheit haben, die uns nicht mehr zur Verfügung steht? Alles Märchen und Erfindungen? Möglicherweise ist die Einsicht in die Unverfügbarkeit des Vergangenen weniger dramatisch, wenn man den Blick in die andere Zeitrichtung lenkt. Denn in geschichtstheoretischer Hinsicht sind Zukunft und Vergangenheit nicht gar so verschieden, weil es sich in beiden Fällen um Zeiträume handelt, die uns nicht unmittelbar zur Verfügung stehen. In beiden Fällen versuchen wir mittels unterschiedlicher Kulturtechniken, wie Erzählungen, Archivierungen, Prognosen etc., eine einigermaßen adäquate Version dieser abwesenden Zeiten zu erstellen. Beide Zeiträume weisen daher einen essentiellen Bezug zu unserer eigenen Gegenwart auf: Es handelt sich jeweils um gegenwärtige Vergangenheiten und gegenwärtige Zukünfte.[8]
Einen entscheidenden Unterschied gibt es natürlich in der Charakterisierung von Vergangenheit und Zukunft als Zeiträumen, mit denen wir uns gegenwärtig beschäftigen: Aus der Vergangenheit ist uns wesentlich mehr Material überliefert. Nicht nur Archive, Bibliotheken und Museen, sondern auch der Erdboden unter unseren Füßen, die Jahresringe von Bäumen oder der heimische Dachboden sind angefüllt mit Tradiertem, das es uns erlaubt, ein Bild von der Vergangenheit zu entwerfen. Mit Blick auf die Zukunft ist das nicht so – oder scheint nicht so zu sein. Denn wenn es stimmt, dass jede Gegenwart ihre eigene Zukunft entwirft, dann sind auch in der Vergangenheit zahlreiche solcher Zukunftsentwürfe enthalten.[9] Zugleich rekurrieren wir in einer Gegenwart immer auf die Vergangenheit, um Modelle der Zukunft zu erstellen, extrahieren beispielsweise aus Daten vergangener Jahre und Jahrzehnte wahrscheinliche Entwicklungen für künftige Ereignisse: beim Wetter, bei Börsengeschäften oder bei demographischen Entwicklungen.
Wenn die Vergangenheit nicht Gegenstand der Geschichtsschreibung sein kann, weil sie nun einmal vergangen ist, dann bedeutet das nicht, dass das Vergangene niemals stattgefunden habe, und es bedeutet auch nicht, dass diese Vergangenheit nichts mehr mit uns zu tun habe (denn das ist die fatale Illusion der Geschichtsverächter, die meinen, es handele sich nur um alten Kram – vielmehr handelt es sich um sehr aktuellen alten Kram). Dass wir Vergangenheit ›haben‹ und die Vergangenheit uns ›hat‹, lässt sich kaum bezweifeln. Aus historischer Perspektive stellt sich daher vor allem die Frage, wie wir Vergangenheit haben.
In diesem Zwischenraum zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen gestrigem Geschehen und heutiger Beschreibung passiert offensichtlich etwas Entscheidendes. Es lässt sich nicht eindeutig fassen in dem Sinn, dass man sagen könnte, es handele sich zweifelsfrei um ›die Vergangenheit‹ oder um ›die Gegenwart‹. Es ist offensichtlich etwas Drittes – aber was? Was ist dieses Zwischen, das sich zwischen den Zeiten ereignet?
Wenn sich die Vergangenheit in dieser Weise als problematisch herausstellt und nicht Gegenstand der historischen Beschäftigung sein kann, dann könnte eine naheliegende Lösung darin bestehen, die Angelegenheit umzukehren und das Hier und Jetzt zum eigentlichen Objekt historischer Bemühungen zu erklären. Das Licht, das von anderen Sternen zu uns dringt, ist einerseits immer unterschiedlich alt – in manchen Fällen erst seit wenigen Minuten oder Stunden, in anderen seit Jahrmillionen unterwegs –, andererseits aber immer nur genau zu dem Zeitpunkt sichtbar, an dem es gesehen wird. Ähnlich ließe sich jede Vergangenheit als eine grundsätzlich präsentische Angelegenheit verstehen. Historische Arbeit wäre letztlich eine Gegenwartsvergewisserung, wäre die Fundierung eines Hier und Jetzt mit freundlicher Unterstützung des Gewesenen.
Gerade zu Beginn des 21. Jahrhunderts lassen sich gewichtige und gehaltvolle Bemühungen erkennen, ein solches Verständnis von der Gegenwärtigkeit des Vergangenen auch theoretisch zu etablieren. In einer inzwischen recht ausgefeilten Diskussion um den Begriff der Präsenz wird von Autoren wie Hans Ulrich Gumbrecht, Eelco Runia oder Frank Ankersmit versucht, für die allgemeine kulturwissenschaftliche wie auch für die geschichtstheoretische Diskussion einige Entwicklungen zu korrigieren, die sich im Kontext postmoderner und poststrukturalistischer Ansätze ergeben haben. Eine Unmittelbarkeit der Erfahrung von Vergangenheit soll wieder möglich gemacht werden, wie sie nach Jahrzehnten elaborierter theoretischer Diskussionen verlorengegangen zu sein scheint. In Abgrenzung zu Stichworten wie Konstruktion, Diskurs oder Narration soll Vergangenheit wieder unmittelbarer erfahrbar gemacht werden, soll ›der Geschichte‹ wieder zu einer Form der Präsenz verholfen werden. Der Präsenzbegriff soll einen unvermittelten Zugang zu den Dingen und Geschehnissen dieser Welt ermöglichen, der nicht mehr hinter den theoretischen Wortungetümen abstrakter Formulierungen versteckt werden kann. Und dieses Bemühen um Präsenz betrifft nicht nur die Gegenwart, sondern ebenso die Gegenwärtigkeit der Vergangenheit.[10]
Eher wenig erfreut scheint der französische Historiker François Hartog bei seiner Analyse der Historizitätsregime von solchen Präsenzeffekten zu sein. Unter Historizitätsregimen versteht er die Modalitäten, mit denen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft einander zugeordnet werden. In diesem Sinne unterscheidet Hartog ein altes (Historizitäts-)Regime (also ein Ancien Régime im wortwörtlichen Sinn), in dem die Vergangenheit die vorherrschende Kategorie war, von einem modernen Historizitätsregime der Zukünftigkeit, in dem das Kommende zum Orientierungsmaßstab wurde. Und auch wenn wir laut Hartog dieses moderne Historizitätsregime noch keineswegs hinter uns gelassen haben, gibt es doch mehr als nur ein paar Hinweise, dass wir derzeit Zeugen einer erneuten Umstellung sind. Denn die Zukunft kann nichts mehr versprechen, weil Modernisierungstheorien obsolet geworden sind. Zudem rückt sie immer näher an die eigene Gegenwart heran, weil beispielsweise im Zusammenhang von Klimadebatten das Ende der Welt wieder vorstellbar wird. Damit drängt ein anderes Deutungsmuster in den Mittelpunkt: Als das zeitgenössisch dominierende Historizitätsregime hat Hartog eine omnipräsente Gegenwärtigkeit ausgemacht, die er unter dem Begriff des Präsentismus fasst und in ihren konkreten Auswirkungen keineswegs willkommen heißt.[11]
Ist natürlich nur die Frage, was die Vergangenheit dazu sagen würde (wenn sie könnte). Die Schwierigkeit solcher gegenwartszentrierter Verständnisse ist, dass die Vergangenheit darunter zu verschwinden droht, weil sie nur noch Steigbügelhalterin eines jeweils aktualisierten Selbstverständnisses wäre und so gut wie keinen Eigenwert mehr besäße. Dieser Eigenwert sollte doch gerade darin bestehen, weder etwas gegenwärtig und unmittelbar Erfahrbares zu sein noch in der völligen Fremdheit vergangener Unzugänglichkeit aufzugehen. Ist denn nicht gerade das der Reiz des Historischen, nicht mehr eindeutig der einen oder der anderen Seite zugeordnet werden zu können, also weder ›die Vergangenheit‹ noch ›die Gegenwart‹ zu sein? Erweist es sich nicht als etwas Drittes, als ein Zwischenreich, das in einem sehr wörtlichen Sinn den Raum zwischen den gegenwärtigen und den vergangenen Zeiten einnimmt?
Ich würde hier ein Paradox bemühen, von dem ich behaupte, dass es für alles, was mit dem Historischen zu tun hat, von zentraler Bedeutung ist. Denn ganz allgemein ist dieses Historische als der Ort, an dem das Verhältnis von Gegenwart und Vergangenheit verhandelt wird, in hohem Maße paradoxal besetzt: Obwohl die Vergangenheit nicht den Gegenstand historischer Bemühungen abgeben kann, berichtet die historische Arbeit ständig davon – befasst sich also mit etwas, das einmal war und nicht mehr ist. Dieses einmal Gewesene wird nur noch dadurch erfahrbar, dass jeweils gegenwärtig davon erzählt wird. Historisches Arbeiten sieht sich also konfrontiert mit einer anwesenden Abwesenheit.[12]
Genau darin manifestiert sich sowohl das Gespenstische und Ungreifbare wie auch das theoretisch immer wieder Problematische im Umgang mit der Vergangenheit und ihrer historischen Verarbeitung. Alle, die sich mit der Vergangenheit als dem Historischen beschäftigen, verhalten sich ein wenig wie Wladimir und Estragon in Samuel Becketts »Warten auf Godot«: Sie hoffen auf eine Vergangenheit, die niemals zu erreichen sein wird, die aber als Sinnstifterin in der eigenen Gegenwart unverzichtbar ist. Wenn diese Vergangenheit auch niemals ist, so ist sie doch immer da – ähnlich wie Godot, der niemals kommt, aber als Erwarteter immer schon gegenwärtig ist. Weit davon entfernt, damit eine Grundhaltung der Hoffnungs- und Sinnlosigkeit zu verbinden, kann man von Wladimir und Estragon auch lernen, wie man im Angesicht dieser anwesenden Abwesenheit das Historische hervorbringt: Indem man gegenwärtig an dem Zeitgerüst arbeitet, mit dem sich zwischen Vergangenheit und Zukunft unterscheiden lässt.[13] Denn wie Estragon sagt: »Man tritt nicht zweimal in denselben Dreck.«[14]
Will man sich daher nicht auf die Seite der Geschichtsverächter schlagen und behaupten, dass die Vergangenheit für uns keine Rolle mehr spiele und spielen könne, weil sie nun einmal vergangen sei (ohne dann allerdings erklären zu können, warum wir uns beständig auf das beziehen, was angeblich vergangen und irrelevant ist), und will man auch nicht behaupten, dass Vergangenheit nur Gegenwart sei, nur unmittelbare Erfahrung und ausschließlich den Interessen des Hier und Jetzt unterworfen (ohne dann erklären zu können, wie diese Vergangenheit in der Gegenwart immer wieder ein irritierendes und unvorhergesehenes Eigenleben entwickelt), dann bleibt einem wohl nicht viel anderes übrig, als sich zwischen die Stühle zu setzen. Beide Seiten hätten dann sowohl recht als auch unrecht. Selbstverständlich ist die Vergangenheit vergangen – und gegenwärtig. Und genau diese Zwischenstellung einer anwesenden Abwesenheit, einer Absenz in Präsenz, macht ein wesentliches Charakteristikum dessen aus, was wir als das Historische bezeichnen können.[15] Obwohl die vergangenen Geschehnisse zum Teil schon sehr lange her sind, gehen sie uns offensichtlich immer noch etwas an; obwohl die Ereignisse vergangen sind, haben sie noch immer etwas mit unserer Gegenwart zu tun; obwohl die Menschen schon längst tot sind, sind sie immer noch ein Teil von uns; obwohl Entwicklungen schon längst abgeschlossen sind, können sie immer noch unmittelbar aktuelle Auswirkungen haben. Fragt man mithin nach dem ontologischen Status des Historischen, stellt sich dieser als nicht gerade einfach dar. Vielfach wird in der Beschäftigung mit dem Historischen immer noch etwas praktiziert, das man als ontologischen Realismus bezeichnen kann, als Suche nach dem wirklichen Geschehen und der historischen Wahrheit. Dabei haben wir es viel eher mit einer latenten Ontologie zu tun, mit einem Historischen, das gleichzeitig ist – und nicht ist.
Es ist eine Aufspaltung, mit der wir ganz selbstverständlich leben, diese Gegenüberstellung von Gegenwart und Vergangenheit. Wir scheinen diese Trennung zu benötigen, um bestimmte Phänomene und Probleme in gewesene Zeiten abschieben zu können, um sie gewissermaßen zu entsorgen, da sie für uns zwar noch von Bedeutung sind, aber nicht mehr als unmittelbar relevant und lösungsbedürftig erscheinen. Zugleich erscheint es möglich, die Dinge im Nachhinein klarer zu sehen, die nötige Distanz zu gewinnen, einen Umstand angemessener beurteilen zu können. In Thomas Manns Erzählung »Unordnung und frühes Leid« gibt Doktor Cornelius, seines Zeichens Professor für Geschichte, diesem Antagonismus treffenden Ausdruck: »Er weiß, daß Professoren der Geschichte die Geschichte nicht lieben, sofern sie geschieht, sondern sofern sie geschehen ist; daß sie die gegenwärtige Umwälzung hassen, weil sie sie als gesetzlos, unzusammenhängend und frech, mit einem Worte, als ›unhistorisch‹ empfinden, und daß ihr Herz der zusammenhängenden, frommen und historischen Vergangenheit angehört. Denn über dem Vergangenen, so gesteht sich der Universitätsgelehrte, wenn er vor dem Abendessen am Flusse spazierengeht, liegt die Stimmung des Zeitlosen und Ewigen, und das ist eine Stimmung, die den Nerven eines Geschichtsprofessors weit mehr zusagt als die Frechheiten der Gegenwart. Das Vergangene ist verewigt, das heißt: es ist tot, und der Tod ist die Quelle aller Frömmigkeit und alles erhaltenden Sinns.«[16]
Es gibt ja nun zahlreiche Gegenstände, mit denen sich die Geschichtswissenschaft in der einen oder anderen Weise, mehr oder weniger theoretisch, immer wieder beschäftigt. Dazu sollte beispielsweise auch die Frage gehören: Mit welchen Gegenständen beschäftigt sich die historische Arbeit überhaupt? Mit der von Professor Cornelius so geliebten, weil toten und daher sinnhaft-geordneten Vergangenheit?
Gerade diese kategoriale, zuweilen gar essentielle Trennung von Gegenwart und Vergangenheit kann einem die eine oder andere Schwierigkeit bereiten. Gegenüber einer reinen Vergangenheitsseligkeit muss man schon deswegen Bedenken anmelden, weil sie sich selbst in ihrer vermeintlich unmittelbarsten Form, selbst bei dem uralten Sternenlicht, das nach seiner langen Reise bei uns eintrifft, nicht von unserer gegenwärtigen Beobachtung trennen lässt. Um wie viel schwieriger wird die Angelegenheit, wenn die Möglichkeit einer beobachtenden Anwesenheit gar nicht mehr gegeben ist? In welcher Weise kann man beispielsweise davon sprechen, dass es einen ›Anfang‹ der Welt gegeben habe und dass dieser sich vor etwa 14 Milliarden Jahren ereignete? Wie soll man sich eine solche ›Situation‹ (falls das überhaupt der treffende Ausdruck ist) vorstellen, ohne dass es eine Beschreibung davon gibt, die irgendjemand angefertigt hat? Natürlich kann diesen Anfang niemand beschrieben haben, weil zufällig niemand zur Stelle war, der diese Aufgabe hätte übernehmen können.[17] Zudem hängt die Idee des Urknalls von einem Konzept der Zeit ab, in der etwas zu existieren beginnt. Aber auch diese Zeit samt ihrem Anfang gibt es nicht ohne Beobachtende, die ein solches Modell überhaupt erst entwerfen und damit (wenigstens ungefähr) sagen müssen, was Zeit überhaupt ist. Wir geraten in eine Argumentations- und Beschreibungsschleife, die unweigerlich zum Zusammenbruch einer Entgegensetzung führt, welche ›die Vergangenheit‹ zum passiven Objekt gegenwärtiger Beobachtungen macht, um dann auch noch feststellen zu wollen, welche dieser Beobachtungen tatsächlich ›wahr‹ ist. Wie aber will man das machen mit Blick auf eine Vergangenheit, die gar nicht mehr existiert? Und bei der im schlimmsten Fall noch nicht einmal jemand dabei war? Jede Version der Vergangenheit hängt unweigerlich von der Beschreibung ab, die darüber angefertigt wird. Beide sind nicht voneinander zu trennen. Würde man nun behaupten wollen, die Vergangenheit wäre von ihrer Beschreibung unabhängig, müsste das im Falle des Urknalls nicht bedeuten, dass man ihn gar nicht beschreiben könnte, weil niemand dabei war? Und würde das dann bedeuten, der Anfang der Welt hätte niemals stattgefunden? Gibt es dann die Welt überhaupt?[18]
Warum umgekehrt eine reine Gegenwartsseligkeit das historische Unterfangen ebenfalls kaum weiterbringt, lässt sich idealtypisch bei Friedrich Schiller lernen. In seiner bekannten Jenaer Antrittsvorlesung »Warum und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte« aus dem Jahr 1789 macht er unmissverständlich deutlich, dass die von ihm konzipierte Universalgeschichte von der Gegenwart auszugehen habe. Denn aus der Masse aller Geschehnisse »hebt der Universalhistoriker diejenigen heraus, welche auf die heutige Gestalt der Welt und den Zustand der jetzt lebenden Generation einen wesentlichen, unwidersprechlichen und leicht zu verfolgenden Einfluß gehabt haben. Das Verhältnis eines historischen Datums zu der heutigen