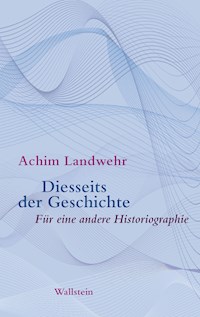14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wenn die Zukunft vorherbestimmt ist, hat die Gegenwart keine Bedeutung - über die Entstehung unseres modernen Zeitempfindens Ein Leben ohne Termine ist heute kaum vorstellbar. Zeit ist ein kostbares Gut, das verwaltet und genutzt sein will. Doch die Zeit ist vor allem eine Idee. Lange glaubte man, die Apokalypse und das Reich Gottes stünden kurz bevor - wozu also die Gegenwart gestalten, da man damit die Zukunft doch nicht verändern kann? Der renommierte Historiker Achim Landwehr erzählt, wie sich diese Zeitvorstellungen im 17. Jahrhundert wandelten und Gegenwart und Zukunft allmählich an Bedeutung gewannen: Kalender boten nun Platz für persönliche Einträge, Zeitungen berichteten vom Hier und Heute, und mit Versicherungen sorgte man für das Morgen vor. Die überraschende Geschichte von der Geburt eines neuen Zeitwissens, durch das sich die Welt ebenso grundlegend wandelte wie durch die großen Entdeckungen von Galilei bis Newton.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 569
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Achim Landwehr
Geburt der Gegenwart
Eine Geschichte der Zeit im 17. Jahrhundert
Über dieses Buch
Leben im Hier und Jetzt, an die Zukunft denken – das ist für uns heute selbstverständlich. Mit dem Kalender gestalten wir unser Leben und planen das Morgen. Nicht so vor 400 Jahren. Damals erwarteten die Menschen zu immer wieder neuen Daten das Jüngste Gericht, die Zukunft schien vorherbestimmt.
Mit viel Esprit schildert der renommierte Historiker Achim Landwehr, wie im Laufe des 17. Jahrhunderts eine neue Vorstellung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft entstand: Kalender, zuvor stets eng bedruckt, boten nun Platz für persönliche Einträge, Zeitungen berichteten vom Hier und Heute, und mit Versicherungen sorgte man für das Morgen vor.
Die überraschende Geschichte von der Entstehung des modernen Zeitwissens - denn die Zeit ist vor allem eine Idee, die Menschen formen und entwickeln.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Covergestaltung: hißmann, heilmann, hamburg / Sybille Dörfler
Coverabbildung: akg-images, Berlin / »Astronomische Wanduhr mit Chronos« von Beat Jakob Brandenberg
Erschienen bei FISCHER E-Books
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2014
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-402940-5
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Kalenderzeit
Kalenderblatt 1717
Geburt der Gegenwart
Ein Massenmedium
Alte Zeiten, neue Zeiten
Was ist Zeit?
Kulturzeit
Zeitschaft
Ein Ende von Anfang an
Kalenderblatt 1630
Das alltägliche Ende
Finale Kalkulationen
Zeit und Ewigkeit
Tausend Jahre
Endloser Weltuntergang
Das Ende als Realität
Quirinus Kuhlmann
Der Niedergang
Irdischer Verfall
Humane Dekadenz
Verehrung der Vergangenheit
Kalenderblatt 1649
Gestern war besser
Der Angriff der Vergangenheit auf die übrige Zeit
Zeugen der Vergangenheit
Das schwierige Alter
Gutes altes Recht
Neue Vergangenheiten
Genealogische Verschiebungen
Theorie der Erde
Biblische Historie
Antiquarianismus
Im Hier und Jetzt
Kalenderblatt 1681
Die Zeit der Zeitung
Zeitungsstreit
Welche Gegenwart?
Der Streit zwischen den Alten und den Gegenwärtigen
Fiktiver Realismus
Warum das 17. Jahrhundert?
Ordnung und Turbulenz
Kalenderblatt 1670
Alamode
Zeit und Mode
Kleiderordnungen
Der Charme der Wiederholung
Katechismen
Vielzeitigkeit
Zeit und Macht
Kalenderblatt 1673
Zeitenwechsel
Uhren- und Kalenderzeit
Der Siegeszug der Uhr
Naturalisierung der Zeit
Zeitstrafen
Anfang ohne Ende
Kalenderblatt 1655
Astrologie
Das Ende vom Ende
Das Ende des Schreckens
Die Geburt der Zukunft aus dem Geist der Apokalypse
Projektemacherei
Wahrscheinlichkeiten und Häufungen
Versicherungen in der Verunsicherung
Anhang
Nachwort
Quellen und Literatur
Quellen
Literatur
Abbildungsnachweis
Sachregister
Personenregister
Kalenderzeit
Zeit zeigt sich nicht, sie macht sich bemerkbar.
Hans Blumenberg[1]
Kalenderblatt 1717
Keine Eintragung für den 1. Januar. »Anfang deß Jenners« ist dort vorgedruckt zu lesen, dazu die Worte »Neue Jahr« und »GOTT geb Glück«, aber es gibt keine handschriftlichen Notizen. Zu Beginn des Jahres ist das vielleicht nicht allzu verwunderlich. Für den 2. Januar weiß der Kalendertext zu vermelden, dass es »windig und gewölckig« wird, aber handschriftliche Notizen finden sich nicht. Der 3. Januar ist der Gedenktag für die heilige Genoveva von Paris – von dem Kalendernutzer wurde immer noch nichts eingetragen. Die Symbole verraten, dass der 5. Januar ein Tag ist, an dem der Aderlass nicht schädlich, aber auch nicht besonders wirksam ist, während es sich um einen guten Tag zum Schröpfen handelt. Für den 12. Januar verzeichnet der Kalender einen Neumond, Notizen finden sich immer noch nicht. Man muss bis zum 15. Januar springen, um eine erste kryptische, handschriftliche Anmerkung zu finden: »P.Ph.«
Abb. 1 Der »Schreib-Calender« von Graf Johann Maximilian IV. Emanuel von Preysing-Hohenaschau auf das Jahr 1717 mit der ersten Januar-Doppelseite Quelle
Kann es ein, dass der Besitzer dieses Kalenders nicht recht wusste, wie er mit dem weitgehend weißen Papier umgehen sollte? Im Grunde lässt sich ein Kalender ohne größere geistige Anstrengung mit Terminen, Einkaufszetteln, kurzen Beobachtungen und Adressen füllen. Dem Grafen Johann Maximilian IV. Emanuel von Preysing-Hohenaschau – geboren 1687, gestorben 1764, eine politisch einflussreiche Figur am Hof der Münchner Kurfürsten in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts[1] – fiel es zunächst aber offensichtlich schwer, seinen Kalender tatsächlich zu benutzen. Einige Namenskürzel pro Woche ohne weitere Erläuterungen, mehr ist im ältesten der von ihm überlieferten Kalender aus dem Jahr 1717 kaum zu finden. Erst ab dem Juni des Jahres 1717 werden die Einträge häufiger, denn Preysing nahm teil an einem Feldzug nach Ungarn gegen das Osmanische Reich im Gefolge des bayerischen Kurprinzen Karl Albrecht.[2]
Der von Preysing verwendete Kalender trägt den Titel:
»Schreib-Calender/Auf ein besondere Form und Weiß/allen Obrigkeiten/Kauff- und Handels-Leuthen/auch männiglich zum täglichen Nutz also eingericht Auf das Jahr nach der Geburt JESU Christi MDCCXVII. Samt einer kurtzen Practica/darneben auch die fürnehmste Messen/und allen Jahr-Märckten im Fürstenthum Ober- und Nidern-Bayrn«.[3]
Sein Besitzer war ein treuer Kunde, denn er benutzte über Jahrzehnte hinweg immer den gleichen Kalender. Das Exemplar des Jahres 1717 – Preysing war 30 Jahre alt – ist das erste in einer Reihe von Kalendern, die aus seiner Hand überliefert sind und die er bis zu seinem Tod im Jahr 1764 fortführte.[4]
Der Markt für Kalenderdrucke war zu Zeiten Preysings schon sehr ausdifferenziert. Die Verleger versuchten den Wünschen und Bedürfnissen unterschiedlicher Käufergruppen entgegenzukommen. Sie vertrieben daher spezielle Kalender mit jeweils abgestimmten Inhalten und unterschiedlichen Informationsangeboten.[5] Auch Preysings Kalender offenbart eine solche Zielgruppenorientierung, denn im Titel werden die Obrigkeiten sowie die Kauf- und Handelsleute als Adressaten angesprochen. Für sie waren die weitgehend weißen Seiten gedacht, um Termine festzuhalten, kurze Notizen zu machen, Stichworte aufzuschreiben. Die Botschaft dieses »Schreib-Calenders« liegt auf der Hand: Seine Benutzer waren dazu aufgefordert, ihren Tagesablauf zu gestalten oder auch Geschehnisse im Rückblick tagebuchartig festzuhalten. Beide Verwendungsweisen, die vorausschauende Organisation wie die rückblickende Reflexion, finden sich auch bei Preysing.
Preysings Kalender geben, wenn auch meist nur stichwortartig, vielfach Auskunft über sein Leben und seinen Aufstieg bei Hof. Aber das soll hier weniger interessieren. Vielmehr lohnt ein Blick in diesen Kalender als Medium. Denn bis auf das Schriftbild ähnelt Preysings Kalender für das Jahr 1717 in seinem Aufbau den Terminkalendern, die man auch heute noch käuflich erwerben kann: Für jede Woche ist eine Seite reserviert, etwa drei Viertel der Seite sind für eigene Eintragungen vorgesehen, das letzte Viertel enthält neben kalendarischen Angaben Hinweise zu den Tagesheiligen, astronomische Informationen, Wettervorhersagen (für das gesamte Jahr!) und astrologische Handreichungen. Letztere sind in Form von Zeichen wiedergegeben und informieren beispielsweise über günstige Tage zum Aderlassen, Haareschneiden oder Säen und Ernten.
Warum aber konnte Preysing mit dem unbedruckten Teil der Kalenderseite zunächst offenbar wenig anfangen? War er nicht dazu in der Lage oder nicht daran gewöhnt, seinen Tages-, Wochen- und Monatsablauf selbst zu organisieren? War er möglicherweise in derart festgelegte Abläufe eingebunden, dass eine individuelle Planung nicht nötig war? Warum kaufte er sich dann aber einen Kalender für »Obrigkeiten« und »Kauff- und Handels-Leuthe«, der schon von seiner Struktur her die eindeutige Aufforderung enthielt, Tagesabläufe selbst zu gestalten und unterschiedliche Vorgänge zu synchronisieren? War dieses Kalendermedium neu für ihn, so dass er sich an seinen Gebrauch erst gewöhnen musste? (Dies jedenfalls gelang nach einer gewissen Zeit, schließlich verwendete er die Kalender nicht nur über Jahrzehnte, sondern kaufte sich später auch sogenannte durchschossene Exemplare,[6] in die zusätzliche leere Seiten eingebunden waren, um mehr Raum zum Schreiben zu schaffen.) Oder ist die ganze Sache wesentlich einfacher – und damit plausibler –, dass es nämlich in diesen ersten Monaten des Jahres 1717 kaum etwas gab, was des Eintragens wert gewesen wäre?
Wir werden dies nie mit letzter Sicherheit wissen. Eindeutig ist jedoch, dass Preysing mit seiner Jahrzehnte währenden Verwendung des Kalenders etwas tat, das uns heute selbstverständlich erscheint: Er nutzte ihn, um Treffen festzuhalten, Termine zu notieren, Ereignisse zu vermerken, Geschehnisse zu reflektieren. Durch die Organisation seines Tagesablaufs gestaltete er aktiv seine eigene Gegenwart und nähere Zukunft. Mit dem Erwerb eines Kalenders kaufte er sich also den gestaltbaren Freiraum für ein Jahr im Voraus (zumindest soweit seine Verpflichtungen dies zuließen). Kalender enthalten mit ihren weitgehend leeren Seiten die Aufforderung, Zeit zu nutzen und zu gestalten.
Das mag uns trivial anmuten, denn welche anderen Möglichkeiten, Kalender zu verwenden, sollte es geben? Historisch gesehen ist aber ein solcher Einsatz von Kalendern und ein entsprechendes Verständnis von Zeit alles andere als trivial. Denn Kalender wie derjenige Preysings waren ein verhältnismäßig junges Phänomen. Kalenderdrucke gehörten zwar zu den frühesten Erzeugnissen der Buchdrucker und finden sich in deren Repertoire seit der Mitte des 15. Jahrhunderts. Für lange Zeit waren diese Kalender aber nur zu einem geringen Teil der eigenen Gestaltung überlassen, waren gerade nicht durch leere Seiten gekennzeichnet, sondern im Gegenteil mit zahlreichen Informationen gefüllt, ja, geradezu vollgestopft. Kalender des 16. und 17. Jahrhunderts quollen über von Hinweisen, Texten, Symbolen und Informationen. Sie gaben vor, was an dem betreffenden Tag geschehen würde, wodurch er gekennzeichnet war und wie man sich an diesem speziellen Tag am besten zu verhalten habe. Der Raum für die eigene Gestaltung (und damit auch für das eigene Schreiben) fiel demgegenüber deutlich geringer aus. Mit anderen Worten: Ältere Kalender waren gerade nicht darauf angelegt, die eigene Gegenwart zu gestalten, denn diese Gegenwart und die nähere Zukunft schienen schon im Vorhinein festzustehen.
Insofern ist Preysings Schreibkalender durchaus bemerkenswert. Wenn Kalender auf die eine oder andere Art jeweils aktuelle Zeitmodelle repräsentieren, dann lässt sich eine einfache Frage stellen: Warum sind die Seiten in Preysings Kalender weiß geworden?
Geburt der Gegenwart
Ich kann mir die Frage sparen, ob Sie einen Kalender besitzen. Selbstverständlich verfügen Sie über ein solches Hilfsmittel zur Terminorganisation. Der Kalender gehört gewissermaßen zu den unhinterfragten Ausstattungsgegenständen erwachsener Menschen. Und obwohl Kalender inzwischen vielfach elektronisch verwendet werden, haben sie sich im Prinzip gar nicht so weit von dem Modell entfernt, das schon Preysing nutzte.
Kalender sind aus unserem Alltag nicht wegzudenken. Es gibt nur wenige Privilegierte, die es sich leisten können, ihr Leben ohne einen Kalender zu gestalten. Kleinkinder gehören zu dieser bevorzugten Gruppe der Kalenderlosen – allerdings auch nur, weil sie sich Eltern halten, die die Terminorganisation für sie übernehmen. Tatsächlich jedoch sind alle, die eingebunden sind in Familien, Vereine, Firmen, Netzwerke, Organisationen und Hierarchien, die verstrickt sind in Abläufe, Verfahren, Geschäfte und Prozesse, die zu tun haben mit Terminen, Verträgen, Projekten oder Vereinbarungen, auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, einen Kalender zu führen, wenn sie nicht im organisatorischen Chaos versinken wollen. Es gibt Taschenkalender, Wandkalender, ewige Kalender, elektronische Kalender, Kunstkalender oder Organizer. Kein Computer und kein Mobiltelefon kommen ohne Kalender aus. Wir sehen Kalender als nützlich an, sie erleichtern unseren Alltag, wir sind von ihnen umzingelt, und wir sind von ihnen abhängig. Der Kalender erweist sich tagtäglich als hilfreiches Medium, um unseren Alltag zu strukturieren. Und zuweilen beschleicht einen der Verdacht, dass unsere Kalender das Leben führen, das wir zu führen meinen. Weil also der Kalender selbstverständlich und allgegenwärtig geworden ist, lohnt sich eine nähere Betrachtung dieses unscheinbaren Gegenstandes – lohnt sich eine ›Entselbstverständlichung‹ des Selbstverständlichen.
Natürlich ist der Kalender nicht die Ursache für historische Transformationen gleich welcher Art. Aber Kalenderdrucke sind ein geeignetes Beispiel, an dem sich das Problem untersuchen und vorführen lässt, das in diesem Buch im Mittelpunkt stehen soll. Sie sind nämlich Ausdrucksformen von Zeitvorstellungen und Zeitmodellen, mit denen Kulturen in bestimmten historischen Situationen operieren. Und das Modell, das sich mit dem Terminkalender und seinen weitgehend leeren Seiten verbindet, setzt auf Gegenwart. Die weißen Seiten beinhalten die explizite Aufforderung, die eigene Gegenwart zu gestalten und damit überhaupt erst zu einer ausgefüllten, wenn nicht sogar erfüllten Gegenwart zu machen. Ein solches Modell ist alles andere als selbstverständlich, wie der historische Blick erweisen soll.
In diesem Buch geht es also nicht um eine Geschichte des Terminkalenders. Eher geht es – das Exempel Preysings vor Augen – um die Frage, wie der Terminkalender überhaupt möglich werden konnte. Welche Bedingungen und Voraussetzungen mussten gegeben sein, um dieses Medium in einer bestimmten historischen Konstellation sinnvoll erscheinen zu lassen?
Mit einer solchen Frage ist man verwiesen auf Vorstellungen bestimmter Zeitmodelle. Ich möchte im Folgenden vor allem mit Blick auf das 17. Jahrhundert vorführen, wie es in Europa zu einem sehr grundlegenden Wandel dieser Zeitmodelle kam. Oder anders formuliert: Dieses Buch handelt davon, wie im 17. Jahrhundert die Gegenwart erfunden wurde. Genauer, aber etwas weniger eingängig formuliert: Es geht um die Frage, wie unser heute noch vorherrschendes Verständnis von Gegenwart im Verlauf des 17. Jahrhunderts emergierte, wie es also geschah, dass man sich auf eine neue Art und Weise auf Gegenwärtigkeit beziehen und damit umgehen konnte.
Das Verb ›emergieren‹ ist dabei erklärungsbedürftig. Emergenzphänomene zeigen sich allenthalben: in V-Formation fliegende Vögel, der Ameisenhaufen, der Stau – all diese und viele weitere Phänomene besitzen Eigenschaften, die bei den einzelnen Elementen, aus denen sie sich zusammensetzen, nicht auftreten. Das Verhalten von Vögeln, Ameisen oder Autofahrern lässt sich nicht dadurch erklären, dass sich ein Verantwortlicher identifizieren ließe, dem das Ergebnis der gemeinsamen Aktivitäten zugeschrieben werden könnte. Vogelschwärme, Ameisenhaufen oder Staus sind nicht geplant und nicht gesteuert, sondern resultieren aus einfachen Regularien und lokalen Interaktionen, die zu komplexeren Regelmäßigkeiten führen – sie emergieren.[1] Nicht anders verhält es sich mit Formen des Zeitwissens. Niemand beschließt, dass die Vergangenheit zu verehren, die Zukunft zu gestalten oder die Gegenwart zu nutzen sei. Solche Modelle emergieren als nicht planbare Ergebnisse verhältnismäßig komplexer Interaktionen, die sich zudem noch über lange Zeiträume erstrecken.
An diese erste These von der wachsenden Bedeutung und Ausbreitung der Gegenwart schließt sich noch eine zweite an: Es war nämlich keineswegs ›Gegenwart‹ allein, die das Verständnis von Zeit im 17. Jahrhundert dominierte, sondern dieses Zeitmodell hatte mit einer Vielzahl anderer Vorstellungen und Praktiken von Zeit zu konkurrieren. Das 17. Jahrhundert war nicht geprägt von einem einzigen Zeitmonopol, sondern von einer Vielzeitigkeit, also einer Vielzahl parallel zueinander bestehender Zeiten.
Diese historische Veränderung erscheint mir deswegen von Bedeutung, weil sich damit ein Konzept von ›Gegenwart‹ etabliert hat, das bis zum heutigen Tag wirksam ist. Ich möchte daher eine historische Beschreibung unternehmen, mit der die Gegenwärtigkeit der ›Gegenwart‹ des 17. Jahrhunderts verdeutlicht werden kann. Und vor allem möchte ich die Frage stellen, warum es ausgerechnet in diesem Zeitraum zu einer Veränderung im Zeitwissen kam und was das möglicherweise mit uns zu tun hat.
Kalender sollen hierbei als Leitfaden dienen. Es wird auch anderes historisch überliefertes Material zur Sprache kommen, wie Zeitungen, Genealogien, Romane, Konversationslexika, Modejournale und anderes mehr. Aber Kalender eignen sich besonders gut, weil sie auf mehrfache Weise Temporalität zum Gegenstand haben. Am Anfang dieser Reise durch die Zeit soll das Ende stehen (Kapitel 2), weil das Wissen von der Zeit in Europa über Jahrhunderte hinweg von der Überzeugung geprägt war, dass die Welt an ein vorherbestimmtes Ende gelangen würde – ein Ende, das nicht allzu weit entfernt war. Zugleich wurde der Vergangenheit eine ungemein große Autorität zugeschrieben (Kapitel 3). Während das Künftige heilsgeschichtlich vorherbestimmt war, galt das Zurückliegende lange als vorbildlicher Maßstab in allen Belangen, nicht zuletzt weil die Vorstellung herrschte, die Schöpfung befinde sich in einer Abwärtsspirale des Niedergangs. Doch diese überlebensgroße Bedeutung der Vergangenheit veränderte sich während des 17. Jahrhunderts merklich. Daneben trat eine durchaus als neu zu bezeichnende Aufmerksamkeit für die eigene Gegenwart und eine Entdeckung von Gegenwärtigkeit als Möglichkeitszeitraum (Kapitel 4). In einer Situation, in der Zukunft noch nicht in einem fortschrittsgeschichtlichen Sinn als umfänglich gestaltbarer Zeitraum verstanden werden konnte, die Vergangenheit aber zugleich an Autorität einbüßte, gewann Gegenwart an Bedeutung. Da wir es hier aber nicht mit einem schlichten Ablösungsvorgang zu tun haben, muss man die Vielzahl der Zeiten angemessen berücksichtigen, die parallel oder auch in deutlicher Konkurrenz zueinander bestanden (Kapitel 5). All diese temporalen Verschiebungen, die sich während des 17. Jahrhunderts beobachten lassen, führten einerseits zu heftigen Turbulenzen im Zeitgefüge, andererseits zu beständigen Ordnungs- und Stabilisierungsbemühungen. Es gab durchaus unterschiedliche Formen, mit Zeit umzugehen – Formen, die dann aber auch wieder synchronisiert und zeitlich in Einklang gebracht werden mussten. Sowohl die Konkurrenz von Zeitmodellen als auch deren Synchronisation verweisen auf die politische Dimension von Zeit. Denn mit Zeit zu hantieren erzeugt zahlreiche Wechselverhältnisse zwischen Zeit und Macht (Kapitel 6). Zeitorganisationen gewinnen nicht nur Macht über Gesellschaften und Menschen, sondern es bedarf auch Formen der Machtausübung, um Zeitmodelle zu installieren, wie nicht zuletzt Kalenderreformen zeigen. Am Ende steht schließlich der Anfang (Kapitel 7). Denn mit der Gewinnung von Gegenwart als zeitlichem Möglichkeitsraum konnten auch neue Anfänge gewagt und konnte aus der einst heilsgeschichtlich geschlossenen Zukunft ein potentiell gestaltbarer Zeitraum werden.
Ein Massenmedium
Mit den Kalendern ist es eine verzwickte Sache. Wir schenken Ihnen kaum Aufmerksamkeit (in dem Sinn, dass wir fragen, um was es sich bei diesem Medium eigentlich handelt), aber ohne sie würde unser Alltag nicht mehr funktionieren, könnte die Politik nicht arbeiten und würde die Weltwirtschaft kollabieren. Diese Mischung aus Allgegenwart und Unauffälligkeit macht sich auch in der historischen Überlieferung bemerkbar. Kalender sind bereits seit Jahrhunderten ein Massenprodukt – und gerade deswegen so selten. Entweder wurden sie von ihren Besitzern nicht der Überlieferung für wert befunden (und wir können daher einem Kalendersammler wie Preysing nur danken),[1] oder sie wurden von den Archiven als nicht aufbewahrenswert erachtet und an Altpapierhändler verkauft.
Dabei sind Kalender wichtige historische Dokumente alltäglicher menschlicher Erfahrung. Gerade Kalender aus vergangenen Jahrhunderten haben eine ungemein breite Palette an Inhalten und Rezeptionsformen anzubieten – wenn auch in spröder und zunächst wenig aufsehenerregender Form. Seit dem 15. Jahrhundert entwickelte sich der Kalender zu einem universellen Informationsmittel,[2] verfügte über »den Wechsel des Vielfältigen, über eine geordnete Unordnung«, die ihn schnell unverzichtbar machte.[3]
Kalender dienten seit dem 16. Jahrhundert als Medien, um Welt zu ordnen und Wissen zu organisieren.[4] Man könnte frühneuzeitliche Kalender als populäre, komprimierte Wissensspender bezeichnen. Sie waren seit ihrer massenhaften Verbreitung im 16. Jahrhundert dazu in der Lage, relativ breiten Bevölkerungskreisen auf verhältnismäßig schlichte Art und Weise wichtiges, weil lebensalltäglich relevantes Wissen zu vermitteln. Genau deswegen waren ihre Seiten lange Zeit gerade nicht weiß, sondern im Gegenteil angefüllt mit einer überbordenden Masse an Informationen.
Abb. 2 Eine Monatsdoppelseite aus dem »Europäischen Currier«, einem Geschichtskalender auf das Jahr 1699, von Paul Conrad Balthasar Han. Im Gegensatz zu den von Preysing benutzten Kalendern gibt es hier nur wenig Platz zum Schreiben, stattdessen überwiegen die vorgegebenen astronomischen, astrologischen, medizinischen, kirchlichen, zeithistorischen und lebenspraktischen Informationen. Quelle
Die Kalenderdrucke, die Anfang des 15. Jahrhunderts entstanden, dienten zunächst nicht der zeitlichen Synchronisation, sondern der medizinischen Information. Ärztliche Behandlungsmethoden waren während des Mittelalters und der Frühen Neuzeit strikten Regeln unterworfen. Das Aderlassen, das Schröpfen oder das Purgieren (also die Anwendung von Abführmethoden) mussten zum richtigen Zeitpunkt durchgeführt werden. Diese Zeitpunkte ergaben sich aus dem Mondstand im Tierkreiszeichen. Schon seit der Antike hatten sich Humoralmedizin (auf der Basis der Vier-Säfte-Lehre) und Astrologie zu einer unauflöslichen Melange vermengt und erlangten als Iatromathematik (Astromedizin) uneingeschränkte Autorität. Frühe Aderlasskalender des 15. Jahrhunderts enthielten daher verhältnismäßig wenige Daten zur näheren Bestimmung des Jahres, dafür aber detaillierte Angaben zu Mondbewegungen und Aderlassvorschriften.[5]
Seit dem Beginn des 16. Jahrhunderts wurden dann immer mehr Informationen in die Kalender eingefügt. Neben die medizinischen Hinweise traten beispielsweise agrarische und allgemeine astrologische Angaben. Die Popularisierung der Astrologie hatte dazu geführt, dass Jahresprognosen mit ihren Vorhersagen über große politische Entwicklungen und über alltägliche Belange Eingang in die Kalender fanden. Neben den kalendarischen Angaben und dem Prognostikon waren beschreibbare Spalten ein wichtiger Bestandteil des ›Gesamtkunstwerks Kalenderdruck‹. Dadurch konnte der Kalender zugleich als Notizbuch verwendet werden. Gegen Ende des 16. Jahrhunderts wurden dann Texte aufgenommen, die eine Unterhaltungs- und Bildungsfunktion übernahmen. Wurden zunächst historische Gedenktage notiert, entwickelten sich daraus schließlich knappe historische Beiträge. Das thematische Spektrum erweiterte sich vor allem im Verlauf des 18. Jahrhunderts, so dass hier die Wurzel für die moralisch-belehrende Kalendergeschichte zu finden ist.[6]
Kalender konnten also ganz grundlegende Fragen beantworten, vor allem: Was ist zu tun, und wann ist es zu tun? Durch ihre Kopplung von Astronomie und Astrologie wussten sie beide Aspekte miteinander zu vermitteln. Auf der Grundlage des Einflusses von Mond und Planeten auf das menschliche Leben konnten sie Fragen der alltäglichen Lebensbewältigung beantworten. Und durch die kalendarische Verknüpfung mit bestimmten Daten konnten diese Tätigkeiten auch exakt verzeitlicht werden.
Aber Kalender waren nicht nur deswegen populäre Wissensspender, weil sie das Was und das Wann beantworten konnten, sondern auch weil sie dies in einer Form taten, die im Extremfall sogar von Analphabeten verstanden werden konnte. Die wichtigsten Informationen – Wetterphänomene, astronomische Erscheinungen (Mondphasen etc.) und astrologische Informationen – wurden mittels bildhafter Zeichen, den sogenannten Erwählungen, vermittelt, die auch ohne Lesefähigkeit leicht memoriert werden konnten.[7] In Preysings Schreibkalender waren diese Erwählungen, wie damals üblich, tabellarisch zusammengefasst. Hier gibt es nicht nur die auch heute noch geläufigen Zeichen für die Sternbilder oder für einzelne Mondphasen, sondern ebenso für gute Tage, um zur Ader zu lassen, zu schröpfen, zu säen und zu pflanzen, Medikamente einzunehmen oder die Haare zu schneiden. Solche astrologisch fundierten Informationen wurden in konziser und äußerst verknappter Form der Leserschaft mitgegeben.
Kalender wurden in sehr hohen Auflagen gedruckt und verkauft. Für den größten Teil der Bevölkerung waren sie neben Bibel und Gebetbuch häufig die einzigen Lesestoffe, die permanent erworben und spätestens seit der Mitte des 16. Jahrhunderts massenhaft produziert und verbreitet wurden.[8] Ausgehend von ihrer jährlichen Erscheinungsweise kann man schätzen, dass die verschiedenen Kalenderdrucke und -typen in der Summe die bei weitem höchste Gesamtauflage aller Druckschriften zwischen dem 16. und dem 18. Jahrhundert erzielten.[9] Es liegen Zahlen vor, nach denen in England in der Mitte des 17. Jahrhunderts Kalenderausgaben die Auflage von ca. 400000 Stück erreichten, womit in etwa jede dritte Familie des Königreichs mit einem Kalender versorgt worden wäre.[10] Auch in Italien waren Kalenderdrucke seit dem 16. Jahrhundert ein populäres Medium, was sich nicht nur am erschwinglichen Preis, sondern ebenso am kleinen Format, an der nicht besonders hohen Papierqualität sowie an der Einfachheit der darin präsentierten Themen ersehen lässt.[11] Der in Wien gedruckte »Krakauer Schreibkalender« war in der Mitte des 17. Jahrhunderts ein echter Verkaufsschlager und erreichte Auflagen von etwa 250000 Stück.[12] Vom »Badischen Landkalender« ist dokumentiert, dass er 1740 eine Auflage von 13000 Exemplaren hatte, und dies bei einer Einwohnerschaft in der Markgrafschaft Baden von ca. 90000 Personen. Setzt man für das 18. Jahrhundert eine durchschnittliche Auflagenhöhe von 10000 Exemplaren pro Kalender an und rechnet diese auf die wahrscheinlich über 200 Kalender hoch, die parallel allein im deutschsprachigen Raum erschienen, dann ergibt dies eine Schätzung von etwa zwei Millionen Kalendern pro Jahr.[13]
Kalenderdrucke lohnen sich als Betrachtungsgegenstand also nicht nur, weil ihre Inhalte Wirklichkeit organisierten, Wissen vermittelten und zeitliche Zusammenhänge vor Augen führten, sondern auch weil sie sich an einem Markt orientieren mussten. Sie konnten nicht nur Vorstellungen einer sozialen oder intellektuellen Elite repräsentieren, sondern mussten sich immer den Interessen ihrer Käufer und damit sozial größerer Kreise anpassen. Drucker und Verleger versuchten in ganz Europa ihre Produkte im Einklang mit den Rezipienteninteressen verkäuflicher zu gestalten.[14] Auf den Absatz für weitere gesellschaftliche Kreise weist auch der von Beginn an sehr hohe Anteil volkssprachlicher Kalenderdrucke hin.[15] Man kann durchaus sagen, dass Kalender die »Bibliothek des gemeinen Mannes« waren.[16] Diesen Status konnten sie nicht zuletzt durch ihren niedrigen Preis erreichen.[17] Auch Handwerksgesellen oder Tagelöhner konnten sich vom Verdienst eines halben Arbeitstages einen Kalender kaufen.[18]
Für die Drucker und Buchhändler scheint sich das Kalendergeschäft gelohnt zu haben, wie der Nürnberger Ratsschreiber Wolfgang Brauser in seinem 1687 erschienenen »Hurtigen Briefsteller« deutlich machte: »Man frage in den Buchdruckereyen und Buchläden, welche Arbeit, Bücher und Schriften, am stärksten abgehen, so wird sichs finden, daß man den besten Nutzen von den Calendern hat.«[19]
Und auch für Autoren konnte die Kalenderschriftstellerei im 17. Jahrhundert ein einträgliches Geschäft sein. Ein – in dieser Form sicherlich außergewöhnliches – Beispiel ist Markus Freund (1603–1662). Der Pfarrer aus Hohenlohe war einer der erfolgreichsten Kalenderschriftsteller seiner Zeit. Vom Nürnberger Verlagshaus Endter, ein europaweit führendes Unternehmen in diesem Bereich, das auch Freunds Kalender veröffentlichte, bezog er gegen Ende seines Lebens ein jährliches Honorar von 300 Gulden, womit er den Verdienst von Lehrern oder Pfarrern deutlich übertraf. Manche der von ihm begründeten Kalender, wie der »Newer und Alter Zeit- und WunderCalender« (erschienen von 1658 bis 1807), wurden unter seinem Namen über anderthalb Jahrhunderte publiziert.[20]
Ein anderes Beispiel ist Johann Heinrich Voigt (1613–1691). Nach einer Ausbildung zum Buchbinder wandte er sich im Alter von 23 Jahren der Mathematik zu und wurde Schreib- und Rechenmeister an unterschiedlichen Stadtschulen. Seinen ersten Kalender schrieb er im Jahr 1665, als er sein 50. Lebensjahr bereits überschritten hatte. Dem vorausgegangen waren autodidaktische Studien des Lateinischen und der Astronomie. Mit seinen Kalendern war er so erfolgreich, dass er den Lehrerberuf bald aufgeben konnte. Die Gunst Herzog Rudolf Augusts von Braunschweig-Lüneburg und eine schwedische Pension entledigten ihn aller materiellen Sorgen. Sein Leben beschloss er als königlich-schwedischer Mathematiker in Stade. Die Pension, die ihm die schwedische Krone im Jahr 1686 zugesprochen hatte, wurde bis in das Jahr 1700 ausbezahlt – so weit im Voraus hatte er bereits seine Kalender erstellt.[21]
Die große Verbreitung der Kalender lässt zweierlei vermuten: Einerseits dürften sie einen wesentlichen Einfluss auf die Vorstellungen von Zeitlichkeit in der Bevölkerung gehabt haben.[22] Denn die Benutzer von Kalendern unterwarfen sich freiwillig den formalen Zwängen dieses Mediums. Das Medium ›Kalender‹ konnte für seine Benutzer so zu einem recht engen Korsett werden, dem sie sich anzupassen hatten.[23] Zugleich war dieses Medium aber auch stark an seinen Rezipienten orientiert, muss also seinerseits allgemein vorherrschende Zeitvorstellungen aufgegriffen haben.
Alte Zeiten, neue Zeiten
Geschichte beschäftigt sich nicht mit Vergangenheit. Wie könnte sie auch, Vergangenheit ist schließlich vergangen, für uns nicht mehr greifbar, nur noch in zufällig bis absichtsvoll überlieferten Relikten zu fassen.[1] Geschichtsschreibung interessiert sich zwar für die Vergangenheit, ist aber immer auf die eine oder andere Art und Weise eine Auseinandersetzung mit der Gegenwart. Jede historische Arbeit offenbart bei näherem Hinsehen unweigerlich ihren tagesaktuellen Bezug, mal mehr, mal weniger offensichtlich. Auch eine Beschäftigung mit Zeitkonzepten des 17. Jahrhunderts ist keine Wissenschaftsesoterik, sondern hat ihren Bezug zu Fragen und Problemen des frühen 21. Jahrhunderts.
Die zum Teil schon seit Jahrzehnten diskutierten grundsätzlichen Probleme, die das derzeitige und zukünftige Leben auf diesem Planeten betreffen, haben unweigerlich Auswirkungen auf unsere Auffassungen von und Einstellungen zur Zeit: der Klimawandel und seine weitreichenden Konsequenzen, die Endlichkeit irdischer Rohstoffe, die Überalterung in industrialisierten Gesellschaften, die Auswirkungen einer Wachstums- und Fortschrittsideologie, die grassierende Staatsverschuldung – all diese und weitere Phänomene finden auch ihren temporalen Niederschlag.[2]
Der französische Historiker Alexandre Escudier hat für die Folgen, die diese risikobehaftete Situation auf unsere Zeitvorstellung hat, den treffenden Ausdruck der »innerweltlichen Eschatologie« geprägt. Demnach wissen wir, dass das Dasein der Menschheit auf Erden an sein Ende gelangen kann. Wir wissen aber aufgrund der großen Komplexität der einschlägigen Systeme und klimatischen Variablen noch nicht, wann dieses Ende kommen wird. Angesichts der kurzfristigen Perspektive wirtschaftlicher Systeme einerseits und der geopolitischen Kräfteverhältnisse andererseits legt diese ökologische Endzeitperspektive das ganze zeitliche Dilemma offen. Es geht um die temporale Quadratur des Kreises im heutigen politischen Handeln: die unmögliche Harmonisierung der Langfristigkeit ökologischer Auswirkungen, wie sie von der globalen technisch-industriellen Sphäre ausgelöst wurden, mit der Kurzfristigkeit demokratisch legitimierten politischen Handelns.[3]
Was Mitte des 20. Jahrhunderts noch in einem recht optimistischen Sinn als Fortschritt bezeichnet werden konnte, ist inzwischen zu unserer Vergangenheit geworden.[4] Wir haben es – nicht ausschließlich, aber doch in unübersehbarer Weise – mit einem Zeitmodell zu tun, das wohl seit dem 17. Jahrhundert in Europa nicht mehr so aktuell war wie heute, nämlich mit der Endlichkeit der Welt. Während aber in früheren Jahrhunderten das Weltende in einem heilsgeschichtlichen Sinn aufgefasst wurde, müssen wir es inzwischen in einem ökologischen Sinn verstehen. Ein Ende der Gegenwart wird möglich.[5] Zudem wird ersichtlich, dass jede Zukunftsgestaltung immer auch mit einer Zukunftsvernichtung einhergeht, weil jede gegenwärtige Entscheidung, die auf das Kommende zielt, alternative Entscheidungen ausschließt – auch und gerade für kommende Generationen.[6]
Die Endlichkeit der Welt zeigt auch deswegen so klare Konturen, weil sie im Konflikt mit der Vorstellung von Fortschritt und Wachstum steht, deren Wurzeln ebenfalls in den Zeitraum des 17. und 18. Jahrhunderts zurückreichen. Wir sind es nämlich noch immer gewohnt, mit dem Blick in eine offene Zukunft zu denken, linear und progressiv. Fortschritt und Wachstum sind immer noch Normen, die nicht verhandelbar zu sein scheinen.
»Die mit dem Begriff ›Wachstum‹ verbundene Vorstellungswelt durchzieht jede Faser unserer gesellschaftlichen und privaten Existenz. […] Der Begriff ›Wachstum‹ hat magische und parareligiöse Qualität, weshalb man sogar im Fall einer Rezession vom ›negativen Wachstum‹ spricht, als sei das Schrumpfen der Wirtschaftsleistung […] der Leibhaftige, den ein guter Christ nicht beim Namen nennen darf.«[7]
Ökologie und Ökonomie verdeutlichen auf besondere Weise die tektonischen Verschiebungen in unseren Zeitauffassungen. So sieht beispielsweise der Journalist Andreas Zielcke in den Reaktionen auf globale Wirtschaftskrisen eine Neuausrichtung temporaler Verhältnisse am Werk, wenn auch keine freiwillig gewählte. Lange war ›die Zukunft‹ die zeitliche Schwester von ›Amerika‹ als Chiffre für unbegrenzte Möglichkeiten. Seit geraumer Zeit verstärkt sich der Eindruck, dass sich genau diese Zukunft recht schnell verbraucht haben könnte. Inzwischen lässt sich dieser Eindruck auch mit immer erdrückenderem Zahlenmaterial belegen. Wir sind möglicherweise schon längst Zeugen (und ›Zeit-Genossen‹) einer Gegenwart, die ihre Zukunft vernachlässigt und deren Potentiale verbraucht. Laut Zielcke geht es eigentlich nicht mehr um die Frage, ob wir heute schon unser Morgen verspielen, sondern ob nicht die jüngst vergangene Gegenwart unsere Zukunft aufs Spiel gesetzt – und verloren hat.[8]
Ob diese Diagnose zutrifft, wird – jawohl! – erst die Zukunft zeigen. Vielleicht liegen all diese düsteren Prognostiker ja falsch? Allerdings hat sich diese Form der Selbstbeschreibung inzwischen zu einem recht einhelligen Chorgesang verdichtet, zu einem basso continuo, der allen politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Diskussionen unterliegt. Das sagt nicht nur viel über die Selbstbeschreibung der Gegenwart des frühen 21. Jahrhunderts aus, sondern wird, wie jedes Selbstbild, ob zutreffend oder nicht, seine eigene diskursive Wirkmächtigkeit entfalten. Es scheint, als würden wir inzwischen auf ein Zeitmodell der Moderne zurückblicken, das lange dominierend war, nun aber seiner Musealisierung entgegengehen könnte, weil es sich womöglich überlebt hat.[9]
Doch wer sich historisch mit solchen Formen des Zeitwissens beschäftigt, will sich nicht in der erinnernden Bewahrung erschöpfen, sondern versucht durch die Beschäftigung mit dem historisch ganz Anderen (und gleichzeitig Ähnlichen) die Augen für unsere eigene Situation zu öffnen.[10] Die Auseinandersetzung mit Zeitwissen der Frühen Neuzeit kann daher nicht nur zeigen, vor welchem Hintergrund es zu entsprechenden Neumodellierungen kam, sondern was es für Kulturen bedeutet, mit dem Verlust von Gewissheiten konfrontiert zu werden. Das 17. Jahrhundert war in einem hohen Maß durch Unsicherheiten, Krisensemantiken und Ordnungsverluste geprägt.[11] Daher stellt sich in diesem Buch (wie für unsere Gegenwart des frühen 21. Jahrhunderts) die Frage: Was passiert, wenn etablierte und als verlässlich gedachte Sachverhalte instabil werden? Wie werden solche Infragestellungen des als sicher Gewussten, wie werden Brüche in etablierten Wirklichkeitsmodellen kulturell wahrgenommen und mit Sinn ausgestattet? Und welche Auswirkungen hat das insbesondere auf das Wissen von und den Umgang mit Zeit?
Was ist Zeit?
Keine Abhandlung zum Thema ›Zeit‹ scheint ohne das folgende Zitat existieren zu können (weshalb es jetzt gleich zum Einsatz kommen soll, um der offensichtlichen Zitierpflicht Genüge zu tun): »Was ist also ›Zeit‹? Wenn mich niemand danach fragt, weiß ich es; will ich einem Fragenden es erklären, weiß ich es nicht.«[1]
Man könnte Augustinus, dem Urheber dieses Satzes, mehrere Antworten auf die Frage anbieten. Eine erste reflektiert den naturwissenschaftlichen Erkenntnisstand, der uns im frühen 21. Jahrhundert vom Kirchenvater des 4. Jahrhunderts trennt. Danach ist die Grundlage der Zeit eine physikalisch exakt bestimmbare Sekunde. Die Dauer einer Sekunde wiederum entspricht den 9192631770 Schwingungen zwischen den Hyperfeinstrukturniveaus eines Cäsium-Nuklids mit dem Atomgewicht 133.[2] Mit dieser Maßeinheit operieren Atomuhren, wie sie beispielsweise von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig betrieben werden. Solche Atomuhren stellen normierende Grundlagen für die Zeit dar, wie sie derzeit unseren Alltag bestimmt.
Mit dem Verweis auf die Braunschweiger Bundesanstalt liegt auch eine zweite Antwortmöglichkeit nahe, nämlich die juristisch-politische: Zeit ist das, was gesetzlich festgelegt wird. Im deutschen Kaiserreich wurde im Zuge der Weltzeitregelung bereits 1893 ein »Gesetz betreffend die Einführung einer einheitlichen Zeitbestimmung« erlassen, das seither in unterschiedlichen Fassungen fortgesetzt und angepasst wurde. Seit dem 12. Juli 2008 gilt in Deutschland die jüngste Fassung des »Gesetzes über die Einheiten im Messwesen und die Zeitbestimmung«.[3] Darin wird auch festgelegt, dass die Braunschweiger Bundesanstalt die gesetzliche Zeit darzustellen und zu verbreiten hat. Will man sich allen tiefschürfenden Problematisierungen hinsichtlich der Zeit entledigen, kann man also auf diese Verbindung von Naturwissenschaft und Politik verweisen, die festlegt, was Zeit ist.
Man kann aber auch versuchen, eine gänzlich andere Antwort zu geben: Zeit gibt es nicht. Zeit wird häufig so behandelt, als käme ihr eine eigene, von den Menschen unabhängige Existenz zu, als sei sie eine eigene Dimension, als würde hoch über uns eine riesige Uhr ticken, die uns die absolute Zeit vorgibt, nach der wir uns zu richten haben, als wären die Atomuhren tatsächlich nur die Schauseite eines zwar vorhandenen, aber leider unsichtbaren Phänomens. Dem ist selbstverständlich nicht so.
Das geradezu Unausweichliche, Zwanghafte und vorgegeben Natürliche, das wir mit der Zeit verbinden, lässt sich wohl besser als Irreversibilität, als Unumkehrbarkeit fassen. Denn was wir als Zwangsjacke einer eigenständigen Dimension begreifen, die auf den Namen ›Zeit‹ hört, ist zunächst nichts anderes als die Erfahrung, dass sich die Dinge nicht zurückentwickeln.[4] Das zerbrochene Glas setzt sich nicht wieder zusammen, den gestrigen Tag können wir nicht noch einmal durchleben, und Menschen werden nicht jünger. Irreversibilität schließt Wiederholung oder Rückkehr natürlich nicht grundsätzlich aus: Das zerbrochene Glas lässt sich möglicherweise reparieren, man kann versuchen, die Ereignisse des gestrigen Tages so gut es geht noch einmal zu durchleben, und Verjüngungsphantasien sind nicht erst das Ergebnis der Möglichkeiten plastischer Chirurgie, sondern wohl so alt wie die Menschheit selbst. Aber dazu ist Kraftaufwand notwendig, und es ist von vornherein klar, dass das Ergebnis nicht dem ursprünglichen Zustand entsprechen wird.[5]
Geht man aber einen Schritt weiter von der Irreversibilität zur Zeit, dann haben wir es mit einem kulturellen und historischen Produkt zu tun. Ansammlungen von Menschen, unabhängig davon, ob man diese als Gruppen, Gesellschaften, soziale Systeme, Kulturen oder wie auch immer bezeichnen mag, bedienen sich bestimmter Techniken, durch die sie etwas hervorbringen, das sich als Zeit benennen lässt. Medien wie Kalender oder Uhren kehren diesen Effekt aber nicht selten um, denn sie erwecken den Eindruck, als würden sie etwas neutral registrieren – nämlich ›die Zeit‹ –, das unabhängig von unserem Wollen und Wirken in einer eigenen Sphäre existiert. Einem solchen »supravitalen« Zeitmodell anzuhängen ist auf jeden Fall vereinfachend, wahrscheinlich naiv und unter Umständen sogar gefährlich.[6]
Tatsächlich machen sich Kulturen ihre jeweils eigene Zeit und bedienen sich dazu unterschiedlicher ›Zeitmaschinen‹. Das Wort ›Zeitmaschine‹ soll hierbei keine Apparatur bezeichnen, mit der man, wie im bekannten Roman von H.G. Wells, durch die Zeit reisen kann. Das ist allein schon gedanklich problematisch, weil die Voraussetzung einer solchen Zeitreise eine eindimensionale und absolute Zeit wäre, durch die man sich wie durch ein Land bewegen könnte, das eine bestimmte geographische Ausdehnung hätte. Ich vertrete hier die These, dass wir in einer Vielzahl von Zeiten leben, die sich nicht auf einen einzigen Nenner herunterbrechen lassen, womit also gar nicht klar wäre, durch welche Zeit man mit Wells’ Zeitmaschine reisen sollte. Wenn ich hier von ›Zeitmaschine‹ spreche, dann meine ich das in einem durchaus produktiven Sinn: Wenn Kulturen sich ihre eigene Zeit (oder besser: ihre eigenen Zeiten) machen, dann benötigen sie dazu bestimmte Techniken. Die geläufigsten sind Uhren und Kalender. Sie scheinen eine Zeit nur zu registrieren, die sie tatsächlich beständig hervorbringen.
Das Perfide an der Zeit und unseren geläufigen Vorstellungen von ihr lässt sich an einer einfachen Beobachtung verdeutlichen: Immer und überall ist die Rede davon, dass Zeit gemessen wird. Zeit ist allerdings nicht sinnlich wahrnehmbar, man kann sie nicht sehen, hören oder riechen. Das bringt natürlich ein Problem mit sich, denn wie kann man ernsthaft behaupten, etwas zu messen, das sich jeder Wahrnehmung verweigert? Eine Stunde ist und bleibt sinnlich ungreifbar. Die Zeit entzieht sich der konkreten Zugänglichkeit – und das, obwohl alles Erscheinen Zeit in Anspruch nimmt und alles sinnlich Wahrnehmbare der Zeit verfallen ist.[7] Aber was tun Uhren dann? Messen sie nicht die Zeit? Wohl kaum. ›Die Zeit‹ als nicht existente, aber höchst wirkmächtige Vorstellung kann von Uhren gar nicht erfasst werden. Vielmehr zeigen Uhren »sozial normierte Geschehensabläufe mit gleichmäßig wiederkehrenden Ablaufmustern«[8] an, wie Minuten, Stunden, die Länge eines Arbeitstages oder die Dauer eines 100-Meter-Laufs. Uhren und Kalender stellen daher Standardisierungen dar, deren Zweck es ist, Relationierungen zu bewerkstelligen. Mittels Uhren können Vergleiche angestellt werden über die Dauer oder die Geschwindigkeit von Abläufen, die keinen unmittelbaren Vergleich zulassen, weil sie zeitlich oder räumlich zu weit auseinanderliegen. Uhren sind demnach sozial standardisierte Muster, um solche nicht direkt vergleichbaren Abläufe miteinander in Beziehung zu setzen. Im Verlauf der Jahrhunderte wurden Uhren daher nicht nur hinsichtlich ihrer Genauigkeit verbessert, sondern erfuhren durch ihre vereinheitlichende Normierung und globale Gültigkeit eine große Bedeutungssteigerung.[9]
Es handelt sich also zunächst um eine durchaus praktische, Abläufe vereinfachende Angelegenheit. Doch darf man den fatalen Effekt nicht übersehen, den ›Zeitmaschinen‹ wie Uhren, Kalender und andere Einrichtungen haben. Sie durchlaufen nämlich einen Prozess der Naturalisierung, machen also vergessen, dass es sich um technische Hilfsmittel handelt, mit denen Zeit nur koordiniert wird. Stattdessen werden sie als sichtbarer Ausdruck dieser unheimlichen Macht namens ›Zeit‹ aufgefasst. Aber:
»Es ist nicht die ›Zeit‹, die wir messen, nein, wir messen Veränderungen, Dynamiken, Prozesse und nennen dies ›Zeit‹. Die Uhr mißt demnach nicht die ›Zeit‹ vielmehr ist es der Lauf der Zeiger, den wir als ›Zeit‹ bezeichnen und mit besonderen Maßstäben etikettieren (Stunde, Minute, Sekunde). Dieser Sachverhalt verleitete Einstein dazu, die ›Zeit‹ als eine ›hartnäckige Illusion‹ zu kennzeichnen. […] Daher ist die Zeit ein menschengemachtes Netz, in dem man Spinne und Fliege zugleich ist. Indem wir die ›Zeit‹ kontrollieren, kontrollieren wir uns selbst. Wir produzieren, so gesehen, jene ›Zeit‹, die auf uns wirkt.«[10]
Zeit wird so zu einem der »schwarzen Löcher des Denkens«,[11] weil sie kein empirisches Außerhalb besitzt, weil Zeit nur in der Zeit vorkommt.[12] Wenn Zeit also nicht existiert, wären wir doch wieder bei der Ratlosigkeit des Augustinus. Lässt sich Zeit nicht bestimmen, obwohl sie unseren Alltag bestimmt? Möglicherweise ist es hilfreicher, die Zeit nicht an ihrem vermeintlichen Kern packen zu wollen, sondern sie eher über die Ränder anzugehen. Zeit hat keinen eindeutig identifizierbaren Ort (wo immer dieser auch angesiedelt werden mag: bei Gott, im Universum, im Individuum oder in der Gesellschaft), sondern Zeit entsteht im ›Zwischen‹.[13] Die Frage kann also nicht mehr lauten, was Zeit ist, sondern muss auf das Problem abzielen, wie Zeit verwirklicht wird, wie sie verwendet wird, in welchen Zusammenhängen sie dingfest gemacht werden kann. An die Stelle der definitorischen und abstrakten Frage nach der Zeit tritt die historische Frage nach den Zeiten.[14]
Kulturzeit
Eine Geschichte der Zeit kann ihren Gegenstand nicht in naiver Weise voraussetzen. Vielmehr ist das Problem in den Mittelpunkt zu stellen, wie Gesellschaften sich selbst zu bestimmten Geschehensabläufen und standardisierten Maßstäben der Zeitmessung in Beziehung setzen. Mit einem geglückten Ausdruck des Soziologen Norbert Elias kann man davon ausgehen, dass Gesellschaften sich ›zeiten‹, das heißt, die für sie bedeutsamen und erinnerungswürdigen Ereignisse in die Dimension der Zeit einordnen.[1]
Die historische Perspektive dürfte dafür ausreichend Belegmaterial liefern. Auch angesichts aller physikalischen oder juristischen Normierungen bleibt festzuhalten, dass Zeit immer um soziale Gruppen unterschiedlicher Größe zentriert war und ist – nicht zuletzt sind auch rechtliche und naturwissenschaftliche Festlegungen nichts anderes als Ergebnisse gesellschaftlicher Regulierungsprozesse.[2] Zeit ist daher zu verstehen als ein Mittel zur Orientierung in der sozialen und kulturellen Welt; sie dient ganz wesentlich dazu, das Zusammenleben von Menschen zu organisieren.
Die Regelmäßigkeit bestimmter Naturabläufe wie Tag-und-Nacht-Wechsel, Mondphasen, Jahreszeiten oder die Umlaufbahn der Planeten, die wesentlich zur Bestimmung der Zeit dienen, haben ohne Frage ihre Gültigkeit, auch ohne menschliche Beobachtungen. Um aus diesen Erscheinungen jedoch Grundlagen der Zeitmessung zu machen und aus ihnen Vorstellungen von ›der Zeit‹ abzuleiten, mithin spezifische Formen des Zeitwissens hervorzubringen, bedarf es des kulturellen Faktors. Schon Aristoteles hat festgestellt, dass es keine Existenz der Zeit ohne ein Bewusstsein geben kann, das diese Zeit wahrnimmt[3] – anders formuliert: kein Zeitwissen ohne menschliche Beobachtung. Die chronometrisch gemessene Zeit läuft nur so lange weiter, wie jemand da ist, der sie misst.[4] Es handelt sich um einen menschlichen und kulturellen Maßstab, der mit seinen Urhebern verschwinden wird.
Zeit ist also in all ihren Formen Teil der Kultur. Dies gilt unabhängig davon, ob man Varianten individuellen Zeitempfindens thematisiert oder naturwissenschaftlich orientierte Zeitvorstellungen, die Zeit als quantitativ, homogen, unendlich teilbar und kontinuierlich ansehen.[5] Zeit lässt sich nicht angemessen verstehen, wenn man sie als Container begreift, in die Geschehnisse menschlichen Lebens fügsam eingeordnet werden. Zeit ist vielmehr ein Bestandteil dieser Geschehnisse selbst,[6] denn sie entsteht erst, wenn etwas durch jemanden gemacht wird – weil mit diesem Machen immer auch Zeit erzeugt wird.
Zeitschaft
Ich will hier keine Theorie der Zeit entwickeln, sondern den Versuch einer Zeit-Geschichte unternehmen. Die Feststellung mag vielleicht überraschen, dass eine solche Geschichte der Zeit für die historischen Wissenschaften kein bevorzugtes Objekt darstellt.[1] Das hat sicherlich damit zu tun, dass die Beschäftigung mit Geschichte die Frage nach Veränderungen in der Zeit voraussetzt, von daher auf den ersten Blick kaum die Notwendigkeit besteht, sich mit dieser Zeit nochmals explizit zu beschäftigen – weil dies vermeintlich ohnehin schon immer geschieht. Bei näherem Hinsehen fällt jedoch auf, dass Zeit eher vorausgesetzt als problematisiert wird. Zeit ist der Rahmen, in dem sich Geschichte abspielt, aber in all seiner sozialen und kulturellen Bedingtheit gelangt dieser Rahmen kaum einmal in den Blick.[2] Gerade aufgrund ihrer vermeintlich selbstverständlichen ›Anwesenheit‹ wird die Zeit tendenziell übersehen: »›Zeit‹ ist etwas geradezu gefährlich Allgegenwärtiges […].«[3] Und ebendies macht eine Geschichte der Zeit umso notwendiger, denn: »Die Zeiten ändern sich mit der Zeit.«[4] Für eine Geschichte der Zeit ist daher weniger die Frage von Bedeutung, was diese Zeit denn nun ist, sondern vielmehr, wie der Mensch und wie soziale Gruppen zur Zeit kommen[5] und wie sich die Arten und Weisen des Zur-Zeit-Kommens im Lauf der Geschichte verändert haben. Das zeigt sich nicht zuletzt anhand der kaum behandelten Frage, was in unterschiedlichen historischen Konstellationen jeweils unter ›Gegenwart‹ verstanden wurde.
Einige begriffliche Instrumente können als Hilfsmittel dienen, um in diesem unendlichen Ozean der Zeiten nicht gänzlich die Orientierung zu verlieren: Zeitwissen, Pluritemporalität, Zeitregime und Zeitschaft sollen mir im Folgenden als begriffliche Richtungsweiser dienen.
Den Ausdruck ›Zeitwissen‹ (der eigentlich im Plural als die Zeitwissen verwendet werden sollte) habe ich bereits erwähnt. Mit diesem Begriff will ich dem Eindruck entgegenwirken, es handele sich bei der Zeit um eine objektive Gegebenheit, gewissermaßen ein Naturphänomen, das es nur noch korrekt zu messen gelte. Denn ›die Zeit‹ gibt es nicht, es gibt immer nur unterschiedliche Wissensformen von der Zeit.[6] Der Begriff ›Zeitwissen‹ bezeichnet daher die soziale und kulturelle Verankerung von Zeit. Unter dieser Maßgabe ist Zeit keine abstrakte, objektive, vom Menschen losgelöste Dimension. Vielmehr handelt es sich um bestimmte, soziokulturell hervorgebrachte Formen des Wissens von der Zeit, die notwendigerweise der historischen Transformation unterliegen.
Dass Zeitwissen immer nur in der Mehrzahl vorkommt, soll mit dem Begriff der Pluritemporalität unterstrichen werden. Pluritemporalität bezeichnet den Umstand, dass Kulturen, soziale Gruppen, Objekte, Ereignisse usw. zumindest potentiell dazu in der Lage sind, eigene Zeitformen auszubilden. Es handelt sich um den methodischen Zweifel an der möglicherweise naheliegenden Idee, wir hätten es nur mit einer einzigen Zeitform zu tun, die mit der Zeit der Uhren und Kalender zur Deckung gebracht werden könnte.[7] Der Ausdruck der Pluritemporalität ist zudem in der Lage, temporale Spannungssituationen zu beschreiben, die in einer bestimmten historischen Konstellation vorherrschen. In solchen Momenten lassen sich zum Beispiel parallel zueinander Phänomene finden, die durch ein rückwärtsgewandtes Zeitmodell, durch reversible Zeitschleifen oder durch den Vollzug irreversibler Zeitsprünge gekennzeichnet sind. Solche Spannungsverhältnisse sollten nicht voreilig wegerklärt werden, indem man einen bestimmten Umgang mit Zeit als den einzig angemessenen identifiziert. Sie müssen im Gegenteil in ihrer Komplexität thematisiert und in den Vordergrund gerückt werden. Der Begriff der Pluritemporalität kann darüber hinaus verhindern, dass sich eine Geschichte der Zeit (also auch meine hier vorgelegte) voreilig auf ein Fortschrittsmodell des Zeitwissens festlegt. Denn alte Formen des Zeitwissens verschwinden nicht einfach, um von neueren nahtlos ersetzt zu werden. Sie werden abgedrängt, verlieren an Bedeutung, erfahren weniger Beachtung, behalten aber trotzdem eine gewisse Bedeutung bei und nehmen an der allgemeinen Konkurrenz der vielfältigen Zeitformen teil.[8]
Das Wissen von der Zeit ist allerdings nicht nur sozial und kulturell fundiert, ist nicht nur historisch variabel und kommt nicht nur in pluralen Formen vor, sondern ist auch machtgesättigt. Der Begriff des ›Zeitregimes‹ (auch hier ist der Plural angemessen) bezeichnet diese machtförmige Aufladung unterschiedlicher Formen des Zeitwissens. Zeit wurde und wird immer eingesetzt, um Macht zu demonstrieren, Macht auszuüben oder auch Gegenmächte zu etablieren.[9] Umgekehrt kann Macht dazu verwendet werden, die einzige Ressource zu vermehren, die sich eigentlich nicht vermehren lässt: Zeit. Dinge zu erschaffen oder zu zerstören erfordert Zeit – die mittels Delegation multipliziert und potenziert werden kann.[10]
Von dem Kunsthistoriker George Kubler stammt die Formulierung, dass es für Objekte ebenso viele Möglichkeiten gibt, Zeit einzunehmen, wie sie Raum einnehmen können.[11] Diese These verweist auf den untrennbaren Zusammenhang von Zeit und Raum, der sowohl im relativitätstheoretischen Begriff der ›Raumzeit‹ wie auch im historischen ›Zeitraum‹ zum Ausdruck kommt. Der Konnex von Raum und Zeit kommt einer Binsenweisheit gleich. Es gibt keine Erfahrung, die ohne einen Ort und ohne eine Zeit auskäme. Mit Blick auf den Raum akzeptieren wir dabei völlig selbstverständlich seine Diversifizierung, seine ungeheure Vielfältigkeit, haben keinerlei Schwierigkeiten, von Räumen im Plural oder von Landschaften zu sprechen. Bei der Zeit geht man hingegen üblicherweise immer noch davon aus, dass es sich um eine einzige und um eine einheitliche handelt. Die Vorstellung unterschiedlicher, parallel zueinander existierender Zeiten wirkt befremdlich.
Der Begriff ›Zeitschaft‹ soll dazu dienen, parallel zum Begriff der Landschaft die Vielfältigkeit der Zeiten zum Ausdruck zu bringen.[12] Im Englischen ist der Begriff timescape schon eher etabliert.[13] Im Deutschen wird zuweilen der Ausdruck des Chronotopos verwendet, wie er vom russischen Literaturwissenschaftler Michail Bachtin etabliert wurde.[14] Die ›Zeitschaft‹ soll ein komplexes Ensemble bezeichnen, das über die Verbindung von zeitlichen beziehungsweise historischen Dimensionen mit räumlichen Konstellationen hinausgeht. Es handelt sich um den Zusammenhang von äußerlichen Voraussetzungen (wie Tag-und-Nacht-Wechsel, Jahreszeiten, Umlaufbahn der Planeten, Entropie, individuelle Erfahrungen des Vergehens von Zeit in Alterungsprozessen etc.), kulturellen Konstruktionen (in Form von Zeiterfassungssystemen oder Konzepten von Vergangenheit/Gegenwart/Zukunft) sowie sozialen, politischen und wirtschaftlichen Nutzungen von Zeit, die jeweils wechselseitig aufeinander einwirken.
Mit einem solchen Begriff der Zeitschaft ergibt sich die Möglichkeit, komplexe Zeitsituationen in den Blick zu nehmen und zu beschreiben, und zwar ohne sich im Vorfeld auf ein bestimmtes Verständnis von Zeit festlegen zu müssen. Damit wäre zunächst und vor allem eine offene Beschreibungskategorie vorgegeben, die sich situationsspezifisch auffüllen lässt. Gerade weil dieses Kunstwort gewöhnungsbedürftig ist, kann es deutlich machen, dass es sich bei der Zeit nicht um etwas gewissermaßen Natürliches, um etwas nahezu Selbstverständliches handelt, sondern um etwas historisch und kulturell spezifisch Geformtes.
Eine Zeitschaft muss als ebenso komplex, vielfältig und bunt angesehen werden wie eine Landschaft (wenn auch mit dem entscheidenden Nachteil, dass sie nicht sinnlich wahrnehmbar ist). In diesem Buch möchte ich die europäische Zeitschaft des längeren 17. Jahrhunderts (also mit Ausgriffen in das 16. und das 18. Jahrhundert) genauer in den Blick nehmen. Wie bereits ausgeführt, erscheint mir dieser Zeitraum deswegen relevant, weil hier mit einer gestiegenen Bedeutung von ›Gegenwart‹ und einem stärkeren Bezug auf Gegenwärtigkeit ein Zeitwissen etabliert wurde, das auch heute noch gilt. Die Frage, die sich aus einem solchen Befund ergibt, ist jedoch, wie es zu diesen Verschiebungen im europäischen Zeitwissen kam. Bevor aber die Gegenwart zu ihrem Einsatz kommt, müssen wir dem Ende aller Zeiten ins Auge blicken.
Ein Ende von Anfang an
What we call the beginning is often the end
And to make an end is to make a beginning.
The end is where we start from.
T.S. Eliot[1]
Kalenderblatt 1630
Es sah nicht gut aus. Die Prognosen wiesen auf Krieg und Blutvergießen hin, auf Pest, Inflation und Hunger, auf Überschwemmungen und Erdbeben, auf den Tod von Oberhäuptern und den Zerfall der politischen Ordnung. Der Schluss, den man aus solchen Aussichten zu ziehen hatte, war naheliegend. Das Ende der Welt kündigte sich an. Solche Verhältnisse als »Elender/betrübter Zustand« zu bezeichnen kam fast schon einer Untertreibung gleich. Gleichwohl machte der unbekannte Herausgeber des Kalenders mit diesem Titel auf den wesentlichen Inhalt seiner Zusammenstellung aufmerksam, in der die Vorhersagen von 20 unterschiedlichen Kalendermachern und Astrologen für das Jahr 1630 vereinigt waren.[1]
Wir haben es hier nicht mit einem klassischen Kalender zu tun, der als terminlicher Wegweiser durch das Jahr dienen würde, sondern mit einer Art Metakalender, einem »Best of« (oder »Worst of«) der wichtigsten – und trübsinnigsten – Aussichten auf das kommende Jahr. Dass dieser Blick voraus nicht allzu erfreulich ausfallen konnte, ist für ein deutschsprachiges Produkt dieses Zeitraums nicht verwunderlich. Immerhin befinden wir uns inmitten des Dreißigjährigen Krieges, und dieser Konflikt, in den erhebliche Teile Europas direkt oder indirekt involviert waren, gab kaum Anlass zu freudigen Erwartungen. Der Kalenderschreiber Mauritius Huberinus (Moritz Huber, Lebensdaten unbekannt), der in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts in Nürnberg tätig war, fand hierfür fast schon poetische Worte:
»Es ist männiglichen bekand/das die jenigen/welche sich unterstehen einen Moren weiß zu baden/oder Wasser in einem Sieb auffzuhalten/jedesmals vergebens gearbeitet haben. Eben dergleichen würde auch mir wiederfahren/wann ich dieser zeit/von Krieg und Unfrieden viel prognosticirens machen wolte/weil kein Winckel in der Welt zu finden/darinnen Mars sein Panier nicht auffgestecket hette […].«[2]
Die Zustände waren aber nicht nur wegen der Dominanz des Kriegsgottes elend und betrübt. Vielmehr war der Krieg nur ein Indiz für einen wesentlich größeren Problemzusammenhang, nämlich für die Überzeugung vom nahenden Ende der Welt. David Herlicius (David Herlitz, 1557–1636), Mathematiker, Dichter und vielfach Gelehrter aus Pommern, wurde in dieser Zusammenstellung dazu wie folgt zitiert:
»Das Griechische Wort Prognosticon heisset so viel auff Deutsch/eine zuvor verkündigung derer ding/die noch künfftig sind. Was sol ich dann vom Krieg verkündigen/der (Gott im hohen Himmel erbarme es doch nunmehr endlich) nicht zukünfftig/sondern leyder/leyder gegenwertig gnug ist? Und ich glaub nicht/das der Teuffel/als der Höllische Störenfried zu wüten auffhören werde. Weil er sieht/daß der liebe Jüngste Tag nicht mehr fern sein werde. […] Ach wer nur hier bald selig sterben/und mit frieden in sein Schlaffkämmerlein kommen möchte.«[3]
Von hier aus war es dann nicht mehr weit bis zu den biblischen, endzeitlichen Plagen, wie sie in der Offenbarung des Johannes eindrücklich geschildert werden und wie sie ein gewisser Jan von der Gartau in dieser Sammlung zusammenfasst.
»[D]ann es sind die letzten Zeiten und Tage/darinnen solche Zeichen und Wunder müssen geschehen/wovon Christus/alle Propheten/Aposteln und heilige Männer geweissaget/und von andern viel geschrieben worden. Die Wunder nun/so geschehen sollen/sind diese/nemlich es geschehen Zeichen an der Sonn/Mond und Sternen […] Es seyn Pestilentz und theure Zeit/und Erdbeben hin und wieder.«[4]
Außerdem drohten Krieg und Viehseuchen, gefolgt von Unwettern, Heuschrecken, Finsternis, Vernichtung der Gottlosen und schließlich dem Jüngsten Gericht – und von all dem kündete das Jahr 1630 nach Christi Geburt laut Auskunft dieser Kalenderkompilation nur allzu deutlich.[5]
Das alltägliche Ende
Am Anfang steht also das Ende. Wenn man im 17. oder im 16. oder in noch früheren Jahrhunderten über die Zeit und den Lauf der Geschichte nachdachte, dann war dieses Nachdenken fast notwendig final ausgerichtet.[1] Die Zeit hatte ein Ende. Für einen ganz erheblichen Teil der europäischen Geschichte war das Ende aller Zeiten nicht nur ein fernes und ungefähres Abstraktum, das fahl durch den Nebel zukünftiger Entwicklungen schimmerte. Es stellte vielmehr eine konkrete Gegenwart dar. Das Ende war gewiss und allseits präsent.[2]
Dieses Ende konnte sich auf sehr vielfältige Art und Weise manifestieren.[3] Das Ende des individuellen Lebens stand den Menschen als jederzeit drohendes Szenario unmittelbar vor Augen – nicht zuletzt weil sein plötzliches und unvorhersehbares Eintreten zu den beständigen Erfahrungen des Alltags gehörte. Doch die Erwartung des Endes der Welt beeinflusste die alltägliche Lebensgestaltung ebenso sehr.[4] Diese Fixierungen auf das letzte Stündlein oder das Jüngste Gericht ergaben sich aus der zutiefst christlichen Prägung der europäischen Wirklichkeit dieser Zeit. Das abendländische Christentum – seit der Reformation in verschiedene Konfessionen aufgespalten – durchdrang den Alltag der Menschen in jeder nur erdenklichen Weise. Es gab eigentlich keinen Lebensbereich, der nicht (auch) durch die Religion geprägt war. Möglicherweise spielte das Christentum seit dem 16. Jahrhundert sogar eine noch größere Rolle im Leben der Menschen als in den Jahrhunderten zuvor. Insbesondere durch eine engere Verbindung von Staat und Kirche sowie durch die neuen medialen Möglichkeiten, die der Buchdruck mit beweglichen Lettern mit sich gebracht hatte, konnten christliche Inhalte auf eine neue Weise in den Alltag eindringen.[5] Man kann durchaus davon sprechen, dass die Menschen dieser Zeit der Überzeugung waren, »Akteure in einem göttlich-kosmischen Drama zu sein, für dessen Aufführung ihnen Gott mit der Bibel nicht nur das Drehbuch, sondern auch die Regieanweisungen gegeben hatte«.[6]
Die Deutung der eigenen Welt und des eigenen Lebens war in einem Maße religiös imprägniert, wie man sich das zu Beginn des 21. Jahrhunderts nur noch schwer vorstellen kann. Dabei ist es vielleicht weniger die Bedeutung des Religiösen an und für sich, die in der historischen Rückschau Schwierigkeiten bereitet, sondern es ist die Alternativlosigkeit, die befremdlich anmutet. Es gab nämlich während der Frühen Neuzeit noch kein Weltdeutungsmodell, das der Religion ernsthaft Konkurrenz hätte machen können – oder zutreffender formuliert: Diese Alternativen bildeten sich in Form der Wissenschaften erst allmählich aus. Für den weitaus überwiegenden Teil der Menschen in Europa bedeutete dies, dass sie auf religiöse Deutungsmuster zurückgreifen mussten, wenn sie sich die Welt erklären wollten.[7]
Das galt nicht zuletzt auch für das Nachdenken über die Zeit, über Vergangenes und Zukünftiges, über Ursprünge und Vergänglichkeiten, über den Anfang und das Ende. Und das Ende war nah. Auch wenn es mit sehr vielen Fragezeichen und Unsicherheiten ob seiner konkreten Ausgestaltung verbunden war, so war doch ein ganz erheblicher Teil der europäischen Bevölkerung der Überzeugung, dass dieses Ende kommen würde, dass es bald kommen würde – möglicherweise schon unmittelbar vor der Tür stand.
Es war eine unhinterfragte Selbstverständlichkeit, dass das irdische Schöpfungswerk irgendwann an sein Ende gelangen werde, um einer anderen Welt Platz zu machen. Die Anhänger des Christentums stimmten seit dessen Anfängen darin überein, dass Christus durch seine Auferstehung den Weg des Heils vorgezeichnet habe. Wenn im Christentum über das Heil nachgedacht wurde, dann war dies immer mit einer Eschatologie verknüpft, mit einer Lehre von den letzten Dingen und dem Ende der Welt, deren zentrale Aussage darin bestand, dass Christus am Ende der Zeiten auf die Erde zurückkehren werde. Endzeitliches Denken führte daher zu einer Inversion der Geschichte: Sie beginnt mit dem Ende und endet mit dem Anfang.[8]
Finale Kalkulationen
Es gab nicht nur ein Ende. Es gab eine Vielzahl an Endzeitvorstellungen, die zu unterschiedlichen Zeiten vorherrschten und die vor allem den jeweiligen Bedürfnissen unterschiedlicher konfessioneller und sozialer Gruppen angepasst waren. Das Ende der Welt, wie man sie kannte, war zwar stets der zentrale Bestandteil – darüber hinaus gab es aber große Meinungsverschiedenheiten darüber, wann das Ende kommen würde, wie es konkret vonstattengehen sollte und wer auf welche Weise davon betroffen wäre.[1]
Mathematische Annäherungen können verdeutlichen, wie bedeutsam und konkret für die Zeitgenossen des 16. und 17. Jahrhunderts das Ende der Welt war. Zwar wurde regelmäßig wiederholt, dass die näheren Umstände zukünftiger Entwicklungen mehr als ungewiss seien, und es war theologisch recht heikel, sich in entsprechenden Mutmaßungen zu ergehen. Doch war das Verlangen, Näheres über das drohende Finale zu erfahren, unübersehbar. Hierauf verwendeten die Menschen eine nicht unerhebliche Menge an Zeit und Energie. Grundlage war die weithin geteilte Überzeugung von der begrenzten Zeit, die der Welt überhaupt zur Verfügung stand. Auf der Grundlage biblischer Angaben und heilsgeschichtlicher Überlegungen wurden für die Dauer der Schöpfung in etwa 6000 Jahre veranschlagt – abgeleitet aus den sechs Schöpfungstagen sowie aus dem Umstand, dass für den Schöpfer tausend Jahre wie ein Tag seien (2. Petrus 3,8). Aufgrund der – sehr schwierigen – Summierung alttestamentarischer Generationenfolgen kam man auf einen Schöpfungszeitpunkt, der circa 4000 Jahre vor Christi Geburt gelegen haben musste, so dass der Welt nach dieser Zeitenwende noch etwa 2000 Jahre zur Verfügung standen.
Solche Berechnungen zum Alter und zur noch währenden Dauer der Welt wurden auch jeder Käuferin und jedem Käufer eines Kalenders mit der größten Selbstverständlichkeit präsentiert. Denn zu den standardisierten Basisinformationen eines Kalenders gehörte die heilsgeschichtliche Einordnung des jeweiligen Jahres. Im Kalender des Mathematikers und Astronomen David Froelich (1595–1648) für das Jahr 1651[2] findet sich beispielsweise folgende, in dieser Form typische Zusammenstellung:
»Im Jahr nach der heiligen Geburt deß Sohns Gottes 1651 [Jahre].
Von Erschaffung der Welt 5600 [Jahre].
Von der Sündflut 3944.
Vom Leiden/Sterben und Aufferstehung Christi 1618.
Vom Anfang des Julianischen Calenders 1695.
Von dem Newen und durch den Pabst Gregorium XIII. corrigirten Calender 69.
Von der beharrlichen Regierung des H. Römischen Teutschen Reichs durch die hochlöblichsten Oesterreichischen Ertzhertzöge das 213.
der Kayserlichen Regierung Ferdinandi III. das 15.
der Königlichen Ungerischen Crönung das 26.
der Böhmischen das 24.
Von Anfang des jetzigen Teutschen Krieges das 33. Jahr«[3]
Insbesondere unter den Reformatoren des 16. Jahrhunderts ging man jedoch davon aus, dass die letzten 1000 dieser etwa 6000 Jahre währenden Haltbarkeit um der Gnade willen verkürzt würden (Matthäus 24, 22), so dass das Ende der Welt nicht erst 2000 Jahre nach Christi Geburt, sondern bereits jetzt, im 16. Jahrhundert stattfinden würde. Und für ebendiese unmittelbar zu erwartende Apokalypse fanden die Zeitgenossen in ihrer Gegenwart mehr als genug Hinweise: Seuchen, Naturkatastrophen, Kriege, bedrohliche Kometen, aber insbesondere der Zustand der päpstlichen Kirche waren mehr als deutliche Fingerzeige, wohin die Reise ging.[4]
Es gab sehr prominente Vertreter einer mathematisierenden Eschatologie. Einer der im 16. Jahrhundert sicherlich einflussreichsten war Martin Luther, der sich auf die Weissagung des Propheten Elia bezog. Demnach sollte die Welt dreimal 2000 Jahre dauern: 2000 Jahre vor Verkündung der Zehn Gebote, 2000 Jahre unter dem göttlichen Gesetz und 2000 Jahre unter dem Messias. Für Luther bedeutete diese Berechnung aber nicht, dass das Jüngste Gericht erst im Jahre 2000 nach Christi Geburt kommen würde und damit aus der Perspektive des 16. Jahrhunderts noch Jahrhunderte hinausgeschoben werden musste. Er nahm vielmehr eine Beschleunigung der Endzeit an – eine fast schon modern anmutende Idee der Temposteigerung. Er fand nicht nur entsprechende Bibelstellen, die besagten, dass die letzten Tage um der Auserwählten willen verkürzt würden, sondern extrapolierte aus dem Umstand, dass Jesus vor seiner Auferstehung nicht volle drei, sondern nur zweieinhalb Tage tot gewesen sei, die Regel, dass man das letzte Jahrtausend halbieren müsse. Die Welt würde demnach nicht 6000, sondern nur 5500 Jahre dauern – ein Zeitraum, der laut Luther dem Jahr 1540 nach Christus entsprach. Hält man sich vor Augen, dass Luther diese Berechnung in ebendiesem Jahr 1540 anstellte, kann man erahnen, wie sehr er (und andere) das Weltende nicht nur als unmittelbar bevorstehend ansahen, sondern geradezu herbeisehnten.[5]
Ähnliche Berechnungen finden sich im 16. und 17. Jahrhundert allenthalben, wobei die zeitliche Einordnung apokalyptischer Erwartungen zunehmend präziser gestaltet wurde. Die prophezeiten Ereignisse wurden einer immer detaillierteren Terminplanung unterworfen und zugleich mit exakteren Bestimmungen hinsichtlich vergangener und gegenwärtiger Ereignisse verknüpft.[6] Zahlreiche Stimmen warteten während des 16. Jahrhunderts mit Terminierungen des Weltendes auf, wobei sich die Daten zum Ende des 16. Jahrhunderts verdichteten. Die Jahre 1577, 1578, 1580, 1581, 1584, 1588, 1604, 1618 oder 1623 wurden unter anderem genannt. Keine herausragende Rolle spielte hingegen das Jahr 1600 als markanter Punkt einer Jahrhundertwende. Diesem Aspekt ließen die Zeitgenossen offensichtlich noch keine größere Aufmerksamkeit zukommen.[7]