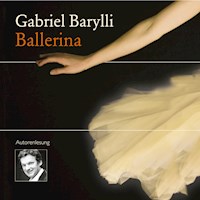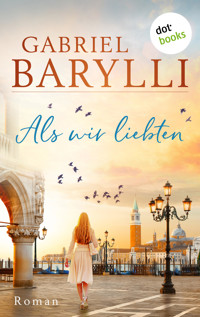5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Glück wartet dort, wo du es am wenigsten erwartest: Der gefühlvolle Roman »Die Bar am Ende der Welt« von Gabriel Barylli als eBook bei dotbooks. Der Duft von wildem Thymian – der sanfte Klang der Wellen … In einer zauberhaften Inselbucht am Mittelmeer liegt eine Bar, umgeben von grünen Pinienwäldern und dem tiefen Blau der See. Wer diesen magischen Ort findet, der atmet Freiheit, vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben. So geht es auch dem fremden Mann, der eines Abends Manuels Bar betritt, sein junges Gesicht von Schmerz und Hoffnungslosigkeit gezeichnet. Doch schon wenige Worte von Manuel reichen aus und die Gesichtszüge des Fremden werden weicher. Und so erzählt Manuel weiter: von dem tiefen Band, das sie alle auf der Insel miteinander verbindet, von seinem Weg zu sich selbst – und zu Verenice, der Liebe seines Lebens. Und während der Abend langsam in die mondbeschienene Nacht übergeht, beginnt der junge Mann zu ahnen, welche Kräfte in seinem eigenen Herzen verborgen liegen … Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der berührende Roman »Die Bar am Ende der Welt« von Bestseller-Autor Gabriel Barylli – auch bekannt unter dem Titel »Alles, was du suchst«. Leser von John Strelecky werden begeistert sein, wie Gabriel Barylli den Zauber der Selbstfindung mit dem Glück von zweiten Chancen und einer bewegenden Liebesgeschichte verwebt. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 372
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über dieses Buch:
Der Duft von wildem Thymian – der sanfte Klang der Wellen … In einer zauberhaften Inselbucht am Mittelmeer liegt eine Bar, umgeben von grünen Pinienwäldern und dem tiefen Blau der See. Wer diesen magischen Ort findet, der atmet Freiheit, vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben. So geht es auch dem fremden Mann, der eines Abends Manuels Bar betritt, sein junges Gesicht von Schmerz und Hoffnungslosigkeit gezeichnet. Doch schon wenige Worte von Manuel reichen aus und die Gesichtszüge des Fremden werden weicher. Und so erzählt Manuel weiter: von dem tiefen Band, das sie alle auf der Insel miteinander verbindet, von seinem Weg zu sich selbst – und zu Verenice, der Liebe seines Lebens. Und während der Abend langsam in die mondbeschienene Nacht übergeht, beginnt der junge Mann zu ahnen, welche Kräfte in seinem eigenen Herzen verborgen liegen …
Über den Autor:
Gabriel Barylli wurde 1957 als Sohn eines Wiener Philharmonikers und einer Sängerin geboren. Nach seiner Ausbildung am Wiener Reinhardt-Seminar folgten Engagements am Burgtheater und in Berlin sowie Salzburg. Neben seinen zahlreichen Rollen für Film und Fernsehen schrieb Gabriel Barylli Theaterstücke sowie Romane, die regelmäßig die Bestsellerlisten eroberten. Seinen gefeierten Debütroman »Als wir liebten«, auch bekannt unter dem Titel »Butterbrot«, verfilmte er erfolgreich selbst. Er ist der meistgespielte deutschsprachige Theaterautor der Gegenwart.
Der Autor im Internet: www.gabrielbarylli.com/
Bei dotbooks veröffentlicht Gabriel Barylli auch seine berührenden Liebesromane »Als wir liebten« und »Die Ewigkeit in jedem Kuss«.
***
eBook-Neuausgabe Juli 2020
Dieses Buch erschien bereits 2001 unter dem Titel »Alles, was du suchst« bei Argon
Copyright © der Originalausgabe 2001 Argon Verlag GmbH, Berlin
Copyright © der Neuausgabe 2020 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock / box of pic / thanakom_pae / Nella / Anna Kraynova / Dudarev Mikhail / Patryk Kosmider / Carcompix / Anton Watman / Sundari
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-96148-965-7
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Bar am Ende der Welt« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Gabriel Barylli
Die Bar am Ende der Welt
Roman
dotbooks.
Für meine Freunde
»Das Lachen ist der Ernst der Götter«
Daniela
Der Gast
Ich kenne diesen Blick.
Man hat ihn, wenn man etwas verloren hat. – Wenn man etwas verloren hat, von dem man schon glaubte, keine Macht der Welt könnte es einem jemals wegnehmen, dann hat man diesen Blick. Langsam heben sich die Augen in die Höhe, wenn eine Bewegung den Raum verändert. Langsam wandern sie von einem Menschen zum nächsten. Es ist eine Stille, die aus diesem Blick erwächst, und die Frage: Warum? ...
Warum ...
Warum hat sich das Leben von einem Tag auf den nächsten verwandelt? Warum ist das Liebste plötzlich zum Fernsten geworden?
Warum?
Jedes Menschenalter hat diese Erfahrungen. Jedes Kind erfährt, daß seine Sandburg am Strand nach wenigen Stunden wieder unsichtbar wird.
An irgendeinem Tag begreift man, daß alles, was wir errichtet haben, vergehen muß. An irgendeinem Tag wird diese Erkenntnis zum ersten Mal zu einem Gefühl. All das, was man bis zu diesem Tag gelesen und gehört hat, daß unsere Sandburgen den Gezeiten unterworfen sind, all das wird zu einer fühlbaren Qualität. Plötzlich heißt es aufwachen und realistisch sein.
Realistisch – was für ein Wort. Ein Wort, dem wir so lange entkommen wollen, bis es uns überholt und lächelnd sagt: »Schau mich an ...«
Dann stehen wir da – atemlos vor Anstrengung – und müssen erkennen, daß wir nicht der Herr der Gezeiten sind. Wir sind nicht die Wellen des Meeres, wir sind nicht Ebbe und Flut, wir sind ... Ja – was sind wir? Diese Frage ist es, die uns zwingt, die Welt mit einem anderen Blick zu betrachten.
Diesen Blick habe ich gemeint, diesen Blick hatte der junge Mann, der vor einer halben Stunde meine Bar betreten hatte.
Er war abwartend über die Schwelle getreten, hatte sich langsam umgesehen und sich dann an einen Tisch nahe beim Fenster gesetzt, von dem aus man das Meer sehen kann. Sein Blick war weich und mit einer zarten Melancholie versehen über die Gegenstände geglitten, hatte auf jedem kurz verweilt und war weitergezogen. Er hatte einen Moment lang auf Verenice angehalten, die nur kurz aus der Küche gekommen war, und war dann zu mir gelangt. Er hatte mir kurz zugenickt und sich dann auf seinen Platz gesetzt. O ja – ich kenne diesen Blick. Ich kenne seine Wehmut, seine Bitte um Verständnis, seine Frage – warum? Ich hatte den jungen Mann angeschaut und wußte, daß er eine lange, schöne Geschichte erlebt hatte, wie alle, die den Weg in meine Bar finden. Sie war schön, weil sie seine Geschichte war. Sie war schön, weil sie ihm durch alle Schmerzen und Verwundungen hindurch zeigen konnte, daß er erst am Beginn seines wahren Lebens stand. Sie war schön, obwohl er in diesem Moment, in dem er meine Bar betreten hatte, ganz sicher der Meinung war, am Ende seines Weges angekommen zu sein.
Ich kenne den Blick, der sagt: Es ist vorbei – das war's! Ich habe gekämpft, um die Wellen des Lebens zu bezwingen, ich habe mich gewehrt gegen Ebbe und Flut, ich habe gefochten bis zum letzten Hieb. Meine Burg zerfällt, ich gebe auf.
In diesem Moment ist es gut, am Ende der Welt angekommen zu sein, ein paar Holzstufen hochzusteigen, über eine Terrasse zu gehen und meine Bar zu betreten.
Verzeihen Sie – ich habe Ihnen ja noch gar nicht erzählt, wo meine Bar liegt und wie sie aussieht –, aber der Ausdruck in den Augen dieses jungen Mannes hat mich so sehr an mich selbst erinnert, als ich vor vielen Jahren an diesen Platz gekommen bin: an diese Bucht, an deren Strand mit seinem einfachen weißen Holzbau, in dem meine Bar liegt.
Stellen Sie sich eine Insel vor. Mitten im Meer. Ein nicht allzu großer Flughafen, eine uralte Hauptstadt, über die die großen Ereignisse der Geschichte hinweggezogen sind wie die Ausläufer eines Sturmtiefes. Die hohen, aus sandfarbenem Stein gebauten Mauern haben viele Eroberungen überstanden. Piraten haben diese Insel oft überfallen. Es gibt keine hohen Berge auf diesem Stück Erde – keine Wasserfälle und keine 1000 Jahre alten Riesenbaumwälder. Es gibt nichts, was einem großen Feldherrn und Schicksalsbestimmer in die Augen stechen könnte. Nichts, was ihn treiben könnte, hier das Lager seiner Macht zu errichten. Kein Gold, kein Silber und kein Öl haben jemals eine Macht verleitet, hier auf dieser, meiner Insel ihre Zelte aufzuschlagen.
Das ist ihr Geheimnis. Ihr Geheimnis ist – daß sie keines hat. Meine Insel ist das, was man unscheinbar nennt – und infolgedessen ein Ort für wahres, tiefes Glück. Das ist wie bei einem Ball, bei dem man beobachten kann, wie sich die Schönen und Strahlenden lachend und lärmend im Kreise drehen, während ein stiller, scheuer junger Mann zu einem Mädchen blickt, das mit einem unsichtbaren Lächeln verloren an der Wand lehnt und wartet. Es gibt für nichts im Leben eine Sicherheit – aber die Wahrscheinlichkeit, daß die beiden ein längeres und tieferes Glück erleben können als all die anderen, die gibt es. So ist es auch mit meiner Insel. Wenn man möchte, ist man mit einem guten Wagen in drei bis vier Stunden einmal rund um ihre Küste gefahren. Man hat ihre sanften Hügel kennengelernt und die Terrassen, die über viele Generationen in die Landschaft gemalt worden sind und auf denen heute wie immer Schafe weiden. In einem bestimmten Tal blühen im Winter die Mandelbäume, und überall riecht es nach Thymian. Das ist alles. Und das Meer. Das habe ich fast vergessen zu erwähnen, weil es mir schon so selbstverständlich ist, nach all den Jahren. Wenn man möchte, sieht man von jedem Punkt meiner Insel das Meer. Sie ist einfach so klein. So klein, daß man sie übersieht, wenn man nicht den Blick für die verborgenen Schätze des Lebens hat.
Ich lebe an einer Bucht. Weicher, heller Sand zeichnet einen weiten Halbmond zwischen dem blauen Meer und dem Grün der Pinienwälder, die meine Bucht umgeben. An der Grenze zwischen dem Strand und den ersten Bäumen steht ein einfaches, weißes Holzhaus. Man geht drei Stufen hinauf und betritt eine Terrasse. Ihr Boden ist aus langen Holzbrettern gezimmert, die im Lauf der Jahre einen weichen Grauton angenommen haben. Sie haben schmale Zwischenräume, durch die man auf den Sand hinuntersehen kann, und manchmal sieht man schnelle Eidechsen, die sich vor der Sonne in den Schatten retten.
Links und rechts von der Treppe führt ein Holzgeländer hinauf zur Terrasse, und jedes zweite Jahr streiche ich die Bretter mit weißer Farbe nach. Das sollte ich eigentlich jedes Jahr tun, aber ich liebe es, wenn die Dinge ihr Alter zeigen und nicht kokett sind. Maskerade und Schminke können über die Realität hinweghelfen. Ich habe auch wirklich nichts dagegen, wenn ich sehe, wie sehr ein klein wenig Farbe im Gesicht eines Menschen ein anderes Universum in seinen Augen aufleuchten läßt – es sollte aber nicht zur Gewohnheit werden. Es sollte nicht soweit kommen, daß man eines Tages den Bemalungen mehr Glauben schenkt als dem Grund, auf dem sie aufgetragen sind – also habe ich es sehr gerne, zu sehen, wie das Holz durchzuscheinen beginnt und jeden zweiten Herbst sein wahres Gesicht zeigt. Es ist eine Mahnung, um die Wahrheit nicht zu verdrängen.
Auf der Terrasse stehen ein paar einfache Holztische und Holzstühle, die mit Armlehnen versehen sind. Es ist ein großer Unterschied, ob man sich auf Armlehnen stützen kann und sich völlig entspannen oder ob man – wie von einem normalen Stuhl – zur Disziplin der aufrechten Haltung angehalten wird. Die lange Vorderfront meiner Bar ist symmetrisch angelegt. In der Mitte sieht man eine Schwingtüre, wie man sie aus dem amerikanischen Westen kennt. Die beiden Flügel sind mit Jalousien versehen, und die linke Angel singt ganz leise und hell, wenn jemand von der Terrasse in die Bar kommt. Neben der Schwingtüre sind links und rechts zwei große Fenster, die man nach oben schiebend öffnen kann. Ich mag diese Art, ein Fenster zu öffnen, weil sie niemanden stört, der dort sitzt und ein Buch liest. Oder auf das Meer blickt. Oder träumt. Wenn man durch die Schwingtüre getreten ist und noch ihr leises, helles Singen hört, steht man in meiner Bar. Der Boden ist aus demselben Holz wie die Bretter auf der Terrasse, nur ohne Zwischenräume verlegt. Durch die gesamte Länge des Raumes zieht sich der Bartresen, hinter dem an der Wand ein großer Spiegel hängt, der auf beiden Seiten von Flaschen aus aller Welt umrahmt wird. Und ich habe es noch nie erlebt, daß jemand bei mir etwas bestellt hätte, das ich nicht an dieser Wand stehen habe. Es kann sein, daß nur diejenigen den Weg zu mir finden, die von ihrer Natur aus mit meinem Angebot korrespondieren. Das wird es sein. Das Leben führt nur Menschen an den Ort, der auf sie wartet. Weil der Ort weiß, daß derjenige Mensch kommen muß, auf den der Ort wartet. Und er wartet mit allem, was er hat, auf diesen Menschen. Sie werden bei mir nicht jedes Getränk dieser Erde finden, aber Sie werden finden, wonach Sie suchen. Wenn man durch die Schwingtüre getreten ist, sieht man als ersten Menschen – sich selbst.
Das Holz, aus dem der Tresen gezimmert ist, hat eine Farbe, die zwischen Honig und Armagnac schwebt. Ich habe dieses Holz mit großer Sorgfalt ausgewählt, als ich den alten Tresen abmontieren ließ. Dieses Haus war nämlich schon eine Bar, als ich zum ersten Mal in dieser Bucht angekommen war, und die Schwingtüre hat schon damals gelächelt, als ich durch sie hindurchgetreten war und Verenice zum ersten Mal in die Augen gesehen habe ... – aber von meinem eigenen Leben erzähle ich Ihnen später; lassen Sie mich noch ein wenig diesen Raum beschreiben, in dem man sich selbst gegenübertreten kann. Die beiden großen Frontfenster führen hinaus und lassen den Blick über die Terrasse zum Meer und weit bis zum Horizont fliegen. Wenn die Scheiben an einem warmen Abend nach oben geschoben sind, hat man das Gefühl, als säße man mitten in den ersten Wellen. Manchmal kommt ein leichter Wind und trägt das Rauschen des Meeres mit sich und das leichte Klingen eines Windspieles, das ich an einem der Holzträger befestigt habe. Es ist ein Windspiel aus Muscheln, und sein Ton hat eine scheue, natürliche Musikalität. Das kommt daher, daß es keine Bambusrohre oder Messingblätter sind, in die der Wind greifen kann, sondern Muscheln aus den Tiefen des Meeres. Ich habe viele Windspiele gehört, und keines hatte so einen anrührenden Ton. Die Schwingung dieses Windspieles ist nicht wie die seiner professionellen Ebenstücke, die manchmal richtige Melodien erklingen lassen. Dieses Muschelspiel ist wie ein immerwährender Versuch, ein Lied anzustimmen, das noch nie erklungen ist. Der Wind nimmt an manchen Tagen seinen Klang mit in den Raum, er dreht seine Pirouetten um den alten Cognac, der gleich links neben dem Spiegel steht, und verläßt uns durch die Türe, die rechts neben der Flaschenwand hinter das Haus führt. Nicht direkt, sondern zuerst durch eine Küche, dann durch einen Vorratsraum, in dem eine Falltüre zum Keller zu nehmen ist, und dann hinter das Haus.
Haben Sie ein Bild von meiner Bar, in der ich jeden Tag seit vielen Jahren neben Verenice stehe und darauf warte, welchen Menschen mir das Schicksal schickt? Der Oleander – ich habe vergessen, den Oleander zu erwähnen. Links und rechts von der Terrasse und auch hinter dem Haus und auch noch eine Strecke den Hügel hinauf habe ich Oleander gepflanzt. Stark und süß riechenden, rosa und dunkelrot blühenden Oleander. Ich habe meine Träume gehabt – schon als sehr junger Mann –, was es bedeutet, die Sonne, das Meer und das ganz Andere zu erleben. Und in diesen Träumen gab es immer den warmen Geruch von blühendem Oleander. Also habe ich rund um das alte Holzhaus Oleander gepflanzt.
Wenn ich vor dem flachen, weißen Holzhaus stehe und das Meer in meinem Rücken spüre und über den Oleander den Hügel hinaufblicke, dann sehe ich mein kleines Hotel. Ungefähr 300 Meter vom Strand entfernt liegt unser Hotel mit seinen sechs Zimmern und dem Blick über die Bucht. Es ist ein schönes, einfaches Haus, und ich werde es Ihnen später beschreiben.
Ich führe das Hotel und die Bar gemeinsam mit meiner Frau Verenice. Ich heiße Manuel, und darum ist über dem Eingang zur Bar auch auf einem Holzschild zu lesen: »Manuels Bar«. Das ist übrigens meiner Frau zu verdanken. Sie kannte meine Träume. Am Tag, an dem der Umbau fertig war, kam ich aus der Stadt mit einem Holzschild zurück. Ich hatte bei einem Maler ein Schild in Auftrag gegeben, auf dem zu lesen stand: »Verenices und Manuels«. Ich stieg aus meinem Jeep und holte das Schild von der Ladefläche und die Packung großer Nägel, die ich gekauft hatte. Aber da hing ein rechteckiges Schild, das mit einer wunderschönen, sonnenblumengelben Farbe grundiert war. Um die Seiten des Brettes zog sich ein Rahmen aus roter Farbe, und mit demselben Rot waren im Zentrum des Schildes zwei Wörter zu lesen: »MANUELS BAR«. Ich stand da und sah sprachlos zu dem Schild hinauf. Der Maler hatte die Buchstaben auf der linken Seite mit einem schmalen weißen Rand versehen, so daß man das Gefühl einer räumlichen Schrift hatte, und nach dem Wort »BAR« hatte er drei Punkte gesetzt. Ich habe es sehr gerne, wenn ich in einem Buch oder einer Zeitung einen Satz finde, der nicht mit einem, sondern mit drei Punkten endet. Das zeigt nur, daß der Mensch, der den Text geschrieben hatte, es meiner Phantasie überlassen wollte, die Geschichte weiterzudenken. »MANUELS BAR ...« – das konnte nur ein Mensch wissen: Verenice ...
Ich stand da mit meinem Schild in der Hand und blickte auf die drei Punkte, als ich ihre Stimme hörte.
»Gefällt es dir so?« Sie öffnete die Schwingtüre und lächelte mich an.
»Ja«, sagte ich, ja, es gefällt mir sehr.«
»Fein ...«
Ich sah sie an und konnte nicht mehr sagen. Sie wußte soviel von mir – manchmal glaube ich, daß sie Dinge von mir weiß, die ich selbst langsam, Schritt für Schritt erlernen darf. Dasselbe gilt übrigens auch umgekehrt. Auch von Verenice weiß ich Geheimnisse, die in ihrem Herzen verborgen sind, die ihr selbst zur Überraschung werden, wenn sie ihnen begegnet. Aber lassen Sie mich später von Verenice erzählen – wir waren noch bei der Besichtigung meines Reiches.
Das Schild, das über dem Eingang hängt, hat eine magische Kraft. Es verwittert nicht. Sie erinnern sich daran, daß die Farbe vom Geländer jeden zweiten Sommer erneuert wird, auch die Außenwände werden bei dieser Gelegenheit gestrichen, und daran arbeite ich fast drei Tage lang. Jedes Mal komme ich dann als letztes an die Vorderseite des Hauses und ziehe den Pinsel mit dichten Querstrichen über die Bretter, bis ich dann wieder einmal dem Schild begegne. Alle zwei Jahre erlebe ich dann dasselbe magische Rätsel dieses Schildes. Es verwittert nicht. Wenn ich mit der Hand über die Farbschichten streiche, fühlt es sich an wie kühle Seide. Fest sitzt die Farbe auf dem Holz und zeigt keine Risse, in die die salzige Meeresluft eindringen kann.
Der Maler, der dieses Schild angefertigt hatte, versteht sein Handwerk. Wahrscheinlich hatte er das Holz des Schildes mit einer speziellen Pinienöl-Lösung getränkt. Vielleicht war er aber auch nur ungleich sorgfältiger im Auftragen der Farbschichten, als ich es jemals sein kann. Das einzige, was ich bemerke, ist, daß die Leuchtkraft der Farben mit jedem Sommer ein klein wenig transparenter wird. Ich sage bewußt: transparenter und nicht schwächer – denn ich habe nicht das Gefühl, daß sich die Strahlkraft des gelben Grundes und der roten Buchstaben auflöst – nein –, es ist wie beim Altern mancher Menschen.
Ich habe die verschiedensten Arten des Alterns beobachtet. Es gibt Wesen, bei denen das Alter die Hülle Jahr um Jahr beschädigt, zernagt und letztlich verfallen läßt, und Hand in Hand mit diesem Zu-Ende-Gehen erlischt auch die Flamme der Seele, die in diesem Körper ein Leben lang zu Hause war.
Dann aber treffe ich von Zeit zu Zeit auf jemanden, der diesen Vorgang des Alterns als eine Verwandlung begreift. Und diese Verwandlung läßt ihn erstrahlen. Er wird transparent. Unzählige Schritte sind es, die man gehen kann, um sich von sich selbst zu verabschieden. Man kann sich verabschieden von seiner Herkunft, von seinen Meinungen, von all dem, was man Persönlichkeit nennt. Alles, an dem man sich so gerne festhält, um »Ich« sagen zu können, all das kann man loslassen. Dann fangen die Menschen an zu schimmern. Wie eine Perle leuchtet ihr wahres selbstloses Wesen durch die dünner werdende Hülle – so wie mein Schild ...
Es scheint eines der Geheimnisse dieser Insel zu sein, daß sie die Wahrheit ans Licht bringt. Schneller als an jedem anderen Ort dieser Erde werden die Dinge und die Menschen zu dem gebracht, was sie wirklich sind. Es gibt solche Plätze, und früher hat man aus solch einer Gegend einen heiligen Ort gemacht. Die Menschen haben ihn aufgesucht, um sich der Kraft des heiligen Ortes hinzugeben und von ihr verwandelt zu werden.
Der heilige Ort hat die Macht, die Eile derjenigen, die ihn finden, in Geduld und Gelassenheit zu verwandeln. Es ist unerheblich, ob man dann eine Kirche, einen Tempel oder eine Bar errichtet. Es wird ein Ort sein, der die Menschen, die ihn finden sollen, anziehen wird. Ohne es erklären zu können, gehen die Menschen dann auf die Suche. Wenn ihre Zeit gekommen ist.
Wenn die Zeit gekommen ist, Furcht vor Veränderung und einer ungewissen Zukunft hinter sich zu lassen. Erst wenn dieser magische Wendepunkt erreicht ist, erst dann findet sich die Kraft, einen Koffer zu packen und einfach loszugehen. Und jeder findet den Platz, der auf ihn und nur auf ihn gewartet hat. Und dann treten einige durch eine Schwingtüre und erblicken sich selbst in einem großen Spiegel.
So ist es auch dem jungen Mann ergangen, der vor einer halben Stunde meine Bar betreten hatte.
Er saß still an seinem Tisch. Er blickte auf das Glas mit Rotwein, das er bestellt hatte, und lauschte. Er hörte auf den Lärm, der noch in seinem Inneren dröhnte. Er hörte auf das Echo seines Lebens, das er hinter sich gelassen hatte. Seine Hände spielten mit dem Fuß des Glases. Langsam drehte er es und beobachtete, wie der Wein zögerlich diese Bewegung übernahm. Manchmal schien es, als würde ein kurzes Lächeln über seine Lippen ziehen, das aber sofort wieder verschwand.
Manchmal hob er den Kopf etwas und versuchte, tief durchzuatmen. Wie viele Tonnen aus Blei lag ein unerklärter Schmerz auf seiner Brust. Wieder trank er einen Schluck aus dem Glas, und dann war es leer.
Er sah, daß es leer war, und auch dieser Umstand verführte ihn zu einem kurzen, ironischen Lächeln. Ich fühlte mit, wie er sich mehr und mehr in den Strudel eines langsam drehenden Selbstmitleids hineinsaugen ließ, und beschloß, seinem Lebensweg eine kleine Änderung anzubieten. Ich blickte über eine Reihe von Flaschen mit meinen besten Rotweinen und überlegte, mit welchem Geschmack ich ihm eine Freude bereiten konnte. Kurz war ich in Versuchung, ihm einen etwas leichteren, heiteren Wein anzubieten, aber im Moment der Überlegung wußte ich auch schon, daß sie falsch war. Paracelsus hat gesagt: Gleiches heilt Gleiches. Der junge Mann machte den Eindruck einer großen Schwere. Natürlich ist das, was man ihm anbieten möchte, Erleichterung. Wenn man es aber tut, indem man ihm ein Glas leichten, duftigen Weines hinstellt, wird sich seine Stimmung in der Reaktion des Trotzes nur verfestigen, und man erreicht das Gegenteil dessen, was man erreichen wollte. Nein – in seinem Fall war es ein sehr tiefer, dunkler Wein, der ihm helfen sollte.
Ich füllte eine Karaffe, nahm zwei Gläser und ging zu dem Tisch, an dem der junge Mann saß. »Verzeihen Sie«, sagte ich, »darf ich mich zu Ihnen setzen?«
Er blickte hoch und sagte mit wohldosierter Höflichkeit: »Bitte schön – wenn Sie wollen.«
Ich bedankte mich und stellte die Karaffe und die Gläser vor uns auf den Tisch. Er blickte mich kurz an und dann an mir vorbei durch das Fenster auf das Meer. So gerne wäre er allein geblieben mit seiner Melancholie. So gerne hätte er sich der Betrachtung seiner Wunden gewidmet, nur um immer wieder am selben Punkt anzulangen. Dieser Punkt war der Punkt, an dem er feststellen konnte, daß die Antwort auf die Frage nach dem ›Warum?!‹ nur lauten konnte: Die anderen sind schuld. Ich wußte keine Details seiner Biographie, aber so viele Möglichkeiten zu scheitern gibt es nicht. Alles läßt sich auf zwei große Felder reduzieren, auf denen wir Sieg und Niederlage erleben. Die äußere Welt teilt sich auf in den Kampf um Erfolg oder um Liebe. Besser gesagt, um das, was wir so schnellhin Liebe nennen. Nur diese zwei Felder sind es, auf denen wir nach einem Sieg streben und auf denen wir eine Niederlage persönlich nehmen und unseren Schmerz damit betäuben, indem wir feststellen, daß die anderen schuld sind an unserem Unglück. Die Frage ist nur, wie lange uns dieses Herumirren auf den Spielplätzen der äußeren Welt interessiert und ab wann wir erlernen, daß ein Ausweg nur im Betreten der inneren Welten liegt. Wenn wir Glück haben, sehen wir eines Tages die Weggabelung und wählen den Abschied vom Lärm der äußeren Welt.
Wir alle erleben es so, daß an irgendeinem Tag das Wechselspiel der Kräfte in der äußeren Welt einen Sprung erhält. Irgendwann wird eine Trennung oder ein Verlust oder eine Schmach so verheerend, daß es uns aus dem Rennen wirft. Von einem Tag zum anderen fühlen wir einen Ruf, der uns zwingt aufzuhören. Eine Stimme ist mit einemmal da, die sagt: ›Du fährst das falsche Rennen – steig aus, solange es noch Zeit ist, zu dir zu kommen.‹ Glücklich sind diejenigen, denen das Schicksal so einen großen Verlust in der äußeren Welt beschert, daß dieser Schicksalsschlag sie zur Besinnung bringt. Dann packt man von einem Tag auf den anderen einen Koffer und verläßt den Ort des Geschehens. Dann beginnt der Aufbruch, dann sind wir unterwegs. Dann und nur dann können wir im Laufe dieses Weges sagen: ›Ich beginne zu fühlen, wer ich sein könnte!‹ Und noch später folgt vielleicht der Satz: ›Ich bin, der ich bin.‹ Dann lebt man in seiner Wahrheit, dann kann man seine Wahrheit teilen und mitteilen. Noch war der junge Mann nicht an diesem Punkt. Eines Tages würde er ganz leicht sagen können: »Verzeihen Sie – ich möchte im Moment lieber alleine bleiben«, wenn sich ein Mann mit einer Flasche Rotwein und zwei Gläsern seinem Tisch nähert. Er würde in der Folge eines wahrhaftigen Lebens mit sich selbst fähig sein, für die Welt erkennbar zu sein. Er würde ›Ja‹ und ›Nein‹ sagen können, ohne jemanden damit zu verletzen, weil sein Ja und sein Nein aus seiner in sich ruhenden Wahrheit kommen würden.
Als ich mich zu ihm setzte, war es aber noch nicht soweit, und ich hatte große Freude daran, ein Stein auf seiner Landstraße zu sich selbst zu sein.
»Sie sind selber schuld«, sagte ich und füllte unsere beiden Gläser. Er war schockiert und fassungslos, wie jemand, der in seinen geheimsten Gedanken entblößt worden war.
»Wie bitte ... was meinen Sie?« Er richtete sich auf. Ich setzte die Flasche ab und atmete langsam den Duft des Weines ein.
»Sie sind selbst schuld«, wiederholte ich, »wenn Sie hier vor einem leeren Glas sitzen, fühle ich mich verpflichtet, Sie einen meiner besten Roten kosten zu lassen.«
Ich lachte ihn an und stellte eines der beiden Gläser vor ihn hin. Er erkannte sein Mißverständnis und begann ebenfalls zu lachen.
»Ich verstehe ... Ich dachte schon, Sie können Gedanken lesen.«
»An manchen Tagen mehr, an manchen Tagen weniger«, erwiderte ich, »und vorhin konnte ich lesen, daß es Sie nach einem guten Wein verlangt.«
Ich hob mein Glas, und dann stießen wir an. Es war schön zu sehen, daß er nicht gleich trank, sondern langsam das Glas hob und erst einmal atmete. Er ließ die Seele des Weines aufsteigen und atmete tief ein. Im selben Moment seiner Konzentration auf den Duft war seine Miene wie verwandelt. Alle Sorgen waren verschwunden, und nur ein Ausdruck der Verzauberung blieb zurück. Unmittelbar und direkt hatte die Schwingung des Weines seine Phantasie verwandelt.
»Ein phantastischer Wein«, sagte er leise, und dann tranken wir den ersten Schluck. Wie ein warmer Wind durchstreifte der Wein unsere Arme und Beine, unsere Hände, die Finger und das Gesicht.
»Darf ich Sie fragen, wie er heißt?« Der junge Mann betrachtete das Rubinrot in seinem Glas gegen das Licht.
»Amarone«, sagte ich und holte uns eine Flasche mit klarem Wasser.
Daß es mir so schnell gelang, ihm eine Ahnung davon zu geben, wie schön das Leben sein konnte, zeigte, daß er schon sehr weit weggetrieben war von der Quelle seiner Schmerzen. Er war schon weggetrieben worden, ohne es selbst bemerkt zu haben.
»Amarone«, wiederholte er langsam und fast andächtig, »ein Italiener.«
»Ein Italiener«, stimmte ich zu.
»Ich habe einmal einen spanischen Rotwein gekostet, der eine gewisse Ähnlichkeit hatte ...«
»Sie meinen sicher den ›Margues de Cazeres‹«, unterbrach ich ihn, und dann begannen wir gleichzeitig zu lachen wie zwei Fremde, die bei einer zufälligen Begegnung auf der Straße entdecken, daß sie im selben Wald als Kinder Beeren gesammelt haben.
»Ich freue mich, daß er Ihnen gefällt«, sagte ich und füllte sein Glas wieder nach.
»Danke sehr – das tut er ... Verzeihen Sie, wir tauschen hier die Namen unserer italienischen und spanischen Bekannten aus, und Sie wissen noch gar nicht, wer ich bin ...« Er reichte mir seine Hand über den Tisch. »Stefan«, sagte er, »ich heiße Stefan Landovsky ...«
Ich ergriff seine Hand und freute mich über seinen festen und ehrlichen Händedruck.
»Sagen Sie einfach Manuel zu mir«, antwortete ich, während wir unsere Hände wieder lösten.
»Aha – daher das Schild über der Türe ...«
Verenice hatte fast lautlos die Bar betreten und begonnen, alles für den Abend vorzubereiten. Sie sah manchmal zu uns herüber, und dann lächelte sie mir zu, als Stefan sagte: »Es ist ein außergewöhnlich schönes Schild.«
»Hast du das gehört, Verenice?!« rief ich zu ihr.
»Ich habe es gehört«, sagte sie lächelnd und blies sich eine Haarsträhne aus der Stirne.
»Guten Tag.« Stefan verbeugte sich leicht im Sitzen und grüßte Verenice.
»Guten Tag«, sagte sie.
»Sie arbeiten zusammen hier?«
»Mein Mann und ich sind ein ganz gutes Team, glaube ich ...« Sie lächelte mir noch einmal zu und ging dann aus dem Raum, um ihre Vorbereitungen in der Küche fortzuführen.
»Ihre Frau?!«
»Ja.«
»Darf ich Sie fragen, wie Sie beide hierhergekommen sind?«
Da war sie wieder, die Frage, die ich schon so oft gehört hatte. So oft schon hatte ein Reisender vor mir gesessen und hatte zu spüren begonnen, daß der Ort, an dem wir einander begegneten, etwas Besonderes war. So oft schon hatte ein Zugvogel gefühlt, daß es sich hier gut rasten läßt, und zur Landung angesetzt. Die ersten Blicke wurden gewechselt, die ersten Höflichkeiten ausgetauscht – dann öffneten sich langsam die Augen, und Verenice und ich wurden wahrgenommen. Wahrgenommen als etwas Seltenes. Etwas, dem man mit einer Frage gegenübertritt, wenn man zu spüren beginnt, daß das Besondere zwischen zwei Menschen schwingt. Ich war die Neugier und die Fragen gewohnt und trotzdem überkam mich auch jetzt wieder eine Welle des Staunens. Ja – wie waren wir hierhergekommen?
»Wenn Sie wissen wollen, wie Verenice bierhergekommen ist, dann müssen Sie sie selber fragen, denn sie war schon lange vor mir da«, sagte ich, »aber wenn Sie wollen, erzähle ich Ihnen gerne meinen Teil der Geschichte.«
»Ja, bitte. Ich habe heute noch nichts vor.« Der junge Mann lehnte sich neugierig in seinem Stuhl zurück.
Endlich – dachte ich –, endlich beginnt er, sich wirklich in diesen Stuhl sinken zu lassen. Die Aussicht, nun eine Geschichte erzählt zu bekommen, ließ ihn endlich ein wenig ruhiger werden und ein wenig den süßen Tropfen der Entspannung kosten.
Nun gut – auch ich lehnte mich zurück und erinnerte mich.
Ich erinnere mich so unendlich gerne an den Tag, an dem ich erfahren durfte, daß es in unserer Seele die Möglichkeit gibt, die Spielflächen des Lebens zu vertauschen. Es gibt in uns die Möglichkeit, herauszutreten aus der Geschichte, die wir begonnen haben zu schreiben, und eine neue Geschichte zu beginnen. Wir können uns selbst ein neues, zweites Leben schenken, wenn es uns gelingt, den Moment zu erkennen, an dem sich die Türe des Gefängnisses unseres Wesens öffnet. Wenn sie sich öffnet und wir das leichte Singen ihrer Angeln hören, dann gilt es aufzustehen und hinauszugehen in das Freie. Es gibt eine Freiheit vor unserer Türe, die auf uns wartet, von uns betreten zu werden. Und bei mir war dieser Moment ein Tag im September vor siebzehn Jahren.
»Also, passen Sie auf«, sagte ich und füllte unsere Gläser noch einmal. »Vor siebzehn Jahren habe ich alles verloren, was mir damals wichtig war. Ich betone deshalb das Wort ›damals‹ so sehr, weil ich heute staunend und lächelnd auf die Dinge zurückblicke, von denen ich mir damals mein Glück erwartet habe.«
»Die da wären?« Er sah mich neugierig an.
»Ruhm, Macht, Reichtum – und natürlich eine Frau.«
Bei den letzten Worten atmete er tief ein, und ich sah, daß sein Schicksalsschlag auf dem Feld der Liebe stattgefunden hatte.
»Ich verstehe.«
»Wie Sie wissen, ist es schmerzhafter, in der Liebe zu verlieren als im Beruf – aber bei mir wollte das Schicksal sichergehen und hat mir zwei Schläge geschenkt.« Ich lachte und blickte kurz auf das Meer hinaus. Die Sonne begann sich langsam zu senken, und der Himmel nahm eine pfirsichfarbene Tönung an. Zwei Vögel zogen kreisend über eine Stelle des Wassers, an der sie Fische vermuteten, und die Oleanderbüsche neben der Terrasse rauschten leise.
»Ja – zwei Schläge habe ich erhalten«, fuhr ich fort, »und war der festen Überzeugung, daß mein Leben zu Ende sei.«
»Ich verstehe.«
»Wie Sie sehen, ist es aber nicht zu Ende.« Ich lachte ihn an und sah, daß er für eine Sekunde dieselbe Hoffnung für sein eigenes Leben verspürte.
»Der Reihe nach. Sie werden es vielleicht nicht glauben, wenn Sie mich heute hier sitzen sehen und ich mit Ihnen die Vorzüge von spanischem und italienischem Rotwein vergleiche, aber ich leitete einmal eine Computerfirma. Meine Firma war sogar führend in der Forschung auf dem Gebiet der Spracherkennung, und wir standen unmittelbar vor einem entscheidenden Durchbruch auf diesem Gebiet. Dazu muß ich sagen, daß ich – wie sie vielleicht schon bemerkt haben – kein geborener Techniker bin, aber genau das war es, was mich und meine Firma an die Spitze bringen konnte.«
»Wie meinen Sie das?«
»Nun – es wird Ihnen doch schon passiert sein, daß Sie vor Wut über die Unlesbarkeit einer Gebrauchsanweisung für ein technisches Gerät das Benutzerhandbuch an die Wand geworfen haben?«
»Allerdings.«
»Sehen Sie – das meine ich. Diese Anweisungen werden von Technikern geschrieben, die das Gerät entwickelt haben und sich in Wahrheit an ihresgleichen wenden. Niemand von diesen Leuten denkt daran, daß eine Mutter von drei Kindern den Videorekorder benutzen möchte und einfache Erklärungen braucht, um sich zurechtzufinden.«
»Wem sagen Sie das!«
»So – nun wissen Sie doch auch, um wieviel unübersehbar schwieriger es ist, sich als Neuling in einem Computerprogramm zurechtzufinden, wenn man schon daran gescheitert ist, die Datumsanzeige im Videorekorder zu programmieren.«
»Darf ich Ihnen ein privates Detail aus meinem Leben verraten?« Der junge Mann beugte sich vor und begann zu flüstern, obwohl wir ganz alleine waren.
»Ich bitte darum.«
»Ich habe meinen Computer nach drei Wochen verkauft, weil ich unfähig war, ihn zu benutzen.«
Ich nickte und sagte: »Ich sehe, wir wissen, wovon wir reden.«
»Und Sie waren einer von diesen Wahnsinnigen, die diese dicken Bücher schreiben, die einen restlos verwirren, wenn man seinen Computer benutzen will?!«
»Eben nicht. Ich hatte eine Vision. Ich wollte einen Computer entwickeln, der mich versteht, und nicht einen, der mich zwingt, ihn zu verstehen.«
»Haben Sie's geschafft?«
»Sehe ich so aus?«
Wir lachten herzlich, und dann erzählte ich weiter: »Ich hatte die Vision, daß ich einen neu gekauften Computer an die Steckdose anschließe, einschalte und dann sage: ›Computer – es geht los!‹«
»Sensationell!«
»Das dachte ich auch – ich wollte das erreichen, was der Autoindustrie mit der Erfindung des Automatikgetriebes gelungen war. Ich wollte den Computer für jedermann.«
»Woran lag es, daß ich ihn noch nicht kaufen kann?«
Ich sah ihn an und wartete eine Weile. Ich wollte, daß meine Worte mit großer Wirkung bei ihm ankommen sollten.
»Es lag an Liebe, Eifersucht und Haß.«
»Das ist nicht wenig«, sagte er und atmete tief durch.
»Das ist nicht wenig«, antwortete ich, »und doch ist es so gering und bedeutet nichts, nichts und noch einmal nichts angesichts der wahren Natur des menschlichen Herzens.«
»Wie bitte?«
»Der Reihe nach – ich hatte meine Firma schon sehr, sehr weit gebracht und stand kurz vor einem Durchbruch bei meinem Forschungsprogramm. Das, was mir in dieser Zeit Kraft gegeben hat und Lust und die Motivation, weiterzumachen und zu siegen, war meine wunderschöne Verlobte.«
»Sie waren verlobt?«
»Ach, ich bitte Sie – das waren wir doch alle irgendwann einmal. Aber in meinem Fall schien es den Segen der Götter zu haben. Sie hieß Lisa und war wie gesagt nicht nur außerordentlich attraktiv – sie war auch noch dazu eine geniale Computertechnikerin. Sie sehen, es ist ein Aberglaube, daß Technik eine kalte Angelegenheit ist, die nur von einsamen Männern betrieben wird. Nein – Lisa war das, was man brillant nennt. Sie war einer dieser Menschen, denen es gegeben ist, ein Problem nicht nur von einer Seite anzupacken, sondern von sämtlichen unmöglichen Seiten gleichzeitig. Sie konnte die weibliche Fähigkeit, ein Rätsel intuitiv zu lösen, mit der männlichen Eigenschaft verbinden, geradlinig weiterzuarbeiten, bis alle Zweifel am Ergebnis beseitigt waren.«
»Eine tolle Frau.«
»Sie sagen es – und doch bin ich froh und glücklich, heute hier mit Ihnen zu sitzen und zu spüren, wie sehr sich Verenice über unser Gespräch amüsiert.«
»Ja – das scheint Lichtjahre von dem entfernt zu sein, was ich hier mit Ihnen erlebe.« Der junge Mann schüttelte erstaunt seinen Kopf.
Ich freute mich zu bemerken, wie er an meiner Geschichte Gefallen zu finden begann.
»Und dann?« fragte er und stützte seinen Kopf in seine Hand, gespannt auf die Fortsetzung meines damaligen Lebens.
»Und dann kam die erlösende Explosion–und die sah folgendermaßen aus: Wir waren mit unserer kleinen Firma an unsere Grenzen gestoßen. Für die vielen Forschungszweige hatten wir ganz einfach zu wenige Mitarbeiter, und um neue anstellen zu können, zu wenig Geld. In dieser Situation lernten Lisa und ich bei einem Kongreß einen Mann kennen, der zuviel Geld hatte und auf der Suche war nach einer erfolgversprechenden jungen Firma, die zuwenig Geld hatte.«
»Besser kann es doch nicht laufen«, sagte Stefan, und ein Ausdruck der Verwunderung zog mit diesen Worten über sein Gesicht.
»Ja, besser konnte es nicht laufen – aber wissen Sie, es ist eine seltsame Angewohnheit des Lebens, in den Momenten, in denen es nicht besser laufen kann, eine Weiche zu stellen, die den Zug der Ereignisse von seinem Kurs abbringt.«
»Ist das Ihrer Meinung nach immer so?«
»Ich glaube fast, daß es immer so sein muß«, sagte ich.
»Verzeihen Sie, wenn ich Ihre Geschichte kurz unterbreche, aber hier und jetzt wirken Sie auf mich wie ein Mann, bei dem es nicht besser laufen kann.«
»Danke.«
»Ist in Ihrem jetzigen Leben auch so eine zerstörerische Weiche angelegt?«
Ich muß sagen – er hatte den Mut, eines meiner Bilder in seiner ganzen Tragweite auf mein jetziges Leben zu beziehen. Der Zug meines jetzigen Lebens lief in der Tat völlig anders als meine frühere Existenz. In Wirklichkeit war es aber immer noch ein Zug – wenn auch ein völlig anderer. Seine Frage war daher kühn, aber berechtigt. Ich hoffte, daß es uns gelingen würde, einander näherzukommen, und daß er verstehen würde, wenn ich ihm sagte: »Die Schienen meines neuen Lebens zeichnen sich dadurch aus, daß sie ausschließlich aus Weichen bestehen. Ich bin bereit zu akzeptieren, daß das Leben eine immerwährend sich verändernde Veränderung bedeutet. Das einmal akzeptiert, und die Tatsache einer Veränderung wird zur Chance und nicht zur Katastrophe.«
»Ich würde gerne mit Ihnen über diese Frage etwas später länger reden – erzählen Sie mir aber doch bitte erst, wie es mit Lisa und Ihnen weitergegangen ist.«
Ich mochte die Art, mit der er die Situation bewältigte.
»Also gut«, sagte ich daher, »zurück zur Weiche meines Lebens, die mit einer totalen Entgleisung meines damaligen Lebensweges in Verbindung stand. Wir hatten diesen Fremden – sein Name tut nichts zur Sache – direkt von dem Kongreß weg zu uns in unsere Firma gebeten. Wir legten ihm unsere Konzepte und Arbeitsmodelle vor, und alles, was er sah, fand seine Zustimmung. Eine Woche später unterschrieben wir einen Vertrag, der ihn zum Partner in unserer Firma machte. Das Geld, das er investierte, erlaubte uns, mehrere Fachkräfte zu engagieren, und die Entwicklungsphase für den Volkscomputer näherte sich dem Punkt, an dem man von einer Serienproduktion reden kann. Dann kam ich eines Nachmittages von einer Reise früher zurück als geplant und fand meinen neuen Partner und Lisa in meinem Büro auf meinem Sofa in dem, was man eine eindeutige Situation nennt.«
»Nein!«
»Doch.« Ich lachte und betrachtete Stefan, der nach Luft rang. Er stand auf und ging zum Bartresen. Er hielt dort kurz inne und griff nach einer kleinen Tonschüssel, in der sich geröstete Mandeln befanden. Er brauchte diese Bewegung offenbar, um sich Luft zu machen. Die Mandeln waren nur eine willkommene Erklärung für seinen Weg durch die Bar, aber nicht das Eigentliche. Das Eigentliche war, daß ich mit meiner Erzählung offenbar etwas in ihm berührt hatte. Offenbar gab es Teile seiner Lebensgeschichte, die sich ähnlich zu meinem Leben darstellten.
Plötzlich drehte er sich zu mir und sagte: »Ist es nicht fast unheimlich, wie sich die Lebensgeschichten gleichen? Ist es nicht schrecklich zu erleben, wie wenig verschiedene Farben es gibt, aus denen das Bild des Lebens gemalt wird, und wie austauschbar ab einem gewissen Punkt Gefühle und Erlebnisse sind? Da glaubt man, ein einmaliges, unverwechselbares Individuum zu sein mit einer nie gehörten Melodie, und wenn man nur genau zuhört, gibt es nur die acht Töne einer Oktave, und alle, alle, alle ergeben dasselbe Musikstück. Ich fasse es nicht.« Er stand da und starrte zu mir herüber.
»Ihr Bild mit den acht Tönen gefällt mir«, sagte ich und stand ebenfalls auf und ging zu ihm, um eine Mandel zu nehmen. »Das Bild gefällt mir sogar sehr, obwohl ich es etwas erweitern möchte.«
»Und zwar wie?«
»Es ist schon so, daß es für die Musik des Lebens nur acht Töne und die Halbtöne gibt – aber trotz dieser kleinen Anzahl ist kein Ende der möglichen Kompositionen abzusehen. Immer noch erfindet sich ein Lied, das es in seiner Tonfolge so noch nie zuvor gegeben hat, neu. Verstehen Sie, was ich meine? Sie haben recht, es wirkt, als würden immer nur dieselben Ereignisse gespielt werden ...«
»Aber so ist es doch!« unterbrach er mich.
»So ist es, und so ist es doch auch wieder nicht, weil Sie eines vergessen.«
»Und das wäre?«
»Wir haben die Freiheit, eine Pause an der Stelle zu halten, und wir haben sogar die Freiheit, mit dem Abspielen der Melodie unseres Lebens aufzuhören. Musik, die ich meine, findet zwischen den Tönen statt. Dort, wo sich das befindet, was wir vorschnell das Nichts nennen, dort ist die Chance verborgen für unsere Rettung. Unsere Rettung kann nur darin bestehen, aus dem Orkan der immer gleichen Üblichkeiten zu fliehen und in die Stille einzutreten. Die Stille, die ich meine, verbirgt sich im Zentrum der Verwüstung. Dort hinzugelangen kann eines der großen Abenteuer, kann eine der erregendsten Expeditionen sein.«
Er sah mich lange und schweigend an. »Ich ahne, was Sie meinen. Würden Sie denn von sich behaupten, im Zentrum des Orkans zu leben?«
»Das ist eine Frage, deren Antwort sich an der Schnittstelle zweier Beobachtungen findet. Die eine Ebene der Beobachtung bin ich selbst und mein Urteil über mich selbst, die andere Ebene sind die Menschen, die mich beobachten und einen Kommentar zu meinem Leben abgeben wollen. Verstehen Sie? Bei allem, was wir tun, sind wir selbst in der Stille Teil eines Ganzen. Wir sind nicht losgelöst, wir sind ein Teil. Auch dann – und erst recht dann –, wenn wir glauben, einsam und völlig verloren zu sein.«
»Meinen Sie mich?« fragte er, und ich sah, daß er diese Frage mit einem feinen Lächeln stellte.
»Wollen wir uns vielleicht wieder setzen?«
»Gerne – aber was halten Sie davon, wenn wir unseren Wein auf die Terrasse mitnehmen?
»Sie nehmen den Wein, und ich trage das Wasser.«
»Einverstanden.«
Wir griffen nach unseren Gläsern und traten hinaus auf die Terrasse. Wir stellten die Schale mit den Mandeln zwischen uns und rückten unsere Stühle so zurecht, daß wir die gesamte Bucht und den Horizont des Meeres im Blick hatten.
Er atmete tief durch und sagte: »Das war eine herrliche Idee!«
In diesem Moment trat Verenice kurz zu uns heraus und sagte:« Ah, da seid ihr. Geht es euch gut?«
»Phantastisch.«
»Manuel, könntest du mir dann bitte in einer halben Stunde helfen – sie kommen in einer Stunde?«
»Gerne, mein Liebling.«
»Ich danke dir. Habt ihr alles, was ihr braucht?«
»Haben wir alles?«
Stefan schreckte kurz aus seiner Betrachtung von Verenices Anblick hoch. »Ja, danke .... oh .... nein, doch ...«
»Bitte?« Sie lächelte mich kurz an und wendete ihr Gesicht dann wieder ihm zu.
»Ich hätte unwahrscheinlich gerne noch ein Glas von diesem Wein.«
»Auch ich hätte noch unwahrscheinlich gerne ein Glas.«
»Bleib sitzen ...« Nach einem Moment kam sie wieder und füllte unsere Gläser. »Also dann – bis gleich.«
»Bis gleich!«
Sie ging, und die Schwingtüre erzählte noch eine Weile davon, daß sie eben hiergewesen war.
»Was werden Sie in einer halben Stunde machen?«
»Ich werde meine Fischsuppe zubereiten, für die ich, in aller Bescheidenheit gesagt, berühmt bin.«
»Verstehe – glauben Sie, es wird ein Teller für mich übrigbleiben?«
»Ich denke, schon.«
»Ich freue mich darauf.«
Es war schön, mit Stefan auf der Terrasse zu sitzen und heiter plaudernd auf die sinkende Sonne zu schauen, die fünf Handbreit über dem Horizont stand.
»Der Wein wirkt so herrlich leicht«, sagte er, und ich mußte an Paracelsus denken.
»Das freut mich.«
»Weiter, bitte ...«