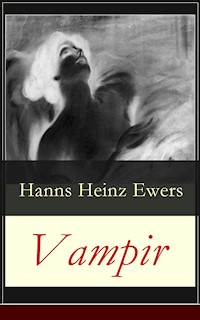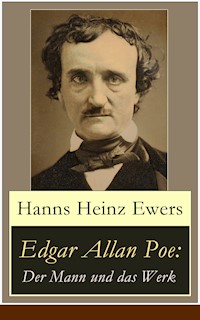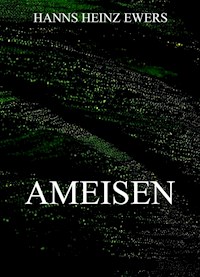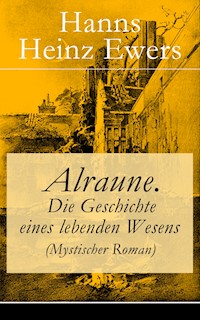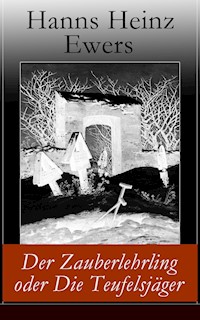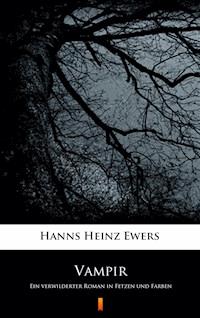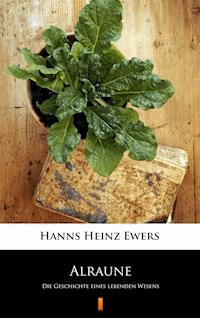Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jojo Media Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: UNTOTE KLASSIKER
- Sprache: Deutsch
DIE BESESSENEN ist nach DAS GRAUEN die zweite Sammlung unheimlicher Geschichten, mit denen ihr Autor Hanns Heinz Ewers noch vor seinem großen Welterfolg, dem Roman ALRAUNE, weitreichende Bekanntheit erlangte. Darin enthalten ist auch seine wohl berühmteste Erzählung DIE SPINNE, die mit ihrer abgründigen Thematik als Prototyp der psychologischen Horrorgeschichte gelten kann. Die Sammlung DIE BESESSENEN wird in der vorliegenden kommentierten Ausgabe als Band 4 der UNTOTEN KLASSIKER erstmals seit beinahe 100 Jahren wieder in ihrer ursprünglichen Zusammenstellung neu aufgelegt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT
Zum Geleit:
Untote Klassiker
Vorwort:
Menschliche Abgründe
Der psychologische Horror im Werk von Hanns Heinz Ewers
LIEBE
Der letzte Wille der Stanislawa d’Asp
DAS BLUT DER VÄTER
Die blauen Indianer
LILITH
Die Spinne
LETZTE KULTUR
Der Spielkasten
LOGOS
C. 3. 3.
DAS ANDERE ICH
Der Tod des Baron Jesus Maria von Friedel
Der GOTT
Delphi
UNTOTE KLASSIKER
In der Reihe UNTOTE KLASSIKER präsentiert der JOJOMEDIA Verlag unentdeckte, vergessene oder vergriffene Highlights aus dem Bereich der unheimlichen Literatur (international auch als „Weird Fiction“ bezeichnet) in neuer, hochwertiger und zeitgemäßer Aufmachung.
Jeder Band enthält neben eigens für die Reihe UNTOTE KLASSIKER gestalteten kunstvollen Illustrationen auch ein vertiefendes Vorwort mit ausführlichen Hintergrundinformationen zu Buch und Autor.
Die UNTOTEN KLASSIKER gibt es als exklusives Hardcover, als edles Paperback mit strukturgeprägtem Einband und als E-Book.
Vorwort
MENSCHLICHE ABGRÜNDE
Der psychologische Horror im Werk von Hanns Heinz Ewers
»Er tat das nicht – etwas in ihm tat es.«
(Aus Der schlimmste Verrat in: Hanns Heinz Ewers, Nachtmahr – Seltsame Geschichten)
Im Frühjahr 1908 kehrte der damals 36-jährige Schriftsteller und Lebenskünstler Hanns Heinz Ewers von einer dreimonatigen Südamerikareise an Bord eines Kreuzfahrtschiffs zurück nach Europa.
Der in Düsseldorf geborene Ewers hatte mit Ach und Krach ein Jura-Studium abgeschlossen, sich aber schon immer mehr für die Kunst und den Lebensstil der Bohème interessiert. Ewers war um die Jahrhundertwende mit erotischen Gedichten, Märchen, lustigen Tierfabeln und als Star der Berliner Kabarettbühne »Überbrettl« bekannt geworden. Danach war er mit einer eigenen Theatertruppe durch halb Europa getourt, hatte sich gemeinsam mit seiner ersten Frau, der Malerin Ilna Wunderwald, für längere Zeit auf der Insel Capri aufgehalten und ausgedehnte Reisen unternommen. Seinen Lebensunterhalt hatte er mit Berichten und Vortragsabenden über diese Reisen sowie mit Tätigkeiten als Übersetzer und Journalist bestritten.
Mit der Veröffentlichung von Das Grauen 1 , einer Sammlung von »seltsamen Geschichten«, hatte Ewers erst ein Jahr zuvor nach seinen satirisch geprägten Anfängen eine neue literarische Richtung eingeschlagen und damit einen Achtungserfolg erzielt. Nach seiner Ankunft in Frankreich schrieb Ewers nun die letzten Geschichten für den hier vorliegenden Nachfolgeband Die Besessenen, darunter auch seine bis heute wohl berühmteste Erzählung Die Spinne. Tatsächlich sollte ihm damit und mit den parallel bereits im Entstehen begriffenen Romanen Der Zauberlehrling oder Die Teufelsjäger und Alraune nur wenig später der Durchbruch zum Bestsellerautor gelingen.
Noch im Herbst 1908 erschien im Georg Müller Verlag die Erstausgabe von Die Besessenen. Darin setzte Ewers sein Konzept der Schilderungen von merkwürdigen und unheimlichen Ereignissen abseits der sogenannten normalen Realität fort. Schon die Geschichten in Das Grauen waren teilweise von Reiseerlebnissen in Spanien und in der Karibik inspiriert gewesen und hatten neben exotischen Schauplätzen im wahrsten Sinne des Wortes »grauenerregende« Geschehnisse und Taten sowie das deviante Verhalten der Protagonisten in den Vordergrund gestellt. In den Kritiken war Ewers dafür die sensationslüsterne Darstellung von Perversionen und blutrünstigen Abscheulichkeiten vorgeworfen worden.
Die Erzählungen in Die Besessenen konzentrieren sich noch stärker auf die häufig extremen Geisteszustände der Figuren und psychologische Aspekte. Der Titel Die Besessenen geht auf Passagen in dem philosophischen Werk Der Einzige und sein Eigentum von Max Stirner zurück, in dem unter anderem die Frage behandelt wird, ob und inwieweit der Mensch nach freiem Willen handelt oder von angeborenen oder erworbenen Zwängen, Vorstellungen und Prinzipien »besessen« ist – ein Thema, das im Spannungsfeld von biologischem Determinismus und Behaviorismus auch heute noch höchst aktuell ist.
Die auf Tabubruch und Provokation angelegte anstößige und »skandalöse« Sujetwahl, die sexualpathologische und sadistische Darstellungen ebenso umfasst wie mysteriöse und im Grenzgebiet zum Fantastischen angesiedelte Vorgänge, sorgte auch diesmal wenig überraschend für Aufsehen und war von Ewers wie schon bei seinen frühen erotischen Gedichten und Texten für das Kabarett bewusst kalkuliert.
Obwohl Ewers neben Gustav Meyrink und Karl Hans Strobl häufig als einer der führenden Autoren der deutschen Fantastik gehandelt wird, so ist er doch kein typischer Vertreter dieses Genres und hat kaum wirklich eindeutig »Übernatürliches« geschrieben, also Ereignisse oder Vorfälle thematisiert, die nicht mit einer rationalen Realitätserfahrung vereinbar sind. Vielmehr bleibt eine Erklärung für die seltsamen Phänomene häufig aus oder insoweit offen, als dass diese nach dem Prinzip der Unentschiedenheit auch als Einbildungen, Träume oder Wahnvorstellungen eines gestörten Geistes gedeutet werden können oder sogar sollen.
Es liegt daher nahe, die literarischen Wurzeln von Hanns Heinz Ewers in den zeitgenössischen Kontext der beginnenden Erforschung der menschlichen Psyche zu stellen. Noch vor der Jahrhundertwende hatte Sigmund Freud in Wien mit seinem Buch Die Traumdeutung den Grundstein für die Psychoanalyse gelegt und damit den Anstoß zu einer weitreichenden wissenschaftlichen und künstlerischen Beschäftigung mit dem Unbewussten und Verdrängten gegeben. Eine von Freuds Patientinnen in dieser Zeit war die junge Marie Bonaparte, Prinzessin von Griechenland und Dänemark, die später selbst als Psychoanalytikerin arbeitete und eine umfassende Studie über Edgar Allan Poe verfasste. Derselbe Poe, der heute als Begründer der psychologischen Kurzgeschichte gilt und den Ewers als Vorbild verehrte. Ewers widmete Poe 1905 sogar eine eigene Monografie. Freud wiederum veröffentlichte 1919 seinen berühmten Essay über Das Unheimliche, in dem er Themen wie Wahnsinn, Animismus oder das Doppelgänger-Motiv behandelt, die Poe und Ewers schon zuvor künstlerisch verarbeitet hatten.
Diesem Ansatz stehen Interpretationen gegenüber, die bereits Ewers frühen Erzählungen und Romanen aufgrund seiner späteren zeitweisen Nähe zum Nationalsozialismus eine präfaschistische Ausrichtung als gestalterische Hauptkomponente unterstellen. Diese bleiben jedoch trotz einiger schlüssigen Analysen (zum Beispiel die tendenziell nationalkonservative und rassistische, aber eben nicht antisemitische Einstellung von Ewers) ebenso redundant und einseitig wie Deutungsmuster, die seine Texte durch die Bank im Zeitgeist des Jugendstils, der Dekadenz oder der Untergangsstimmung angesichts der aufkommenden Moderne verorten.
Vielmehr erscheint es schlüssig, dass viele der von Ewers in Das Grauen und Die Besessenen verwendeten inhaltlichen Motive einen starken Ursprung in der Persönlichkeit, den Interessen und der Weltsicht des Autors selbst haben. Ewers litt zeitlebens darunter, immer in die Ecke der leichten Unterhaltung gestellt zu werden und als Künstler nicht ernst genommen zu werden, auch als er sich in den Folgejahren innovativen Kunstformen wie dem Film oder dem Musical zuwandte und sich als ernsthafter Dramatiker versuchte. Das aus diesem Minderwertigkeitskomplex heraus entstandene Selbstempfinden als geistig überlegener Intellektueller, Abenteurer und verführerischer Lebemann schimmert nicht nur in den in der Ich-Form erzählten Geschichten wie Die blauen Indianer, Der Spielkasten oder C.3.3. durch, sondern auch in der später noch mehrmals wieder aufgegriffenen Alter-ego-Figur des Jan Olieslagers in Der letzte Wille der Stanislawa d’Asp.
Gleiches gilt für die Frage nach der sexuellen Identität, die neben dem Konzept der gespaltenen oder multiplen Persönlichkeit in Der Tod des Barons Jesus Maria von Friedel omnipräsent ist. Ewers schrieb schon früh für die Zeitschrift Der Eigene, in der – damals sehr gewagt! – offen Homosexualität propagiert wurde. Er war im Lauf seines Lebens mit vielen prominenten Homosexuellen wie dem Banker Dr. Benedict Friedlaender, dem Sexualwissenschaftler Magnus Hirschfeld und sogar dem SA-Führer Ernst Röhm befreundet, sodass vermutet wurde, Ewers sei selbst homo- oder zumindest bisexuell. Noch 1929 sorgte Ewers mit seinem Roman Fundvogel, in dem es um eine Geschlechtsumwandlung geht, für Irritationen.
Das ebenfalls sexuell konnotierte und um die Jahrhundertwende beliebte Motiv der männervernichtenden Femme fatale wiederum findet sich handlungsprägend nicht nur in Ewers späterem Erfolgsroman Alraune, sondern auch in den Erzählungen Der letzte Wille der Stanislawa d’Asp und Die Spinne, die sich wie C.3.3. und die schon einige Jahre zuvor entstandene allegorische Geschichte Delphi auch mit der Konstruktion von Wirklichkeit und dem Gegensatz von Traum und Realität auseinandersetzt.
Die sensationsheischende Auswahl von Stoffen und Motiven sowie seine übersteigerte Selbstinszenierung in der Öffentlichkeit standen dem künstlerischen Ruf von Ewers jedenfalls von Anfang an entgegen. Nachhaltig beschädigt wurde das Bild von Ewers in der Nachwelt aber vor allem durch seine späteren nationalistischen Schriften sowie die Propagandaromane Reiter in deutscher Nacht und Horst Wessel, die seine ursprünglich opportunistische Haltung gegenüber den Nationalsozialisten belegen. Diese wurden aufgrund der enthaltenen anrüchigen Elemente (z. B. die Thematisierung von unterschwelliger Homosexualität im Militärkorps oder der Beziehung von Horst Wessel zu einer Prostituierten) aber dennoch ebenso wie sein gesamtes früheres Werk nach der Machtübernahme der Nazis in den Dreißiger Jahren rasch verboten und Ewers selbst mit Schreibverbot belegt.
Sprachlich präsentieren sich die Erzählungen in Die Besessenen auf einem zwiespältigen Niveau. Gelingen Ewers einerseits Szenen, die einen rauschhaften Sog von beinahe hypnotischer Kraft und fiebriger Intensität entfalten, folgen gleich darauf wieder schludrig geschriebene Passagen mit grammatikalischen Unschärfen und unglücklicher Syntax. Zusammen mit anderen stilistischen Eigenheiten wie der Anhäufung von Substantiven mit Dativ-e, der Auslassung von Prädispositionen, der Verkürzung von Verben oder einer unorthodoxen Zeichensetzung mit dem exzessiven Einsatz von Semikolons und Gedankenstrichen ergibt sich eine heute oftmals etwas anachronistische und altmodische Anmutung der Originaltexte.
Wir haben uns daher für die vorliegende Neuausgabe zu einem konsequenten Ansatz entschlossen. Über das Korrektorat und die Anpassung an die aktuelle Rechtschreibung hinaus haben wir die Texte einem ausführlichen Lektorat unterzogen und sie behutsam stilistisch überarbeitet, um modernen Lesegewohnheiten entgegenzukommen und die Erzählungen von Hanns Heinz Ewers auch für die heutige Leserschaft möglichst zeitgemäß zu präsentieren. Wir haben uns dabei bemüht, jedwede sinnverfälschende oder verharmlosende Änderung zu vermeiden, wie sie bei vergleichbaren Literaturbearbeitungen vor dem Hintergrund einer neuen »Cancel Culture« durchaus nicht unüblich ist. Bestärkt wurden wir in unserer Absicht auch durch die Tatsache, dass der Autor selbst bereits einmal seine Erzählungen für eine Neuveröffentlichung im Rahmen seiner Gesammelten Werke bearbeitet hat. Weiters haben wir, wo erforderlich, eine Reihe von Erläuterungen und Anmerkungen in die Geschichten eingefügt, die heute nicht mehr geläufige Anspielungen und Namensnennungen in ihrem Kontext verständlich machen sollen.
Auf jeden Fall würden wir uns freuen, wenn es uns gelingt, mit dieser Publikation das Interesse einer neuen Generation von Leserinnen und Lesern an den seltsamen Geschichten von Hanns Heinz Ewers im Speziellen und an der unheimlichen Literatur im Allgemeinen zu wecken, für die unsere Reihe UNTOTE KLASSIKER steht.
Der Herausgeber Wien, im August 2022
„On s’exténue, on se ranime, on se dévore Et l’on se tue et l’on se plaint Et l’on se hait – mais on s’attire encore.“ 1
„Man verausgabt sich, man erholt sich, man verzehrt sich nach einander. Und man bringt sich um und beklagt einander. Und man hasst sich, zieht sich aber immer noch gegenseitig an.“
1(Aus L‘Amour in: Émile Verhaeren, Les visages de la vie)
1 Erschienen als Band 1 in der Reihe UNTOTE KLASSIKER
Dieses Zitat des belgischen Dichters Émile Verhaeren war den Geschichten in „Die Besessenen“ in der Originalausgabe des Georg Müller Verlages vorangestellt. In der von Ewers nochmals durchgesehenen späteren Ausgabe der „Gesammelten Werke“ aus dem Sieben Stäbe-Verlag ist das Zitat nicht mehr enthalten.
LIEBE
Der letzte Wille der Stanislawa d’Asp
»Isòt ma drue, Isòt m‘amie, En vous ma mort, en vous ma vie.«
»Isolde meine Geliebte, Isolde meine Freundin, Ihr seid mein Tod, Ihr seid mein Leben.«
(Refrain aus dem mittelalterlichen VersromanTristan und Isolde von Gottfried von Straßburg)
Bois de Cise (Somme), Juli 1908
Es ist wahr, dass Stanislawa d’Asp den Grafen Vincenz d’Ault-Onival durch zwei volle Jahre erbärmlich behandelte. Er saß allabendlich im Parkett, wenn sie ihre empfindsamen Lieder sang und reiste ihr nach, jeden Monat in eine andere Stadt. Seine Rosen gab sie den weißen Kaninchen zu fressen, mit denen sie auf die Bühne trat, seine Brillanten versetzte sie, um die Kollegen einzuladen und die schmarotzende Bohème. Einmal hob er sie aus der Gosse auf, als sie betrunken mit einem kleinen Zeitungsschreiber nach Hause torkelte. Da lachte sie ihm ins Gesicht: »So kommen Sie doch mit! Sie können uns dann das Licht halten!«
Es gab keine gemeinste Beleidigung, die sie dem Grafen ersparte. Worte, aufgelesen aus verpesteten Betten stinkender Hafenbordelle, Gebärden, so schamlos, dass sie jeden Zuhälter erröten machten, Szenen, die ein sicherer Dirneninstinkt aus Büchern witterte, die ein Aretin 2 verleugnete – das war ihm gewiss, wenn er nur wagte, in ihre Nähe zu kommen.
Die Leutchen vom Varieté liebten ihn, hatten ein unendliches Mitleid mit dem armen Narren. Sie nahmen wohl das Geld, das die Dirne verschleuderte, aber sie hassten sie umso gründlicher und verachteten sie, diese Hure, die ihren ehrlichen Artistenstand bloßstellte, deren Kunst ein Schmarrn war und die nichts hatte als ihre blendende Schönheit. Und der älteste der »Five Hobson Brothers«, Fritz Jakobskötter aus Pirna, zerschlug ihr einmal die Rotweinflasche auf dem Kopf, so dass die blonden Haare dick troffen von klebrigem Blut.
Dann, eines Abends, als sie wieder einmal so heiser war, dass sie kaum einen Ton über die trockenen Lippen bringen konnte, als der Theaterarzt ihr nach einer flüchtigen Untersuchung grob erklärte, dass sie schwindsüchtig sei im letzten Zustand – was sie längst wusste – und dass sie in ein paar Monaten beim Teufel wäre, wenn sie so weiter darauf los lebe, ließ sie den Grafen in ihre Garderobe rufen.
Sie spuckte aus, als er eintrat, und sagte ihm, dass sie jetzt bereit sei, seine Mätresse zu werden. Als er sich herabbeugte, um ihr die Hand zu küssen, stieß sie ihn weg und lachte. Aber die kurzen Wellen giftigen Lachens rissen in ihren Lungen, und sie bog sich in erstickendem Husten. Dann, kaum wieder still, vornüber gebeugt über Schminken und Puderquasten, schluckte sie wimmernd über dem seidenen Taschentuch. Der Graf legte ihr leise die Hand auf die Locken, da sprang sie auf: »Also nehmen Sie mich nur!« Sie hielt ihm das Tuch unter die Nase, voll von Blut und gelbem Schleim. »Da, mein Herr – das bin ich noch wert!«
So war Stanislawa d‘Asp. Aber es lässt sich nicht leugnen, dass die Dirne von heute auf morgen eine Dame wurde. Der Graf fuhr mit ihr durch Europa, brachte sie von einer Heilanstalt in die andere. Sie tat, was er sagte und was die Ärzte sagten, klagte nie und gab nie ein kleinstes Widerwort. Sie starb nicht, sie lebte Monate und Jahre und erholte sich, ganz langsam, aber mehr und immer mehr. Und allmählich ließ sie auch ihren Blick zuweilen auf dem Grafen ruhen. Mit dieser Ruhe, mit diesem stillen, ewig gleichen Leben wuchs in ihr eine Dankbarkeit.
Als sie von Algier abfuhren, sagte der Arzt, es sei wohl möglich, dass sie einmal wieder ganz gesund werden würde. Der Graf wandte sich ab, aber sie sah wohl seine kleine Träne. Und plötzlich, um seine Freude noch größer zu machen, berührte sie seine Hand. Sie fühlte, wie er zitterte, da lächelte sie: »Vincenz, ich will für dich gesund werden.« Das war das erste Mal, dass sie seinen Namen aussprach, das erste Mal, dass sie ihn du nannte, und das erste Mal, dass sie ihn berührte. Er blickte sie an – dann stürzte er fort, nicht mehr Herr über sich. Aber als sie ihm nachsah, stieg die bittere Galle in ihr hoch. »Ah, wenn er nur nicht weinen wollte.«
Und doch wuchs ihre Dankbarkeit und ihr Mitleid mit ihm. Ein Schuldbewusstsein dazu, ein Pflichtgefühl, diese ungeheure Liebe erwidern zu müssen. Und dazu eine Art Achtung, eine große Bewunderung vor dieser merkwürdigen Liebe, die eine Sekunde gebar für ein ganzes Menschenleben. Wenn sie im Strandstuhl saß und auf die Wogen hinausträumte, dachte sie wohl darüber nach. Da wurde ihr zur Gewissheit, dass dieser Liebe nichts unmöglich war, dass sie etwas gefunden hatte, so herrlich, so wunderbar, etwas, das es in Jahrhunderten nur einmal gab. Und als sie dann anfing zu lieben – und als sie liebte –, liebte sie doch nicht ihn, sondern nur seine große Liebe.
Sie sagte ihm das nicht, sie wusste, dass er sie doch nicht verstehen würde. Aber sie tat nun alles, um ihn glücklich zu machen. Und nur ein einziges Mal sagte sie Nein!
Das war, als er sie bat, seine Frau zu werden.
Aber der Graf ließ nicht nach und es gab ein Ringen durch Monate. Sie sagte, sie würde an seine Familie schreiben, wenn er nicht aufhören würde, sie zu bitten, da schrieb er selbst und teilte seine Verlobung mit. Erst kam ein Vetter, dann ein Onkel; sie nannten sie reizend und sehr verständig, ihn aber einen dickköpfigen Dummkopf. Der Graf lachte und sagte, er würde doch tun, was er wolle. Dann kam seine alte Mutter; da spielte Stanislawa d’Asp ihren großen Trumpf aus. Was sie gewesen sei, das wisse er ja und könne es selbst seiner Mutter sagen. Aber dann zeigte sie ihre Papiere, sagte, dass sie Lea Lewi 3 heiße und ein uneheliches Kind sei. Und Jüdin sei sie und würde es bleiben ihr Leben lang. So, und wenn Graf Vincenz d’Ault-Onival, der Marquis von Ronval, der fromme Sohn des christlichsten Hauses der Normandie, sie nun doch heiraten wolle, so möge er es tun. Dann ging sie hinaus und ließ ihn allein mit der Gräfinwitwe.
Das war wohlüberlegt, was sie da tat. Sie kannte den Grafen gut und wusste, wie sehr er in seinem Kinderglauben lebte, wusste, dass er nicht aufstand und nicht zu Bette ging, keine Mahlzeit nahm, ohne seine Gebete zu sprechen. O, ganz leise, ganz unauffällig, und kein Fremder würde es merken. Sie wusste, dass er zur Messe ging und zur Beichte, wusste auch, dass er das alles aus tiefstem, innerstem Gefühl tat. Und sie wusste dazu, wie er an seiner Mutter hing, wie er sie liebte und verehrte. Die würde nun zu ihm sprechen, eine kluge alte Frau, und ihm noch einmal sagen, wie unmöglich diese Ehe sei, wie er sich lächerlich mache vor seinen Leuten und sich versündige gegen seine Mutter und seinen Glauben.
Sie stand auf ihrem Balkon und wartete. Sie kannte jedes Wort, das die Mutter sprach, sagte es selbst. Sie wäre am liebsten dabei gewesen, um ihr einzuflüstern, dass sie nur recht deutlich, recht überzeugend all die Gründe benannte. Ja, es sollte ein Weltmeer von Unmöglichkeiten zwischen ihr stehen und seiner Liebe, und dann – dann sollte er doch …
Da fiel ihr etwas ein. Sie lief durch das Zimmer und hinüber in das des Grafen. Sie riss die Türe auf und drang in die Dämmerung ein, hastig, atemlos, keuchend nach Worten. Sie blieb stehen vor der alten Dame; kantig und hart sprangen die Silben: »Und meine Kinder – wenn ich je Kinder habe – sollen jüdisch sein, jüdisch, wie ich es bin!«
Sie wartete nicht auf Antwort, rannte hinaus in ihre Räume, fiel schwer auf das Bett. So, jetzt war es entschieden! O, gewiss, das musste ihn niederwerfen, diesen dummen großen Jungen, diesen empfindsamen Aristokraten aus fremder Welt, diesen christlichen Krankenwärter mit seinem Glauben und seiner Liebe. Und sie empfand eine große Genugtuung, dass sie endlich ein Tor gefunden hatte, zu eisern, zu stark für diese ungeheure Liebe, die sie immer fühlte und doch nie ganz verstand.
Sie wusste, sie würde ihn jetzt verlassen, würde fortgehen, wieder aufs Varieté, ins Bordell, oder die Sorrentiner Felsen hinunterspringen – das alles war ganz gleich. Aber sie fühlte sich stark und groß in ihrem frühen Instinkt, der sie ihn einst bespeien ließ und ohrfeigen mit schmutzigen Worten. Der Graf hatte verspielt und sie war wieder eine Dirne, eine erbärmliche jämmerliche Dirne, und keine Macht des Himmels konnte je sie herausreißen aus all dem Schmutz.
Dann ging die Tür auf. Sie sprang vom Bett auf, sicher in ihrem alten Lachen. Kottriefende Phrasen, die sie längst vergessen hatte, zuckten in ihrem Hirn, o sie wusste, wie sie den Grafen empfangen wollte.
Es war die alte Dame. Ganz still kam sie auf die junge Frau zu, setzte sich aufs Bett, zog sie zu sich. Stanislawa hörte ihre Worte, aber verstand sie kaum. Es war ihr, als ob ferne irgendwo eine leise Orgel spiele. Und diese Töne sprachen zu ihr und sie fühlte nur, was sie wollten.
Sie möge tun, was sie wolle; alles, alles. Nur möge sie ihren Sohn heiraten, möge ihn glücklich machen. Sie selbst, die Mutter, komme, um für ihn zu bitten. Denn seine Liebe sei so groß …
Da stand Stanislawa auf und sagte: »Denn seine Liebe ist so groß.«
Sie ließ sich hinunterführen zu dem Grafen. Sie ließ sich küssen von ihm und von seiner Mutter. Sie fühlte: Das war die Erlösung und die Genesung. An Leib und Leben. Denn ihr Leben war nur ein Gefäß für seinen kostbaren Inhalt: den Glauben an seine große Liebe.
Stanislawa heiratete den Grafen. Es war ein seltsames Leben, das sie führte in diesen Monaten. Sie liebte ihn nicht, das verstand sie wohl. Aber es war, als ob sie still auf weichen Fellen vor dem Kamin kauern würde; und diese leichte Glut streichelte sanft ihr kühles Fleisch. Sie war immer müde, so wohlig müde; sie träumte so dahin im Halbschlaf seiner wärmenden Liebe. Er küsste ihre Hände, wenn sie zufrieden lächelte, so leise vor sich hin; er meinte, sie sei nun wohl glücklich. Aber es war nicht ein Glück, das sie lächeln machte, es war immer wieder der Gedanke an diese unbegreifliche Liebe, die unendlich war wie die Welt, und in der sie schwebte, leicht getragen von warmem Hauch, ein spielendes Blatt in Mittagswinden. In dieser Zeit starben in ihr alle Sehnsüchte, versanken alle fernen Vergangenheiten. Und ihr Glaube wuchs, und sie wusste wohl, wo sie lag, und dass es in allen Tagen nichts geben würde, das seine Liebe nicht für sie tun könne.
Bisweilen, o nur ganz selten, pochte sie auf diese seltsame Liebe, diese geheimnisvolle Kraft, die alles tun konnte. In Auteuil setzte sie ein paar Goldstücke auf ein ganz schlechtes Pferd. »Nimm es nicht«, sagte der Graf, »es ist nichts wert.« Da sah sie ihn an, voll, mit langem Blick: »Aber nicht wahr, Vincenz, es wird doch gewinnen? Ich möchte, dass es gewinnt.« Und als man das Rennen lief, schaute sie nicht auf die Pferde, sah nur zu ihm hinunter auf den Sattelplatz. Sie sah, wie er die Hände verschränkte, wie seine Lippen sich leise bewegten. Da wusste sie, dass er betete. Als dann die Favoriten rechts und links ausbrachen und der jämmerliche Außenseiter den ersten Platz belegte, verstand sie, dass es sein Werk war und die Macht seiner großen Liebe.
Dann kam die Zeit, als Jan Olieslagers in ihr Leben trat. Er war ein Freund des Grafen seit Schultagen und es auch über die Jahre hinweg geblieben. Er bereiste die Welt, und nie wusste man, wo er war. Aber dann kam eine Postkarte von ihm irgendwoher, aus Cochinchina, aus Paraguay oder Rhodesia. Nun war er in Europa, und der Graf hatte ihn in sein Schloss in Ronval eingeladen.
Das kam alles sehr rasch. Dem Flamen gefiel diese Frau, und er war es gewohnt, das zu nehmen, was ihm gefiel. Einmal, viel später, machte ihm jemand Vorwürfe, dass er sie so genommen hatte, die Frau seines guten Freundes, die er nicht einmal liebte. Da sagte er: »Er war mein Freund – aber war er deshalb kein Esel?« Und dann: »Hat je eine Frau meine Lippen allein besessen? Weshalb sollte er einziger Herr über die ihren sein?«
Er nahm Stanislawa so, wie er das Pferd des Grafen ritt, wie er seine Maschine fuhr, wie er sein Brot aß und seinen Wein trank. Das, was er tat, war selbstverständlich und ohne Interesse. Und im Grunde war es ebenso natürlich, dass sich die Frau ihm hingab, ohne Sträuben, ohne Widerstand, von heute auf morgen.
Nicht als ob, auch nur eine Sekunde lang, die alte Dirne in ihr erwacht wäre. Jan Olieslagers eroberte die Gräfin d’Ault-Onival und nicht Lea Lewi. Und vielleicht würde diese ihn kaum beachtet und sich gewiss nicht in ihn verliebt haben, während er die Gräfin bis in den kleinsten Puls in Flammen setzte. Nicht, weil er ein guter Reiter war – der Graf ritt viel besser als er. Aber weil er zu Pferd ein anderer Mensch war, o ein ganz anderer als der, den sie eben gesehen hatte. Der Graf war immer derselbe, ob er zur Jagd war oder am Bridgetisch saß. Und dieser Mann war immer ein anderer, was er auch tat. Alles war ein Spiel für ihn, aber er spielte alles gleich gut. Nichts in der Welt nahm er ernst; obwohl ihn alles interessierte, schien ihm doch nichts dieses Interesse wirklich wert. Nur dass er da war und lebte. Das war für ihn der Mittelpunkt, und dieser einzige Instinkt war so eingewurzelt und stark, dass er sich unbewusst auf seine Umgebung übertrug.
Vielleicht war das der Grund seiner Siege. Man vergaß ihn schnell, wenn er fern war, aber wenn er da war, war er der Herr.
Stanislawa d’Asp fand in ihm eine neue und weitere Welt. Eine Welt voller Rätsel und Geheimnisse, voller verschlossener Türen und Tore, und er machte keine Miene, sie zu öffnen. Bei dem Grafen war alles einfach und klar; wie in dem stillen Schlosspark wandelte sie da. Sie kannte jedes Beet und jeden Rosenbusch, und hinten die gewaltige Eiche, die kein Weststurm entwurzeln konnte, stolz und aufrecht: seine große Liebe. Bei dem anderen aber lief sie in einem verhexten Irrgarten. Sie ging einen Weg dahin, der ihr schön erschien, schöner als einer vom Schlosspark. Unendlich weit schien er zu führen und doch war er nach wenigen Schritten zu Ende, abgeschnitten durch undurchdringliche Stechpalmhecken. Sie bog in einen anderen Pfad ein, und diesen versperrte irgendein närrisches Tier. Und sie fand nicht heraus und taumelte fast in den schweren Düften, die ihre verschlafenen Sinne seltsam weckten.
Der Flame aber suchte nichts bei dieser Frau. Und eines Abends, beim Nachtmahl, sagte er, dass er entzückende Wochen verlebt habe auf dem stillen Schloss und dass er seinem Freund und der liebenswürdigen Gräfin von Herzen dankbar sei. Aber dass er nun fort müsse, wieder hinaus in die Welt, und dass er morgen abreise, nach Bombay. Er sprach das alles leichthin, aber es war wohl so wahr, wie er es sagte. Der Graf drängte ihn, doch zu bleiben, aber die Gräfin sagte kein Wort. Nur als sie aufstanden und der Graf den Dienern Befehle für die Abreise gab, bat sie den Gast, ihr in den Garten zu folgen.
Und dort sagte sie ihm, dass sie mitfahren werde. Jan Olieslagers war auf eine Szene gefasst, doch nicht darauf; so kam es wohl, dass er ein wenig von seiner Sicherheit verlor, dass er nach Worten und Gründen suchte, die irgendeinen Anschein von Vernunft trugen, und dass er etwas sagte, das er sonst vielleicht vermieden hätte. Er wollte ihr nicht sagen, dass er ihre Begleitung nicht wünschte, dass sie ihm gar nichts bedeute und in dem großen Schloss seiner Erinnerungen höchstens ein kleines, verlorenes Kämmerlein bewohne. Dass sie irgendeine Blume sei, abgepflückt so im Vorübergehen für das Knopfloch, gut für den Nachmittag, bis man zum Abendessen den Anzug wechsle. Da fand er ein Argument, das ihm deshalb brauchbar schien, da die Gräfin wissen musste, dass etwas Wahres daran war. Und dann mochte auch das andere gelten. So schickte er denn mit Gefühl und mit gutem Anstand erst ein paar Phrasen voraus: dass er lange gekämpft habe und dass ihm fast das Herz breche. Aber er sei nun einmal das große Leben gewöhnt und wisse bestimmt, dass er es nicht mehr missen könne. Sein Vermögen aber reiche kaum für ihn aus und würde nicht entfernt genügen für die Ansprüche der Gräfin. Sie seien beide so verwachsen mit Luxus und Komfort, und jede Entbehrung würde … Und einmal müsse man sich doch trennen, und eben darum gehe er jetzt, um nicht den Abschied noch schmerzlicher …
Wie immer glaubte er im Moment an das, was er sagte, so überzeugt war er, dass die Gräfin ihn in jeder Silbe ernst nahm. Sie schwieg, da legte er seinen Arm um sie. Ein wenig verzog sich seine Oberlippe, nur noch ein paar Worte – nicht weinen – Schicksal – Wiedersehen – Seufzer und Tränen – so, und dann wäre es gut.
Aber die Gräfin entwand sich ihm. Sie erhob sich, sah ihm voll ins Gesicht, dann sagte sie ruhig: »Vincenz wird uns das geben, was wir brauchen.« Er war sprachlos, starrte sie an, gurgelte halbe Worte: »Wa…? Du bist ja wahn…«
Aber sie hörte ihn nicht mehr, schritt langsam auf das Schloss zu. Und so gewiss war sie ihrer Sache, so sicher in ihrem starken Glauben an die allmächtige Liebe des Grafen, die ihr auch dieses Opfer, das größte, bringen würde – so felsenfest in ihrem unerschütterlichen Vertrauen, dass sie sich auf der Freitreppe umwandte und ihm lächelnd zurief: »Warte nur auf mich!«
So königlich war ihre letzte Geste, dass Jan Olieslagers diese Frau beinahe wieder reizvoll fand. Er ging da im Mondschein auf und nieder, blickte auf das Schloss, ob er irgendein erleuchtetes Fenster sähe. Aber er sah keins. Er ging nahe heran, um irgendwelche Stimmen zu hören, einen Schrei, ein hysterisches Schluchzen. Aber er hörte nichts. Keinen Augenblick dachte er daran, hineinzugehen, er hatte eine instinktive Abneigung vor allem, was unangenehm war. Er überlegte nur, wie er es anstellen konnte, diese Frau loszuwerden, wenn der Graf wahnsinnig genug sein sollte, sie ihm zu geben und auszustatten noch dazu. Wie er sie loswerden konnte, ohne roh, ohne brutal zu werden. Ein paarmal lachte er auf, das Komische der ganzen Geschichte kam ihm wohl zu Bewusstsein. Aber es war nicht stark genug, um es wirklich zu genießen. Dann langweilte er sich, nachdem er alles von allen Seiten erwogen hatte und doch keine Lösung fand, verlor er allmählich das Interesse.
Und endlich, nachdem er stundenlang in dem stillen Park herumgeirrt war, schien es ihm, als ob ihn das alles gar nichts mehr anginge. Als ob es schon vor undenklicher Zeit passiert wäre, oder aber irgendeinem anderen und nicht ihm. Er gähnte nun, dann ging er ins Schloss, durch lange Gänge und Treppen hinauf in sein Zimmer, kleidete sich aus, pfiff leise einen Gassenhauer und legte sich zu Bett. Der Kammerdiener weckte ihn früh, sagte, dass das Auto bereit sei, half ihm beim Packen. Jan Olieslagers fragte ihn nicht nach der Herrschaft, setzte sich aber hin, um dem Grafen zu schreiben. Drei Briefe hintereinander – aber er zerriss sie wieder. Und als der Wagen durch das Parktor prustete, hinaus in die Morgennebel, seufzte er ein erlöstes »Gott sei Dank!«
Er reiste nach Indien. Diesmal schrieb er keine Postkarten mehr. Aber nach anderthalb Jahren erreichte ihn ein Brief, der ihm monatelang nachgereist war. Das Kuvert trug seine Pariser Adresse von der Hand des Grafen, es enthielt die gedruckte Anzeige des Todes der Gräfin. Jan Olieslagers antwortete sogleich, schrieb einen schönen, klugen Brief, mit dem er sehr zufrieden war. Er vergab sich nichts darin und war doch offen und ohne Rückhalt, es war ein Brief, der schon den Eindruck machen musste, für den er bestimmt war. Und er empfand Genugtuung, als er ihn in den Kasten gab, so, als habe er eine gute Tat vollbracht. Aber er erhielt keine Antwort; erst ein Jahr später, als er nach Monaten wieder in Paris war, erreichte ihn ein zweiter Brief des Grafen.
Er war kurz, aber aufrichtig, herzlich fast, wie in alter Zeit. Der Graf bat ihn bei ihrer Jugendfreundschaft, so bald wie nur möglich zu ihm nach Ronval zu kommen. Es handelte sich um den letzten Willen der Gräfin.
Jan Olieslagers stutzte, etwas Angenehmes konnte diese Reise gewiss nicht bringen. Er empfand keine Spur von Neugierde für den Ausgang dieses Familiendramas, das ihn längst nicht mehr berührte. Es war wirklich ein Rest von Kinderfreundschaft, dass er sich endlich doch dazu entschloss.
Der Graf war nicht am Bahnhof. Aber der Diener, der ihn zum Schloss fuhr, bat ihn, gleich in die Bibliothek zu kommen, der Graf erwarte ihn dort. Jan Olieslagers war nach diesem Empfang sicher, dass ihm der neue Aufenthalt im Schloss kaum Vergnügen bereiten würde. So ging er nicht gleich zum Grafen, begab sich in dem Gefühl, dass man alles Unangenehme immer noch früh genug erlebe, in seine Zimmer, die ihm der Kammerdiener anwies, badete sehr langsam, kleidete sich um und ließ sich dann, da er Hunger spürte, auf seinem Zimmer servieren. Es war schon reichlich spät am Abend, als er sich seufzend entschloss, seinen alten Freund aufzusuchen.
Er fand ihn vor dem Kamin sitzend. Kein Buch, keine Zeitung lag in der Nähe, und doch musste er schon stundenlang dagesessen haben; die Aschenschale stand übervoll von Zigarettenresten vor ihm.
»Ah, da bist du endlich«, sagte er leise, »ich warte schon lange auf dich. Willst du trinken?«