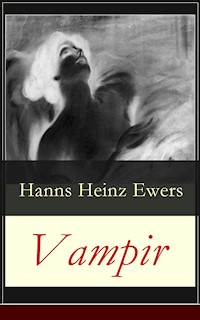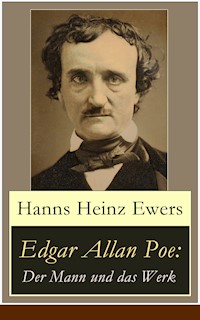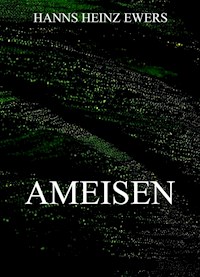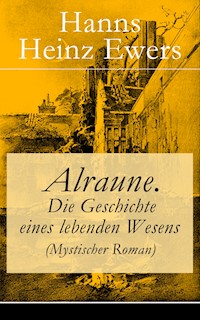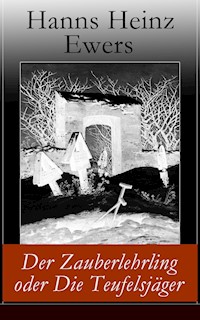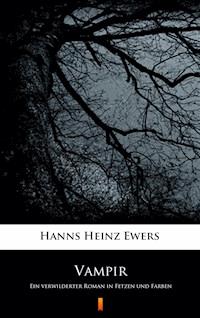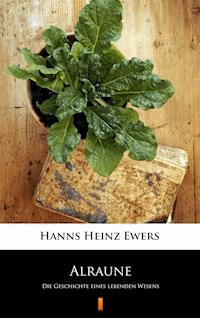Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In diesem Band fasste der bekannte Schriftsteller Ewers seine besten, humoristischen Kurzgeschichten zusammen. Unter anderem sind enthalten: Das verlorene Äffchen Von elf Chinesen und ihrer aufgefressenen Braut Mein Begräbnis Von den Eilftausend Jungfrauen und den Vier Heiligen Dreikönigen Anthropoovaropartus Wie ich im Paradiese war Die vornehme Elly Bärwald Karneval in Cadiz Die Kurve Abenteuer in Hamburg Der strahlende Mann Die Blumenspiele in Nippes "Sie haben meine Mutter gekannt -" Bibelbilli u.v.m.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 290
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Grotesken
Hanns Heinz Ewers
Inhalt:
Das verlorene Äffchen
Von elf Chinesen und ihrer aufgefressenen Braut
Mein Begräbnis
Von den Eilftausend Jungfrauen und den Vier Heiligen Dreikönigen
Anthropoovaropartus
Wie ich im Paradiese war
Die vornehme Elly Bärwald
Karneval in Cadiz
Die Kurve
Abenteuer in Hamburg
Der strahlende Mann
Die Blumenspiele in Nippes
»Sie haben meine Mutter gekannt –«
Bibelbilli
Die Knopfsammlung
Die bewachsten Hosen oder »Schäflein, Schäflein kniee dich!«
Die Bittschrift
Der einsame Briefkasten
Warum Arno Falk sich verlobte
Der Spass des Dr. Teufelsdrökh
Die freie Ehe
Der Lustmord einer Schildkröte
Eine Strafkammersitzung
Der gekreuzigte Tannhäuser
Der Mensch von Nr. 17
Grotesken, H. H. Ewers
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849642785
www.jazzybee-verlag.de
Das verlorene Äffchen
Dies ist eine ganz verrückte Geschichte. Ich würde sie keinem Menschen glauben, wenn er sie mir erzählen würde. Dennoch hab ich sie selbst erlebt, vor manchen Jahren einmal, in Traben-Trarbach an der Mosel.
Auf einer Hochzeit in Saarbrücken hatte ich ein hübsches Fräulein kennen gelernt – eine Freundin der Braut aus Wiesbaden; die war Brautjungfer. Das ist eine böse Zwitterstellung, die keinem echten Fräulein recht gefällt und meinem schon gar nicht: Braut wollte sie so bald als möglich werden und Jungfer die längste Zeit gewesen sein. Ich stellte ihr vor, daß man nicht alles gleich auf einmal haben könne; man solle zufrieden sein, wenn man den einen Wunsch erfüllt bekäme – der andere würde dann mit der Zeit ja wohl auch noch in Erfüllung gehen. Was mich beträfe, so käme ich zwar als völlig hoffnungsloser Referendar beim Landgericht für den ersten Wunsch, sie zur Braut zu machen, leider gar nicht in Frage; dagegen mache ich mich anheischig, ihr den zweiten Wunsch in für beide Teile äußerst zufriedenstellender Weise zu erfüllen. Sie fand meine Vorschläge, wie es sich für die Tochter einer ersten Familie schickt, im höchsten Grade unpassend, geradezu kränkend, gemein und niederträchtig. Sie begriff gar nicht, wie ich es wagen könne, ihr so etwas anzubieten, besonders da ich sie erst seit zwei Stunden kenne. Der schlechte Ruf, den ich habe, schiene wohl verdient zu sein; ich solle mich schämen und –
Sie hielt mir eine sehr schöne Rede und ich sagte ihr, daß sie vollkommen recht habe. Es dauerte wenigstens noch sechs Stunden, bis wir einig waren; aber man hat ja Zeit an so einem langen Hochzeitstag.
Nur: zur Ausführung unserer löblichen Absichten gab's für uns auch nicht den Funken einer Möglichkeit in Saarbrücken. Wir waren beide sehr ideal veranlagte Menschen und das Ganze mußte hübsch romantisch eingewickelt werden, wenn's uns beiden Spaß machen sollte. Die Sache selbst war ja gewiß wichtig genug, aber ohne ein schillerndes Drum und Dran ging's nun mal nicht.
Also verabredeten wir was, als sie am nächsten Tage nach Hause fahren mußte. Ich sollte die Mosel hinunterfahren und sie von Koblenz herauf; da wollten wir uns in Traben-Trarbach treffen in dem alten Gasthof Klaus-Feist. Sie würde mir mitteilen, wann sie das möglich machen könne.
Töchter wirklich guter Familien können alles Mögliche möglich machen, wenn sie nur wollen; nach ein paar Wochen bekam ich also Nachricht, daß ich am nächsten Samstagnachmittag sie erwarten möge. Ich bin ein Mann strenger Grundsätze und halte meine Versprechungen; so fuhr ich an einem trüben Oktobertage die Saar und die Mosel hinunter und lief am Nachmittage zum Bahnhof zu jedem Zuge, der sie vielleicht hätte bringen können. Als sie auch mit dem letzten Zuge nicht kam, verschenkte ich meine Blümchen an die alte Frau, die am Bahnhof sich nützlich machte und der ich, trotzdem sie mich all die Zeit über durch freundliche Blicke eingeladen hatte, doch ihr Gemach einmal aufzusuchen, nichts zu verdienen gegeben hatte.
Wütend zog ich dann in mein Gasthaus – recht übler Laune, so wie sich das für einen versetzten Liebhaber gehört. Um das gleich zu sagen: am andern Morgen, als die Sonne lachte, bekam ich ein Telegramm, daß sie erst an diesem Tage eintreffen könne; sie kam auch und alles verlief in bester Ordnung. Aber dieses Liebesabenteuerchen hat nichts mit meiner Geschichte zu tun. Es erklärt nur, wie ich durch das Fräulein aus Wiesbaden an die Mosel kam und wie ich in Traben-Trarbach, weil sie mich einen Tag dort warten ließ, etwas erlebte, das höchst eigentümlich genannt werden darf und für das ich noch heute keine rechte Erklärung weiß.
Auf den Gesang zu persönlichem Gebrauch hab ich Zeit meines Lebens wenig Wert gelegt. Das Weib war mir, für diese Nacht wenigstens, durch die Lappen gegangen. An Wein aber konnte ich, obwohl ich vom Saarbrücker Kasino her recht verwöhnt war, hinauf und hinab Rhein, Mosel, Ruwer und Saar sicher nichts Besseres finden als im Keller Klaus-Feist zu Traben-Trarbach. Also beschloß ich, als guter Rheinländer, mich dem stillen Suff zu ergeben.
Es war gegen neun Uhr, als ich in die Gaststube trat. Am anderen Ende war noch ein runder Tisch besetzt, augenscheinlich von den Honoratioren des Städtchens; außer ihnen war ich der einzige Gast. Ich speiste also zu Abend.
Und der Wein. Ich begann mit einer Flasche Ungsberger. Dann versuchte ich Trabener Rickelsberger. Dann: Gaispfad. Es tat mir jedesmal leid, mich von der einen Sorte zu trennen – nur so lange jedoch, bis ich mit dem ersten Glase der nächsten mir den Mund gespült hatte. Aber der Hühnerberger ist so gut, daß ich nun schon bei der zweiten Flasche dieses Weinchens saß.
Da schob sich die Tür auf – heran trat ein seltsam es Gast. (Nein, lieber Setzer, nicht »r«, nicht seltsam er Gast – wirklich, es muß schon »seltsam es Gast« heißen!) Denn dieses Wesen, ob es gleich sicherlich ein Mann war und auch männliche Kleidung trug, hatte etwas merkwürdig, gradezu aufreizend Sächliches. Es war sehr klein und vogelscheuchenhaft dünn, die schwarzen Hosen und der Gehrock schienen ihm dennoch zu eng zu sein: die Hosenröhren gingen kaum über die Waden, die langen Hände starrten weit aus den Ärmeln. Das schwarze, runde, steife Melonenhütchen deckte kaum den halben Kopf, der viel zu groß auf dem dürren Hals saß; überall quollen schwarze, angegraute Haarwuscheln heraus. Das Wesen trug einen steifen, viel zu weiten und sehr schmutzigen Kragen mit einem schwarzen Schlips; die graue, verstoppelte Gesichtshaut spannte sich über die Knochen. Ein mächtiger Adamsapfel; scharf Kinn und Nase; weit abstehende Ohren; dazu schwarze, wild flackernde Augen. Und dieses Kerlchen war von oben bis unten mit Kot bespritzt, als ob es sich den ganzen Tag im Regen in den Weinbergen herumgetrieben habe. Das Seltsamste aber: von jedem Knopf des zweireihigen zerschlissenen Gehrocks hing, Kopf nach unten, ein toter Maulwurf herab, an einigen gar zwei oder drei.
Der Schankkellner schien ihn gut zu kennen. »Guten Abend, Herr Urz!« begrüßte er ihn.
Der Mensch sah ihn an, erwiderte aber den Gruß nicht. Keiner der Herrn Honoratioren, bei denen auch der Wirt saß, schien sich um ihn zu kümmern; er nahm seinen Hut nicht ab, setzte sich schweigend an einen Tisch neben mich. Eine nach der andern löste er die schwarzen Scharrmäuse von seinen Knöpfen, legte sie vor sich hin und schob sie dann alle zusammen über den Tisch.
Der Kellner nahm sie auf, zählte sie. »Neunzehn,« nickte er. »Ich werde sie anschreiben.« Er ging; kam nach einer Weile wieder und brachte dem Lumpenkerl etwas kaltes Fleisch und Käse, Butter und Brot. Dazu einen Schoppen Wein.
Der Mann aß. Erst als er das letzte Krümchen verzehrt hatte, goß er ein Glas ein und leerte es. Stellte es zurück auf den Tisch, seufzte tief. Seufzte, seufzte – eine ganze Armee von Seufzern kroch über seine blauen Lippen.
Endlich bewegten sich diese Lippen. Erst flüsterten sie, murmelten etwas. Dann wurden ganz deutliche, jammernde Worte daraus.
»Ich habe mein Äffchen verloren!« krähte der Herr Urz in hohem Diskant
Nichts mehr. Still, ohne sich zu rühren, saß er da, schlürfte langsam seinen Schoppen. Als er fertig war, brachte ihm, ohne erst zu fragen, der Kellner einen zweiten.
Ich vertiefte mich in meinen Hühnerberger; den kann kein Mensch trinken, ohne bei jedem Schluck einen Blick zum Himmel aufzutun! Und wenn man genug davon trinkt, hört man die lieben Engelchen im Himmel Hallelujah singen. Nichts störte meine stille Andacht. Langsam nur stand einer nach dem andern der Herrn Honoratioren auf, nahm Hut, Schirm und Mantel und eilte hinaus in die Nacht. Jeder einzelne wandte sich um und rief: »Guten Abend, Herr Urz!« Aber der schien das nicht einmal zu hören. Er saß und suckelte an seinem Wein. Nur zuweilen seufzte er. Und ab und zu jammerte er kläglich: »Ich hab mein Äffchen verloren!«
Es ging auf Mitternacht, als der Wirt den letzten Herrn, den Oberförster, zur Türe geleitete. Er kam dann zu mir; grade als er sich niedersetzte, klagte das stille Gast in höchsten Fisteltönen wieder von seinem verlorenen Äffchen.
All mein Ärger war längst verflogen; ich fühlte mich höchst zufrieden bei meinem Wein und wollte alle Welt auch lustig sehn. »Bring dem Herrn zwei Flaschen Hühnerberger!« rief ich dem Kellner zu. »Wenn er sein Äffchen verloren hat – will ich ihm gern ein neues kaufen. Und einen ganz großen Mordsaffen dazu, der sich morgen in den allerschönsten Kater verwandeln soll!«
Der Kellner ging; der Wirt, dem ich ein Glas vollschenkte, stieß mit mir an. »Sehn Sie,« begann er, »das war unser Küster, der Herr Urz –«
Er unterbrach sich, die Türe ging auf – ein später Gast kam herein. »Niemand mehr da?« rief er.
Der Wirt erhob sich, half ihm aus dem schweren Gummimantel. »Alle schon fort, Herr Doktor!« sagte er.
»Sauwetter draußen!« rief der Arzt. »Und die Achse gebrochen – drei Stunden zu Fuß gelaufen. Steinhäger, Herr Wirt, den Magen zu wärmen!«
Es war ein dicker Herr, Sechziger, mit grauem Barte und einem Zwicker auf der Nase. Aber kräftig und gesund; ein richtiger Landarzt, der seinen Patienten ein gutes Beispiel vorlebte. Der Wirt brachte den Schnaps; der Arzt goß ein großes Glas hinter die Binde. Gab dann dem Kellner seinen triefenden Schirm, hängte seinen Hut an den Ständer. »So und nun noch ein Schöppchen,« bestellte er, »vor dem Zubettgehn.«
»Doktor!« rief ich. »Wenn Sie mir die Ehre geben wollen?«
Der Arzt schielte auf die Flasche. »Hühnerberger!« dehnte er. »Na, Sie wissen, was gut schmeckt! Da bin ich so frei – Dr. Schmitz heiß ich.«
»Angenehm!« nickte ich. »Mein Name ist – ist –« Ich stotterte; es fiel mir im letzten Augenblick ein, daß ich dem Wirt bei meiner Ankunft einen falschen Namen angegeben hatte. Das, schien mir, gehörte durchaus zur Romantik, wenn man mit einem Fräulein ein Stelldichein hat; ich hatte also in treuer Anhänglichkeit den Namen meines Ersten Staatsanwalts ausgeborgt. »Mein Name ist Dr. Schmeißer!« schloß ich.
Er nahm Platz, nicht ohne das stille Gast zu begrüßen, vor das der Kellner grade die von mir bestellten Flaschen hinsetzte. Der Herr Urz erwiderte diesen Gruß so wenig wie einen der andern; still seufzend füllte und leerte er sein Glas.
Wir stießen an und tranken – einen ganz gewaltigen Zug hatte der Doktor. Er schaute betrübt auf die Flaschen, die neben meinem Stuhl standen und ohne ihn leergeworden waren. »Das muß ich nachholen!« lachte er. Und das tat er auch – gründlich.
Wieder ließ der Herr Urz, schrillhoch, seinen Klageruf tönen:
»Ich hab mein Äffchen verloren!«
»Sagen Sie mir doch, meine Herrn,« bat ich, »was ist's denn eigentlich mit ihm? Hat der arme Kerl wirklich ein Äffchen gehabt, das ihm fortlief und dem er nun nachtrauert?«
»Nie hat er eins gehabt!« sagte der Wirt.
»Doch hat er eins gehabt!« sagte der Doktor. »Aber erzählen Sie nur, Klaus, erzählen Sie, ich werde nachher schon meinen Senf dazu tun.«
»Es ist gar nichts besonders,« meinte der Wirt. »Der Urz war eben Küster bei uns; leitete den Knabenchor in der Kirche, sang sehr schön selbst mit Dazu trat er den Blasebalg der Orgel; verrichtete alle Küsterpflichten dreißig Jahre lang zur vollsten Zufriedenheit des Herrn Pfarrers und der Gemeinde. Ein bißchen wortarm und menschenscheu war er ja stets – nur am Samstagabend kam er hierher, setzte sich still an seinen Tisch und trank sein Schöppchen. Dann, ganz plötzlich, vor etwa drei Jahren, erwachte er eines Tages mit dem fixen Gedanken, daß er sein Äffchen verloren habe. Nichts anders hatte er mehr im Sinn, als diese wilde Idee. Er vernachlässigte all seine Pflichten; es war unmöglich, ihn länger als Küster zu behalten. Die Gemeinde bewilligte ihm ein kleines Ruhegehalt. Immer tiefer bergab ging's mit ihm – nun treibt er sich tagsüber die ganze Woche lang in den Weinbergen herum und fängt Maulwürfe. Die bringt er mir dann her; ich kauf sie ihm ab – Maulwurfsfelle werden ja gut bezahlt heute.«
»Fertig?« rief der Doktor und hielt sein Glas hin, um bei der neuen Flasche nicht zu kurz zu kommen. »Nun, lieber Herr, so sieht's der Laie an. Mir, dem Arzt, liegt der Fall ein wenig anders. Sehn Sie – der Herr Urz hatte wirklich eine sehr hohe Stimme; daß er mit Leichtigkeit das hohe »C« sang, ist ganz sicher. Ich bin nicht sehr musikalisch gebildet – aber ich habe mir sagen lassen, daß es mal einen berühmten Sänger – Farinelli – gegeben habe, der zweieinhalb Töne darüber das hohe »F« habe singen können. Ich habe nun den Urz vor manchen Monaten behandelt – die Lungenentzündung hatte er – und es hat mich große Mühe gekostet, ihn wieder auf die Beine zu bringen. Ich habe bei der Gelegenheit ein wenig seine Psyche kennen gelernt. Ich glaube, daß er, wie weiland der weltberühmte Farinelli, das hohe »F« singen konnte. Das ging nun eines schönen Tages nicht mehr und damit bekam sein Leben einen Riß: der Herr Urz ist untröstlich, weil er sein »F«chen verlor!«
»Das ist aber doch sehr merkwürdig!« begann ich. »Erlauben Sie mal –«
»Gar nicht merkwürdig!« unterbrach der Wirt. »Es geht alles mit rechten Dingen zu.«
»Doch sehr merkwürdig!« rief der Doktor und gab dem Wirt einen tüchtigen Rippenstoß. »Es geschehen seltsame Dinge im Moseltale. Warum dem Herrn nicht die reine Wahrheit sagen, Klaus? War das Geschehnis der beiden Schneidermamsellen nicht auch sehr merkwürdig?«
»Welcher Schneidermamsellen?« fragte der Wirt. Aber der Arzt gab ihm einen zweiten Rippenstoß und trat ihm dazu auf den Fuß. Da nickte der Wirt und sagte kleinlaut: »Ja, ja – natürlich! Ja – gewiß!« Er zog eine neue Flasche auf und füllte die Gläser.
»Was ist's mit den Schneidermamsellen?« fragte ich.
Der Arzt erzählte: »Zwei Schwestern waren es, Zwillinge dazu, alte Jungfern. Sie hatten ihr Geschäft von der Mutter geerbt und es ging ganz gut. Sehr tüchtig waren sie; arbeiteten für alle Damen der Stadt. Jeder mochte sie gerne; Elisabeth hieß die eine und die andere Charlotte, aber man nannte sie nur die Schneiderlili und die Schneiderlolo. Und nun stellen Sie sich vor, lieber Herr, am Dreikönigstage vor nun sieben Jahren verloren die Lili und die Lolo ihre Ellen! Erinnern Sie sich noch, Klaus?«
»Natürlich erinnere ich mich!« bekräftigte der Wirt.
»Vier Ellen hatten sie,« fuhr der Doktor fort, »Sie müssen wissen, daß man bei uns auch heute noch nicht mit Metern, sondern mit Ellen mißt. Jede hatte zwei Ellen – zwei die Lili und zwei die Lolo. Und die waren fort, die vier Ellen – einfach fort über Nacht! Wie kann man ein Schneidergeschäft führen ohne Ellen?«
»Ja, aber,« versuchte ich, »warum kauften sie –«
»Warten Sie nur,« rief der Doktor, »das ist noch nicht alles! Um diese Zeit war der dicke Weinhändler Rappapport aus Köln da, der hörte von der Geschichte. Und bei einer Weinprobe – hier an dem Tische, an dem Sie jetzt da sitzen, lieber Herr – erklärte er, daß er den beiden armen Mädchen helfen wolle. Vier Ellen könne er ihnen zwar nicht geben, da er keine habe. Aber er habe vier Péchen und die wolle er ihnen schenken!«
Ich trank meinen Wein aus, ganz wirr wurde mir im Kopfe. »Was wollte er ihnen geben?« fragte ich.
»Vier Péchen!« wiederholte der Doktor. »Alle vier, die er hatte! Er hieß doch Ra ppapport, nicht wahr, Klaus?«
»Gewiß! Ra ppapport hieß er!« bekräftigte der Wirt.
»Und nun stellen Sie sich vor,« fuhr der Arzt fort, »welch Geklatsch und Gelächter das in unserm Städtchen gab! Denken Sie scharf nach, lieber Herr: die Lili und die Lolo hatten ihre Ellen verloren, liefen ohne Ellen in der Welt herum, nackt und bloß, die armen Wesen! Und dafür wollte nun der Kölner ihnen seine vier Péchen anhängen, jeder zwei – was wäre draus entstanden? Der reine Hohn war es! Die armen Dinger weinten sich fast die Äuglein aus, wagten kaum mehr sich auf der Straße sehn zu lassen. Schließlich zogen sie fort, kamen immer mehr herunter. Was ist aus ihnen geworden? Irgendwo im Hessischen sind sie gestorben!«
»Aber, lieber Doktor,« versuchte ich, »das ist alles doch nur ein Witz! Wenn die –«
»Ein Witz?« johlte der Arzt. »Ein Witz? Trinken Sie, trinken Sie, lieber Herr, damit unser guter Wein Ihrem Geiste mehr Klarheit verleiht! Das ist eben das seltsame Verhängnis unsrer Stadt, daß solche Witze bei uns zu tragischen Wirklichkeiten werden – jeden Tag kann so etwas geschehn bei uns! Stelln Sie sich nur vor, Herr Dr. Schmeißer, daß Ihnen einmal ähnliches widerfahren würde! Sie haben eine mächtige Zeche heute Abend und mit Gottes und unserer Hilfe wird sie noch höher werden – prosit, lieber Herr! Das wird manches schöne Emmchen kosten, was, Klaus? Und nun überlegen Sie, was geschehn könne, wenn Ihnen dieser unerbittliche Wirt auch das letzte, ich betone ausdrücklich, das allerletzte Emmchen kaltblütig wegnehmen würde? Ich frage, Herr Doktor Sch meißer – was würde ohne dies Emmchen aus Ihnen werden?«
»Hören Sie auf,« rief ich, »um aller lieben Heiligen willen hören Sie auf! Ich will es nur gestehn: ich heiße gar nicht Dr. Schmeißer! Ich habe den Namen nur ins Fremdenbuch geschrieben, weil – weil ich – inkognito reise!«
»Freuen Sie sich, lieber Herr Inkognito,« lachte der Doktor, »daß es so ist und daß Sie diesmal der Gefahr entronnen sind! Sie werden zur Strafe noch ein paar Flaschen kommen lassen und dabei lernen, wie furchtbar das Schicksal der Schneidermamsellen war und das des armen Herrn Urz noch ist.« Er wandte sich um, trank dem stillen Gast zu und rief: »Wer war der beste Orgelblasebalgtreter der Stadt?«
»Ich! Ich!« jammerte der Urz. »Aber nun hab ich mein Äffchen verloren! Ich kann keinen Wind mehr machen!«
»Nein, nein,« meinte der Doktor, »das geht nun leider nicht mehr!«
»Er pfeift auf dem letzten Loch!« fügte der Wirt hinzu.
»Das Schicksal unsrer armen Stadt!« sagte der Arzt und bekreuzte sich. »Aber wir wollen von heiteren Sachen reden – nichts mehr davon. Trinken Sie, lieber Herr, trinken Sie!«
***
Ich habe nicht viel Erinnerung daran, was weiter geschah – nur daß die beiden mich später die Treppen hinauftrugen, auszogen, zu Bett brachten.
Aber am andern Tage schien die helle Oktobersonne ins Moseltal. Gar keinen Jammer hatte ich – und dann kam auch bald das hübsche Fräulein aus Wiesbaden. Da vergaß ich das seltsame Verhängnis, das über Traben-Trarbach schwebte, und dies stille Gast, den Herrn Urz, dem die Maulwürfe von seinen Gehrockknöpfen baumelten.
Gott, wenn man jung ist –
Von elf Chinesen und ihrer aufgefressenen Braut
Dies ist eine sodomitische Geschichte. Manche Leute mögen solche Sachen nicht – das sind die, die sie nicht kennen. Oder aber: geborene Tartuffes. Denn es ist gar keine Frage, daß sodomitische Geschichten immer sehr lustig sind. Wenn mal ein Fall vor Gericht kommt, so freuen sich alle Richter und Staatsanwälte und Schreiber und Rechtsanwälte und besonders die Herrn Referendare – nur das Publikum kann sich nicht freuen, weil die Öffentlichkeit leider jedesmal ausgeschlossen wird, um die Sittlichkeit nicht zu gefährden: so genießt die schwarztalarte Familie still für sich. Das ist natürlich ein heller Blödsinn, denn kein harmloser Erdenbürger würde dadurch zur Sodomiterei verführt werden, daß er sieht, wie ein armer Teufel für ein bißchen vergnüglichen Greuels auf ein paar Jahre ins Zuchthaus gesteckt wird.
Und das ist noch, sagt das Gesetz, mild und human. Früher machte man's nicht so billig. Der liebe Gott ließ gleich Pech und Schwefel über die verseuchten Städte regnen und zerstörte Sodom und Gomorrha von Grund aus. Nur der brave Lot und seine Töchter wurden gerettet – aber Frau Lot wurde zur Salzsäule verwandelt, bloß weil sie sich noch einmal umwandte nach den Stätten des Greuels. Nun war die Familie Lot durchaus nicht übersittenstreng, denn die beiden Töchterlein schafften ihrem Papa gleich einen tüchtigen Schwips an, um sich dann von ihm – wie sagt man's nur hübsch druckanständig? – gesegneten Leibes machen zu lassen. Gleich alle beide! Wenn sich so die gottesfürchtige Lot-Familie benahm, die einzige, die der liebe Gott ihrer Sittenreinheit wegen vor dem Untergang rettete – wie mögen dann erst ihre Landsleute in Sodom sich aufgeführt haben!
Immerhin: lustig genug ist diese ganze Geschichte Sodoms trotz allem Pech und Schwefel – und lustig sind alle sodomitischen Greueltaten bis auf unsere Zeit. Daran haben die schauderhaftesten Strafen: kreuzigen, vierteilen, versäufen, rädern, verbrennen nie etwas ändern können, wie sie auch nie imstande waren, die Sodomiterei aus der Welt zu schaffen. Stets von neuem und überall in der Welt blüht das sodomitische Unkraut, das kein sittenreiner Gärtner je aus der Menschheit Garten wird ausrotten können – alle möglichen Tierlein erfreuen sich immer wieder allzu feuriger Menschenliebe. Zeitepochen, bestimmte Menschenklassen, einzelne Landstriche und Städte haben bald hier, bald dort den Götzen Sodoms Opfer gebracht. So gilt die zweite Hälfte des elften Jahrhunderts als eine Blütezeit der Sodomie, galt der Orden der Tempelritter als eine sehr sodomitisch verruchte Gesellschaft. Einige Landstriche Siziliens und der Abruzzen, ein Teil Dekans in Indien, das südliche China, ein hübsches Stück von Tunis und manche Strecken im Kaukasus sind heute bekannt als Greuelstätten der Sodomiterei, die zudem natürlich in allen Weltstädten ihre geheimen Tempel für Liebhaber hat. Auch gibt es in allen Ländern die eine oder andere Stadt, wo Sodoms Kultus mehr als sonst blüht – bald ist es Federvieh, bald ein vierfüßiges Viehlein, das besonders beliebt ist. Im Rheinland ist die alte Stadt Mettmann den Gerichten bekannt dafür, daß sie – und fast sie nur allein – solch amüsierliche Strafprozesse liefert – ach, werden die braven Mettmänner schimpfen, daß ich das ausplaudere! Mein Freund, der Referendar Jahn, wollte seine Doktorarbeit darüber schreiben: »Ursachen und Zusammenhänge der kulturellen Entwicklung des Kreises Mettmann zu dem zweiten Absatz des § 175 R.-Str.-G.-B. vom zwölften Jahrhundert bis heute.« Aber die Heidelberger Juristische Fakultät hatte wenig Verständnis für dieses Thema – da mußte er sich entschließen, über die »Bewegung der Grundverschuldung der Gemeinde Hubbelrath« zu schreiben. Was ja gewiß sehr viel wichtiger war – aber sicher nicht halb so lustig.
Denn kein Mensch kann leugnen, daß jeder einzelne Fall von Sodomiterei eine überaus komische Seite hat. Vom Goldenen Esel des Apulejus angefangen bis zu unseren Tagen haben wir eine lange Kette drolliger Schnurren und Anekdoten. Dieses harmloseste aller »Verbrechen« – es ist eine Affenschande, daß auch heute noch etwas, das den Arzt angeht, nie aber den Richter – in allen Strafgesetzbüchern der Welt mit schwersten Strafen genannt wird – ist von jeher sowohl dem gemeinen Volke als auch den über dem sogenannten Bildungspöbel stehenden Massen lediglich als etwas Lächerliches vorgekommen. Boccaccio, Aretino, Rabelais, Voltaire, Goethe, Balzac haben ihren Witz daran geschliffen. Heines bissigstes Gedicht beginnt:
»Zu Berlin im alten Schlosse Sehen wir in Stein gemetzt, Wie ein Weib mit einem Rosse Sodomitisch sich ergötzt.«
Die fürstliche Familie, zu deren erlauchten Ahnfrau der Spötter dieses roßlüsterne Weib macht, hat ihm diesen Witz nie vergessen – na, man kann's ihr weiter nicht übelnehmen. Höchstens der große Friedrich hätte gelacht über den frechen Scherz, obgleich der Voltairesche Anwurf, daß er's mit seinen Windhündinnen halte, keineswegs nach seinem Geschmack war. Doch befand er sich da in bester Gesellschaft: in seiner »Pucelle« läßt Voltaire die Jungfrau Johanna, nach der Einnahme von Orléans, ihren Reitesel zu sich in die Schlafkammer kommen. Freilich meinte der liebe Voltaire das nur allegorisch: der Reitesel bedeutet hier – die römische Kirche. Bekannt ist ein aus dem achtzehnten Jahrhundert stammender, übrigens nicht verbürgter und bald diesem oder jenem obersten Gerichtsherrn zugeschriebener Spruch, der ein niederes Urteil abänderte, wonach ein armer Kerl, der auf frischer Tat mit einer Ziege ertappt war, nach altem Rechte auf den Scheiterhaufen sollte. Ein Delinquent mußte brennen, so bestimmte nun mal das Gesetz; da entschied der kluge Gerichtsherr: »Die Ziege wird verbrannt!« Witziger und tierfreundlicher war schon Friedrich der Große, der unter Abänderung eines Urteils, das einen Husaren wegen allzu großer Liebe zu seiner Stute zum Hängen verurteilte, an den Rand schrieb: »Der Kerl wird zur Infanterie versetzt.« Heute macht man unter Kameraden kaum mehr eine Anzeige. Die Sodomiterei, die im Weltkrieg überall im Verborgenen blühte, wurde fast stets mit einem Witze abgetan. »Frau Feldwebelleutnant« hieß eine Kuh im Osten – und solch vierbeinige Soldatenfrauen gab's in allen Heeren.
***
Weil das nun einmal so ist und weil kein Pfarrer und kein Richter es je wird ändern können, und weil wir wissen, daß aus tiermenschlicher Vermischung weder Kentauren noch Faune, noch andere Mischwesen jemals hervorgehen können, und daß bei diesem »gräßlichen Greuel« wirklich niemandem die kleinste Unbill geschieht, so soll man auch den elf Chinesen, deren übrigens völlig wahres Abenteuer ich jetzt erzählen will, ihre sonderbare Liebesgeschichte nicht allzu übelnehmen.
Also da waren elf Chinesen in Chicago –
Aber nein, ich muß es anders anfangen. Da war mein Freund Fritz Lange in Chicago, der war Wäschermeister. Eigentlich war er Assessor, dann aber war er – Spielergeschichten – vor die Hunde gegangen. Rüber nach Amerika: Kellner, Geschirrwäscher, Plakatkleber, Rausschmeißer, Möbelkutscher, was man so werden kann da drüben. Schließlich hatte er doch Glück gehabt, hatte die Tochter eines Wäschereibesitzers geheiratet. Hatte sich eingearbeitet, dann das Geschäft, als der Alte starb, übernommen und sehr ausgebaut. Nun hatte er eine mächtige Wäscherei und ein paar Dutzend Annahmestellen in der Stadt verstreut.
Der kam zu mir, der Fritz Lange, ganz aufgeregt. Ich müsse ihm helfen: elf seiner Arbeiter seien verhaftet; Chinesen natürlich, das sind die besten und zugleich billigsten Wäscher in den Staaten. Und ich könne ihm helfen, da ich den Polizeirichter, der den Fall habe, gut kenne: Richter Mc Ginty sei es, mit dem ich ein paarmal in der Woche Stud-Poker spiele. Der aber, Mc Ginty, sei ein umgänglicher Mensch, mit dem sich reden lasse. Er müsse die elf Kerls haben; es sei nicht so leicht, im Handumdrehn elf andere chinesische Wäscher aufzutreiben.
Die elf Chinesen waren eingesperrt worden, weil sie den rothaarigen Jackie Murphy, einen vierzehnjährigen irischen Bengel, gottsjämmerlich verprügelt hatten.
»Warum haben sie ihn verprügelt?« fragte ich.
»Er hat die Braut verführt,« sagte Fritz Lange.
»Na, dann wird's nicht so gefährlich sein,« meinte ich. »Judge Mc Ginty ist zwar auch ein Sohn Erins und wird sicher für den Lausejungen sich einsetzen gegen die gelben Brüder, aber beim Whisky wird man's schon bereden können.«
»Es ist doch gefährlich!« rief mein Freund Lange. »Die ›Braut‹ – so nennen sie meine Chinesen! Die Braut ist nämlich nicht nur die Braut eines, sondern gleich aller elf! Zudem ist sie auch nicht ein weibliches Wesen weißer oder gelber Farbe! Kurz, die Braut der Elfe ist keine menschliche – sondern eine ganz richtige, vierbeinige, schweinische Saul«
»Und die hat der Jackie verführt?« fragte ich.
»Ganz richtig,« nickte der Weilandassessor. »Die Chinesen hier leben ja von nichts, sparen nur und sparen durch Jahr und Tag, um schließlich mit einem vollen Beutel nach Hause zu fahren. Nur auf eines können sie nicht verzichten – das ist die Fleischeslust in irgendeiner Form. Geil wie die Affen sind sie, da können sie halt nichts dafür. Also etwas müssen sie haben. So haben sich meine elf Kerls zusammengetan und ein Schwein gekauft – vom ökonomischen Standpunkt betrachtet gewiß ein gescheiter Gedanke, da sie etwas Billigeres kaum hätten finden können. Sie hausen alle zusammen in einer Kellerwohnung, und die Sau haust da mit ihnen. Der Jackie, der Sohn des Hausverwalters, ist ihnen nun auf ihre Schliche gekommen – dem Lausejungen hat die Sauerei augenscheinlich äußerst gefallen. So ist er denn, wenn meine Chinesen zur Arbeit waren, in den Keller gedrungen und hat in dem edlen Kreise der Liebhaber das Dutzend vollgemacht. Na, und das haben nun wieder die Chinesen gemerkt; die Eifersucht erwachte mächtig in ihren liebestollen Seelen: so haben sie den rothaarigen Bengel halb totgeschlagen.«
»Donnerwetter!« rief ich. »Das sieht ja bös aus. Und weiß Judge Mc Ginty das alles?«
»Natürlich weiß er!« antwortete Fritz Lange. »Jackies Vater ließ die Chinesen einsperren, und sie entschuldigten ihre Mißhandlungen mit des Buben Greueltaten. Der wurde nun auch eingesteckt – und erzählte heulend, daß er nur der zwölfte im Bunde war und alles erst von den Chinesen gelernt habe. Was dabei rauskommt? Zwanzig Jahre Zuchthaus wenigstens nach dem Gesetz des Staates Illinois – man ist hier nicht so milde wie bei uns drüben! Und ich bin meine besten Wäscher los! Nur: die ganze Sache ist erst bei der Polizei, noch nicht bei den ordentlichen Gerichten. Den Polizisten werde ich selber einen freundlichen Händedruck geben – wenn du nur den Mc Ginty, den Polizeirichter, auf dich nimmst!«
Er griff in die Tasche und holte ein Stück Nephrit heraus, wie ein Truthennenei so groß. Kaiserliches Jade, wundervoll geschnitten und von herrlichster grüner Farbe – ein paar hundert Dollar und mehr wert.
»Da!« rief er. »Das haben mir die Kerls gegeben. Sie haben immer etwas sehr wertvolles, das sie aus einer möglichen Patsche herausreißen kann. Zeig das Judge Mc Ginty – ich denke, er wird mit sich reden lassen.«
Also gut, ich nahm den Stein und ging zu Mc Ginty. Er war nicht zu Hause; seine Frau empfing mich, hübsch und sehr stattlich trotz ihrer fünfundvierzig Jahre. Und sie verstand es, sich anzuziehn.
Ich zeigte ihr gleich meinen Jadeklumpen – ihre Augen wurden groß und noch größer.
»Ich hab's mal geschenkt bekommen,« sagte ich leichthin, »und ich wollt's Ihrem Manne anbieten, da ich notwendig ein paar Dollars gebrauche.«
In diesem Augenblick kam Mc Ginty. »Kauf es!« rief ihm seine Frau entgegen. »Seit Jahren habe ich mir solch ein Stück gewünscht. Er läßt dir's sehr billig, nur –«
Der Richter betrachtete den herrlichen Stein, steckte ihn dann in die Tasche. »Kommen Sie,« sagte er zu mir. »Ich will Sie nicht übers Ohr hauen, wir wollen ihn abschätzen lassen.«
Er zog mich mit hinaus, trotz der Bitten seiner Frau, doch den Handel gleich abzuschließen. »Gott, um fünfzig Dollars!« rief sie uns nach.
»Was ist's damit?« fragte er mich auf der Straße.
Ich sagte: »Na, Judge, Sie wissen ja von den Chinesen, die gestern eingeliefert wurden. Mein Freund Lange braucht die Arbeiter, will sie raushaben. Die Kerls haben ihm den Stein gegeben, um ihn zu Geld zu machen für ihre Verteidigung.«
Mc Ginty sah mich scharf an. »Ich weiß nicht recht –« begann er. »Was haben sie eigentlich angestellt?«
»Nichts besonderes,« log ich. »Sie haben einen vierzehnjährigen Jungen verprügelt.«
»Sonst nichts?« sagte der ehrliche Richter. Er zwinkerte mich an und gab mir einen Rippenstoß.
»Nicht, daß ich wüßte!« lachte ich.
Judge Mc Ginty räusperte sich, dann sagte er:
»Also gut, ich will den Stein kaufen, weil er meiner Frau so gefällt. Aber mehr als zehn Dollars kann ich nicht dafür geben. Da – hier sind sie! Das genügt zur Verteidigung. Gehn Sie gleich zu Jim Mc Namus, dem Anwalt, wissen Sie. Geben Sie ihm die zehn Dollars – warten Sie, ich lege noch einen hinzu, da bekommt er einen Dollar für jeden. Den Lausbub Murphy muß er umsonst verteidigen, weil er auch irisch ist. Sagen Sie Mc Namus, er möge um sechs Uhr heute abend zum Polizeigericht kommen, da machen wir die Geschichte rasch ab. Und nun, bitte, entschuldigen Sie mich – ich muß zu meiner Frau – ihr die Kleinigkeit bringen, in die sie so vernarrt ist.«
Er spielte mit dem Stein in der Tasche – ah, Judge Mc Ginty wußte sehr genau, was er wert war.
Am Abend war ich im Polizeigericht. Ein Polizist sagte aus, daß die elf Kulis den Jungen Murphy verprügelt hätten. Der Bengel sagte nichts. Die Chinesen sagten erst recht nichts. Der Verteidiger bat um eine milde Strafe. Judge Mc Ginty verurteilte jeden zu einem Dollar Strafe an die Staatskasse und zu einem weiteren Dollar Schmerzensgeld an den Vater des Jungen. Fritz Lange bezahlte sofort die zweiundzwanzig Dollars und noch fünfundzwanzig weitere als Kosten des Verfahrens. Sehr befriedigt gingen alle nach Hause – noch nicht fünf Minuten hatte alles gedauert.
***
Eine Woche später holte mich abends Fritz Lange ab. Ich möge mitkommen zu seinen Chinesen, sagte er, die wollten sich bedanken bei mir. Also, ich ging mit ihm; wir stiegen in den Keller hinunter. Alle elf waren da und mit ihnen der rothaarige Murphybub. Sie waren sehr höflich zu mir, boten mir Saki an und ein wenig Reis.
Dann aber begann erst das Festmahl.
Es gab Schweinebraten.
Sie waren einmal hereingefallen – und hatten es teuer bezahlt. »Führe uns nicht in Versuchung« dachten sie.
So hatten sie ihre Braut geschlachtet.
Und verzehrten sie nun – mit beneidenswertem Appetit.
Ich darf wohl sagen: ich bin ziemlich vorurteilslos. Bin auch kein Kostverächter.
Aber damals habe ich doch gedankt.
Mein Begräbnis
Drei Tage vor meinem Tode schrieb ich eine Postkarte an die »Roten Radler«. Ach so, diese Geschichte sollen ja auch die Berliner lesen! Die Berliner sind fein, sie sagen nicht Fahrstuhl, sondern Lift, sie sind »Gents« und beileibe keine »Herren«, und wenn sie etwas besorgen wollen, so schicken sie zum »Messenger-Boy-Institut«. Und daraus kann man schon ersehn, daß diese Geschichte nicht in Berlin sich abspielte, denn ich schrieb eine Karte an die Roten Radler, weil das sehr hübsch klingt, und gar nicht an die Messenger-Boys, weil das ein ganz abscheuliches Wort ist. Meine Karte lautete:
»Bitte, drei Tage nach Empfang dieser Karte, mittags um zwölf Uhr eine Kiste zum Friedhofe zu besorgen. Die Gegenwart aller Roten Radler ist dabei erforderlich. Bezahlung und nähere Anweisungen liegen auf der Kiste.«
Dann Name und Anschrift.
Die Roten Radler kamen pünktlich und mit ihnen kam der Herr Oberradler – in Berlin würde man sagen: der Messenger-Boy-Institutsgeneraldirector. Es war eine große lange Eierkiste, die sie holen sollten, und ich hatte mit vieler Mühe darauf gemalt: »Glas!« und »Zerbrechlich!« und »Vorsicht!« und »Nicht stürzen!« In der alten Eierkiste lag natürlich meine Leiche, aber ich hatte den Deckel nicht zuschlagen lassen, weil ich durchaus eine ›schöne Leich‹ sein wollte und daher aufpassen mußte, ob auch alles richtig besorgt würde. Der Oberradler nahm zuerst das Geld, das ich auf den Deckel gelegt hatte und zählte es nach. »Fünfundvierzig Rote Radler« sagte er, »für zwei Stunden – es stimmt!« Er steckte das Geld in die Tasche und las nun meine Anweisung. »Nein,« sagte er dann, »das geht nicht! – Das ist nicht unser Geschäft.« Ich machte meine Stimme recht dumpf und antwortete aus der Kiste: »Die Roten Radler besorgen alles!«