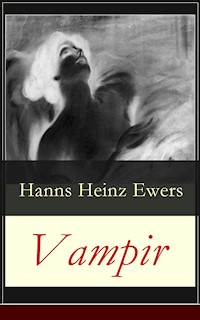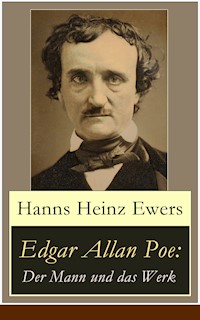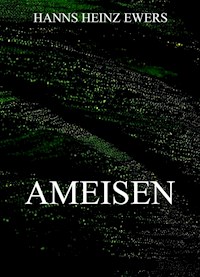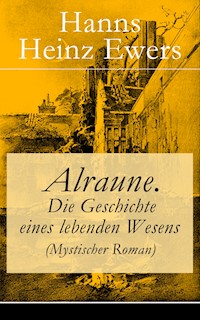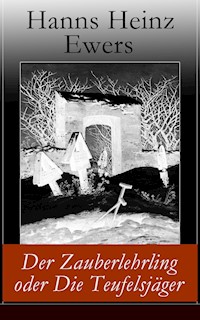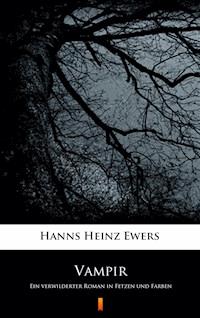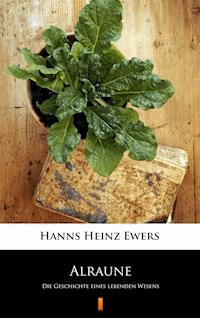Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: MetaGIS E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Roman "Fundvogel. Die Geschichte einer Wandlung" erschien tatsächlich bereits 1928. Ein Fakt, den man kaum zu glauben vermag, wenn man der spannenden Handlung folgt. Er wurde 1934 von den Nationalsozialisten verboten. Hanns Heinz Ewers schrieb in FUNDVOGEL von unerfüllter Liebe, von Sexualität, vom Gefühl, im falschen Geschlecht gefangen zu sein, von einer erfolgreichen Geschlechts-umwandlung (zu einer Zeit, als dies medizinisch noch reine Zukunftsfiktion war) und letztlich von Liebe, die in einer homosexuellen Beziehung ihre Erfüllung findet. Wen wundert, dass dies alles den Nazis gar nicht gefallen hat? Ewers Sprache ist modern, seine Themen aktueller denn je!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 672
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
HANNS HEINZ EWERS
FUNDVOGEL
ROMAN
© der digitalen Ausgabe 2017 by MetaGIS E-Books
Die originale Erstausgabe dieses Romans von Hanns Heinz Ewerserschien 1928 in Berlinbei der Sieben Stäbe Verlags- und Druckereigesellschaftunter dem Titel »FUNDVOGEL. Geschichte einer Wandlung.«
Für die bei MetaGIS-Books erschiene Ausgabe(ISBN 978-3-936438-85-7 // © 2016 by MetaGIS-Books)wurde der Text der neuen deutschen Rechtschreibung angepasst.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise –nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Redaktion: Matthias Werner, Maran Alsdorf & Horst IllmerVorwort: Horst Illmer
Lektorat & Kommentar: Maran AlsdorfKorrektorat: Horst Illmer, ReichenbergUmschlaggestaltung: Maran AlsdorfSatz: MetaGIS Books, Mannheim
eISBN: 978-3-936438-81-9
INHALT:
VORWORT
Eine Einführung von Horst Illmer.
AUTORENPORTRAIT
Hanns Heinz Ewers
KAPITEL I
So liegen die Dinge.
KAPITEL II
Von Gänsen, Geistern und Blutegeln.
KAPITEL III
Falken auf Woyland.
KAPITEL IV
Der Mann vom Pustertal.
KAPITEL V
Von Englischen Fräulein und Sonnigen Inseln.
KAPITEL VI
Schiffbrüche.
KAPITEL VII
Alea jacta!
KAPITEL VIII
Der Habicht Hella.
KAPITEL IX
Von Doppelgängern und von der Heiligen Kümmernis.
KAPITEL X
Von Iffi und Ivo.
KAPITEL XI
Großer Tag in Illmau.
KAPITEL XII
Wind weht von West.
KAPITEL XIII
Le Nez de la Rigolette.
KAPITEL XIV
Vom Roten Stein.
KAPITEL XV
»Partita«.
ANHANG
Begriffserklärung
Namedropping (Verzeichnis historischer Perönlichkeiten)
Übersetzung fremdsprachiger Textteile
Ort: Der Planet Erde
Zeit: Die letzten 150 Jahre
Thema: Die sexuelle Identität des Menschen
Im Neuentwurf der Klassifizierung ICD-11 ist »Transsexualismus« als medizinischer Zustand enthalten (Condition related to sexual health), der als »gender incongruence«, d. h. »geschlechtliche Nichtübereinstimmung«, bezeichnet wird.
Damit wird nach dieser zukünftigen Klassifikation Transsexualität nicht mehr als Persönlichkeits- oder Verhaltensstörung bzw. psychische Störung angesehen.
Das Inkrafttreten der ICD-11 ist für 2017 vorgesehen.
Zu Beginn des Jahres 1872, knapp 2 Monate nachdem Hanns Heinz Ewers am 3. November 1871 in Düsseldorf zur Welt kam, tritt in Deutschland das neue Strafgesetzbuch in Kraft, dessen Paragraph 175 die gleichgeschlechtliche Beziehung zwischen Männern unter Strafe stellt.
Als Ewers am 12. Juni 1943 in Berlin stirbt, erleben Homosexuelle in Deutschland gerade die Zeit ihrer intensivsten und extremsten Verfolgung.
Der Paragraph 175 STGB wird erst am 11. Juni 1994 ersatzlos aus dem Strafgesetzbuch gestrichen.
Laut der internen Statistik von Google ist Bruce (bzw. Caitlyn) Jenner im Jahr 2015 die Person, nach der am zweithäufigsten gesucht wird. Bruce W. Jenner kommt am 28. Oktober 1949 als Junge zur Welt, gewinnt 1976 die olympische Goldmedaille im Zehnkampf der Männer und zeugt in (bisher) drei Ehen mehrere Kinder. In den 1980er Jahren beginnt er Hormone zu nehmen, um eine Angleichung an sein als weiblich empfundenes Geschlecht zu erreichen. Zudem unterzieht er sich diversen Operationen. Anfang 2015 erklärt Jenner, dass er eine Transfrau ist und sich ab sofort Caitlyn Marie Jenner nennt. Im September 2015 werden Namensund Geschlechtsänderung gerichtlich bestätigt. Jenner sucht bewusst die Öffentlichkeit, lässt sich für Zeitschriften fotografieren und ihre Transformation mittels einer Fernsehserie dokumentieren.
Ab 1900 erscheinen die Hauptwerke Siegmund Freuds (DIE TRAUMDEUTUNG, ZUR PSYCHOPATHOLOGIE DES ALLTAGSLEBENS, DER WITZ UND SEINE BEZIEHUNG ZUM UNBEWUSSTEN) mit denen er zum Begründer der Psychoanalyse wird. Im Jahr 1913 folgt TOTEM UND TABU, in dem er sich mit dem Inzestverbot beschäftigt.
In diesen Jahren erscheinen die frühen Hauptwerke von Ewers (die Kurzgeschichtensammlungen DAS GRAUEN und DIE BESESSENEN sowie die Romane DER ZAUBERLEHRLING und ALRAUNE), die allesamt zu riesigen Erfolgen werden und es dem Autor erlauben, als Globetrotter um die Welt zu reisen.
In Deutschland haben gleichgeschlechtliche Paare kein Recht auf Eheschließung. Sie dürfen nur eine sogenannte »eingetragene Lebenspartnerschaft« schließen, welche im Vergleich zur Zivilehe mit den gleichen Pflichten, aber weniger Rechten ausgestattet ist. Seit dem 23. Juli 2008 ist es allerdings ausnahmsweise möglich, dass, wenn in einer verschiedengeschlechtlichen Ehe ein Partner sein Geschlecht ändert, die Ehe nach deutschem Recht weiterhin Bestand hat, obwohl beide Partner dann das gleiche Geschlecht haben. Die Ehe darf nach der ersatzlosen Streichung des § 8 Abs. 1 Nr. 2 Transsexuellengesetz ungeschmälert fortgeführt werden.
Der erste Weltkrieg überrascht Ewers auf Kuba. Nachdem er von dort in die USA gelangt ist, wird er vom deutschen Botschafter aufgefordert, für das Deutsche Reich Kriegspropaganda zu betreiben. Daraufhin wird er von den USA unter Beobachtung gestellt und zeitweise interniert. Erst 1920 darf er nach Deutschland ausreisen. Ewers wandelt sich in diesen Jahren scheinbar vom Kosmopoliten zum Nationalisten.
1919 eröffnet der Sexualforscher und Arzt Magnus Hirschfeld in Berlin das Institut für Sexualwissenschaft, die weltweit erste Einrichtung zur Erforschung der menschlichen Sexualität.
1928 erscheinen fast zeitgleich die Romane ORLANDO von Virginia Woolf und FUNDVOGEL von Hanns Heinz Ewers. In beiden Büchern geht es um den Wechsel des natürlichen Geschlechts einer Person in sein Gegenteil – allerdings könnten die beiden Bücher kaum unterschiedlicher sein, sei es der literarische Stil oder die »Methode«, mittels derer der Wandel erfolgt.
Ewers hat für seine »Geschichte einer Wandlung« intensiv in Berliner Kliniken und Instituten recherchiert und mit Ärzten, Psychologen und Patienten gesprochen. Die medizinischen und psychologischen Beschreibungen in FUNDVOGEL belegen dies eindrucksvoll – und sichern Ewers damit einen Platz in der Literaturgeschichte als Autor des ersten Romans in dem eine Geschlechtsumwandlung mittels moderner Medizintechnik durchgeführt wird.
Im Jahr 1931 berichtet der Mediziner Felix Abraham in der Zeitschrift für Sexualwissenschaft über die ersten gelungenen vollständigen Operationen zur »Geschlechtsumwandlung an zwei männlichen Transvestiten«.
Hanns Heinz Ewers, geboren am 3. November 1871 in Düsseldorf als Hans Heinrich Ewers, war Schriftsteller, Filmemacher, Globetrotter und Kabarettist.
Er entstammte einer künstlerlischen Familie. Ewers’ Geschichten und Romane kreisen um die Themen Phantastik, Erotik, Kunst bzw. Künstler und Reisen in exotische Länder.
Seine teils äußerst drastischen Darstellungen machten ihn zum skandalumwitterten Bestsellerautor.
Gleichzeitig mußte er sich immer wieder gegen den Vorwurf zur Wehr setzen, seine Werke seien trivial, unmoralisch oder pornografisch.
In seinem äußerst bewegten Leben vertrat Ewers auch einander wiedersprechende Positionen. So trat er 1931 der NSDAP bei und engagierte sich in der Propagandaarbeit, setzte sich aber zur selben Zeit für die Gleichberechtigung der Juden ein.
Nach dem Röhm-Putsch am 30. Juni 1934 soll Evers auf der Liquidationsliste der SS gestanden haben. Mit den Nürnberger Gesetzen 1935 war die Entrechtung der deutschen Juden vollständig – Ewers begann seine Abkehr vom Regime und unterstützte seine jüdischen Freunde, indem er ihnen Ausreisevisa in die USA oder Großbritannien beschaffte.
Bereits im Jahr zuvor war ihm ein generelles Publikationsverbot erteilt worden, das – nach endlosen Eingaben seinerseits – erst 1943, kurz vor seinem Tod, wieder aufgehoben wurde.
Er starb, gesundheitlich stark angeschlagen und durch persönliche und berufliche Niederlagen geschwächt, am 12. Juni 1943 in seiner Wohnung in Berlin. Seine Asche wurde am 15. Oktober desselben Jahres auf dem Düsseldorfer Nordfriedhof beigesetzt.
The winds were foul, the trip was long,
Leave her, Johnny, leave her!
But before we go, we'll sing this song –
And it's time for us to leave her!
Oh, sing that we boys will never be,
Leave her, Johnny, leave her!
In a dirty bitch the like of she.
And it's time for us to leave her!
Well the rats have left – and we the crew,
Leave her, Johnny, leave her!
Oh, it's time by damn' that we went to!
Now it's time for us to leave her!
Matrosenlied um 1850
Andrea Woyland hielt einen Scheck in der Hand, starrte ihn an: zehntausend Dollar. Die Schrift war noch nass; sie hörte, die Treppe hinunter, die Schritte des Mannes, der ihn ausgestellt hatte. Das war Parker Aspinwall Briscoe von der ›Central Trust Bank‹, Briscoe, der Herr der ›Amalgamated Steel Company‹, der Mann, der Wolfram und Iridium in der ganzen Welt kontrollierte, der drei große Eisenbahnlinien im Land sein eigen nannte, dazu Kupferbergwerke in Chile, Platingruben im Ural, Ölfelder in Oklahoma, Mexiko und Persien. Nun, eben: Briscoe.
Und diese Zehntausend waren nur ein Anfang – sie würde mehr bekommen, viel, viel mehr. Sie würde eine runde Million auf ihrem Namen haben, auf ihrem eigenen Konto, frei zu ihrer Verfügung.
Würde das haben, wenn… Ja, wenn! Und: vielleicht!
Freilich, dafür hatte sie eingewilligt – jetzt eben, vor zwei Minuten erst – dass sie, sie, Andrea Woyland – nun, dass sie – aufhören würde, zu sein.
Das war es, was Briscoe von ihr verlangte, nichts weniger als das.
Sie hatte eingewilligt. Herrgott, was lag ihr an dieser Frau: Andrea Woyland? Die war fertig mit ihrem Leben, das wusste sie seit Monaten schon, ach, seit einem Jahr und mehr!
Nun aber, mit diesem Zettel in der Hand?! Nun – nach alldem, was ihr Parker A. Briscoe gesagt hatte?! Ah – Möglichkeiten!
Und, wie es auch kommen sollte, einstweilen hatte sie Zeit. Das ging nicht so schnell – viel war da noch zu tun. Langwierige Vorbereitungen – schwierigstes Austüfteln aller Einzelheiten. Wie groß immer Briscoes Tüchtigkeit sein mochte – und seine Macht und sein Reichtum – dies konnte er gewiss nicht. Er hatte gesagt, dass er schon jemanden auftreiben würde, der alles für ihn ordnen könne. Nun gut, das mochte sein – aber einstweilen war dieser Jemand nicht gefunden. Ob es überhaupt einen gab für solch eine Aufgabe – in diesem Land?
Dann – nach Europa musste sie für alle Fälle, so weit war Briscoe im Klaren. Das war ein Glück – gründlich leid war sie die Staaten und die Stadt New York. Auch: diesen Stadtteil, in dem sie wohnte, dieses Möchtegern-Zigeuner-Viertel: Greenwich Village. Ihre Trödelkramwohnung, zwei Zimmer und ein Küchenloch, die aufwartende Niggerschlampe, die dazu gehörte – sehr leid war sie das alles.
Andrea Woyland fuhr mit der Hand über die Stirn, lachte auf.
Ah – etwas könnte sie gleich haben. Heute noch, jetzt, im Augenblick! Sie sah auf die Uhr: eben Mittag vorbei. In ein paar Stunden konnte sie im Hotel sein.
Sie hörte die schwarze Aufwartefrau in der Küche hantieren, rief sie herein.
»Packen, Dinah,« befahl sie, »ich geh fort.«
Sie achtete nicht auf das Geschwätz der alten Negerin, ging durch die Zimmer, überlegte, was sie mitnehmen sollte. Manche Möbel gehörten ihr, dann Kleider und Wäsche und all der Krimskrams; aber sie beschloss, es stehen und liegen zu lassen, wie es lag und stand. Immer weniger schien ihr wert, mitgenommen zu werden – zwei Handkoffer füllte sie schließlich und ihren Schrankkoffer. Nicht einmal voll war der.
Dann rief sie das ›Plaza‹ an, bestellte Zimmer, befahl, gleich einen Pagen herzuschicken, ihr das Gepäck zum Hotel zu besorgen. Am Telefon fiel ihr der junge Rossius ein, von der ›Harald Tribune‹; der war schon lange scharf auf eine Wohnung im ›Village‹ – schwer genug konnte man da Zimmer bekommen und teuer obendrein. Der würde sich freuen – für ein Jahr noch hatte sie den Mietvertrag, und für diesen Monat war schon bezahlt.
All ihren Trödel mochte er haben, das, was sie Dinah nicht gab. Die konnte er auch gleich mit übernehmen, die war gewohnt an den Stall. Sie rief ihn an: noch am Abend, könne er einziehen, sagte sie, Dinah würde ihn erwarten. Tee sei noch da und ein paar Flaschen Wein und allerlei Vorräte – Dinah würde ihm alles zeigen. Sie? Nein, sie würde schon fort sein, würde niemanden mehr sehen von den Leuten des ›Village‹. Ja – Dinah habe die Schlüssel.
Sie lächelte, als sie auflegte. Rossius – warum gerade der? Der oder ein anderer – wie gleichgültig war das! Einmal, zweimal hatte sie ihn mitgenommen, spät nachts von ›Romany Mary's‹, wo die Boheme lärmte und schlechten Whisky trank, hatte mit ihm geschlafen, ach, wie mit anderen auch, so dann und wann. Nun würde sie ihn vergessen, nie wieder an ihn denken, wie sie die anderen vergaß.
Noch einmal lief sie durch die Zimmer; ihr Blick fiel auf den Schreibtisch, den sie übersehen hatte.
Papier, Schreibzeug – alles mochte liegen bleiben.
Nur die Füllfeder nahm sie. Sie riss die Schubladen auf, nahm die unbezahlten Rechnungen heraus; zehn, zwölf – sieh doch an, wohl tausend Dollar zusammen – die mochte nun die Bank zahlen. Die Briefe zerriss sie zu Fetzen, warf sie in den Papierkorb. Fünf waren dabei von Gwinnie Briscoe, Parkers Tochter – einen Augenblick zögerte sie, dann vernichtete sie auch diese Briefe.
Gwinnie, Gwinnie Briscoe: Um die allein ging ja das alles! Von der würde sie noch manches Schreiben bekommen, viel mehr, als ihr lieb war, dutzende, hunderte. Eine letzte Schublade – da lagen zwei Briefe allein für sich, von ihrem Vetter Jan Olieslagers. Sie sah nach dem Datum: der eine, aus Bermuda, war ein Jahr alt, und der andere drei Jahre schon – aus Peking. Sie nahm sie auf, riss sie halb durch – dann stockte die Hand; gedankenlos gab sie die Briefe in ihre Handtasche.
Sie kam an dem Spiegel vorbei, warf unwillkürlich einen Blick hinein, wandte sich schnell ab. Nein, nein, sie wollte nicht wissen, wie sie jetzt aussah.
Am Morgen erst hatte sie hier gestanden, eine gute Stunde lang, hatte sehr sorgfältig sich zurechtgemacht, mit allen Künsten, für den Besuch Parker Briscoes. Aber Spiegel – Spiegel waren ja überall: im Hotel mochte sie sich stundenlang ansehen, wenn sie Abschied nehmen wollte von Andrea Woyland, von – sich selbst.
Sie war fertig. Gab Dinah Geld und letzte Befehle. Dann ging sie die Treppe hinab, aus dem Haus hinaus. Durch die Gasse, hinaus aus der Gasse. Durch die Straßen – fort aus dem ›Village‹. Nicht einmal wandte sie den Blick.
So, das lag nun hinter ihr; nie würde sie dieses Haus, nie die Minetta Lane wiedersehen. Nie wieder Greenwich Village, Gott sei's gedankt!
Indianersommer, letzte Oktobertage. Helle Sonne über den Steinmassen der Riesenstadt.
Sie nahm die Untergrundbahn, fuhr zur Wall Street. Schritt die William Street hinunter, die Pine Street, bog ein in die Nassau Street. Dort lag die ›Central Trust‹.
Sie zahlte ihren Scheck ein, ließ sich ein Konto einrichten. Gab Auftrag, die Rechnungen zu bezahlen, zog ein paar hundert Dollar. Das ging schnell genug.
Als sie aus der Tür trat, stieß sie mit Briscoe zusammen. Sie nickte ihm zu, er riss den Hut ab.
»Ah, Miss Woyland!«, rief er. »Ihren Scheck ein gezahlt?«
»Ja«, sagte sie. »Und – ich wohne jetzt im ›Plaza‹. Für den Fall, dass Sie mich sprechen wollen.«
»Gut«, nickte er, »ich werd's Gwinnie sagen. Ich war zu Hause, war bei Gwinnie – darum komm ich so spät her. Ich hab ihr Bescheid gesagt – so in großen Zügen wenigstens.«
»Oh«, machte Andrea Woyland. »Wie geht's ihr?«
»Besser, danke schön, viel besser!« rief Briscoe eifrig und rieb sich die Hände. »Diese Nachricht, dass Sie einverstanden sind, wird sie bald wieder hochbringen. Gefahr ist längst nicht mehr vorhanden, seit ihr Dr. Nisbett rechtzeitig den Magen auspumpte. Aber freilich wird sie noch manche Schmerzen auszustehen haben, bis alles wieder in Ordnung ist. Ungestraft trinkt schließlich kein Mensch Lysol! Aber vielleicht war's ein guter Denkzettel – vielleicht wird sie nun vernünftig werden.« Er seufzte; dann fiel ihm ein, dass sie immer noch in der offnen Tür standen.
»Verzeihen Sie, Miss Woyland,« sagte er, »ich bin unachtsam. Darf ich Sie bitten, in mein Privatzimmer zu kommen?«
Sie konnte es nicht gut abschlagen, nickte, folgte ihm. Sie gingen zum Fahrstuhl, fuhren hinauf, traten in sein Büro. Sie sah sich um, versuchte den Gedanken: Von hier aus also regiert Parker A. Briscoe…
Aber es gelang ihr nicht. Sie wollte ins Hotel fahren, für sich sein, allein. Sie dachte: ›Seul avec mon âme!‹ Wer sagte das doch? – Robespierre oder so einer! – Ah, sie hatte genug gehört an diesem Morgen. Sie bedauerte nun, dass sie zur ›Central Trust‹ gegangen war – warum nicht in eine andere Bank?
Er schob ihr einen Sessel hin, seitlich an den Schreibtisch, setzte sich dann selbst. Nahm die Gegensprechanlage, gab Befehl, nicht zu stören für zehn Minuten. Dann wandte er sich ihr zu.
»Es ist mir sehr lieb, dass ich Sie noch einmal traf, Miss Woyland, sehr lieb. Was ich Ihnen heute Morgen sagte, war geschäftlich, ich hatte mir's lange überlegt – fast Wort für Wort. Es war das Ergebnis meiner Besprechungen mit Edison, Steinmetz und ach, ich sagte Ihnen das wohl schon. – Sie können sich denken, was ich diese Woche durchgemacht habe. Erst dieser scheußliche Selbstmordversuch meiner einzigen Tochter – eben siebzehn, eben siebzehn! Und dann Gwinnies Eröffnungen – ihre Gründe für das, was sie tat! Verliebt – verliebt in eine Frau! Jesus, ich weiß, dass es das gibt, weiß, dass kein Kräutchen dagegen gewachsen ist. Nun – auch solche Menschen finden schließlich ihr Glück!«
Sie sah, wie dieser kräftige, sehr breitschultrige Mann sich zusammennahm, wie er sich in einen Gedankengang hineinzwang, der doch seiner innersten Natur zuwider war. Einen Augenblick zeigte er sein weißes, mächtiges Gebiss, seine Kaumuskeln arbeiteten, obwohl er gewiss keinen Gummi im Mund hatte.
Auf dem Tisch trommelte seine Hand. »Sehen Sie, Miss Woyland«, fuhr er fort »ich habe meine Frau sehr geliebt, habe nie eine andere Frau berührt außer ihr – werde es nie tun. Und ich sage Ihnen: ich bin heute froh, dass sie tot ist, bin froh, dass sie das nicht zu erleben braucht. Ich – ich verstehe das ja, muss es verstehen – aber sie würde nichts davon begreifen! Denken Sie doch, ihre Tochter, Evelyn Briscoes Tochter, verliebt sich in eine Frau und versucht Selbstmord, weil diese Frau von solchen Gefühlen nichts wissen will!!«
Er schwieg; Andrea hatte das Empfinden, dass sie nun etwas erwidern müsse.
»Um die Wahrheit zu sagen«, begann sie, »ich habe mir die redlichste Mühe gegeben. Gwinnie ist sehr hübsch, sauber und klug – ein Blinder muss sehen, wie entzückend sie gewachsen ist. Sie ist lieb und schmeichlerisch – war mir angenehm vom ersten Augenblick an. Ich merkte sehr bald, wie es stand mit ihr, merkte, wie sie sich mehr und mehr quälte, wie ihre – ihre Liebe zu mir mit jedem Tage wuchs. Ich versuchte immer wieder, sie abzulenken, allen Gelegenheiten nach Möglichkeit aus dem Wege zugehen. Aber Gwinnie hat ihren Willen – ihren eignen Willen, wie Sie, Mr Briscoe. Sie scheut sich nicht, geht grade zu auf das, was sie will. Sie erklärte sich und – und –«
Er unterbrach sie: »Ja, und Sie hatten Mitleid mit dem Kind – ich weiß, Miss Woyland.«
»Das auch«, erwiderte sie, »Mitleid wohl auch. In aller Frauen Liebe steckt ein wenig Mitleid. Aber es war, ich leugne es nicht, weit mehr als das. Eitelkeit war dabei – Parker Briscoes Tochter hoffnungslos verliebt zu meinen Füßen. Neugier auch – da mochte, tief schlummernd in mir, ein unbekanntes Gefühl plötzlich wach werden. Und vielleicht ein Kitzel und eine Lust – etwas reizte mich an ihr, das Schlanke vielleicht, das Knabenhafte ihres jungen Leibes. Kurz – ich versuchte es, dachte, es wird schon gehen. Doch ging es nicht, ging ganz und gar nicht. Ich tat, was mir möglich war – aber es wurde ein Fehlschlag, ein jämmerlicher, erbärmlicher Fehlschlag. Je mehr ich mich zwang, ihre Empfindungen, ihre Zärtlichkeiten zu erwidern, umso kläglicher wurde es –«
»Ich weiß, weiß«, unterbrach sie Briscoe, »Gwinnie hat mir alles erzählt – Sie sind eben ein echtes Weib, eine völlig – wie sagt man das? – völlig normale Frau! So gut verstehe ich Sie – immer widerlicher wurde Ihnen das. Schließlich kam es so weit, dass Sie Gwinnie nicht mehr ansehen, ihre Stimme nicht mehr hören konnten! Und da sie nicht nachgab, besessen war, immer wieder Sie mit ihrer Liebe – nun Sie wissen ja! Also dann krachte es, explodierte: Sie spien sie an, warfen sie hinaus. Und Gwinnie begriff endlich, dass es Schluss war und aus, dass nicht ein Fünkchen leisester Hoffnung für sie glimme. – Da nahm sie Lysol – Lysol, wie ein Stubenmädchen!«
»Ach, sie wird es gerade zur Hand gehabt haben«, sagte Andrea.
Er schüttelte den Kopf. »Nein, nein, nichts hat sie zur Hand gehabt – sie hat das Zeug eigens gekauft. Hat vermutlich davon in der Zeitung gelesen – sehr beliebt ist das in solchen Fällen.
Gwinnie spricht von Freitod! – Freitod! Ein Wort hungerleidender Literaturjünglinge – als ob das etwas anderes sei als Selbstmord! – Noch einmal, Miss Woyland, glauben Sie nicht, dass ich Ihnen den allergeringsten Vorwurf mache, Sie haben völlig recht gehandelt, haben mehr als genug für meine Tochter getan. Aber das ist's; ich liebe Gwinnie – sie ist das Einzige, was ich habe, ist ein Geschenk meiner Frau – ich muss zu ihr halten. Und ich bin gewohnt, die Tatsachen zu sehen, wie sie sind, mögen sie für mich noch so unangenehm sein. Ich kenne keine törichten Hoffnungen, keine verschwommenen, sentimentalen Gefühle, pflege mir niemals selbst etwas vorzulügen – es kommt nichts dabei heraus, sage ich Ihnen.«
Er griff die Shagpfeife, die vor ihm lag. »Darf ich rauchen?«, fragte er. Sie nickte; schweigend stopfte er die kurze Pfeife, brannte sie an, machte ein paar rasche Züge.
»Der Gedanke, Miss Woyland«, fuhr er fort, »den ich Ihnen vortrug, wuchs in meinem Hirn. Ich las wohl einmal davon in einem Blatt, ich weiß nicht in welchem – sicher war's in der Untergrundbahn. Es machte Eindruck auf mich, blieb mir haften – und jetzt, jetzt fiel's mir ein. Ich stand vor der Tatsache; Gwinnie ist – ist einmal so, wie sie ist. Daran ist nichts zu ändern – seit Sapphos Tagen auf dieser – Verzeihen Sie! – dieser gottverdammten Insel Lesbos! Gwinnie ist in eine Frau verliebt – so heiß, so hoffnungslos, dass sie um dieser Frau willen Gift nimmt, Gwinnie erklärt, sie würde nur diese Frau je lieben – nur diese, nie eine andere! Das sagt schließlich jeder und jede unglücklich Liebende, Aber: Gwinnie ist meine Tochter. Sagte ich Ihnen nicht schon, dass auch ich nur einmal liebte in meinem Leben? Nur eine einzige Frau – meine Frau! Darum glaube ich das, was Gwinnie sagt – Erbteil ist's.«
Er schob die Hände ineinander, rieb sie heftig, als ob er sich wasche. Leiser wurde seine Stimme: »Wer ist Gwinnie? Mein Kind, meiner Frau Kind – ihr Fleisch und Blut und meins. Ist sie, Gwinnie, da verantwortlich? Die Eltern sind's – ich bin's! – Was ich also tun kann, muss ich tun – ich möchte sie glücklich sehen. Wenn's nur die leiseste Möglichkeit dazu gibt – will ich sie ergreifen. Dann fiel mir ein: Das, was ich, vor manchen Monaten vielleicht, einmal in der Zeitung las, das, schien mir, war eine solche Möglichkeit. Ich fuhr zu meinen Freunden – ich brauche Ihnen wohl nicht zu sagen, dass es die besten Köpfe der Staaten sind. Ich sprach mit Thomas Alva Edison, sprach mit Hiram P. Maxim, sprach mit Proteus Steinmetz und mit Jacques Loeb vom Rockefellerinstitut. Und die lachten mich nicht aus – sagten mir, dass das, was ich versuchen wollte, theoretisch wenigstens durchaus im Bereich der Möglichkeit liege. Darauf suchte ich Sie auf, machte Ihnen meinen Vorschlag. Und Sie – Sie nahmen an!«
»Ja, das tat ich«, sagte Andrea Woyland. Sie verstand nicht, wo er hinaus wollte. Das alles, kühler freilich, geschäftlich, immer gespickt mit verlockenden Dollarziffern, hatte er ihr schon heute Morgen gesagt.
»Ich bin gleich zu Ende«, begann er wieder, »verzeihen Sie bitte, wenn ich Sie aufhalte. Eins muss ich Ihnen noch sagen: Ich sah bisher die ganze Angelegenheit nur von meinem Standpunkt aus, und von dem Gwinnies. Unser Interesse allein kam für mich in Frage. Dann sprach ich mit Ihnen. Natürlich sah ich Sie an – aber es wurde mir doch nicht recht bewusst, wer Sie waren, was Sie sind, wie Sie aussehen. Das fiel mir erst ein, als ich draußen auf der Straße war, vielmehr, erst auf dem Weg von Gwinnie zur Bank. Ich dachte an Sie, nicht nur an Gwinnie, in dem Augenblick, als ich Ihnen unten an der Türe in die Arme lief.«
Er sah sie an, ruhig und prüfend. »Sie sind eine schöne Frau«, sagte er langsam. »Schön – vielleicht klug – und sicher wertvoll.«
Sie machte eine Bewegung, aber er ließ sie nicht zu Wort kommen. »Man soll die Menschen nur nach der ersten Begegnung beurteilen – ich habe es immer so gehalten und mich selten geirrt. Man fühlt, wie sie sind – wenn man die Begabung dafür hat – fühlt es, ob man dies Gefühl auch gewiss nicht begründen kann. Darum, Miss Woyland, ist es mir lieb, dass ich Sie vorhin traf. Ich will Ihnen sagen, dass ich – vielleicht – dies Opfer nicht von Ihnen verlangen darf. Vielleicht habe ich Sie überrumpelt heute Morgen – man rühmt mir nach, dass ich es besser verstehe, Menschen zu überreden, als irgendeiner im Land, und dass darin der Grund meiner Erfolge läge. Wünschen Sie etwa Bedenkzeit, wollen Sie meinen Vorschlag noch einmal gründlich überlegen? Vielleicht spielt Ihnen Ihr gutes Herz einen Streich, Ihr Mitleid mit der armen Gwinnie – vielleicht werden Sie einmal bitter bereuen, dass Sie so leicht –«
Die Frau erhob sich. »Sie irren sich, Mr Briscoe. Kein Mensch hat mich je überredet, etwas zu tun, das ich nicht tun wollte. Ich benötige keine Bedenkzeit, will nichts überlegen – und ich gebe Ihnen mein Wort, dass ich nichts bereuen werde. Auch habe ich heute gar kein Mitleid mit Ihrer Tochter. Was aber mein gutes Herz angeht…« Sie brach ab, lachte auf.
Er legte seine Pfeife auf die Schale, stand auf, trat zu ihr hin. »Wollen Sie mir sagen, weshalb Sie es tun, warum Sie uns dies Opfer bringen?«
»Ja, das will ich«, erwiderte sie ruhig. »Ich bringe Ihnen dies Opfer – wie Sie es nennen – weil es für mich kein Opfer ist. Ich nehme Ihren Vorschlag an, um des Geldes willen, Verstehen Sie mich recht: nur darum!«
Er lauschte auf den tiefen Alt ihrer Stimme. Sah sie still an, sagte dann sehr bestimmt: »Das ist nicht die Wahrheit, Miss Woyland.«
Das verwirrte sie, nervös knüpfte sie an ihren Handschuhen. »Es ist – die – halbe Wahrheit«, flüsterte sie.
Parker Briscoe wiegte den Kopf. »Oh. Gut«, sagte er, »Sie wollen nicht mehr sagen, und ich habe kein Recht, mehr zu verlangen.«
Er riss einen Zettel von einem Block, nahm einen Bleistift, schrieb. »Hier ist meine Privatnummer – rufen Sie mich an, wann Sie wollen. Was Sie bedürfen, steht zu Ihrer Verfügung. Wenn Sie mir noch erlauben würden, Ihnen – gelegentlich, meine ich – im Namen von Gwinnie natürlich…«
Er stotterte, rieb wieder die Hände, wie eine Fliege die Vorderbeine. Sie verstand ihn, half ihm rasch. »Ja, ja, Sie dürfen«, sagte sie mit einem harten Lachen, »dürfen nach Herzenslust! Ich werde nicht beleidigt sein – erlaube es Ihnen und Gwinnie auch. Sie dürfen mir Blumen schicken, so viel Sie wollen, Früchte und Zuckerzeug, Bücher, Pelze, Schmuck – alles. Und Geld auch, vergessen Sie das nicht, Geld auch – je mehr je besser!«
Briscoe lächelte, schüttelte den Kopf, »Danke«, sagte er, »Sie werden mich nicht an Ihnen irremachen. – Übrigens: Gwinnie wird fortreisen, nach Florida zu meinem Schwager – er hat einen Landsitz dort. Sie wird fahren, so bald es eben geht, wird Sie jetzt nicht mehr aufsuchen. Ich denke, dass das so besser ist – sie schien's auch einzusehen, hat mir's versprochen.«
Andrea nickte, das war gute Nachricht. Sie ging zur Tür; er öffnete, brachte sie hinaus zum Fahrstuhl. Sie zog ihren Handschuh aus, ehe sie ihm die Hand reichte, aber sie erwiderte kaum seinen Druck. Sie hielt seinen Blick und Briscoe begriff: Diese Frau wusste gut, was sie tat. Was er ihr auch geben würde – nie würde er ihr etwas schenken.
Würde dennoch immer in ihrer Schuld sein.
Er ging zurück in sein Arbeitszimmer; Tex Durham wartete auf ihn, sein Privatsekretär. Ein junger Bursche, blond und blauäugig, frisch von Harvard. Aufgeregt kam er ihm entgegen. »Endlich sind Sie da, Mr, Briscoe!«, rief er. »Ich muss Sie sprechen.«
»Geben Sie erst die Post, Tex«, befahl Briscoe.
»Liegt auf dem Schreibtisch«, rief der junge Mann, »da, wo sie immer liegt. Haben Sie sie noch nicht durchgesehen? Es ist ein Brief dabei – ich möchte mit Ihnen sprechen, ehe Sie den lesen!«
»Mein Gott, Tex«, lachte Briscoe. »Was haben Sie nur? Können Sie nicht eine halbe Stunde warten? Ist's so eilig?«
»Sehr eilig«, antwortete Durham. »Wenn Sie's wissen wollen: Mein Leben hängt davon ab – meines und vielleicht das Ihrer Tochter, Miss Gwendolin!«
Briscoe lachte wieder. »Ach, was Sie nicht sagen! Also so wichtig ist's? Wollen Sie mir zunächst verraten, warum Sie von meiner Tochter als ›Miss Gwendolin‹ sprechen? Es klingt ein wenig komisch, was? Kein Mensch hat sie je anders genannt, als Gwinnie – warum Sie nicht, Tex?«
»Gwin – Miss Gwendolin hat mir's verboten«, sagte der Sekretär. »Sie hat mir ausdrücklich befohlen, zu ihr und von ihr nur als Miss Gwendolin zu sprechen und zu denken. – Darf ich nun reden?«
Briscoe nickte: »Gott, ja, wenn's sein muss!«
Tex Durham ging zum Schreibtisch, nahm einen Brief, schob ihn nach vorn. »Dieser Brief ist von Ralph Webster – der ist auch verliebt in Miss Gwendolin. Er ist eifersüchtig, natürlich – darum schrieb er das. Es ist eine Gemeinheit; mein bester Freund war er, war mit mir auf der Schule, dann in Harvard…«
»Ja, ja«, drängte Briscoe, »ich weiß das. Machen Sie's kurz, Tex, ich habe wirklich keine Zeit.«
Der junge Mann nahm einen neuen Anlauf. »Was in dem Brief steht, ist durchaus richtig. Natürlich ist's nicht alles – alles weiß Ralph nicht. Aber es ist besser, dass ich's Ihnen sage, einmal müssen Sie's doch erfahren. Also hören Sie: Ich habe mich eingeschlichen in Ihr Haus, mich Ihnen aufgedrängt für meinen Posten, weil…«
Briscoe unterbrach ihn. »Reden Sie doch nicht solch erstaunlichen Blödsinn, Tex! Ich habe Ihnen diese Stellung gegeben, weil sie frei war. Ihren Vorgänger sandte ich nach Mexiko, wie Sie wissen. Und ich gab sie Ihnen, weil Ihr verstorbener Vater mein alter Freund war, weil Sie aus guter Familie und gut erzogen sind, weil Sie von der Universität die besten Zeugnisse brachten. Dann auch, weil Sie mir angenehm sind und ich manchmal lachen kann über Ihre Tapsigkeit. Und endlich, weil ich mir einbilde, dass Sie nirgends so viel vom Geschäft lernen können wie bei mir.«
»Aber ich will gar nichts davon lernen!«, platzte Durham los. »Es ist mir völlig gleichgültig! Ich bin für Golf zu haben, für Baseball und für mein Flugzeug! Ich habe Sie angelogen, Mr Briscoe, habe mich eingeschlichen bei Ihnen – wirklich, es ist schon so. Ralph weiß es auch – da in dem Brief steht's. Und ich hab es wegen Gwendolin getan: Wie konnte ich ihr leichter nahe kommen, als in dieser Stellung als Ihr Privatsekretär? Natürlich hab ich's ausgenutzt, nach besten Kräften. Ich konnte leicht jeden Tag erfahren, wo sie hinging – gut, da war ich auch. In der Oper, im Theater, im Konzert, in allen Läden! Und natürlich zu Hause bei Ihnen – nirgends war sie sicher vor mir. Gwendolin weiß davon, vor ihr hab' ich kein Geheimnis; sie lacht darüber – aber Sie werden's wohl nicht so leicht nehmen.«
Briscoe setzte sich an den Schreibtisch, brannte seine Pfeife wieder an. »Eine Frage, Tex. Wissen Sie, dass Gwinnie krank ist?«
»Natürlich weiß ich's«, rief Durham entrüstet. »Jerry, Ihr Butler, ruft mich alle paar Stunden an, um zu berichten, wie's ihr geht. Eine Magenverstimmung hat sie – von dem ewigen Eiswasser vermutlich.«
»Ja, ja, eine Magenverstimmung!«, bestätigte Briscoe händereibend. »Noch etwas: Haben Ihre Bemühungen um Gwinnie einigen Erfolg gehabt?«
Tex nickte: »Freilich haben sie das, sehr sogar; Miss Gwendolin hat mir ausdrücklich gesagt – und mehr als einmal! –, dass sie sich weder aus Ralph noch aus einem der anderen das Geringste mache: Sie gäbe nichts darum, wenn sie alle zusammen morgen früh der Schlag träfe. Das hat sie gesagt! Und mehr noch: von all ihren Verehrern sei ich ihr – bei weitem! – der liebste und bequemste.«
»So, so,« echote Briscoe, »der Liebste und – Bequemste. Sagen Sie, haben Sie sich Gwinnie sonst genähert? Ich meine – haben Sie ihre Hand gehalten, sie geküsst, in die Arme genommen?«
Der junge Bursch schüttelte den Kopf. »Nein, das nicht, das noch nicht. Miss Gwendolin ist komisch darin, sie hat nicht gern, wenn man sie anrührt. Sie ist sehr kitzlig, sagt sie. Aber, glauben Sie mir, das wird schon kommen!«
»Meinen Sie?«, lachte Briscoe. »Na, Tex, dann weiß ich wirklich nicht, worüber Sie sich beklagen wollen.«
Der Sekretär starrte ihn an, hilflos genug, mit treuen, blauen Augen. »Beklagen – ich mich beklagen?! Ich dachte, dass Sie… Ja, werden Sie mich denn nicht hinauswerfen?«
Briscoe schüttelte den Kopf. »Eine Bedingung habe ich. Sie schwatzten vorhin so was – ›dass Ihr Leben davon abhinge‹! Nun, ich habe eine starke Abneigung gegen Selbstmorde und Freitode und alles, was damit zusammenhängt; selbst das Gerede davon mag ich nicht. Wir wollen die Entscheidung Gwinnie überlassen. Schließlich ist sie ihr eigner Herr, wird schon wissen, wen sie will und wen nicht. Sie aber, Tex, werden zufrieden sein, wie sie sich auch entschließen mag. Versprechen Sie mir das?«
Er streckte dem jungen Mann die Hand hin, die dieser kräftig schüttelte.
»Gewiss«, rief er, »ganz gewiss und aus vollem Herzen! – Sie aber, Herr, Sie hätten nichts dagegen?«
Briscoe lachte, doch sein Lachen klang bitter ernst. »Ich sage Ihnen, Tex, mir – mir wäre nichts lieber. Von mir aus können Sie mit Gwinnie Tag und Nacht zusammen sein, hören Sie: Tag und Nacht!« Seine Stimme hob sich, drohend klang es und doch fast verzweifelt, als er fortfuhr: »Wenn es nach mir ginge, Tex – ich möchte sie am liebsten nackt in Ihr Bett tragen – heute Nacht noch, mein Junge!«
Mit beiden Händen fuhr er sich übers Gesicht, als wolle er heißen Schweiß wegwischen. Dann nahm er die Pfeife wieder auf. »Sprechen wir nicht mehr davon«, sagte er. »Geben Sie mir endlich die Post.«
Tex Durham hatte nichts zu lachen an diesem Nachmittag in der ›Central Trust‹; nicht eine Minute Ruhe ließ man ihm.
Um fünf Uhr erst wurde er von Briscoe entlassen.
Was er nun zu tun hatte, war ihm völlig klar. Gewiss begriff er nichts von den Beweggründen Briscoes, hatte auch keine Zeit gehabt, darüber nach zudenken; aber das verstand er gut, dass ihm von Seiten des Vaters keine Schwierigkeiten gemacht würden.
Also kaufte er zunächst einen großen Busch Orchideen, fuhr dann in die Park Avenue zu Gwinnies Haus. Jerry, der Hausmeister, führte ihn gleich hinauf; oben freilich gab's einen Kampf mit der Krankenschwester, die ihn nicht kannte und nicht ins Schlafzimmer lassen wollte. Aber Tex Durhams Mut hätte heute schlimmere Feinde besiegt: Bald stand er, strahlend lächelnd, vor Gwinnies Bett.
»Ach, du bist's, Texie,« rief sie ihm entgegen, »das ist recht, dass du herkommst! Und Blumen bringst du auch – leg sie da auf den Tisch.«
Er machte Miene, seine Orchideen auf den Nachttisch zu legen, aber sie wies ihn gleich zurecht.
»Siehst du nicht, dass da kein Platz ist? Leg sie dort hinten hin.«
Er gehorchte, lief durch das große Zimmer, kam zurück. Blieb vor ihr stehen, blickte sie an und genoss in vollen Zügen diesen Anblick.
Entzückend sah sie aus in ihrem Bett. Blauäugig und blond, wie er selbst; Pagenlocken umrahmten das Köpfchen und ruhten auf dem Spitzenkissen. Nackt Hals und Arme, fein und zart die Gelenke. Wie aus Elfenbein geschnitten das Gesichtchen, blühendrot Wangen und Lippen. Den Daumen der linken Hand hatte die süße Docke im Mund, suckelte und lutschte eifrig daran.
»Du siehst gar nicht krank aus, Gwendolin«, sagte er bewundernd. »Ganz gesund sind deine Farben –«
»Du bist ein Dummkopf, Texie,« lachte sie, »gib mir den Lippenstift!«
Er nahm den Stift vom Nachtkasten, hielt ihn fest.
»Nimm erst den Daumen aus dem Mund,« verlangte er, »du weißt, dass ich's nicht leiden kann. Du bist doch kein Säugling mehr!«
Sie gehorchte – rund herum war ein roter Ring um den Finger; sie wischte ihn achtlos am Kopfkissen ab. Nahm den Lippenstift, trug noch ein wenig mehr Rot auf, ihre Gesundheit zu verbessern.
Dann zuckte sie, drückte beide Hände auf den Leib, wand sich hin und her, stöhnte auf.
Er erschrak. »Hast du Schmerzen?«, fragte er.
Sie fuhr ihn an: »Frag' nicht so dumm. Natürlich hab ich Schmerzen – hélas! Im Magen und in der Speiseröhre – im Mund auch. Bring die Schale mit Eis, Tex, sie steht hinten auf dem Schminktisch.«
Er fasste ihre Hand, die sie ihm gleich wegzog.
»Wie oft soll ich dir sagen, dass du mich nicht anfassen sollst! Hol das Eis.«
Durham seufzte. »Wie kann man nur an den Händen so kitzlig sein! – Und das Eis bring ich dir gewiss nicht, Gwendolin, deine ganze Krankheit kommt von diesem ewigen Eisessen und Eiswasser trinken. Kein Wunder – da muss man ja Läuse in den Bauch kriegen!«
Gwinnie pfiff, dann sagte sie: »Gleich bringst du das Eis, sonst schick ich dich fort.« Da ging er, holte die Schüssel.
»Steck mir ein Stückchen in den Mund«, befahl sie. »Und wenn's fertig ist, noch eins und dann wieder eins, hörst du? Und, dass du's weißt: Es ist sehr gut für mich – Dr. Nisbett hat's sogar verordnet. Überall brennt's inwendig, und das Eis kühlt.«
Er wollte sich auf den Stuhl setzen, aber der lag voll von Kleidern. »Setz dich aufs Bett«, meinte sie. »Willst du auch ein Stückchen Eis?«
»Nein«, sagte er, »aber du könntest mir Tee kommen lassen. Und ein paar Butterbrote – ich habe heute keinen Lunch gehabt.«
Sie schellte und bestellte Tee für ihn. Mittlerweile ließ sie ihn keine Minute in Ruhe, hatte immer neue Befehle. Bald musste er die Heizung abstellen, weil es ihr zu heiß war – gleich darauf wieder andrehen, musste ihr Zigaretten holen, dann Schokolade. Dabei wusste er nicht, wo er mit der Eisschüssel hin sollte, trug sie sorgfältig mit sich herum.
Er war froh, als die Krankenschwester den Teetisch heranrollte; da konnte er die Schüssel wenigstens absetzen. Traurig sah er die dünnen Sandwiches an – mit Salatblättern waren sie belegt und ein wenig Mayonnaise darüber.
Er wandte sich an die Pflegerin. »Möchten Sie nicht dem Butler sagen, dass er mir noch einige Sandwiches bringt?«
»Er soll Zunge bringen und Schinken und Krabben und Hühnersalat«, befahl Gwinnie. »Er soll alles bringen, was er da hat! Siehst du, Tex, ich lass dich nicht verhungern, wie mein Vater.«
»Sag nichts gegen deinen Vater«, antwortete er kauend. »Er hat ein sehr gutes Herz.«
Sie nickte. Sagte dann nachdenklich: »Das glaube ich, das muss er wohl haben. Denn sonst, Texie, sonst hätte er dich sicher längst hinausgeschmissen.«
Der große Junge nahm den Bissen aus dem Mund.
»Warum sollte er mich hinauswerfen, Gwendolin?«
Sie lachte: »Weil du so schrecklich blöd bist, Texie, darum!«
Er lachte mit ihr. »Nun – vielleicht hat er's noch nicht gemerkt. Aber, Gwendolin, wenn's dir recht ist, möchte ich einmal ganz ernsthaft –« Er unterbrach sich; Jerry brachte große Platten heran, baute sie vor ihm auf.
»Iss, Texie, iss«, mahnte Gwinnie.
»Möchtest du nicht auch?«, fragte er.
»Nein«, sagte sie, »das bekommt mir nicht – hélas! Gib mir lieber noch ein Stückchen Eis.«
Tex gehorchte, schob ihr das Eis in den Mund.
»Gwendolin«, sagte er, »gewöhn dir wenigstens dies scheußliche ›hélas‹ ab.«
»So«, echote sie, »scheußlich findest du das? Du kannst mir glauben, Tex, dass es sehr vornehm ist und sehr klassisch. Alle Heldendamen sagen es in allen klassischen Stücken der französischen Literatur. Außerdem steht es mir gut – schau nur!«
Sie schloss die Augenlider, öffnete sie langsam, stieß dazu einen herzinnigen Seufzer aus. Spitzte die Lippen, zog sie wieder zurück, holte tief Atem, hauchte ihr schmachtendes: »hélas«.
»Nun, Texie?« fragte sie.
Es stand ihr gut – das musste selbst Tex Durham zugeben.
Schweigend aß er, überlegte dabei. Ja, es war schon das Beste, gleich mit ihr zu sprechen – frei, offen, frisch von der Leber weg.
Es fiel ihm auf, wie still sie war. Er blickte sie an, sah, dass sie ein kleines gerahmtes Foto in der Hand hielt und anstarrte. »Wer ist denn das?«, fragte er.
Sie schrak auf, hielt ihm das Bild hin. »Kennst du sie?«
»Ach, eine Frau«, sagte er völlig beruhigt. »Ich fürchtete schon, es könnte Ralph Webster sein oder einer von den anderen Dummköpfen, die immer um dich scharwenzeln. Eine Freundin nur – na, da magst du meinetwegen Dutzende 'rumstehen haben.«
»Kennst du sie?«, wiederholte Gwinnie.
Jetzt erst sah er das Bild näher an. »Die da?«, überlegte er. »Ich denke, ich sah sie einmal mit dir in Carnegie Hall bei einem von diesen albernen Konzerten. Und – bist du nicht mal ausgeritten mit ihr, im Central Park? – Übrigens eine hübsche Frau«, schloss er sachverständig, »eine ganz nette Frau.«
»So? Meinst du?«, sagte Gwinnie. Dann sehr verträumt: »Sehr schön ist sie, sehr schön. Andrea heißt sie.«
Ihr Blick küsste zärtlich das Bildchen, das die schmale Hand vorsichtig und liebevoll hielt, wie einen edlen Schmuck. ›Ihr Haar ist braun‹, überlegte sie, ›aber es leuchtet, hat roten Schimmer, wenn das Licht darauf fällt. Sehr lang ist dies Haar – welche Frau wagt noch, langes Haar zu tragen in New York oder sonst wo in dieser Welt? Sie aber tut's. Andrea Woyland tut's. Hochgesteckt in Flechten – wenn sie die löst, kann sie sich hinein hüllen wie in einen Mantel.‹ – Oh, Gwinnie zitterte, als sie daran dachte – ›Und ihre Augen sind grau, groß und grau und glänzend. So tief sind diese Augen, man schaut und schaut und blickt doch nie auf den Grund. Sehr ebenmäßig das Gesicht – stark geschwungen die Lippen‹. Gwinnie schloss die Augen, jetzt sah sie klarer noch. Alle Einzelheiten, Wangen und Ohren, Brauen und Wimpern. Die Stirn und das Kinn – wohlgeformt alles. ›So schön‹, dachte sie. ›Der war ein großer Künstler, der das schuf. Und das Ganze dann: ein stolzes Gleichmaß, in dem kein Missklang war. Schlank der Hals – wie edel der Ansatz zum Nacken! Welche Schultern, welche Arme – ach, und die Brust –‹.
Endlich war der Junge satt; viel war nicht übrig geblieben. Er gab sich einen Ruck, sagte rasch: »Ich habe heute mit deinem Vater gesprochen. Sehr ernstlich, über dich und mich – über uns beide.««
Sie antwortete nicht.
»Hörst du nicht, Gwendolin?«, rief er. »Leg doch endlich das dumme Bild weg.«
›Welch ein Gang‹, dachte Gwinnie. ›Und die Figur –‹.
»Sie ist so groß wie du, Tex«, flüsterte sie.
»Meinetwegen mag sie noch zwei Köpfe größer sein!«, rief er. »Hast du nicht ge…«
Sie blickte auf. »Doch – ich hab's gehört«, seufzte sie. »Du hast mit Vater gesprochen. Über dich und mich. Sehr ernsthaft.«
»Ja«, nickte er, »ganz offen, Auge in Auge – wie ein Mann zum anderen.«
»So«, dehnte sie, »wie ein Mann zum anderen? Das muss sehr langweilig gewesen sein. – Gib mal den kleinen Spiegel, Texie.«
»Gwendolin«, versuchte er, »ich möchte dich bitten, doch –«
Aber sie schnitt ihm das Wort ab. »Gib den Spiegel, Tex, hörst du nicht?«
Er reichte ihr den Handspiegel; sie malte wieder an ihren Wangen.
»Sag mal, Tex – ganz aufrichtig – findest du mich sehr hübsch? Nichts auszusetzen?«
Er rückte herum auf dem Bett, schnalzte ungeduldig mit der Zunge. »Tja – gewiss bist du sehr hübsch.«
»Auszusetzen?«, bestand sie. »Ich will wissen, was du auszusetzen hast. Nichts?«
»Doch«, rief er tapfer, »natürlich hab' ich allerhand auszusetzen. Du bist viel zu dünn, Gwendolin. Am Hals kommen die Knochen raus. Deine Arme – Ärmchen! Du musst eben mehr essen – von dem Eis kann kein Mensch fett werden und vom Daumen lutschen erst recht nicht. Und dann dein Busen und – da hinten rum –«
»Was du nicht sagst«, lachte sie. »Also darauf hast du auch schon geachtet?«
»Natürlich«, betonte er. »Beim Schwimmen. Du könntest wirklich etwas zunehmen, Gwendolin.«
»Vielleicht hast du recht«, gab sie zu, »Wie viel meinst du, dass ich zusetzen sollte?«
Er besann sich, zögerte. »In Pfund kann ich dir's nicht genau sagen. Aber die Brüste – weißt du, eine gute Hand voll dürfte es schon sein. Nicht deine – meine Hand – vielleicht auch ein bisschen mehr. Und hinten – ach, etwa so…« Er fuhr mit beiden Armen in der Luft herum, beschrieb einen Bogen.
Sie scherzten gar nicht, durchaus sachlich besprachen sie das. »Mag sein, dass du recht hast«, schloss sie. »Ich will mir's überlegen. Andrea ist sicher viel voller.« Sie legte den Spiegel fort, nahm wieder das kleine Bild.
»Da siehst du es«, sagte er triumphierend, »nimm dir ein Beispiel an ihr.« Dann fuhr er fort: »Also Auge in Auge sprach ich mit deinem Vater – er ist völlig einverstanden. Ihm ist's recht: je eher, je besser.«
Sie wandte keinen Blick von dem Bildchen.
»Was ist ihm recht?« fragte sie achtlos.
»Die Heirat!«, rief er. »Wir haben uns geeinigt, dir die Entscheidung zu überlassen. Entscheide dich bitte – am liebsten gleich, Gwendolin. Mir liegt sehr daran – und deinem Vater noch mehr; du würdest ihm eine riesige Freude damit machen, das hat er wörtlich so gesagt. Tu ihm doch den Gefallen – er hat's wirklich verdient. Und schließlich – deine Mutter ist tot, und er ist der einzige Vater, den du hast!«
»Ach«, seufzte sie, »daran habe ich noch gar nicht gedacht. Ich habe stets geglaubt, dass ich ein Dutzend hätte.«
Tex runzelte die Stirn. »Immer machst du dich lustig über mich«, rief er unwillig. »Du weißt ganz gut, wie ich's gemeint hab. Bitte, sag: Ja!«
Sie dehnte die Worte: »Denkst du nicht, dass ich erst etwas dicker werden sollte?«
»Nein, entschied er, »das ist gar nicht notwendig. Ich werd' dich schon aufnudeln.«
»Ja«, sagte sie, »und dann wirst du mich anfassen wollen. Du weißt, Tex, dass ich das nicht vertragen kann!«
»Herrgott Jesus«, rief er, »das wird vorübergehen, dies Kitzligsein! Lass mich dich erst nur ganz leise ein wenig streicheln – du sollst mal sehen, wie schnell du dich dran gewöhnst!«
»Meinst du, Texie?«, antwortete sie. »Aber dann willst du auch nicht, dass ich Eis esse und ›hélas‹ dazu sage.«
Ganz verzweifelt schrie er: »Meinetwegen kannst du Tag und Nacht nichts anderes tun, als ›hélas‹ seufzen, Eisstückchen suckeln und am Daumen lutschen!« Dann nahm er sich zusammen; sanft und zärtlich wurde seine Stimme: »Sag ›Ja‹, Gwendolin! Du hast mir doch selbst gesagt, dass ich dir der Liebste sei von allen Jungen, die du kennst.«
Sie nickte. »Das bist du, Texie, wirklich, das bist du. – Grade weil du so dumm bist, mag ich dich, und du weißt gar nicht, wie ungeheuerlich blöd du sein kannst. Und darum will ich dir versprechen: Wenn ich je einen Mann heirate, soll er Tex Durham heißen.«
»Gut!«, rief er. »Gut! Nun sag mir nur, wann etwa…«
Heftig unterbrach sie ihn: »Gar nichts: Wann, Tex! – Ich hab jetzt genug von all dem dummen Zeug! Du wirst mir nie wieder davon sprechen, bevor ich es dir erlaube. Hörst du: nie wieder und nicht ein Wort! Ich hoffe, dass wir da klar sind, und dass du mich ganz richtig verstanden hast?«
Nichts hatte er verstanden. Eingeschüchtert senkte er den Kopf, flüsterte: »Ja! Wie du willst, Gwendolin.«
Sie schlug ihn leicht auf die Hände, zärtlich fast. »So ist's recht, mein Junge. – Und jetzt kannst du gehen.«
Er gehorchte sofort, stand auf.
»Warte noch, Tex«, zögerte sie, »du könntest mal telefonieren für mich. Ruf…« Sie überlegte, fuhr dann fort: »Ruf an: Spring 6688. Frag nach Miss Woyland. Sag ihr – sag ihr, du habest ihr Bild gesehen – und du fändest sie sehr schön.«
»Aber ich bin ihr gar nicht vorgestellt…«, wandte er ein.
»Tu, was ich sage!«, rief sie. Er gehorchte, nahm den Hörer vom Telefon, das auf dem Nachttisch stand, rief die Nummer an. Eine Männerstimme antwortete ihm; er fragte nach Miss Woyland.
»Was?«, rief er. »Ist nicht da, sagen Sie? Ist ausgezogen?«
Gwinnie flog hoch, riss ihm das Telefon aus der Hand, »Hier ist Gwinnie Briscoe«, rief sie erregt hinein, »Andrea – Miss Woyland ist ausgezogen? Wann denn? Wo ist sie hin?«
»Oh, danke sehr«, flüsterte sie dann. »Im ›Plaza‹? Danke sehr – danke sehr!«
Sie ließ den Hörer fallen, sank zurück in die Kissen. Wieder packte sie der brennende Schmerz; sie bog sich zurück, krümmte sich.
Durham fischte in der Schüssel, fand ein letztes Eisstückchen, schob es ihr in den Mund. Langsam beruhigte sie sich,
»Ist dir besser?«, fragte er.
Sie nickte, suchte herum mit den Blicken. »Wo sind deine Blumen?«, verlangte sie. »Bring sie her.«
Er tat es, hielt sie ihr hin.
Sie nahm sie nicht. »Orchideen«, hauchte sie. »Ich mag sie nicht – ob Andrea sie mag?« Sie hob die Stimme, fuhr fort: »Du musst gleich zum ›Plaza‹ fahren. Gib die Blumen ab – für Miss Woyland.«
»Aber, Gwendolin«, versuchte er, »ich habe sie doch für dich…«
Sie schüttelte den Kopf. »Oh, Tex! Tex!«, rief sie entrüstet. »Musst du denn immer widersprechen? Kannst du nie gleich tun, was man dir sagt?«
Er nickte, wandte sich zum Gehen. Als er in der Tür war, rief sie ihm nach: »Bestell der Schwester, es sei kein Eis mehr da – hélas!«
Still lag sie, wie eine süße Docke aus bemaltem Elfenbein. Langsam kroch die linke Hand aus den Spitzenkissen, leise stahl sich der Daumen in die roten Lippen.
Diese Blumen fand Andrea Woyland in ihrem Zimmer, als sie spät abends zum Hotel kam. Sie war nach ihrem Besuch in der ›Central Trust‹ zum Columbus Circle gefahren, wollte am Park vorbei zum ›Plaza‹ gehen, durch die 59th Street.
Doch fühlte sie sich unruhig und nervös; nahm ein Taxi, fuhr den Riverside Drive hinauf und weiter den Hudson entlang über Fordham und Spuyten Duivel zur Abbey Inn. Dort entließ sie das Auto, ging in die Wirtschaft, trank Tee. Sie wollte nachdenken, überlegen – aber ihre Gedanken verwirrten sich, schweiften ab, liefen in die Irre. Sie zahlte und ging die Landstraße zurück nach New York, hoffte, ein Taxi unterwegs zu finden. Aber sie fand keins.
So lief sie zu Fuß. Müde war sie; die ungewohnte Frische der Oktoberluft griff sie an, machte das Hirn schmerzen. Jedes Auto, das zur Stadt fuhr, rief sie an; aber die meisten waren voll besetzt, keines hielt.
Bitter stieß ihr auf: Über fünf Jahre war sie nun in diesem Land – nicht einmal ein eignes Auto hatte sie!
Endlich hielt doch ein Wagen – lärmend und johlend kam er heran. »Nehmt mich mit«, rief sie.
»Wohin?«, fragte der Mann am Steuer.
»›Plaza‹!« antwortete sie.
»Gut! ›Plaza‹!« lachte er gutmütig. »Immer rein, dass der Karren voll wird!«
Es war augenscheinlich eine Booze-Party – eine lustige Gesellschaft, die irgendwohin hinausgefahren war, wo's was zu trinken gab. Drei Burschen und vier Mädel – alle betrunken. Sie quetschte sich dazwischen – einer nahm sie lachend auf die Knie, fasste sie gleich um den Leib. Alle sangen und brüllten, zwei Weiber beschimpften einander, zankten und keiften. Und der Kerl am Steuer fuhr los wie ein Wahnsinniger.
Tritte, unabsichtlich, denen sie nicht ausweichen konnte, Griffe dazu, sehr absichtlich, die sie nicht abwehren konnte. Das Mädel neben ihr schlang den Arm ihr um den Hals, lallte: »Küss mich, Sissie!«
Und ein Bursch vorne neben dem Lenker begann loszuheulen, verlangte auszusteigen, übergab sich dann…
Ah – widerlich war es.
Irgendwo hielten sie – in Washington Heights.
Sie stieg aus, fand endlich ein Taxi, fuhr zum Hotel.
Sie ließ sich ihr Zimmer zeigen, bestellte Abendessen, badete, zog einen Kimono an, packte ihre Sachen aus. Aß sehr wenig, schickte das Essen fort.
Öffnete das Fenster, blickte hinaus in die klare Oktobernacht über den sterbenden Park. Fröstelte, schloss das Fenster, ließ sich auf den Sessel fallen.
Stand wieder auf, suchte nach Zigaretten, zündete eine an. Aber es schmeckte ihr nicht, und sie warf sie weg.
Nein, es würde ihr nimmer gelingen heute – keinen klaren Gedanken konnte sie fassen. Wenn sie nur jemanden da hätte, mit dem sie hätte sprechen können über all das! Einer – der sie gut kannte, einer, der ihr Stichworte bringen konnte.
Aber wer mochte das sein? Sie dachte an alle Menschen, die sie kannte in dieser Stadt. Wen sollte sie anrufen?
Keiner war da, keiner!
Ihr Vetter natürlich, Jan Olieslagers, mit dem hätte sie sprechen können. Wo war der in der Welt?
Sie nahm seine Briefe, die sie in ihre Tasche getan hatte; las sie beide durch, zerriss sie dann mit heftiger Bewegung. Sprang auf, schritt erregt auf und ab im Zimmer.
Was denn nur? Sie wusste doch seit einem Jahr, was in dem letzten Brief stand. Dass er Nachricht hatte aus Deutschland, von der Großmutter – seiner und ihrer.
Die Nachricht, dass ihre – ihre, Andrea Woylands – Tochter sich verlobt habe und verheiratet. Mit einem frühern Seeoffizier, Korvettenkapitän, einem tüchtigen und vermögenden Landwirt aus dem Allgäu; der würde nun Schloss und Land Woyland übernehmen und ihm neuen Glanz bringen.
Drei Zeilen schrieb der Vetter davon – ganze drei Zeilen!
Das war ein Jahr her – über ein Jahr. Und also würde das Mädchen, würde ihre Tochter – wie hieß sie doch noch, wie hieß sie doch noch? War es nicht Gabriele? Nein, so nicht…
Nicht einmal den Namen ihres Kindes wusste sie.
Seit einem Jahr war dieses Kind verheiratet. Ah, und würde vermutlich – sicher, ganz sicher! – heute selbst ein Kind haben.
Und dann war sie, war Andrea Woyland – Großmutter!
Sie rechnete. Sechzehn Jahre war sie alt, als sie dem Mädchen – dieser jungen Frau nun und Mutter – das Leben gab. Das war fast zwanzig Jahre her – zwanzig lange Jahre – so würde sie selbst, in wenigen Wochen, sechsunddreißig sein!
Die Schläfen schmerzten sie; sie suchte herum, fand schließlich Veronaltabletten. Schluckte eine hinunter – spülte Wasser nach.
Trat vor den Spiegel – lachte auf.
Was hatte Parker Briscoe gesagt? Eine schöne Frau sei sie, klug vielleicht und ganz sicher wertvoll.
Wertvoll, wertvoll – wo steckte denn ihr Wert?
Wie denn hatte sie ihr Leben gesteuert? Schiffbrüche und immer wieder Schiffbrüche! Klug?
Würde sie immer gescheitert sein, wenn sie wirklich klug wäre?
Und schön erst! Das, was da vor ihr stand, was sie angrinste aus dem Spiegel, das war in Wahrheit Andrea Woyland! Das allein – und nicht das, was Briscoe sah und die kleine Gwinnie!
Nirgends eine Farbe; bleich war ihr Gesicht. Nicht mehr so glatt und gespannt die Haut. Ein paar Krähenfüße schon um die Augen, leichte Falten von den Ohren herab und andere an den Mundwinkeln.
Kein graues Haar – hatte sie die nicht sorgsam ausgezupft, heute erst, ehe Briscoe kam? Aber mehr würden kommen und mehr, jeden Tag mehr. Und die Brust würde schlaff werden und der Hals… Sie trat weg vom Spiegel. Setzte sich aufs Bett. Schlug beide Hände vors Gesicht.
Dann holte sie tief Atem. Und sie empfand deutlich: Sie hatte recht getan, als sie Briscoe ihr ›Ja‹ sagte und ihm die Hand darauf gab. Als sie ihm erklärte, dass sie bereit sei, das zu tun, was er verlange.
Andrea Woyland war fertig, ganz und gar fertig. Andrea Woyland hatte ausgelebt.
Mochte abtreten von dieser Affenbühne.
Wie es auch kommen würde: Andrea Woyland würde verschwinden, würde nicht mehr sein.
Und das war gut so, sehr gut!
Sie stand wieder auf. Nahm eine Schere, schnitt, dicht am Kopf, die langen Flechten ab.
›Irgendwo muss man anfangen‹, dachte sie.
Ging zum Schreibtisch. Nahm ihre Füllfeder, schrieb mit kleinen, scheuen Lettern oben auf einen Bogen:
ANDREA WOYLAND.
Besann sich dann. Dachte: ›Hier will ich hinschreiben, alles, was ich von ihr weiß!‹
Aber sie ließ die Feder fallen; sehr müde fühlte sie sich plötzlich, völlig schlaftrunken. Das Veronal wirkte.
Sie erhob sich, taumelte zum Bett. Fiel hinein, zog die Decke hoch.
Sehr fest schlief sie.
… – das sind die bunten Narren,
die gern in Märchen wildern
und wilde Märchen schildern,
die Büchsen schwingen und rütteln,
glitzernden Staub draus schütteln
und den Kindern aus leichten Sachen
können leuchtendes Gold wohl machen.
Gottfried von Straßburg
Sehr allein lebte Andrea Woyland in dieser Zeit. Wenn es dämmerte, lief sie wohl durch den Park, besuchte auch die Konzerte in der nahen Carnegie Hall. Später, als es kälter wurde, kaufte sie Schlittschuhe, ging zur Eisbahn, wie vor zwanzig Jahren.
Sie meinte, sie müsse alles verlernt haben; zögernd, ängstlich fast machte sie die ersten Schritte. Aber es ging nach wenigen Minuten, die Beine übersprangen die Zeit, taten ihren Dienst, wie sie einst getan. Eins nach dem anderen fand sie ihre kleinen Kunststücke: Bogenlaufen und Holländern, Achter, Dreier und Reben – ganz von selbst kam alles.
Jeden Tag lief sie ein paar Stunden – es war, als ob ein neues Leben sie erfüllte: ihr Leben und doch ein anderes.
Auch das war Erinnerung – wie die Beine längst verlorene Bewegung, so fand das Hirn längst vergessene Empfindung wieder.
Und dies Empfinden war wie das Ahnen einer Zukunft: bald musste ein früher Märzwind wehen, mussten Aprilschauer lärmen, musste die süße Maisonne junggrüne Wiesen küssen.
So war es damals, als sie am Niederrhein bei Schloss, Woyland eislief – alte Rheinarme, die alles Land überschwemmten. Eis, glattes Eis unendlicher Flächen, selten nur ein Mensch. So war es jetzt ob auch ringsherum sich die Menschen drängten, ob auch dieser Tümpel im Central Park jämmerlichster Notbehelf war. Sie sah die Menschen nicht. War allein für sich, warm erfüllt von diesem Ahnen neuen Frühlings.
Selten traf sie Bekannte. Dann grüßte sie wohl, wenn's nicht anders ging, sprach ein paar gleichgültige Worte, brach rasch ab, ging davon. Einige Male rief Briscoe an, öfter schrieb ihr Gwinnie – sie antwortete ihr, sprach auch mit ihrem Vater, aber schnell das alles, für Minuten nur. Und wischte es, gleich darauf, weg aus ihrem Gedächtnis.
Allein war sie. Viele Stunden lang saß sie in ihrem Zimmer. Sie kam nach Hause von der Eisbahn, Nerven, Muskeln, Adern heiß erfüllt mit dieser schwellenden Sehnsucht. Diesem halb bewussten Wünschen einer Larve, die fühlt, dass sie sich bald verpuppen wird. Dann, wenn sie ruhig daliegt und dahindämmert, dann werden ihr Flügel wachsen, und die enge Hülle wird fallen, und sie wird flattern und fliegen in alle Sonnen zum Äther hinauf.
Sie machte sich nicht mehr schön; unberührt blieben Lippenstift und Puderquaste. Dennoch tat es ihr leid um die verschnittenen Haare, selbst Zuhause trug sie ein Seidentuch um den Kopf, wand es wie einen Turban.
Sie lag auf dem Diwan, saß auf dem Sessel – vor ihr lag das weiße Blatt mit den Worten: ›Andrea Woyland‹. Alles, was sie von der wusste, wollte sie aufschreiben, Dutzende von Seiten, Hunderte.
Noch einmal durchlesen, dann – ja wem sollte sie das geben? Wer würde es verstehen – so wie sie es verstand? Und sie fand wieder keinen Namen als den ihres Vetters, Jan Olieslagers.
Der, immer der! Der sich kaum um sie kümmerte, der ihr sehr selten schrieb, den sie seit manchen Jahren nicht mehr sah. Nein, auch ihn wollte sie vergessen.
Niemandem wollte sie diese Seiten geben, ins Feuer sollten sie wandern, in Flammen versinken, so, wie sie selbst bald versinken würde. Aber sie schrieb keine Zeile, nicht ein Wort schrieb sie.
Lag auf dem Diwan, dachte nur.
Schloss Woyland – ja! Einmal war's eine finstere Wasserburg. Gräben herum und dunkler, wilder Forst. Zugbrücke zu mächtigem Tor, viele Wappen darüber. Hier hausten alte Geschlechter; wenn das eine ausstarb, saß ein anderes da: verwandte Sippen, verlorne Blutstropfen. Die Schonenveldt und Eulenburg, die Zülnhart und Wickede, die Bronkhardt, auch die Croy und Spaen.
Dann, im siebzehnten Jahrhundert, flatterte über den Türmen der rote Adler von Brandenburg: der Große Kurfürst erwarb die Burg, als er endlich Kleve gewann, Mark und Ravensberg und die spanischen Truppen aus dem Lande wies, das schon sein Großvater erbte. Als er seine oranische Prinzessin heimführte und Louise Henriette mit ihren Falken nach Brandenburg brachte. Doch erst sein Urenkel hauste hier – als er noch kein alter Fritz war und noch kein großer König. Der junge Friedrich II., eben König geworden, hatte hierhin zum ersten Male Voltaire geladen, ihm zu Ehren wehte der schwarze, der preußische Adler.
Wohl fühlten sich die beiden gewiss nicht in dem düstern Kastell vergangener Tage – leichtes Spiel flimmernder Sonnenstrahlen brauchten sie, wenn sie des Tages Arbeit vergessen wollten: Sanssouci.
So verkaufte der preußische König die alte Wasserfeste.
Nun saßen die Woylands da – die bauten um. Schufen, in missverstandener Gotik, einen englischen Landsitz, ein weites Schloss, wie es Windsor ist. Schufen einen großen englischen Park, sorgsam gepflegt. Aber der Graben blieb; über die Brücke fuhr man zum efeuumrankten Schloss. Große bronzene Hirsche lagen zu beiden Seiten.