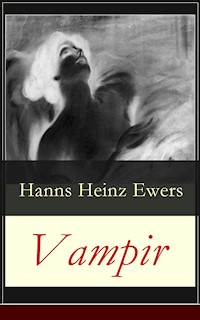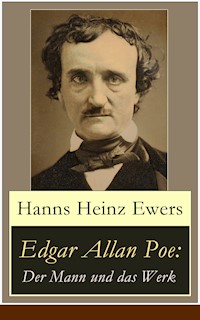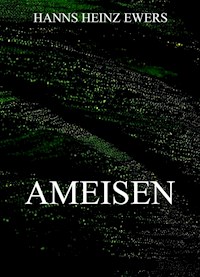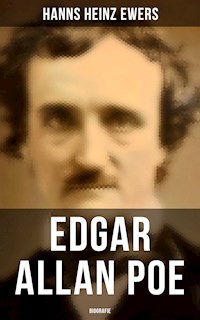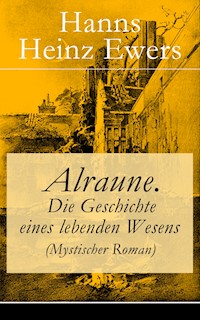Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
In Hanns Heinz Ewers' Werk 'Die Teufelsjäger' taucht der Leser ein in eine düstere Welt des Okkulten und der dämonischen Kräfte. Das Buch erzählt die Geschichte einer Gruppe von eigenartigen Charakteren, die sich der Jagd auf Teufel und Dämonen verschrieben haben. Ewers' literarischer Stil zeichnet sich durch eine mitreißende Erzählung und eine detaillierte Beschreibung der grotesken Szenarien aus. 'Die Teufelsjäger' ist ein Meisterwerk der phantastischen Literatur, das Einflüsse aus dem deutschen Expressionismus und der Romantik vereint. Ewers schafft eine einzigartige Atmosphäre, die den Leser fesselt und in ihren Bann zieht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 524
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Teufelsjäger
Books
Inhaltsverzeichnis
I.
Inhaltsverzeichnis
Wer Schönes hier und Zartes sucht, der sei gewarnt! In diesen Blättern schläft manches Grau'n, und aus den Lettern grinst oft, was scheusslich und verrucht.
Osc. Panizza, Heilige Antonius.
»So kommen Sie doch mit!« sagte Frank Braun.
Der alte Pfarrer schüttelte den Kopf. »Unmöglich,« antwortete er, »es ist ganz unmöglich.«
– – Der kleine Gardadampfer hielt; die beiden stiegen mit der Menge an Land. Frank Braun suchte herum, fand endlich den Portier seines Hotels, winkte ihn heran und übergab ihm den Gepäckschein und die Handtaschen. Dann wandte er sich wieder dem Pfarrer zu.
»Darf ich Sie begleiten, Hochwürden?«
»Verzeihen Sie – nein.« sagte der Alte. »Ich muss ins Pfarrhaus, habe dort einiges zu erledigen. Aber wenn Sie gestatten, werde ich Sie heute abend im Hotel aufsuchen.«
»Es wird mir eine grosse Freude sein. – Also zum Abendessen, Don Vincenzo!«
Der Pfarrer gab ihm die Hand. »Auf Wiedersehn.«
Frank Braun ging langsam dem Hotel zu, das dicht am See lag. Er liess sich ein Zimmer geben, wusch sich, schrieb ein paar Briefe. Er machte einen Spaziergang; kam eben zurück, als das Gong schlug. Aber er ging nicht gleich in den Speisesaal, erst hinauf in sein Zimmer. Er rasierte sich sorgfältig, langsam genug; dann legte er den Abendanzug an. Man trug schon den dritten Gang auf, als er unten eintrat. Er fand den Pfarrer an einem kleinen Tische am Fenster sitzen.
»Ich habe Sie warten lassen,« entschuldigte er sich. »Es ist das eine schlechte Gewohnheit von mir – –« Er nahm die Weinkarte und liess sich von seinem Gaste Rat geben. Bald fand er die Marke, die jener liebte.
»Das ist merkwürdig.« lachte er. »Gerade das, was ich selber bevorzuge!«
Aber er trank kaum ein halbes Glas und ass ebensowenig. Er liess sich nicht nachservieren und sorgte nur, dass des Pfarrers Teller nimmer leer wurde. Beim Dessert schälte er ihm ein paar grosse Calvilleäpfel; der Alte ass sie zum Käse.
»Aepfel essen Sie auch nicht?« fragte er.
»Doch.« antwortete Frank Braun. Er nahm eine Scheibe und streute ein wenig Salz darauf.
Der Pfarrer schüttelte den Kopf. »Mit Salz? Aepfel mit Salz?«
»Gewiss, Hochwürden. So kann man erst den Geschmack des Apfels herausfinden.«
Der Pfarrer stippte sogleich seine Apfelscheibe in das Salzfass. »Zu viel, Don Vincenzo, zu viel!« lachte der Deutsche. Jener kratzte das Salz wieder ab.
»Ist es so gut?«
»Ja, so ists gut.«
Der Alte kostete. »Ja – ja – Sie haben recht. Der reine Geschmack kommt wohl bestimmter heraus. Ich werde mir das merken, Doktor; ich werde es nächstens unsern Bischof lehren. Der schätzt solche kleine Feinheiten. – Man muss eben den Dingen auf den Kern kommen!«
»Freilich, Don Vincenzo. – Das ist das Erste.«
»Erlauben Sie – – wieso das Erste?«
Frank Braun füllte das Glas seines Gastes. »Nun, ich meine – die Diagnose ist überall und immer das Erste. Wenn wir zum Beispiel einen Apfel machen wollen, so müssen wir doch erst genau wissen – –«
»Einen Apfel – machen?« unterbrach ihn der Priester. »Aber wir wollen doch keinen Apfel machen!«
Frank Braun sagte: »Warum wollen wir nicht? Wir wollen alles machen. Aber nehmen wir etwas anderes, wenn Ihnen die Zukunftkunst, einen Apfel zu machen, zu ferne liegt. Da ist eine Krankheit – sagen wir die Cholera. Erst in dem Augenblicke können wir daran gehen, sie wirksam zu bekämpfen, wenn wir die Bazillen, die die Krankheit erregen, und deren Lebensart genau kennen. Die genaue Erkenntnis ist immer das Erste – in allen Dingen. Nicht wahr, Hochwürden?«
»O ja – gewiss!« Der Pfarrer leerte sein Glas. »Jetzt verstehe ich, was Sie meinen, Doktor. Aber verzeihen Sie, so ganz bin ich doch nicht einverstanden, wenn Sie mir den Apfel plötzlich wegnehmen und dafür die Cholera hinsetzen. – Den Apfel wollten Sie – machen – – nicht wahr, Doktor? So wie er da Hegt, so wie er auf den Bäumen wächst. Von der Cholera aber wollen Sie gerade das Gegenteil: sie zunichte machen! Man soll sie bekämpfen – – aber doch nicht machen!«
Der andere lächelte. »Nein? – Und warum denn nicht? Sie freilich, Hochwürden, möchten sich allerdings nicht damit abgeben. Und ich – nun ich werde wohl auch kaum jemals eine Gelegenheit dazu haben. Aber andere Leute? Erfinden wir denn nicht in jedem guten Jahr irgendeine neue schöne Sache, um möglichst viele Menschen möglichst rasch und sicher vom Leben zum Tode zu bringen? Torpedos und Revolverkanonen? Unterseeboote und Kriegsflieger? Lyddit, Melinit, Nitroglycerin und all diese hübschen Dinge? Warum sollte man nicht irgendeine furchtbare Pest in Feindesland werfen, so eine schwarze oder gelbe Seuche, die besser arbeitet als alle Mordgewehre der Welt?«
Der Pfarrer bekreuzigte sich: »Heilige Mutter Gottes!« rief er. »Das mögen alle guten Heiligen verhüten!«
Der Deutsche nickte. »Ja, das hoffe ich auch. Ein Krieg ist immer dumm und man kann ihm nur sehr wenige Seiten abgewinnen, für die sich ein kleines Interesse lohnen möchte. Aber die Möglichkeit ist da, Seuchen zu machen, das geben Sie doch zu, Don Vincenzo? Jeder Pfuscher kann es – – heute schon. Aepfel machen freilich, das ist schwerer: aber wir werden auch das lernen – später einmal. Wir sind ja noch so jung.«
»Jung?«
»Nun ja, Hochwürden! Der älteste Mensch, dessen Knochen wir fanden, starb vor kaum dreieinhalb Millionen Jahren.«
»Und das nennen Sie jung?« Der Pfarrer sah ihn scharf an, gerade in die Augen. Hatte er nicht schon einmal – –? Aber er irrte sich gewiss. Nein, er hatte dieses Gesicht noch nie gesehen. Nur der Ausdruck erinnerte ihn – – ja, den kannte er doch! Lächelnd, überlegen, gefangennehmend – gegen allen Willen. Schon einmal hatten ihn diese Züge erschreckt – – irgendwo auf einem Bilde? Oder auf einer Zeichnung in einem alten Buche? Er besann sich, starrte sein Gegenüber an.
Glatt rasiert war dieses Gesicht, schmal und gebräunt. Die Augen hatten keine bestimmte Farbe, mochten blau sein oder auch grün oder grau. Ueber die hohe Stirne – leicht gewölbt über den schwachen Brauen – fiel eine wirre Strähne aschblonden Haares; die Lippen zogen sich ein wenig nach unten um den halboffnen Mund. Der Alte sah das gute, weisse Gebiss, hie und da blitzte das Gold dazwischen. Dieses Gesicht schien jung, sehr jung zu sein – und doch mochte es wieder alt sein – – wie alt nur? Die matten Opalaugen lachten nun, harmlos, fast gutmütig. »Wie ein guter Junge.« dachte der Pfarrer. – »Ein Kind, er ist ein rechtes Kind.«
Der Fremde erwiderte lächelnd diesen langen Blick. Nun aber kehrten sich seine Augen ab, irrten umher, blickten durch das offene Fenster zum See hinaus. Und der Pfarrer begriff sie schnell: verträumt, phantastisch, verirrte Späher aus Seelenland, wo alle Sehnsüchte wohnten. Dann wieder wandte jener den Kopf, blickte ihn voll an, ernst, fast drohend. Jetzt sah der Alte kaum des anderen Augen – aber er fühlte, fühlte diesen Blick. Und doch war ihm, als ob diese seltsame, beschwörende Kraft nicht daher komme. Oder – doch nicht allein daher – –
»Nein, nein, Hochwürden! Sie kennen mich nicht. Heute morgen, als Sie in Sirmione an Bord kamen, sahen Sie mich zum erstenmal.«
Der Deutsche lachte, und es war ein frisches, gesundes Kinderlachen.
»Was heisst das?« fragte der Pfarrer ein wenig verwirrt und doch gleich beruhigt durch das gutmütige Gelächter. »Sie können Gedanken lesen?«
»Ist das so schwer? Sie haben ein tell-tale-face – – so trinken Sie doch, Don Vincenzo!« Er füllte von neuem das Glas. »Rauchen Sie?« Er reichte ihm sein Etui. »Fast alle Menschen haben solche Gesichter und ganz besonders die Geistlichen. – Man hat Mühe, sich das abzugewöhnen. Es ist nicht gut, so als aufgeschlagenes Buch durch die Welt zu laufen.«
»Gott sei Dank können nicht alle Menschen lesen.«
»Richtig, Don Vincenzo, es gibt grässlich viel Analphabeten. – Aber da sind wir wieder: das Lesen ist das Erste. Das ist das Sehen, das Erkennen. Und dann erst kommt das andere – das Schreiben: das ist das Schaffen.«
»Das ist nicht für uns, lieber Doktor, nicht für die Priester.«
»Und doch weiss ich einen, der es wohl konnte.«
»Einen Priester?«
»Ja, er ist Priester wie Sie. Noch mehr: er ist Ihr Namensvetter, und ich denke, Sie sollten ihn kennen.«
»Vincenzo –? – Vincenzo Alfieri – Sie meinen doch nicht Pater Vincenzo Alfieri von Padua?«
»Gerade den meine ich.«
»Und Sie kennen ihn?«
»Ja, ich glaube, dass ich ihn gut kenne.«
»O, er ist ein begabter Mensch! Er war der beste Prediger Italiens.«
»Er kann lesen und schreiben. Er ist ein Schaffender.«
»Erzählen Sie mir von ihm. Ich hörte ihn einmal in Padua sprechen – das war vor acht – nein vor neun Jahren. Ich weiss nicht mehr, was er sagte, aber ich werde nie in meinem Leben vergessen, wie er sprach. Es war, als trüge er meine Seele in weite Höhen. Wo ist er jetzt? Man sagt, der Papst habe – –«
Frank Braun unterbrach ihn: »Ja, ja – man sagt! Man sagt! – Uebrigens kann ich Sie versichern, Don Vincenzo, dass Seine Heiligkeit wirklich keinen Grund hatten, die Tätigkeit Alfieris abzubrechen. Es war eine läppische Intrigue der römischen Jesuiten und schliesslich eine reine Machtfrage gegen Kardinal Méry del Val, dessen Schützling er war. Ich bin überzeugt, dass der Papst das plumpe Spiel wohl durchschaute; aber er wollte eben dem Streit ein Ende machen. So schloss er das Kompromiss und sandte den Paduaner nach Spanien.«
»Er predigt nun in Spanien?«
»Ja, in Madrid. Und mit demselben gewaltigen Erfolg. – Aber ich sage Ihnen, die Bewegung, die er macht, ist ganz, ganz ungefährlich. Er ist ein Helfer der Kirche. – Sperrt ihn sechs Jahre lang in ein Kloster ein – und es mag ein Mahomet aus ihm erstehen oder ein Luther. Er liest, aber er erkennt nur wenig das, was er liest. Und so schreibt er – – verstaubte, abgegriffene Bücher.«
Der Pfarrer sah ihn verständnislos an: »Alfieri schreibt – –? Was schreibt er denn?«
Wieder lachte der Deutsche: »Gar nichts schreibt er natürlich! Aber er schafft – und was er schafft ist verstaubt und abgegriffen. Schlecht. Ungefährlich. – Aber immerhin: es schafft, schafft – – und darum liebe ich ihn.«
»Nun gut, Doktor – aber was in aller Welt schafft er denn?«
Frank Braun beugte sich weit über den Tisch. Er stützte die Ellenbogen auf die Platte und legte die Hände leicht nach vorne. Don Vincenzo fühlte wieder den leisen Zwang dieser seltsamen Augen, aber sein eigener Blick ruhte gebannt auf den Händen des andern. Grosse, starke Hände, Hände wie eines Raubtiers grausame Tatzen. Schmal die gespreizten Finger, aber knochig und dick in den Gelenken – – unerbittliche Hände, die sich wie Stricke um eine Kehle schnüren mussten. Wilde, mitleidlose, fürchterliche Hände – –
Daher kam es, daher, mehr noch wie aus den Augen – –
Der Pfarrer starrte auf diese Hände. Wie von weither kamen zu ihm die langsamen, fast feierlichen Worte:
»Der Paduaner schafft; ein Schöpfer ist er. Aus tausend Leibern reisst er tausend Seelen und schweisst sie zu einer in seiner Rede Flammen. Da stehen sie, Kinder, Weiber und Männer – jedes für sich – ein lächerliches Jammerbild! Und der Paduaner greift sie und formt sie und macht ein Grosses daraus, eine einzige starke Masse: ein gewaltiges, wahnsinniges Tier. – Das schafft er, das schafft er, Don Vincenzo!«
Dann seufzte er, lehnte sich langsam zurück. Er zündete eine Zigarette an, stiess in leichten Kringeln den Rauch von sich. »Nur leider, leider,« fuhr er fort und seine Stimme zuckte beinahe wehmütig, »kann er nicht gut lesen, der Paduaner. So zerschlägt er hunderttausend kleine Gedanken in all den Köpfen und gibt ihnen nicht einen andern dafür – einen – einen – grossen! Allen ergeht es wie es Ihnen erging, Don Vincenzo: zeit Ihres Lebens werden sie wissen, wie er sprach – – aber was er sagte, das haben alle vergessen! – Das Tier ist schon da, das herrliche, gewaltige Tier – – aber es kann nicht laufen, nicht beissen! – Ein Jammer ist es, ein Jammer! Ein Antichrist hätte er werden können – und bleibt zeit seines Lebens ein ungefährlicher Prediger! Wie gerne hätte ich ihn lesen gelehrt! – – – – Trinken Sie doch, Don Vincenzo!«
Der Pfarrer schwieg. Langsam ergriff er das Glas, hob es und stellte es wieder hin. Leise fragte er: »Herr Doktor, sind Sie katholisch?«
Die Frage kam schnell, plötzlich. Aber der andere zögerte nicht mit der Antwort.
»Augenblicklich nicht.« sagte er ruhig. »Wer weiss, ob ich es nicht wieder einmal werde!« – Er trommelte leicht mit den Fingern auf dem Tisch. »Aber lassen wir das, Don Vincenzo, wir wollen uns nicht über Religionen streiten! Ich sprach Sie, ein Wildfremder, heute morgen auf dem Dampfer an und Sie gaben mir so liebenswürdig Auskunft; es wäre recht undankbar von mir, wenn ich Sie jetzt in Dispute verwickeln würde, die immer ärgerlich werden.«
»Nein, nein!« lachte der Pfarrer. »Ich fürchte mich gewiss nicht. Ich stehe auf festem, starkem Grunde.«
»Glauben Sie?« Fast mitleidig klang des Deutschen Stimme. »Sie stehen da, wo Alfieri steht. Hart wie der Stein eurer Berge sieht dieser Boden aus und ist doch nur ein nie fassbares Gemisch loser Nebelflecken. Ah – ein Grund, ein Grund! Geben Sie diesem Manne nur einen festen Punkt, auf dem er stehen mag, und er wird Rom aus ihren Angeln heben! – Es ist immer wieder dasselbe: die grosse Erkenntnis. – Das ist das Geheimnis.«
»Ich verstehe Sie nicht, Doktor!«
»Das glaube ich, Hochwürden! – Aber wollen wir nicht das Thema fallen lassen? – – Ich bat Sie, mir einen stillen, einsamen Ort in Ihrem Sprengel zu nennen, wo ich ganz ruhig ein paar Monate bleiben könnte. Sie nannten mir Val di Scodra –«
»Ja,« sagte der Pfarrer kurz, »Val di Scodra.«
»Ist es still?«
»Ja.«
»Einsam?«
»Ja, ja! Einsam! Sie werden auf der ganzen Welt kein abgelegeneres Dorf finden.«
Frank Braun streckte ihm seine Hand hinüber. »Nicht böse sein, Hochwürden! Wir sind allzumal Sünder – –«
Er sah so harmlos, so gutmütig drein, dass der Alte lachte. Er nahm die Hand und schüttelte sie.
»Ich bin gar nicht böse. – Aber ich gab Ihnen ja schon ganz genau heute morgen jede Auskunft.«
»Und ich weiss auch alles ganz genau – ich habe leider ein sehr gutes Gedächtnis. Ich werde also bei dem braven Gastwirte Peppino Raimondi wohnen und werde – – – Aber warum wollen Sie nicht mitkommen, Don Vincenzo? Sie sagten mir doch, dass Sie eine Inspektionsreise durch Ihren Sprengel machen – – und dieses eine Dorf in den Bergen wollen Sie nicht besuchen? Dabei gehört es doch zu Ihrer engeren Gemeinde und ist Ihr Heimatdorf obendrein?«
Der Pfarrer unterbrach ihn: »Weshalb wollen Sie eigentlich, dass ich mitkomme?«
»Weshalb? Es ist eine Laune – – verzeihen Sie! Ich habe eine Arbeit vor, sehen Sie; ich schreibe nämlich. Und ich brauche dazu ein stilles Loch in den Bergen. Da will ich arbeiten – – wer weiss, vielleicht auch nicht. Aber auf jeden Fall will ich ein paar Monate lang allein sein, ganz allein mit mir selbst. Das ist nun so, wie ein kaltes, eiskaltes Bad. Man steht davor, man zaudert, wartet noch ein, zwei Minuten – dann erst geht man hinein. Sehen Sie, Don Vincenzo, wenn Sie mitfahren, habe ich noch ein oder zwei Tage Gesellschaft, ehe ich in mein kaltes Bad steige.«
»Auf Ihr Wohl, Doktor!« Der Pfarrer lachte fröhlich und leerte sein Glas. »Also ich soll noch ein Weilchen Ihr wärmender Bademantel sein? – – Aber leider: es geht nicht, geht wirklich nicht – ist ganz unmöglich.«
»Unmöglich? Ein Pfarrer, der sein Gemeindedorf nicht besuchen kann?«
»Nicht kann – sagen Sie lieber: nicht will! – Und ich habe heute abend zu Hause einen Brief vorgefunden, der es vielleicht wünschenswert erscheinen lässt, dass auch Sie lieber nicht nach Val di Scodra gehen.«
»Wirklich, Hochwürden, nun machen Sie mich neugierig! – Ich soll auch nicht hingehen? Meinen Sie, dass ich dem Dorfe gefährlich werden würde – oder am Ende gar – – das Dorf mir?«
»Nein, nein, Doktor, beides ganz gewiss nicht! – Aber nach den Nachrichten, die ich erhielt, scheint mir Val di Scodra doch nicht mehr so ganz still und ruhig zu sein. Es geht da etwas vor.«
»Oh, oh – Sie giessen mir warmes Wasser in mein eiskaltes Bad! – – Nun, und was geht denn vor, das für mich Interesse haben könnte?«
»Ich weiss nicht, ob es für Sie ein Interesse hat, wahrscheinlich wohl nicht. – Man hält da schwärmerische Versammlungen ab.«
»Wer?«
»Die Leute von Val di Scodra. Der eigentliche Urheber heisst Pietro Nosclere, oder Mister Peter, wie er sich lieber nennen hört. Der Amerikaner, wie die Leute sagen.«
Frank Braun horchte auf. »Wer ist dieser Mister Peter?«
»Lassen Sie mich Ihnen die Dinge erzählen, so wie sie sich zutrugen, Herr Doktor; da werden Sie gleich den Zusammenhang verstehen. Sie müssen wissen, dass aus unsern armen Bergdörfern alljährlich eine Menge Leute auswandern nach Amerika, aus keiner Gegend so viele im ganzen Trentino. Die meisten bleiben drüben, aber manche können doch ihre alte Heimat nicht vergessen, kehren zurück, sowie sie genug Geld verdient haben, um ein Stück Land hier zu kaufen. So einer war Pietro Nosclere. Vor bald dreissig Jahren wanderte er aus, ein sechzehnjähriger Bube Er war erst in Neuyork, dann in Chicago und schliesslich irgendwo in Pennsylvanien. Nirgends hatte er recht Glück, verdiente kaum genug, um für sich und seine Frau – eine Bergamaskerin, die er drüben kennen lernte – das tägliche Brot zu erwerben. Ein Glück nur, dass keine Kinder da waren! – Es scheint nun, dass er dort, in Pennsylvanien, Beziehungen zu einer Schwarmsekte fand, der er sich im Anfang wohl nur aus materiellen Interessen anschloss. Die Leute kümmerten sich augenscheinlich gut um ihn, von diesem Augenblick an fielen die Nahrungssorgen ab von ihm. Aus dem kleinen Flickschuster wurde ein richtiger Schuhmacher – bald darauf ein Schuhwarenhändler. Dann kam das grosse Glück: bei einer Lotterie, die die Gemeinde zum Bau eines neuen Gotteshauses veranstaltete, zog Pietro den Hauptgewinn: zwanzigtausend Dollars. Er blieb noch ein Jahr dort, aber mit der eingewurzelten Geldvorsicht unserer Bergbewohner konnte er sich doch nicht entschliessen, seinen Reichtum in irgendein Geschäft hineinzustecken. Dazu nagte an ihm, stärker wie je, das alte Heimweh.
So kam er zurück. Er hielt sich nirgend auf, machte genau denselben Weg – oder Umweg – den er vor soviel Jahren gegangen, über Amsterdam, München und Wien. Selbst hier in der Stadt blieb er nur eine Nacht, dann fuhr er in sein Dorf. Er fand bald einen Hof, den er kaufte; nun sitzt der Amerikaner da seit bald drei Jahren.«
Der Deutsche lachte. »So, so! Und Mister Peter vertreibt sich nun die Zeit damit, die fremde Lehre, die ihm selbst so gut bekommen ist, in seiner Heimat auszubreiten?«
»Ja, so ungefähr,« bestätigte der Priester. Uebrigens ist es gar keine Lehre, ich habe mir vergeblich Mühe gegeben, herauszubekommen, was er eigentlich will. Sehen Sie, der Mann lebt da auf seinem Hofe und hat nichts, gar nichts zu tun. Sein Geld hat er auf meinen Rat in Staatspapieren angelegt und das bisschen Landbau, von dem er gar nichts versteht, sowie die Wirtschaft besorgt seine Frau mit einem Knechte und einer Magd. Zuerst beschäftigte er sich eifrig mit seinem kleinen Garten, dazu legte er einen Schuhladen an. Aber beides nimmt ihn noch keine Stunde am Tage in Anspruch. Da kamen ihm die Erinnerungen an die Brüder in Pennsylvanien.«
»Womit fing er an?«
»Er hielt Andachten ab in seinem Hause. Dann zog er allmählich andere hinzu – Leute, die im Tagelohn für ihn arbeiteten, oder denen er ein wenig Geld geborgt hatte. Sie verstehen: er ist ja der Krösus in seinem Dorfe und da kommt das Ansehen von selbst. Jeder will ihm zu Gefallen sein.«
»Was predigt er denn?«
»Busse. Er lässt die Leute gemeinschaftlich beten und singen. Sie langweilen sich ja alle zu Tode in dem verlorenen Dorf, sowie sie nur die Arbeit aus der Hand legen. So bieten denn des Amerikaners Andachten eine willkommene Abwechslung – es kamen immer mehr Leute zu seinen Versammlungen. Seine Stube wurde bald zu klein; nun hat er eine grosse Scheune als Saal herrichten lassen.«
»Ist er denn regelrecht aus der Kirche ausgetreten mit seiner Sekte?«
»Ausgetreten? Gott behüte! – Es scheint, dass auch von seinen Genossen da drüben keiner seine Konfession aufgab, ob er nun Protestant oder Katholik, Quäker oder Methodist war. Ich habe ein paarmal mit Pietro darüber gesprochen, er ist sich gewiss selbst nicht klar, was eigentlich jene Pennsylvaniagemeinde erstrebte. Er führt immer nur dieselben Phrasen im Munde – spricht von Busse tun – von heilig werden, schon hier auf Erden – von der Bekämpfung des Teufels und dergleichen Dingen. Und zu diesem Zwecke scheint ihm die katholische Kirche allein nicht zu genügen.«
»So tritt er offen gegen irgendeine ihrer Einrichtungen auf?«
»Ja – und nein. Er sagt zum Beispiel: die Beichte wäre gut. Aber es genüge nicht, dass man heimlich seine Sünden des Priesters verschwiegenem Ohre vertraue, man müsse den Mut finden, sie in öffentlichen Versammlungen zu bekennen. Nur so möge es gelingen, den bösen Geist zu bannen. Ueberall kröche der Teufel herum auf dieser Erde, man müsse ihn austreiben mit Gesang und Gebet.«
»Das alles ist hübsch im Stile der Heilsarmee, Don Vincenzo. – Und es scheint mir nicht gerade im Sinne der Kirche zu sein, wenn Sie da die Hände in den Schoss legen und ruhig zuschauen, bis Ihnen die Bewegung über den Kopf wächst.«
»Sie kennen unsere Berge nicht, lieber Doktor, sonst würden Sie anders urteilen. Sich gar nicht darum kümmern, ruhig die Leute gewähren lassen, das ist in diesem Falle das einzige, was wir tun können. – Sehen Sie, da wachsen die Menschen auf, unten tief im Tale, rings umgeben von Bergen, die hoch in die Wolken wachsen. Die steilen Wände engen sie ein, wie in ewigem Kerker hausen sie da. Ihre Welt ist so unendlich klein, nie sehen sie den Horizont, nie geht ihr Blick heraus aus ihrem engen, tiefen Loche. Und so wachsen sie auf, Geschlecht um Geschlecht; eng, klein, von Felswänden umgeben ist ihr karges Leben.
Gehen Sie nur hin, Sie werden dann sehen, wie recht ich habe! Alle haben sie irgendein Gebrechen; der ist am Leibe, jener an der Seele verkrüppelt. Wie Blinde tappen sie daher und so sehr haben sie das Leben vergessen, dass sie es nicht einmal kennen lernen, wenn sie draussen sind. Dreissig Jahre war Pietro in Amerika und weiss nicht mehr davon wie diese Flasche da auf dem Tisch! Es ist, als ob die Berge ihren Geist erdrücken, zusammenpressen, in engem Schraubstock halten die Jahrhunderte lang –«
Er unterbrach sich, lächelnd. »Jetzt wollen Sie fragen: ›Nun – und Sie, Don Vincenzo? – Sind Sie nicht auch daher?‹«
»Ich hätte das nicht gefragt.«
»Nicht? – Aber Sie haben es gedacht! Gestehen Sie doch!«
»Gedacht – vielleicht!«
»Ich wusste es wohl,« fuhr der Alte fort. »Gewiss, ich bin aus Val di Scodra und darum kenne ich die Leute, besser wie irgendeiner. Aber ich kam hinaus als kleiner Bube, herunter in die Ebene. Sehen Sie, schon hier am See lebt ein anderer Schlag. Die Menschen hier fliegen hinüber, herüber über die blaue Garda, keiner klebt an seinem Fleck. Und ich war dort unten, wo keine Berge mehr sind. Und dann am Meer, wo der Blick weit schweift, ohne Ende in alle Ferne. Da habe ich begreifen lernen, dass nur im weiten flachen Lande, nur an gewaltigen Strömen und am unendlichen Meere grosse, freie und starke Völker wohnen können.«
Der Alte holte tief Atem, dann leerte er sein Glas.
»Mein Tiroler Volk aber ist klein und schwach und elend, ob es nun deutsch oder wälsch spricht. Wir schreien den guten Andreas Hof er und den tapfern Pater Haspinger als Helden aus und bilden uns ein, dass sie für die Freiheit kämpften. Und sagen Sie einem, dass sie gegen die Freiheit und für die schwärzeste Reaktion zu Felde zogen – so lacht er Sie aus.«
»Und das sagen Sie, Hochwürden, Sie, ein Priester?«
»Ich bin ein Priester. Aber vor allem andern bin ich Italiener, wenn ich auch Untertan des Habsburger Hauses bin. Und das Volk, dessen Sprache ich spreche, das Volk der Ebene und des Meeres, gewann mit Frankreichs Hilfe Freiheit und Einheit und immer wieder im Kampfe gegen Rom und gegen Oesterreich. Die Helden Tirols aber haben stets nur für diese Mächte gekämpft – – das war ihre Freiheit! Heute noch, nach hundert Jahren, erzählen sie von dem guten Kaiser Franz – – und das war derselbe Herrscher, der einmal sagte: ›Völker? Was ist das? – Ich weiss nichts von Völkern, ich kenne nur Untertanen‹.«
Frank Braun lachte leicht. »Und dieser selbe Kaiser Franz – verzeihen Sie, Hochwürden, – war durchaus kein Deutscher. Er gehörte dem Volke an, das Sie lieben, er war Italiener zu neunundneunzig Prozent.«
»Sie mögen recht haben,« sagte der Pfarrer, »ich weiss das nicht. Aber für das Volk der Berge war er nur der Kaiser und seine roten Hosen waren den Tirolern ein Gegenstand der Verehrung und sind es heute noch.«
»Und wie Sie, Don Vincenzo, so denken –«
»– Wenige nur, ganz wenige! Die Berge sind klerikal, römisch und österreichisch! Hofer und Speckbacher sind Freiheitshelden – auch bei uns, die wir wälsch sprechen.«
Er seufzte schwer. »Denken – sie denken überhaupt nicht, diese Höhlenmenschen der Bergtäler. Sie träumen nicht einmal. Sie leben kaum, sie vegetieren, wie ihre morschen Tannen. Klein und plattgedrückt sind ihre Schädel, unförmige Kröpfe hängen an ihrem Halse. Sie lieben Gott und den Heiland und die Madonna, und sind die frommsten Christen der ganzen Welt. Aber selbst uns Priester fasst manchmal ein Grauen, wenn wir sehen, wie sie ihre Heiligen anbeten. Der Bischof sagte einmal: ›Unsere Berge haben mehr Götter, als Hellas und Rom und ganz Asien‹!
Und dann, manchmal, kehrt sich ihr Blick nach innen. Sie werden schwärmerisch, ekstatisch, hellseherisch. In Sempiglio auf der andern Seite des Sees, hinter dem Monte Baldo, lebt ein Bergbauer, der jedes Feuer ansagt, auf viele Meilen im Umkreise und oft Stunden vorher. Und er ist lange nicht der einzige! Auch vergeht kaum ein Jahr, dass nicht in irgendeinem entlegenen Dorfe sich religiöse Schwarmgeister zeigten. Sie sehen also, was in Val di Scodra vor sich geht, ist uns nichts Neues; neu ist da nur, dass Mister Peter einige amerikanische Schlagwörter und Gesten hineinwirft.«
»Und Sie lassen die Leute dann ruhig gewähren, Hochwürden?«
»Ja, das tun wir. Das ist die Taktik, die seit über zwölf Jahren unser Bischof verfolgt. Er ist ein sehr kluger Mann; ich versichere Sie, es ist das allerbeste so. Manche unserer Priester haben im Anfang den Kopf geschüttelt – heute haben alle längst eingesehen, dass er recht hat. – Haben Sie nie von den ekstatischen Schwarmgeistern von Mezzoveneto gehört?«
»Nein, Hochwürden, ich glaube nicht.«
»Das war vor einem Vierteljahrhundert. Die Leute des weltfernen Tales predigten Busse; irgend so ein kleiner Prophet führte sie. Sie machten grosse Prozessionen, sangen, beteten, schrieen, zogen auch wohl in die Nachbardörfer. Der streitbare Pfarrer suchte mit allen Mitteln sie zur Vernunft zu bringen, mit Güte erst und dann mit Strenge. Und der damalige Bischof wandte sich an die Behörden – die Bewegung wurde unterdrückt, mit regelrechten Kämpfen. Was war die Folge? Einige Tote und manche Verwundete auf beiden Seiten; drei Leute kamen ins Irrenhaus, nicht weniger wie sechsundfünfzig ins Zuchthaus oder ins Gefängnis. Viele flohen, eine ganze Reihe wanderte aus – – noch heute steht das halbe Dorf leer! Und dann ein grosser Skandal, ein Geschrei in allen Blättern – – nein, nein, unser Bischof hat ganz recht: man muss alles tun, um ein neues Mezzoveneto zu verhüten!«
»Und Sie tun nun alles, indem Sie – nichts tun?«
»Ja, Doktor, nichts, rein gar nichts! Und damit erzielen wir die ausgezeichnetsten Erfolge. – Wir lassen die Leute ruhig gewähren, ziehen uns still zurück. Nach kurzer Zeit ist dieser merkwürdige Rausch wieder vorbei, alle strömen zurück in die Kapellen, als sei nichts geschehen. Es ist ein flackerndes Strohfeuer, an dem die Schwärmer sich wie Kinder freuen, und es erlischt so schnell wie es kam. – Denn sehen Sie, es ist ja nie eine greifbare Idee dabei, keiner weiss, was er eigentlich will. Es ist eine harmlose Krankheit der Berge, weiter nichts; unser Bischof nennt sie das Talfieber.«
»Und weiss er auch von der neuen Seuche in Val di Scodra?«
»Gewiss. Ich habe unlängst in Trient Bericht erstattet, als mir die Sache gar zu lange dauerte und grössere Dimensionen annahm. Der Bischof lachte und meinte, dass es wenigstens mal eine kleine Abwechslung sei mit dieser neuen pennsylvanischen Mode. Er hat ein schönes Wort gesprochen, das ich mir wohl gemerkt habe; ich will es Ihnen wiederholen: »Lange nachdem der brüllende und brausende Gebirgsbach dieser seichten Schwärmer seinen Wahnsinn ausgeschäumt hat, sieht man den tiefen und ruhigen Strom der Kirche noch majestätisch dahinfliessen, jenen Strom Gottes, an dessen Fluten die heilige Stadt fröhlich ist, die Stätte, da die Wohnungen des Höchsten sind.« – So sprach mein Bischof und er riet mir dringend, nur ja mich still zu verhalten – – jeder Druck muss stärkeren Gegendruck erzeugen, sagte er.
Nun war ich schon seit Monaten nicht mehr dort. Das letzte Mal hielt ich die Messe in ihrer Kirche – für einen Menschen – oder für anderthalben, wenn Sie wollen! Mister Peter hält nämlich jetzt auch Sonntagmorgens Versammlungen ab und alle laufen natürlich dahin. Meine Gläubige war Teresa, mein Beichtkind, die Tochter des Gastwirtes, den ich Ihnen empfahl, – und dieser selbst war mein anderer Gast. Nur – er ist nur halb zu zählen, denn er ist recht und schlecht ein Ungläubiger, der sonst nie zur Messe geht. Er kam damals nur so mit – aus Höflichkeit sozusagen. Vielleicht auch ein wenig aus Opposition gegen den Amerikaner! – Sehr schwer ist ihm das Opfer gewiss nicht geworden, da er arg schwerhörig ist und sicher kein Wort verstand, von dem, was ich sagte. Uebrigens ist ihm dieser Gang schlecht genug bekommen: er war Ortsvorsteher–bei den neuen Wahlen aber hat man den Amerikaner gewählt. Das schreibt mir eben Teresa, mein Beichtkind – – sie ist mein kleiner Spion in Val di Scodra.«
Er zog einen Brief aus der Tasche und blickte hinein. »Immer dasselbe, immer dasselbe!« fuhr er fort. »Und kein Ende abzusehen. Viermal in der Woche grosse Bussversammlungen mit Singen und Lärmen auf allen möglichen wüsten Instrumenten! Das ist auch so eine amerikanische Erfindung, die mein lieber Neffe importiert hat!«
»Er ist Ihr Neffe, Don Vincenzo?«
»Ja, sagte ich Ihnen das nicht schon? Pietro ist meiner einzigen Schwester Kind. Und das ist auch ein Grund, weshalb ich alle Auseinandersetzungen mit weltlichen und geistlichen Behörden ihm ersparen möchte, die doch letzten Endes diese ganze Sache nur noch schlimmer machen würden. – Aber Sie begreifen jetzt, Doktor, warum ich Sie nicht begleiten kann. Ich darf nicht noch einmal hingehen und wieder vor leeren Bänken predigen – – das hiesse die Würde unserer heiligen Kirche aufs Spiel setzen. Sich Watte in die Ohren stopfen, nichts hören und nichts sehen, die Leute ganz in Ruhe lassen, das ist das rechte Mittel. – Nur weiss ich nicht, ob man Sie auch so hübsch in Ruhe lassen würde, bei den wilden Konzerten von Trommeln und Klappern und Pfeifen! Freilich, Raimondis Haus liegt an einem Ende des Dorfes, dicht an dem kleinen See, des Amerikaners Hof aber, mit seiner Versammlungsscheune, weit am andern Ende, ein wenig den Berg hinauf.«
Frank Braun lachte. »Nun, so wird es nicht so gefährlich sein mit dem ruhestörenden Lärme in Val di Scodra.«
»Sie wollen es also versuchen, Doktor?«
»Gewiss will ich das, morgen schon. Vielleicht ist der Amerikaner ein Mann, den ich gebrauchen kann.«
»Den Sie – gebrauchen können?«
»Ja, Hochwürden. Ich sammle merkwürdige Menschen – das ist so eine Marotte von mir.«
»Aber – was wollen Sie denn mit ihm?«
»Kann man das wissen? Der Augenblick gibt es. – Da war Kolumbus, der lief herum mit einem hübschen Gedanken, den er einem guten Freunde gestohlen hatte. Die katholische Isa bella gab ihm drei alte Kähne und hundert Zuchthäusler – – da zog er aus und fand eine Welt. – Wer weiss, was Pietro finden mag?«
Der Alte zuckte ungeduldig die Achseln.
»Er? – Ich sage Ihnen, er hat gar keinen Gedanken!«
»Und wenn man ihm nun den Gedanken gäbe?«
»Den Gedanken? – Welchen Gedanken?«
»Ich weiss nicht. – Irgendeinen.– – Den, den er braucht! – Eine Kraft liegt da, in den tiefen Tälern dieser Berge – irgendeine geheimnisvolle, schwärmerische, ekstatische Kraft. Und sie verpufft, Jahr um Jahr – in jämmerlichem Strohfeuer. – Man sollte keine Kraft brach liegen lassen.«
»Es ist eine Krankheit, diese Kraft! Je schneller das Feuer verpufft, um so besser für alle!«
Der Deutsche lehnte sich weit in den Stuhl zurück, sein Auge nahm einen seltsamen Glanz an. »Nein, alter Mann!« sagte er halblaut. »Das ist nicht wahr. Nichts soll zugrunde gehen, ehe es gelebt hat.«
»Doch, das Böse!«
»Nein, auch das Böse nicht. Es hat sein Recht zu leben, wie alles andere. – Nur was klein ist, ist hässlich!« Seine Stimme schwoll, seine Hand krallte sich um die Serviette. »Aber lassen Sie es nur wachsen–das, was Sie böse nennen! Es wird gross werden – und alles ist schön, was gross ist.«
»Ich stehe auf dem Boden – –«
Er unterbrach ihn: »Ich weiss, Don Vincenzo, auf welchem Boden Sie stehen. Aber müssen darum alle auf diesem selben Boden stehen? Lassen Sie doch Ihren Neffen sein Glück da suchen, wo er es zu finden hofft I Warum soll man wünschen, dass auch diese Flamme verlischt, weil sie nirgend mehr Nahrung findet? Warum soll man nicht Brennstoff hineinwerfen, Balken und Zunder, dass sie hoch auflodert aus ihrem Talkessel, eine rote Fackel, über die Berge hinaus weit wächst in die Wolken?«
Der Alte wiegte den Kopf. »Gut, gut, lieber Doktor! Nur – mein armer Neffe wird nie verstehen, was Sie da sagen!«
»Er braucht es ja gar nicht zu verstehen. – Wenn er nur schaffen kann, schaffen! Wenn er nur aus seinen Bergleuten eine einzige Masse formt, so wie der Paduaner tat. Das Tier will ich haben, das gewaltige Tier, Don Vincenzo: glauben Sie mir, ich will es schon beissen lehren!«
Der Pfarrer schlug ein Kreuz. »Das wird Gott im Himmel verhüten!«
Da beugte sich der Deutsche leicht über den Tisch, seine Lippen zuckten. »So – meinen Sie, Hochwürden? – – Nun – da muss man eben an eine andere Türe klopfen!«
Der Alte sprang auf, seine Stimme bebte.
»Was sagen Sie da?« – Aber er erhielt keine Antwort.
Seine Lippen bebten leise, seine Hände zitterten. Er bezwang mühsam seine Erregung; mit weit offenen Augen starrte er hinüber.
»Wollen Sie mir eine Frage beantworten, Herr Doktor?«
»Gewiss.«
»Nun denn – wer sind Sie?«
Da stand auch der andere auf; ein helles Kinderlachen spielte auf seinem Gesicht. »Wer ich bin?« antwortete er. »Nichts Sonderliches. Frank Braun heisse ich. – Ich kann lesen und schreiben.«
II
Inhaltsverzeichnis
»Dem Indra tropfe der Trank.«
Relig. d. Veda.
Frank Braun musste einige Tage warten bis zum Posttage. Die Post ging nur einmal wöchentlich nach Val di Scodra – oder vielmehr, sie fuhr auf der Bergstrasse darüber hinweg, weit zur Grenze hin. Hoch über dem Dorf machte sie Halt und lud die wenigen Briefe und Pakete aus. Jemand wartete dort und trug alles hinunter ins Tal.
»Nehmen Sie nicht die Post.« riet ihm der Oberkellner. »Fahren Sie mit unserm Automobil. Wir veranstalten Ausflüge, alle paar Tage jetzt in der Saison, sowie genug Beteiligung ist. Sie lassen dann bei Val di Scodra halten und steigen aus.«
»Wird man meine Koffer mitnehmen können?«
»Warum denn nicht! Es ist ein schwerer Opelwagen, vierundsechzig Pferdekräfte. Mit der Post werden Sie hinauf sieben bis acht Stunden gebrauchen, so aber sind Sie in kaum zwei Stunden da.«
»Gut also.«
– Das Auto stieg in die Berge über weite, staubige Serpentinen. Die Reisenden schwatzten und lachten, gewillt den teuren Ausflug nach besten Kräften auszukosten. Ein dicker Herr aus Dresden hatte seinen Baedeker genau durchgelesen, jede neue Bergspitze, jeden Wasserfall nannte er stolz bei Namen. Wenn ein Ochsenkarren vorüberkam, wenn irgendeine scharfe Kurve den Abhang besonders deutlich zeigte, kreischten die Damen; das Hochzeitspärchen, das vorne sass, rückte dann noch enger zusammen.
Frank Braun starrte in die Landschaft, gleichgiltig, gelangweilt. Kein Wort sprach er.
»Sehen Sie dort – rechts – da ragt der Monte Terlago auf!« erklärte ihm sein Nachbar. Aber er bekam keine Antwort.
Das Auto hielt. »Hier ist Val di Scodra! Sie müssen aussteigen!« rief der Chauffeur. Er sprang ab, schnallte die Koffer los und stellte sie auf die Landstrasse.
Frank Braun kletterte aus dem Wagen. »Wo liegt das Dorf?«
»Dort unten. Erst ein wenig weiter die Strasse hinauf hat man einen Ausblick ins Tal. Ich habe aber gleich hier gehalten, weil hier der Pfad hinabführt.«
»Und wie bekomme ich mein Gepäck ins Dorf?«
Der Chauffeur lachte. »Ja, das werden Sie nun wohl einstweilen auf der Strasse liegen lassen müssen. Gehen Sie nur hinunter und lassen Sie es dann holen. – Es liegt ja sicher genug da – übrigens ist auch jemand da, der aufpassen kann. – He, Alte!« rief er. »Komm doch einmal her!«
Frank Braun wandte sich um, er sah ein altes Bettelweib, das an das Auto getreten war und höchst gewissenhaft einem Reisenden um den andern die hohle Hand hinstreckte. Sie beeilte sich nicht, wartete, bis auch der letzte ihr seinen Kreuzer gab; dann erst kam sie näher. Ihr Rücken war von irgendeinem Leiden gekrümmt; wie ein Bogen spannte er sich steif nach vorne hin, so dass der Kopf mit den wirren, grauen Haaren sich kaum über Hüfthöhe hinaushob. Sie pflegte das Gesicht zur linken Seite zu drehen und schielte merkwürdig von unten herauf.
»Hallo, Sibylla Madruzzo,« rief der Chauffeur, »so kommt doch! Ihr sollt auf die Koffer da am Wegrand aufpassen. Der Herr geht zum Dorfe und lässt sie später holen. – So, setzt Euch oben drauf, das ist das beste.«
Frank Braun gab der Bettlerin ein paar Nickelstücke. »Wie lange Zeit werde ich gebrauchen?«
Die Alte bewegte die Lippen, sie hob den kurzen Krückstock und machte mit den Fingern ein paar absonderliche Zeichen.
»Sie ist stumm.« erklärte der Chauffeur. »Aber der Weg führt steil den Berg hinab. Ich denke, Sie werden in dreiviertel Stunden unten sein.« Er grüsste, drehte die Kurbel an und sprang rasch auf seinen Sitz. In dichten Staubwolken verschwand sein Wagen.
***
Frank Braun stieg den Berg hinab. Es fiel ihm auf, wie anders hier die ganze Natur war. Vor ein paar Stunden noch war er am Ufer der Garda gegangen – unter Palmen. Unter schwindsüchtigen, langweiligen, gestutzten Hotelpalmen freilich, aber es waren doch Palmen. Bambusbüsche deckten den kleinen Zierteich, Magnolien und breitblättrige Bananen wuchsen auf den Beeten. Verschnittene Pinien, spindeldürre Zypressen ragten hier und da auf, dann und wann auch ein starker Eukalyptus. Zitronen wuchsen unter Schutzdächern am Berghange und weithin zogen sich die Kulturen verkrüppelter Oelbäume am See hin.
Hier war nichts von alledem, weit hinter ihm lag der Süden. Und der Frühling, der unten am See in voller Pracht stand, wagte hier kaum erst anzuklopfen mit bescheidenem Finger.
Ziemlich steil führte der schmale Weg hinab. Ein paar Ziegen begegneten ihm, die das dünne Gras zwischen den Felsen suchten. Dann, bei einer Wendung, blieb er stehen. Hier war endlich ein Ausblick; von einem breiten Steine konnte er hinabsehen. Fast kreisrund lag dort unten ein kleiner See. Ihm gegenüber, und auch nach beiden Seiten hin, fielen die Felswände glatt in das Wasser hinab, es sah aus, als ob kaum ein Hund da noch vorbeilaufen könnte. Zu seinen Füssen weitete sich das Tal ein wenig – da stand das Dorf. Unregelmässig lagen die Dächer verstreut – braunrote Klumpen verwitterter Ziegel. Hier war ein Haufen von Häusern zusammengeballt – da standen zwei – oder eines nur – wie es gerade die ebene Fläche erlaubte. Langsam stieg das Dorf nach Nordosten zu die Berge hinauf – ganz hinten leuchtete matt noch ein letztes, grösseres Dach. Mitten im Dorfe lag die kleine Kirche, von ihr führte ein breiter Weg über den buschbestandenen Abhang der Nordseite weiter hinauf, lief zu einer starken Platte, die fast über dem See hing. Sie schien ganz frei und eben, am äussersten Ende trug sie drei mächtig aufragende Kreuze. Das grösste, ein wenig erhöht, in der Mitte – da hing der Erlöser; zu beiden Seiten ragten die Kreuze der Schacher. Es musste wohl ein Kalvarienberg sein, deutlich sah er auf dem Wege die vierzehn Stationen.
Langsam schritt er tiefer hinab. Er traf einen Buben, der eine Kuh grasen Hess. »Wo ist das Gasthaus des Raimondi?« fragte er. Aber der Bengel starrte ihn an, wie ein Gespenst, zog seine Kuh am Stricke in den Busch hinein und gab keine Antwort.
Er ging weiter. Kleine Fluren waren eben in den Abhang geschnitten, unten sah er einen Oelgarten, hie und da rankten ein paar alte Reben zwischen verschnittenen Weidenstämmen. Ein Knecht bearbeitete den Boden mit dem Spaten.
»Wo ist das Gasthaus des Raimondi?« fragte Frank Braun. Der Bursche rührte sich nicht. Er hatte ein breites, bartloses, hartes Gesicht, über die Massen dumm und hässlich. Ein verschmitztes, starres Bauernlächeln lag über dem weitoffenen Munde.
Frank Braun wiederholte seine Frage.
»Ich bin nicht von hier –« grinste der Knecht.
Der Deutsche wurde ungeduldig. »Zum Henker – du wirst doch wissen wo das Gasthaus ist!« Er gab ihm ein paar Kreuzer. »Da! Führe mich hin!«
Der Knecht nahm seinen Spaten über die Schulter und schritt voran.
»Wie heisst du?« fragte Frank Braun.
Er grinste, aber antwortete nicht.
»Nun, es scheint, dass man dich alles zweimal fragen muss! Wie du heisst, will ich wissen!«
»Angelo.« sagte er. »– Aber ich bin nicht von hier.«
»Das weiss ich bereits. Also woher bist du?«
Der Bursche hob den Spaten und wies nach Norden. »Daher!« Dann besann er sich und zeigte nach Westen. »Nein – daher! – Aus Turazzo.«
Ein Haus lag vor ihnen, dicht am See. Eine breite Steintreppe führte zu einer kleinen Veranda; Crimson Rambler kroch dicht darüber, aber noch blühte keine der kleinen, roten Rosen. Der Knecht stellte seinen Spaten an die Wand und schickte sich an durch die niedrige Seitentüre in den Stall zu treten.
»Dienst du hier?« fragte Frank Braun.
»Ja.«
»Aber du solltest mich doch zu Raimondis Gasthaus führen.«
»Das ist hier.«
»Hier? – Also du dienst bei ihm, Bursche? – Und vorhin wolltest du nicht einmal wissen, wo er wohnt?«
Der Knecht lachte blöde. »Ich bin nicht von hier.« Dann stapfte er in seinen Stall; ein frohes Ziegenmeckern empfing ihn.
Frank Braun stieg die Treppe hinauf, öffnete die Türe und blickte in das Zimmer.
»Niemand da?« rief er. Er trommelte mit der Faust auf den Tisch. Aber es kam niemand. Er trat ans Fenster und blickte hinaus über den See, über den kleinen Platz vor dem Hause, über die Strasse – – nirgends sah er einen Menschen. Er wartete eine Weile und rief von neuem – vergebens.
Vielleicht hatte ihn der blöde Knecht doch in ein falsches Haus geführt? Er ging hinaus und wanderte über die Gassen. Vorbei an den Häusern und Höfen. Er blickte durch ein paar offene Türen und Fenster, trat hier und da in einen Garten. Nirgends war ein Mensch in dieser toten Stille – ein einziger starker, schwarzer Hund lag auf der Gasse und blinzelte ihn verwundert an.
»Verwunschenes Dorf!« dachte er.
Von Osten drang ein verworrenes Geräusch zu ihm her. Er ging darauf zu, langsam stiegen die Häuser hier höher hinauf. Bald genug unterschied er–es war ein Singen – dann die gezogenen Töne der Harmonika. Und dazwischen zerhackte Klänge von Tamburin und Triangel.
»Des Amerikaners Konzert.« dachte Frank Braun. »Da also ist das ganze Dorf heute versammelt.« Er überlegte, ob er zu der Versammlung gehen sollte, schliesslich schüttelte er den Kopf. »Ein andermal!«
Er wandte sich und ging wieder zurück. Hinten im See, ganz am andern Ende, sah er ein Boot liegen. Eine kleine Bucht schob sich da in die Felsen, die ein wenig zurücktraten, er sah das Schilf vorne, dahinter einen schmalen dreieckigen Landstreifen. Hinten sprang ein Giessbach hoch herunter in selbstgesprengtem Spalt – der mochte das bisschen Land da angeschwemmt haben. Er sah, wie ein Mädchen sich hob in dem Kahn, dann sich niederbückte, wie sie die Reusen aus dem Schilfe hob und vorsichtig am vorderen Ende die langen Weidenkörbe aufnahm.
Da war also wieder jemand, der nicht in der Versammlung war! – Oben: Sibylla Madruzzo, das krumme und stumme alte Bettelweib – dann der kleine Bub mit seiner Kuh und Angelo, der Knecht, – der ja freilich nicht von hier war! – Und nun das Mädchen.
Gemächlich schritt Frank Braun zurück, dem See zu. Auf der breiten Bank vor dem Hause, in das er zuerst getreten war, sass ein graubärtiger Mann in Hemdsärmeln, bequem vornübergebeugt, die Ellenbogen auf den runden Steintisch gestützt.
»Wieder einer. Der fünfte, der nicht bei Mister Peter ist!« lachte der Deutsche. »Ich habe dem Dorfe unrecht getan, es ist doch noch Leben da.«
»Guten Abend.« sagte er. »Seid Ihr Peppino Raimondi?«
Der Gastwirt stand auf, brummte etwas und schaute ihn verwundert an. Dann nahm er die Pfeife aus den Zähnen und sagte: »Wo kommt Ihr denn her, Herr?«
»Ich möchte hier bleiben und bei Euch wohnen.« antwortete Frank Braun. »Ihr seid doch Raimondi, was? – Don Vincenzo wies mich an Euch.«
Der Wirt nickte. »Ja, ja, schönes Wetter.« sagte er.
»Kann ich bei Euch wohnen?« wiederholte Frank Braun.
»Ja, ja! Der Frühling kommt.« brummte jener.
»Ob ich bei Euch wohnen kann?« rief Frank Braun noch lauter. Dann fiel ihm ein, dass ja der Pfarrer schon von des Wirtes Schwerhörigkeit gesprochen hatte. Er hatte keine Lust zu schreien, so nahm er ein Stück Papier und schrieb seine Wünsche auf.
Raimondi nahm das Blatt, setzte seine Brille auf und las bedächtig, langsam, Wort um Wort.
Dann sah er ihn über die Gläser hin an und fragte: »Ihr wollt ein paar Monate in Val di Scodra bleiben? Wollt zwei Stuben? – Wollt bei mir wohnen?«
Frank Braun nickte.
Aber der alte Wirt begriff es noch immer nicht. »Hier – hier bleiben? – Ein paar Monate? – Herr, ist das Euer Ernst?«
Da schrie ihm der andere ins Ohr: »Ja, ja, ja!«
Raimondi kratzte sich den Kopf und sagte: »Ja – ich verstehe sehr gut! – Bitte, Herr – –warten Sie einen Augenblick.« Er nahm seinen Rock von der Bank und zog ihn an.
»So –« fuhr er fort. »Also Sie wollen hier bleiben? Einige Monate? – Ja und was wollen Sie denn bezahlen?«
»Was wollen Sie haben?« gab Frank Braun zurück.
Beide gingen ins Haus, setzten sich an den Tisch. Der Wirt begann zu handeln. Was denn der Gast verlange? Zwei Stuben? Gleich zwei? – Ja, wenn er es nicht anders wolle, dann müsse man es eben einrichten. Und was er zum Frühstück wolle? – Auch Eier? – Gut also – zwei Eier – –
Er flocht immer ein paar deutsche Worte in seine Rede – da sprach Frank Braun ihn deutsch an. Aber der Alte verstand nur wenig. Nein, nein, er hatte alles vergessen – – in den Jahren. Früher – ja, früher! Als er noch Kaiserjäger war. Und seine selige Frau – die war eine Deutsche gewesen – aus Brixen. Die Pfeife da – von ihrem Vater stammte sie noch her. – Aber seine Tochter, ja – die Teresa – die sprach so gut Deutsch wie der Kaiser selbst – Gott erhalte ihn!
»Jemand muss meine Koffer herunterschaffen.« sagte Frank Braun.
Koffer – Koffer habe er auch? Und wo sie denn seien? Auf der Landstrasse oben – – o, er sei mit dem Automobil gekommen? Nun, der Knecht müsse sogleich hinaufgehen, die Post zu holen. – Wie? – Ja, ja, der Postmeister, das sei er. Er zog eine Schublade auf, nahm eine Handvoll Karten heraus und ein paar Bogen mit Freimarken.
»Sehen Sie – das ist die Post von Val di Scodra.« Dann ging er ans Fenster und rief dem Knechte. »Angelo! Angelo! Leg dem Maultier den Lastsattel auf. Und vergiss die Stricke nicht. Du musst die Koffer herunter holen, die auf der Landstrasse stehen. Die alte Sibylla bewacht sie.«
Der Knecht nickte und schritt dem Stalle zu. – »Sag mal, warum bist du denn nicht in der Versammlung?« rief ihm Frank Braun nach.
Angelo grinste: »Ich bin nicht von hier.«
»Gewiss! Ich konnt es mir denken!« lachte der Deutsche. »Und so musst du wohl dein Leben hier für dich leben.« Dann folgte er dem Alten die Treppen hinauf.
Der Wirt stiess ein paar Türen auf. – »Es sind genug Zimmer im Hause.« sagte er. »Welche wollen Sie, Herr?«
Drei Stuben lagen zur Seeseite hin, aber nur eine schien bewohnt, die beiden andern standen beinahe leer. Frank Braun wählte die erste und den anstossenden Raum. »Wer wohnt hier?« fragte er. Er sah ein Muttergottesbild mit einem kleinen Weihwasserbecken zur rechten und einem ewigen Lämpchen zur linken Seite. Frische Buchsbaumzweige steckten im Rahmen.
»Meine Tochter.« gab der Wirt zurück. »Aber sie muss dann ausziehen.«
»Also gut.« sagte Frank Braun.
Er half Raimondi die Sachen des Mädchens in das dritte Zimmer tragen. Dann stellte er die Möbel um, nach seinem Behagen. »Gehen Sie nur überall herum.« sagte der Alte. »Nehmen Sie das, was Sie haben wollen.«
Der Deutsche ging hinunter und wieder hinauf, suchte sich zusammen, was ihm gefiel. Er rückte einen alten Lehnsessel ans Fenster, schob Holzleisten unter die Füsse des wackligen Tisches. Er schleppte auch einen kleinen Weinkorb heran, den er als Papierkorb benutzen wollte –
»Da, tragen Sie die Uhr hinaus.« sagte er zu dem Wirte und zeigte auf die alte Pendule, die über der Türe hing.
»Warum denn?« fragte jener.
»Ich mag keine Uhr im Zimmer. Keine Uhr und keinen Kalender. – Immer das Datum wissen, immer die Stunde – nein, ich lebe anders.«
»Aber sie geht ja gar nicht.« beteuerte der Alte.
»Sie geht nicht? – Dann mag sie bleiben. – Eine Lampe?«
»Ja, eine Lampe ist auch da.« – Der Alte brachte sie.
Endlich war er fertig. »Bringen Sie mir Wasser!« rief er. Der Wirt ging hinunter und füllte die grossen Krüge. Aber er trug sie nicht selbst hinauf, gab sie dem Knecht, der eben mit dem Maultier vom Berge kam.
Angelo schleppte die Krüge hinauf, dann die Koffer und Taschen.
Frank Braun begann auszupacken. Schnell, gewandt – eine gewohnte Arbeit. Er war fertig, ehe die Sonne sank. Wusch sich und ging hinunter.
***
Im Gastzimmer, neben dem Wirt, sass ein dicker, schnauzbärtiger Grenzgendarm, trank in mächtigen Zügen aus der Korbflasche. »Auf Ihr Wohl!« rief er dem Fremden auf deutsch zu.
»Danke.« sagte Frank Braun.
Der Gendarm schnäuzte sich. »Wissen Sie, das war ein gescheiter Gedanke, dass Sie hierher – –« Aber er stockte, lachte, trank wieder – der Gedanke schien ihm doch nicht so ganz gescheit zu sein. »Immerhin – es ist sehr gut,« fuhr er fort, »sehr gut! – Was hab ich dir gesagt, Raimondi,« brüllte er dem Wirte zu, »was hab ich gesagt? – Kommen die Betbrüder nicht, kommt ein anderer! – Na, und da ist er nun! Hätts ja selbst nicht geglaubt – aber da ist er, das ist nun wahr! Und bringt dir mehr Geld ein als alle Teufelsjäger zusammen!«
Frank Braun horchte auf. »Als – wer?« fragte er.
»Als die Teufelsjäger!« lachte der Gendarm. »Sie müssen nämlich wissen, in diesem verrückten Dorf hat ein Amerikaner – –«
»Ja, ich weiss.« unterbrach ihn der andere. »Ich habe davon gehört. Sie nennen sich also Teufelsjäger?«
»Ja, Herr!« bestätigte der Grenzer. »Weil sie nämlich den Teufel verjagen und mit Stumpf und Stiel ausrotten wollen – mit ihrem Beten und Singen. Diese wälschen Fack'n! – Na, wenn ich hier wäre, würds anders werden! – Was, alter Freund?« – Er stiess den Wirt lachend vor den Bauch. – »Ich jage auch den Teufel – aber besser, verdammt noch mal!« Er hob sein Glas hoch. »Komm her, alter, roter Alkoholteufel – wir haben keine Angst vor dir.« Er leerte es in einem Zuge und setzte es klirrend auf den Tisch zurück. Dann wischte er sich den Schnurrbart. »So – das Beelzebübchen da wäre vernichtet. – Was, Raimondi, wir sind die wahren Teufelsjäger!«
»Die Leute trinken also nicht?« fragte Frank Braun.
»Nicht einen Tropfen!« rief der Gendarm. »Wollen fromme Christen sein und erklären den Wein für Teufelswerk, den doch unser Herrgott wachsen liess. – Der alte Noah soff sich alle Tage toll und voll und war doch ein Patriarch. – Seit nun bald zwei Monaten haben die Kerls keinen Schritt mehr ins Wirtshaus gesetzt – – ich bin des Alten einziger Gast und ein schlechter dazu. – Ich zahle nämlich nicht, müssen Sie wissen.« Er hustete in überstürztem Lachen.
»Trink nur, Drenker.« sagte der Wirt seufzend. »Für seinen alten Regimentskameraden muss man ja wohl seinen Keller offen halten.«
»Na, hab dich nur nicht,« rief der Grenzer, »ich komme selten genug her ins Dorf. Alle drei Wochen, auf ein paar Stunden, wenn mans möglich machen kann. – Die verdammten Pascher lassen einem ja keine Ruhe in den Bergen.«
Ein Lichtschein drang durch die Türe, die ein junges Mädchen öffnete. Sie trug zwei grosse Kerzen ins Gastzimmer und stellte sie auf den Tisch.
»Ihre Tochter?« fragte Frank Braun den Wirt.
»Ja, das ist die Teres, seine Tochter!« sagte der Grenzer. »Ein braves Mädchen. Komm her Teres!« Aber das Mädchen drehte sich gleich herum und ging wieder hinaus, ohne ein Wort zu sprechen.
»Bring das Essen,« rief ihr der Vater nach, »die Gäste haben Hunger.«
Nach einer Weile kam sie zurück, breitete ein weisses Leintuch über den Tisch und trug die Gedecke auf. Dann stellte sie das Essen auf den Tisch.
Frank Braun bot ihr guten Abend, aber sie nickte kaum. Sie nahm auch nicht am Tische Platz, sondern setzte sich an das andere Fenster auf die Bank, zog ihr Nähzeug heraus.
Er betrachtete sie. Sie war hoch gewachsen und schlank – wohl zwanzig Jahre alt. Schwarzhaarig wie der Vater, aber mit grossen blauen Augen – – man sah wohl, dass ihre Mutter eine Deutsche war. Er rief sie an, bat sie, ihm Brot zu geben. Sie brachte das Brot, aber sie antwortete nicht auf seine Fragen. Sah ihn gross und misstrauisch an, ging dann zurück zu ihrem Platze.
Er ass und trank und plauderte mit dem Gendarm, während Raimondi neben ihm sass und schweigend seine Pfeife rauchte. Er beobachtete das schöne Mädchen – bemerkte wohl, wie sie hin und wieder, rasch und verstohlen, einen fragenden Blick auf ihn warf. Dann sah er, wie sie einen Brief aus der Tasche zog, ihn las und dazwischen wieder still zu ihm hinblickte.
Frank Braun dachte: » Dir also hat die Post einen Brief gebracht heute abend, dir, mein Kind! – Und er ist ganz gewiss von Don Vincenzo, deinem Beichtvater! Und er warnt dich darin vor mir. – Wie, mein Kind? – Darum also bist du so misstrauisch.«
Er lächelte und dachte: »Alter Mann – wie dumm du doch bist. Ich würde sie ja nicht ansehen und nicht anrühren, dein armes, kleines Beichtkind. – Nun aber – warum reizt du mich, Pfarrer? Bist so alt und weisst nicht, dass man nur das will – was verboten ist? – Und – du und ich, alter Mann? – – Welch ein ungleicher Kampf um dies Kind da!! – O, wie dumm du doch bist.«
Er sah hinüber und begehrte sie im Augenblicke. Diese Stirn war steil und nicht hoch, sie sprang zurück an beiden Schläfen. Die dichten schwarzen Brauen wölbten sich über den tiefblauen Augen, die die langen Wimpern beschatteten. Und die Nüstern der geraden Nase blähten sich und zitterten bei jedem Atemzuge. Ihr Mund schien ihm ein wenig zu gross, und die Lippen, leicht aufgeworfen, leuchteten wie starke Granatblüten in dem wachsbleichen Gesicht. Eine Demut, eine stille Sanftmut lag auf diesen weichen Zügen, aber darunter schien irgendein anderes zu schlummern.
Ein Genialisches vielleicht. Dieses Mädchen mochte einmal eine gute Künstlerin werden. Oder auch eine grosse Kokotte – –
Er sah, wie ihre Brust sich hob und senkte in zu engem Mieder. Er zog sie aus mit gierigen Blicken, riss ihr das Tuch vom Nacken und den schweren Silbergürtel vom Leibe –
Da fing sie seinen Blick. Sie wurde rot – eine Scham machte sie die Lider schliessen und ein rascher Hass hob sie von neuem. Ihre Hand zitterte. Sie stand auf, blieb stehen, steckte den Brief in die Tasche. Dann wandte sie sich; rasch, festen Schrittes ging sie durchs Zimmer. Klatschend fiel die Tür hinter ihr ins Schloss.
Frank Braun starrte ihr nach. Langsam verlor sich der wilde, gierige Zug. Seine Lippen glätteten sich, die Augen nahmen einen stillen verträumten Ausdruck an.
»Armes, schönes Kind.« murmelte er. Dann fuhr er mit der Hand durchs Haar und schüttelte wild den Kopf, als wolle er alle Gedanken fortjagen.
»Ich will singen!« rief er. »Und du, Wirt, bring uns von deinem besten Wein!«
Er lief auf sein Zimmer, nahm die Guitarre von der Wand und kam zurück. »Auf Ihr Wohl, Herr Drenker!« rief er. Er stiess mit dem Gendarmen an, dann mit dem Wirt. »Es ist gut, dass doch wieder einmal ein paar Leute im Dorfe sind, die wissen, wozu der Wein gut ist! Was gilt die Wette, ich trinke Sie unter den Tisch!«
»Bravo!« lachte der Grenzer. »Aber wetten Sie lieber nicht. Sie wissen nicht, was Aloys Drenker leistet.«
Frank Braun rief: »Ich will wetten! – Also Ihr Helm gegen meine Guitarre?«
»Mein Helm – –?«
»Ja – fürchten Sie sich?«
»Ich? Aber, lieber Herr –«
»Also angenommen?«
»Angenommen!« brummte der Grenzer und hob sein Glas. Bedächtig stand er auf, löste die Koppel von seinem dicken Leibe und stellte den schweren Säbel in die Ecke.
»So.«
Frank Braun stimmte die Guitarre. »Was wollt ihr hören?«
»Ist ganz gleich.« rief der Gendarm. »Was Sie eben können.«
Der Deutsche sang. Freche Studentenlieder. Dann lüsterne Couplets, die er aufgelesen irgendwo in wüsten Tingeltangeln. Und Soldatenlieder, strotzend von derben Zoten – begeistert brüllte der Grenzer den Kehrreim mit.
Unerschöpflich war er. Verse napolitanischer Strassensänger, triefend von Kot, andalusische Coplas, deren schwermütige Melodien den obszönen Inhalt noch stärker heraushoben. Matrosenlieder, die wie geile Schreie abgesperrter Affen nach Weiberfleisch brüllten, Strophen vom Montmartre, in denen Wort und Ton sich geschickt verbanden zu witzig zyninischen Spitzen –
Der Wirt verstand nur wenig, brummte still die Melodien mit, sog an seinem Glase und an der Pfeife. Aber der Gendarm wieherte vor Lachen, schlug mit der breiten Faust auf den Tisch, dass die Flaschen sprangen. Und er brüllte den Kehrreim:
»Kommt 'ne verheira-tö-te Oder 'ne andre Kröte Durch den dustern, dustern, dustern Wald – –«
Ein Glas leerte er um das andere.
Und nicht eines blieb ihm Frank Braun schuldig. Lächelnd, still, als sei es klares Wasser, goss er den Wein hinunter. Immer ein Glas auf einmal – dann griff er wieder in die Saiten.
»Ja, in Hamburg, da bin ich gewesen In Samt und in Seide gehüllt, Meine Ehre, die hab' ich verloren, Denn ich bin ja ein Mädchen für Geld!
Meine Schwester, die tut mir immer schreiben: ›Liebe Alma, o kehre doch zurück! Deine Mutter liegt sterbend im Bette, Sie beweinet dein elendes Glück.‹
Meiner Schwester, der tu ich immer schreiben: ›Liebe Schwester, ich kehre nicht zurück! Meine Ehre ist längst ja verloren, In der Heimat da blüht für mich kein Glück!‹
Ja in Hamburg, da bin ich gewesen In Samt und in Seide gehüllt! Meine Ehre, die hab' ich verloren, Denn ich bin ja ein Mädchen für Geld!«
Er sang Bordellieder. Abgestandene, sentimentale Weisen, Hurenlieder, die mit Gefühlen hausierten, wie mit Jahrmarkthonigkuchen. Und Herr Aloys Drenker schluchzte und gluckste und seufzte und nahm einen tiefen Schluck nach jedem guten Seufzer.
»Hör zu, Gendarm! Ich sing dir das Lied der hallischen Dirnen!«
»Gestern Abend in dem Sturm Ging ich um den roten Turm!«
– – Dann, wenn dem Grenzer die Wehmut hoch in den roten Hals stieg und dicke Tropfen den stieren Blick verschleierten, warf ihm Frank Braun plötzlich helle, höhnische, freche Strophen ins Gesicht.
»Mädchen mit den striffen, straffen Brüsten, Warum sollt mich nicht nach dir gelüsten? Bin so jung – – wie ein Aff! Und mein Vater war ein Pfaff!«
Da grinste Aloys Drenker, blähte sich vor Vergnügen. Er suchte mit trunkenen Augen rings herum, als stände da irgendwo eine dicke Dirne, als wolle er hintatschen mit seinen plumpen, roten Fingern auf die straffen Brüste.
»Trink, du Schwein!« rief ihm der Deutsche zu.
Der Gendarm fuhr auf. Tief blau stieg ihm das Blut ins Gesicht, zugleich vor Wut und vor Scham. Aber er traf einen ruhigen, lächelnden Blick – da duckte er sich. »Prosit!« sagte er und trank.
Frank Braun gab ihm Bescheid. Wieder und wieder. Er legte die Guitarre auf die Bank und trank.
»Noch ein paar Flaschen.« sagte er.
»Nein – es ist genug.« lallte der Gendarm.
»Genug – schon? Geh, hol Wein, Raimondi!«