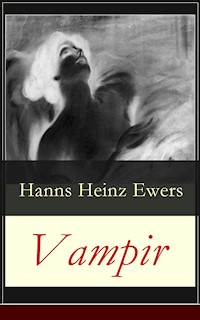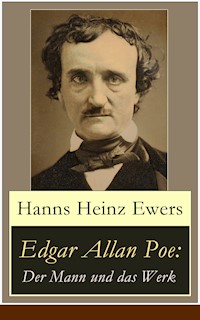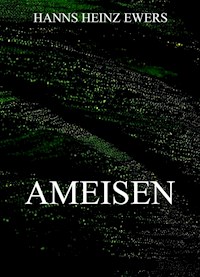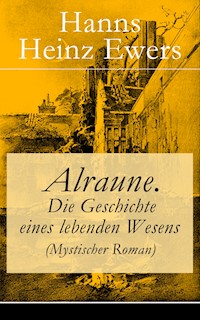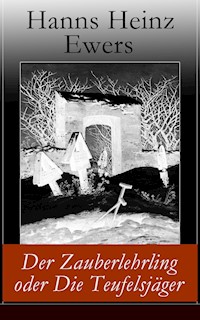Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zeit seines Lebens war Ewers gerne und ausgiebig auf Reisen. Seine Fahrten finanzierte er durch Feuilletons für verschiedene Medien, die er dann unter anderem in diesem Band zusammenfasste.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Von sieben Meeren
Fahrten und Abenteuer
Hanns Heinz Ewers
Inhalt:
Von sieben Meeren
Ich reite im Regenland.
Die verrückte Wally.
Eileen Carter.
Von Sevilla.
Ich kaufe einen Tiger in Johur.
Berlins erster Boxkampf.
Die Drei im Turm.
Ich trinke Schlangenbrühe und finde – ein süßes Wort.
Der Mann aus Düsseldorf.
Von Heiligen Kanonen.
Die Festnacht des persischen Märtyrers.
Das Hya Hya Mädchen.
Ich trinke eine Silvesterbowle.
Nachwort.
Von sieben Meeren, H. H. Ewers
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849642761
www.jazzybee-verlag.de
Von sieben Meeren
Die Namen von Ländern, Städten, Bergen, Flüssen usw. sind nach Möglichkeit so gegeben, wie sie ausgesprochen werden. Der Engländer schreibt ja nur deshalb »Singapore«, weil er dieses »pore« wie das deutsche » pur« ausspricht; es ist also gewiß in Deutsch besser »Singapur«, »Johur« usw. zu schreiben. Ebenso ist das holländische »oe«, das wie unser »u« gesprochen wird, auch »u« geschrieben, also »Jagur« (statt Jagoer) »Surakarta« (statt Soerakarta).
Natürlich gilt das nur für Wörter exotischer Sprachen; englische, französische, spanische usw. Namen habe ich in ihrer Schreibweise gelassen. Hier bilden nur die Namen eine Ausnahme, für die sich eine besondre deutsche Sprachweise seit Jahrhunderten eingeführt hat; es würde lächerlich sein, Milano, New York, Roma, Napoli zu schreiben, wenn unser Sprachgebrauch diese Städte als Mailand, Neu-York, Rom und Neapel kennt.
H. H. E.
Ich reite im Regenland.
Im Stillen Ozean, an der Salpeterküste. An Bord S. S. ›Melbourne‹. 16. VI. 19..
– – Woher kommt es, lieber Baron, daß sich plötzlich für eine Stadt, für ein ganzes Land einem ein festes Gefühl aufdrängt, das man zeitlebens in Gedanken damit verbindet? Ich schrieb Ihnen einmal darüber, vor Jahren, von Quito aus. Ich war nicht eine Viertelstunde dort, als ich fühlte: dies alles ist nicht heute – dies alles ist so, wie es vor einhundertundfünfzig Jahren war. Dieses Empfinden war so stark, daß auch ich in der Äquatorstadt umherlief als ein Mensch des achtzehnten Jahrhunderts, daß ich gar das Empfinden hatte, als müsse ich meine Briefe datieren: A. D. 1760.
Hier, in Chile, ist's anders. Schon unten in der Magelhaensstraße wuchs in mir ein Gefühl: nun wird etwas geschehn. Aber nicht jetzt – später erst. Ganz sacht, ganz leise, ganz allmählich. Doch es ist nichts Wirkliches, das geschehn soll, kann nichts Wirkliches sein, weil all dies Land und dies Meer und dieser Himmel – weil alles hier ganz unwirklich ist. Die blauen Gletscher, die ins Wasser hineinwachsen, die Bettelindianer, die im Boot ans Schiff fahren, mit Jacken bekleidet, aber ohne Hosen, Männlein wie Weiblein, die Albatrosse, die wie Enten spielen –
Doch all das, schien mir, waren nur Folgen. Wenn die Alpe ins Meer geht, wenn der beste Flieger den plumpsten Schwimmer macht, wenn Menschen, die allem Herkommen nach auf den Mustang in die Pampa gehören, als Familienwohnsitz ein Boot sich wählen, um ein armselig Feuer da herumhocken und auf ein Schiff lauern, um ihre Otterfelle gegen einen Schluck Whisky einzutauschen, so muß da etwas sein, das sie solch Unmögliches tun läßt.
Und dann, plötzlich, ist das Gefühl da: es ist der Regen. Man mag sich lange vorerzählen: das ist ja Unsinn. Was hat der Regen damit zu tun? Gar nichts!
Dennoch empfindet man: es ist der Regen. Der Regen, nichts andres. Natürlich ist es kein gewöhnlicher Regen. Nicht so ein frischer, fröhlicher Klatschregen, der kommt und wieder geht. Der nicht. Es ist ein ganz leichter, ganz dünner Sprühregen, wie ihn die zarteste Dusche mit Nadelstichlöchern nicht feiner geben könnte. Aber er fällt gestern und heute und immer und immer und zu jeder Stunde. Ganz unwirklich ist dieser Regen.
Hinauf nach Corral und in die Holzstadt Valdivia. Eine andre Dusche, größere Löcher; ein wenig wirklicher. Aber auch – immer, immer, ohne jede Unterbrechung. Es bleibt das Gefühl: es wird etwas geschehn.
Valparaiso – Sonne; dahin paßt der Regen nicht, nach Valparaiso. Ich fuhr fort noch am selben Tage, der Sonne zu entfliehn.
Das war gewiß seltsam, lieber Baron.
Denn Sie wissen ja, wie ich die Sonne liebe. In den Tropen, wenn's so heiß ist, daß der Europäer sich auflöst, wie eine Nacktschnecke, auf die Kinder Zucker gestreut haben, da erst hab ich recht wohl mich gefühlt. Dann erst konnte ich am besten arbeiten.
Ich saß im Zuge nach Santiago, ohne es recht zu wissen. Merkte jetzt erst, daß ich die Sonne floh.
Drei Tage in Santiago – Sonne, Sonne. Und der Staub, der alles fingerdick bedeckt. Aber ich blieb – blieb still in meinem Zimmer. Wartete: etwas mußte kommen.
Der Regen kam, am vierten Tage. Genau wie unten im Feuerlande, aus Nadelstichlöchern, fein, leicht, unendlich zart.
Nun fühlte ich klarer: etwas mußte kommen. Aber nicht jetzt – später. Langsam, allmählich.
Ich ging aus. Und ich sah: das ist nicht mehr Wirklichkeit. Das ist nur ein Übergang vom Wirklichen zum Unwirklichen, ist nur da, um das Seltsame, das kommen soll, wahrscheinlicher zu machen.
Durch die Straßen lief ich in feinem Sprühregen. Sehr viele Kirchen und sehr viele Klöster und ringsherum die mächtigen Häuserblocks, die den Kirchen und Klöstern gehören.
Leutnants kommen. Preußische Leutnants, genau wie sie in Berlin Unter den Linden herumlaufen. Einer singt halblaut: »Im Grunewald, im Grunewald ist Holzauktion.«
Ich weiß freilich: die chilenische Armee ist uniformiert und gedrillt nach deutschem Muster von deutschen Offizieren. Neugeordnet und festgefügt von General Körner – ich traf ihn im Klub, als ich dasletztemal hier war.
Ich weiß das natürlich. Weiß: wenn ein paar der Leutnants deutsch reden, sind es Deutschchilenen vom Süden, Söhne von Waldbesitzern, Sägemüllern, Holzhändlern – da ist der alte Schmarrn zum Nationallied geworden.
Was nutzt mir dies Wissen? Es ist dennoch ganz unwirklich, daß hier in Chile zwischen Klöstern und Kirchen preußische Leutnants die ›Holzauktion‹ singen.
Leutnants gehn zur Straßenbahn. Weiblichen Geschlechts der Schaffner. Dunkelhäutige Indianerin, Strohhut, weiße Schürze. Und natürlich die Zigarette zwischen den blanken Zähnen.
Santiago del Nuevo Estremo – schade, daß man den Namen vergaß, den Don Pedro de Valdivia dieser Stadt gab, die er gründete.
Feinster Sprühregen. Indianische Straßenbahnschaffnerinnen. Preußische Leutnants –
Ich kam am Museum vorbei, ging nicht hinein. Deutsche Gelehrte, die beiden Philippis, haben's gemacht, in strenger Lebensarbeit. Nun ist es ein echtes, rechtes Museum von Rang, bildend, belehrend und all das. Aber ich möchte, es wäre heute noch so, wie es Philippi, der Vater vorfand, als er herkam. Ein Raum voll alten Gerümpels. Zerbrochene Töpfe aus Araukanerland, spanische Radsporen aus Silber, grün seit Menschenaltern. Ein ausgestopfter Ameisenbär, dem der Schwanz fehlt; eines Gürteltieres zerbrochener Riesenpanzer; ein paar Rebhühner, längst federlos. Das Modell einer Dampfmaschine mit zerbrochenen Rädern; eine Schmetterlingssammlung, von den Ameisen zerfressen. Und alles dick verklebt von der Jahre Staub und dennoch – so alle zehn Monate einmal – dem einsamen Besucher ehrfürchtig gezeigt von dem uralten Kustos: »Museo Nacional.« So sollte es heute noch sein – und der feine Sprühregen draußen!
Nicht Wissenschaft. Aber ein Gedicht.
###
Wir ritten hinaus nach einem Städtchen – ich vergaß den Namen. Es war ein großer Festtag – und ich weiß nicht, welcher. Flaggen durch die Gassen, die hübschen Damitas an den Fenstern. Gauchos ritten durch – riesige Rundhüte und die Sporenräder kaum kleiner – in bunten Ponchos. In den Zelten überall Tanzmusik; stets ein Klavier, auf dem ein altes Indianerweib herumtrommelt, während ein andres auf einem Xylophon hackt und ein drittes ein seltsames Krächzen von sich gibt. Die Cueca tanzen sie, ernst, melancholisch, wie der Regen, der immer und immer sprüht. Sie schwingen ihr Taschentuch, jeder Bursch und jedes Mädel – laufen umeinander herum. Dann kauft er zwei Glas Bier – Anwandter-Bier aus Valdivia – am Schenktisch, reicht ihr eins. Sie nimmt es, leert es, gibt es zurück, ohne ein Wort, ohne einen Blick. Und tanzen wieder. Sie sind sehr ernst und sehr feierlich, die Indianerkinder.
Aber sie tanzen und trinken und trinken und tanzen den ganzen Tag durch und die ganze Nacht. Dann endlich kocht es in den Adern dieser seltsamen Puppen. Kein Blut freilich – Alkohol nur. Nun schrein sie, greifen zu den Navajas.
Ich saß mit den Leutnants da, spielte ›Siebeneinhalb‹. Ein greuliches Spiel. Aber der alte chilenische Wein war sehr gut. Urmeneta heißt er.
###
Zum Abend ging ich hinaus in den Regen. Wollte eigentlich nach den Pferden sehn, hatte so ein Gefühl: etwas wartet auf mich in Santiago. Ich strich durch die Avenida, ganz langsam, barhäuptig: genoß mit unsäglichem Entzücken diesen feinen Regen. Ich dachte: ›Jetzt mußt du in das dritte Tanzzelt gehn. Oder nein doch – in das nächste. Oder wieder in das nächste: etwas ist da, das auf dich wartet.‹
Ich trat in das Zelt. Klavier, Holzbrettchen, Krächzen – drei Indianerweiber. Und die Zamacueca – taschentuchschwingende Paare, todernst. An einem Tische saß eine Gesellschaft, Kavaliere aus Santiago mit ihren Damen. Sie stritten; es war besonders eine Damita, die erregt schien. Ich konnte ihr Gesicht nicht sehn, da sie mir den Rücken kehrte. Die andern versuchten sie zu beruhigen, aber diese Schlanke wollte nicht hören. Sie sprach reinstes Kastilianisch, ohne den kleinsten kolonialen Klang. Sie habe genug, rief sie, und sie gehe nun, gehe gleich, gehe sofort –
Sie stand auf, kam durch die Menge. Einen Augenblick drauf stand sie vor mir; ich trat zur Seite, um ihr den Ausgang zur Straße frei zu machen. Von dem Tische hörte ich einen der Herrn seinem Freunde zurufen: »Bleib nur, Alfonso; kein Mensch mag Dolores halten, wenn sie fort will!«
Sie schritt an mir vorbei, und ich sah sie gut. Sie war doch Chilenin, trotz ihrer Sprache von Madrid. Hochmütig in Gang und Blick: gewiß eine Señora. Irgendeines Großgrundbesitzers Tochter.
Draußen im Regen blieb sie stehn, unschlüssig. Wandte sich, blickte mich an. Kam zurück, deutete auf die Gerte, die ich in der Hand hielt:
»Caballero,« fragte sie, »haben Sie ein Pferd da?«
Ich nickte. »Wo steht es?« fragte sie. »Leiht es mir: ich will zurück nach Santiago.«
Ich nickte wieder, reichte ihr die Gerte. Schweigend schritten wir über die Gassen. Sie hüllte den Kopf eng in ihr Tuch.
Ich zog mein Pferd aus dem Stall, hob sie hinauf. Rittlings saß sie.
Dann, ein zweitesmal, traf mich ihr Blick. Sehr langsam sprach sie: »Im Hotel Oddo? Nicht wahr, Caballero?«
Wieder nickte ich. Natürlich sah sie, daß ich ein Fremder war. Und wo hätte ich sonst wohnen sollen?
Dann schwang sie die Gerte, warf den Gaul in Galopp. Jagte durch den Regen.
Ich empfand garnicht das Komische. Diese schlanke Frau – im englischen Ledersattel im Herrnsitz. Stöckelschuhe, dünne, seidene Strümpfchen, die Röcke hochgestreift, ein Stückchen weißes Fleisch über den Knien. Zierliche Spitzenhöschen –
Aber ich lächelte nicht einmal. So unwirklich war das alles. Wann ritt je eine chilenische Dame so nach Santiago hinein?
Mein Pferd war ich los. Mußte mit der Bahn fahren. Eine halbe Stunde nur; aber eingepfercht zwischen Menschenleibern, daß man kein Glied mehr rühren konnte. Und die Nase büßte für der Augen Dummheiten.
###
Eine Woche lang hörte ich nichts von der schönen Frau. Auch mein Pferd sah ich nicht wieder. Ich lief durch den Regen die Tage lang. Man sollte glauben, ganz Santiago sei in tiefer Trauer: alle Damen in schwarzem Schleier oder schwarzem Manton. Ich schaute nach jeder und lief vielen nach in viele Kirchen und Kapellen. Aber ich fand sie nicht.
###
Dann gab mir der Portier ein Briefchen. Ich las: »Caballero! Lota, Parque Cousiño. Mittwoch, nachmittags sechs Uhr.«
Ein »D« darunter.
###
Mittwoch – das war noch Tage hin. Ich fuhr nach Concepcion, fuhr dann nach Lota. Und dieser feine, wunderbare Regen begleitete mich. Ich wartete auf diesen Mittwoch – und dies Warten empfand ich unendlich süß. Ich hätte wochenlang so warten mögen.
Dann war ich in dem herrlichen Park; keinen schönern kenn ich in Südamerika. Im Regen, wie immer, und ganz allein. Ich schritt durch die Wege, weiter und weiter. Ich suchte sie nicht. Es war mir, als ob dieses Wandeln im Regen schon höchste Erfüllung sei.
Die Dämmerung kam. Langsam ging ich weiter. Steinbilder zwischen dem Laub – aber nicht ein Laut. Allein, in tiefster Einsamkeit war ich.
Da wuchs vor mir ein mächtiges Haus – ein Schloß fast. Ein großer Garten ringsum, mitten im Park. Aber nirgends ein Licht in den Fenstern.
Ich suchte ein Tor im Gitter, fand es verschlossen. Doch keine Schelle; so mußte ich hinüberklettern. Und ich sah bald, als ich zum Hause kam: unbewohnt war es. Überall Holzplanken vor den untern Teilen der Türen und Fenster.
Rings um das große Haus ging ich – dachte: irgendwo mußt du hineinkommen. Ich sah ein Fenster, das lose schien. Riß die Planken ab, stieß es auf, stieg hinein. Völlig leer war das Zimmer.
Ich mußte mich eilen, ehe es allzu dunkel wurde. Weit offen standen alle Türen; ich lief durch die Räume, oben und unten. Nichts. Ein altes Sofa in einem Zimmer; der Brokat hing in Fetzen herunter. Ein paar dreibeinige Stühle in einem andern; dann wieder ein riesiger, schwarzer Eichentisch. Zum Dach stieg ich hinauf und hinab zum Keller.
Nichts. Leer, öde, still. Nur mein eigner Schritt hallte in den weiten Räumen. Und ich fühlte wohl: niemand war hier durchgegangen in langen Jahren.
Nun war es dunkel. Ich mußte Streichhölzchen anzünden, um mich zurechtzufinden. Fand endlich mein Fenster, sprang in den Garten.
So schwarz war es ringsum, daß ich nichts mehr sah. Doch wußte ich: ich muß herum um das öde Haus, um das Gittertor wiederzufinden.
Da sah ich, hinten, ein Licht. Ich ging darauf zu, fand mich nun zurecht. Das Licht mußte grade beim Tore brennen. Und ich hörte von dorther das ungeduldige Wiehern eines Pferdes.
Weit offen stand das Tor. Dabei, angehalftert am Gitter, mein Pferd. Eine Pechfackel, rot schwälend, stak in einem Eisenring an dem Steinpfeiler.
Ich riß die Fackel hoch – kein lebend Wesen war da. Nur ich – und meine Stute. Sie schnupperte, erkannte mich, schob die Schnauze liebkosend über meine Schulter. Ich löste die Halfter, griff den Sattelriemen. Da hing am Steigbügel ein großer Strauß tiefblauer Veilchen. Angebunden mit einem Spitzentüchlein. Und ich las den Buchstaben »D«.
Die Stute kannte die Wege im weiten Parque Cousiño. In langsamem Schritte ging sie, trug mich hindurch. Die Zügel lagen ihr lose auf der Mähne. Mit beiden Händen hob ich den Veilchenstrauß. Trank den Duft dieser großen, blauen Veilchen. Ritt durch den feinen, süßen Regen. Der Regen sang: »Dolores, Dolores –«
Und das war es: ich war garnicht enttäuscht. So mußte es sein, und so war es viel schöner als irgend etwas, das hätte geschehn mögen zwischen mir und dieser Frau.
Nein, nein, nichts Wirkliches durfte geschehn. Nichts, nichts durfte den Zauber zerreißen, diesen süßen Zauber des Unwirklichen, den der Regen spann.
Im Chinesischen Meer. An Bord D. S. ›Prinz Waldemar‹. 14. III. 19..
Sie hieß garnicht ›Wally‹. War vielmehr, mit Deinhardt-Cabinet, auf den ehrlichen Namen ›Prinz Waldemar‹ getauft, einer der Dampfer der Prinzenklasse des Bremer Lloyd. Aber kein Deutscher in der Südsee, von Sydney hinauf bis Yokohama, nannte sie anders als die ›Verrückte Wally‹. ›Loose Screw Wally‹ hieß sie bei den Engländern, und alles, was Pidgin sprach, Chinesen, Malaien, Papuas, kannten sie nur als ›Wally belong mad‹! Der Agent oben in Brisbane, der mir die Fahrkarte ausschrieb, meinte: »Schon recht – Sie haben grade noch gefehlt an Bord!«
»Was ist's mit ihr?« fragte ich.
Der Mann zuckte die Achseln. »Das Schiff hat noch keine Fahrt gemacht, ohne daß was Besondres vorgefallen wäre. Was andre Schiffe in zehn Jahren nicht erleben – das macht die Wally auf jeder Reise. Sie ist eben übergeschnappt – die Wally – und alles, was auf ihr fährt, nicht weniger.«
Ich ging abends an Bord. Der Erste Offizier zählte grade seine Chinesen durch; er brüllte und fluchte dabei. Ich wartete geduldig, bis er fertig war, fragte ihn dann, wo er mich unterbringen wolle. Er rief einen der bezopften Stewards heran.
»Der Kerl soll Sie führen,« sagte er. »Haun Sie ihm nur gleich eine runter, wenn Sie gut bedient sein wollen. Übrigens können Sie sich die Kabine aussuchen, die Ihnen am besten gefällt; meinetwegen können Sie auch alle belegen! Es wird sonst doch niemand mitfahren auf diesem verdammten Schiff!«
»Sind Sie auch verrückt?« fragte ich höflich.
»Noch nicht!« lachte er grimmig. »Aber ich werde es sicher werden. Wenn ich noch zwei, drei Reisen lang mich mit den Zitronenniggern rumärgern muß – bin ich genau so verdreht wie alles andre an Bord!«
Er stellte sich vor, Venediger hieß er. Er war ein breitschultriger, sehr kräftiger Mann, blond, bartlos, blauäugig. Sicher ein gutmutiger Geselle, wenn er auch seine Chinesen am liebsten höchst eigenhändig zu Mus zerhackt hätte. Na, das kann man ihm weiter nicht übelnehmen: sie kosteten ihm jährlich nicht nur sein ganzes Gehalt, sondern darüber hinaus noch eine schwere Stange Goldes.
»Wenn's so weitergeht,« seufzte er, »kann ich ein eisgrauer Kapitän werden, ehe ich dem Lloyd meine Schuld abgezahlt habe.«
So kam das. Die ›Wally‹, wie alle Schiffe, die in der Südsee kreuzen, hatte Malaien für die Schiffsmannschaft, aber Chinesen für die Maschine, auch als Köche und Stewards – und diese Chinesen waren alle verdammte Durchbrenner. Nun hat die australische Regierung ein sehr scharfes Gesetz gegen die gelbe Einwanderung. Jeder Dampfer muß bei Ankunft und bei Abfahrt die Schiffsliste vorlegen: wieviel Chinesen an Bord? Sie werden sorgsam gezählt, fehlt einer, so wird die Schiffahrtslinie haftbar gemacht und in Strafe genommen: hundert Pfund für jeden Ausreißer. Die Linie aber hält sich wieder an den Ersten Offizier – der ist verantwortlich! Und er kann aufpassen, wie er will: kaum eine Fahrt vergeht, ohne daß ihm einer durchgeht.
»Sieben in fünfzehn Monaten!« fluchte Venediger, »Siebenhundert Pfund – wie soll ich das je bezahlen können?«
So ist der Haß groß und sehr gegenseitig auf allen Schiffen: die Chinesen hassen ihre scharfen Aufpasser, und die hassen sie ebenso gründlich.
###
Es war doch ein Passagier an Bord, ein Pflanzer aus Petershafen. Er gab mir gleich beim Nachtmahl die Quintessenz seiner Lebensweisheit: wenn man sich vor Fieber bewahren wolle, müsse man stets wenigstens vier Zoll hoch Whisky im Magen haben. Er handelte danach – nur war sein Zollmaß meist beträchtlich höher.
Dann war der rothaarige Kapitän da – von dem habe ich nie ein andres Wort gehört als: »Een, twee, dree – hei lucht!« Und dabei goß er einen großen Schnaps herunter, der den schönen Namen ›Magerfleisch‹ führte, und von dem er behauptete, daß sich aller Whisky der Welt dahinter verstecken müsse. Er hatte auch einen großen Haß – gegen den Ersten Ingenieur; aber das ist nun mal alte Tradition auf allen guten Schiffen überall in der Welt, daß Brücke und Maschine einander nicht riechen können. Übrigens war der Erste Ingenieur nicht weniger durchgedreht; in seinen Freistunden beschäftigte er sich ausschließlich mit Laubsägearbeiten. Dazu sang er mit heller Tenorstimme Choräle. Immer dieselben. Zuerst: ›In dulci jubilo‹. Dann: ›Die Himmel rühmen!‹ Und endlich: ›Befiehl du deine Wege‹. Diesen letzten Choral brüllte Venediger regelmäßig mit, so dröhnend, daß es vom Bug bis zum Heck schallte;
»Befiehl du deine Wege Und was dein Herze kränkt, Der allertreusten Pflege Des, der den Himmel lenkt!«
Nur machte Venediger stets eine kleine Variante: statt ›Himmel lenkt‹ sang er ›Kasten lenkt‹ oder ›Dampfer lenkt‹ oder ›Wally lenkt‹ oder was ihm grade einfiel. Dann grinste der Kapitän; aber der Erste Ingenieur sah ihn giftig an.
Ferner waren an weißen Menschen vorhanden: der Zweite und der Dritte Offizier, noch zwei Ingenieure, der Schiffsarzt, der Zahlmeister und die Stewardess. Der Zweite Offizier war ein harmloser Bursche, der sich im Daumendrehn übte und die fixe Idee hatte, daß er wieder ein durchaus vernünftiger Mensch werden würde, sowie er nur erstmal nach Bremen zurückkehrte. Der Dritte besaß ein Dutzend schwerer Hanteln, mit denen er in der glühendsten Tropenhitze herumarbeitete; er wurde von allen als völlig hoffnungslos tief bemitleidet. Der Zahlmeister, ein uckermärkischer Baron, nach manchen Fehlschlägen beim Lloyd angekommen, saß in seiner Kabine und addierte drauf los – immer falsch und immer falsch. Verzweifelt wandte er sich an jeden, ihm doch zu helfen – aber solche Hilfe wurde stets grinsend abgelehnt.
Der Zweite Ingenieur schnitzte Holzfiguren; er war äußerst unbeliebt an Bord, weil er die reizende Angewohnheit hatte, abgebrannte Streichhölzer wieder sorgsam in die Schachtel zurückzutun. Er hielt das für einen ganz ausgezeichneten Witz und freute sich, wenn jemand eines seiner abgebrannten erwischte und wütend damit die Reibfläche bearbeitete. Der Dritte Ingenieur hieß Christian Fürchtegott Tittenfroh – schon der Name allein berechtigte ihn zu einem Ehrenplatz auf der ›Wally‹ und machte ihn äußerst begehrt. Er übte sich im Tischrücken, zu dem auch zuweilen der Zahlmeister und die Stewardess hinzugezogen wurden; außerdem besaß er das schöne Planetentabellenbuch ›Ephemeriden‹ und stellte danach mit Leidenschaft Horoskope. Dem Kapitän allein hatte er schon sechsmal das Horoskop gestellt, und diese sechs Horoskope waren in jedem Punkte völlig voneinander verschieden und stimmten nur darin überein, daß sie mit dem Verlaufe des wirklichen Lebens des Kapitäns auch nicht die allergeringste Ähnlichkeit hatten. Sein Chef, der Erste Ingenieur, mochte ihn nicht leiden, weil er fortwährend was versaute in der Maschine; aber der Kapitän schätzte ihn um so mehr, eben weil er Christian Fürchtegott Tittenfroh hieß. Deshalb – und aus dem Grunde, weil Christian überzeugter Temperenzler war, lud er ihn sogar manchmal zu ein paar ›Magerfleisch‹ ein, die der Arme mit zugekniffenen Augen pflichtschuldigst herunterschlucken mußte.
Immerhin: all diese Menschen hatten wenigstens zwölf Stunden am Tage tüchtige Arbeit – der Arzt aber und die Stewardess hatten gar nichts zu tun.
Der Arzt war ein großer, bildhübscher Mann, mit weichem, blondem Schnurrbart. Ein Münchener, der fünfzehn Jahre in Erlangen studiert, dann doch sein Examen gemacht hatte – seither schwamm er als Schiffsdoktor zwischen Melbourne und Yokohama. Was er gelernt, hatte er längst wieder vergessen; er kannte nur zwei Mittel: Chinin gegen Fieber und Rizinusöl gegen alles andre. Er saß den ganzen Tag und die halbe Nacht über im Rauchzimmer, trank Bier und rauchte lange Pfeifen dazu.Er machte es wie die Nigger in Alabama: »When it's nice an' cool, I sets an' thinks, an' when it's hot, I jest sets.«
Aber es war halt immer heiß da, wo die ›Wally‹ herumschwamm!
Und die Stewardess: eine verarmte Gräfin und alte Jungfer dazu. Aus Scham, ihre Armut in der Heimat zur Schau zu tragen, hatte sie sich beim Lloyd gemeldet und war aus Gnade angenommen worden. Seit Jahren kreuzte sie nun in der Südsee. Wenn einmal ein weiblicher Passagier an Bord war – aber welcher Pflanzer ließ seine Frau auf der ›Wally‹ fahren? –, wurde sie dennoch kaum in Anspruch genommen: man konnte sich doch nicht gut von einer Dame bedienen lassen und von einer Gräfin dazu! So hatte sie überhaupt nichts zu tun – aus reiner Gutmütigkeit ließen sich die Offiziere von ihr die Wäsche waschen und die Socken flicken, obwohl das die chinesischen Stewards weit besser machten. Abends hockte sie mit dem Zahlmeister zusammen – dann lasen die beiden im ›Gotha‹, die Stewardess wußte ganze Bogen davon auswendig. Manchmal ließ sie der Kapitän ins Rauchzimmer kommen, dann mußte sie ihm aufsagen. Er hörte tiefernst eine halbe Stunde lang zu, dann meinte er: »Een, twee, dree – hei lucht!« knallte die Männerfaust auf den Tisch und trank einen ›Magerfleisch‹.
###
Die erste Freude hatten wir schon im Korallenmeer. Nichts Besondres, nur so ein kleiner ›Brandenburger‹, ein netter Brand in der Maschine. Der Kapitän grinste vor Vergnügen – na, natürlich, mit solchem Ingenieur! Er war ordentlich betrübt, als nach ein paar Stunden alles wieder in Ordnung war. Tags drauf, so bei der Dianabank, liefen wir plötzlich rückwärts – auf ein Haar wären wir aufgelaufen. Der Kapitän behauptete, daß da nie ein Riff gewesen wäre; der Erste Ingenieur meinte, daß es immer da gewesen sei – aber natürlich, mit solchen Leuten auf der Brücke! In der Göschenstraße setzte ein braves Wetter auf, und die ›Wally‹ rollte und schlingerte nach Herzenslust. Der Doktor fragte höflich, ob ich vielleicht Anzeichen von Seekrankheit verspüre. Er bot mir dafür Chinin oder Rizinusöl an – ganz nach meinem Belieben.
An diesem Abend saß ich mit dem Kapitän im Rauchzimmer, als der Zweite Ingenieur eintrat. Er schleppte eine fast dreimeterhohe Figur herein, die er in seiner Freizeit aus Affenbrotbaumholz geschnitzt hatte. Ein weibliches Wesen im Renaissancegewand, hohes Mieder und lange Zöpfe, alles bunt bemalt, augenscheinlich nach einer süßen Gretchenansichtspostkarte gearbeitet. In der einen Hand hielt sie eine Kunkel, in der andern eine Spindel.
Wir bewunderten seine Kunst; dann bat er mich, ihm behilflich zu sein. Ich kenne doch den Generaldirektor des Lloyd, meinte er: bei dem möge ich vorstellig werden, daß man sein Holzmädchen ankaufe und als Galleonsfigur am Bug unsres Schiffes anbringe.
»Das Schiff heißt doch ›Waldemar‹«, wandte ich ein, »oder meinetwegen ›Wally‹. Aber doch nicht Gretchen!«
»Es soll auch gar kein Gretchen sein«, erwiderte er ganz ernsthaft. »Wir malen drunter: ›Die schöne Spinnerin‹! Darum hat sie ja die Kunkel!«
Ich begriff ihn nicht. »Spinnerin?« fragte ich. »Wenn wir noch wenigstens Wolle als Fracht hätten! Aber wir haben doch nur Kopra und Trepang.«
Er schüttelte den Kopf über so viel Unverständnis. »Wally, die schöne Spinnerin!« wiederholte er melancholisch. »Sie spinnt doch! Alles spinnt an Bord!«
Der Kapitän hämmerte die Faust auf den Tisch. »Een – twee – dree – hei lucht!« rief er. Kippte seinen ›Magerfleisch‹ und schenkte sich einen neuen ein.
###
In Matupi war Erdbeben, als wir vor Anker lagen; da ist immer Erdbeben, wenn die ›Wally‹ ankommt. Wir bekamen einen alten Kasuar an Bord und einen jungen englischen Methodistenmissionar – der Herr Venediger sah beide sehr scheel an.
»Man weiß nicht, was mehr Unglück bringt,« brummte er, »Kasuare oder Missionare!«
»Vielleicht heben sie sich gegenseitig auf,« tröstete ich.
Aber der Erste wollte nichts davon wissen – es gibt Dinge in der christlichen Seefahrt, über die man nicht spotten soll.
Natürlich behielt er recht: schon am Abend brach der Kasuar in des Zahlmeisters Kabine ein. Der erwischte ihn, als er grade die mühsam aufaddierten Seiten aufgefressen hatte, versuchte ihn mit kräftigen Fußtritten zu vertreiben. Das nahm wieder der Kasuar sehr krumm; er zerriß die zahlmeisterliche Hose und hackte ihm ein paar Löcher, daß der arme Kerl sich bis Yokohama nicht mehr setzen konnte. Der Doktor bot ihm Chinin an – aber schließlich erbarmte sich die Stewardess seiner und verband das beschädigte Hinterteil.
Der Zahlmeister wollte sich rächen an dem Kasuar, aber der Erste Offizier legte sich ins Mittel. Das wäre ja noch schöner! donnerte er. Der alte Kasuar sei Fracht, und alle Fracht sei ihm heilig, und er trage dafür der Gesellschaft gegenüber die Verantwortung!
Das war gesprochen wie ein Mann, und alle waren auf seiner Seite – Brücke und Maschine hielten plötzlich zusammen gegen den armen Zahlmeister. Aber der englische Missionar, den der Kapitän mit ›Magerfleischen‹ aufgeputscht hatte, fand das so komisch, daß er draufloswieherte und aus seinem Lachanfall gar nicht mehr herauskommen konnte.
Und da geschah etwas Schreckliches.
Der junge Missionar hatte nämlich keine Zähne mehr. Kein Mensch wußte, wie er sie verloren hatte; man munkelte, daß sie ihm ein alter Kanake auf Buka herausgeschlagen habe, dem das Methodistenchristentum ein Greuel war, weil er bei der amerikanischen Konkurrenz die Herrlichkeiten des Baptistenchristentums kennengelernt hatte. Wie dem immer war, der Missionar hatte keinen eignen Zahn mehr im Munde; dafür aber hatte ihm auf Kosten seiner Religionsgemeinschaft der beste Zahnarzt in Sydney ein wundervolles Gebiß gefertigt.
Und dies Gebiß, dies herrliche, blendend weiße Prachtgebiß verschluckte bei seinem Lachanfall der unglückselige Methodistenjüngling!
Es war ein Jammer zu schaun!
Nun aber nahte des Schiffdoktors große Stunde! Keinen Augenblick war dieser Mann der Wissenschaft im Zweifel, was hier zu tun sei: ohne mit der Wimper zu zucken, verwarf er das Chinin und griff zum Rizinusöl. Einen Löffel – noch einen Löffel – fünf Löffel – es war unglaublich, wieviel er in den zahnlosen Missionarsrachen hineingoß. Alle schauten der Kur mit großem Interesse zu; lieblich lächelnd stimmte der Erste Ingenieur dazu seinen Choral an:
»Befiehl du deine Wege Und was dein Herze kränkt, Der allertreusten Pflege Des, der – –«
Der dumpfe Baß Venedigers unterbrach ihn:
»Der allertreusten Pflege Des, der Rizinus schenkt!«
Der arme Missionar hatte eine entsetzliche Nacht. Laufen – laufen – laufen – ich glaube, er hat einen Rekord aufgestellt!
Aber die Kur des Doktors war ein voller, großartiger Erfolg. Am andern Morgen saß der Missionar wieder beim Frühstückstisch, bleich, aber gefaßt. Der Ausreißer war wiedereingefangen, saß wieder da, wohin er gehörte, und tat seine Pflicht – mit hörbarem Eifer zerkaute das englische Prachtgebiß Toast und Ham and Eggs und Kippered Herrings und Mutton-Chops! Ja, man hat schon seinen Hunger in der Südsee, wenn man fünf Jahre lang bei Konservennahrung den Menschenfressern Christentum gepredigt hat! Da sieht man leicht weg über kleine ästhetische Bedenken – wo in aller Welt hätte der Ärmste auch ein ander Gebiß hernehmen sollen mitten im Bismarckarchipel?
###
Dann hörten wir, daß Herr Vahlen vermißt würde, seit ein paar Monaten schon; auf seinem Schoner war er losgefahren, um Kopra von seinen Inseln zu holen, und war seither nicht zurückgekehrt. Der Herr Vahlen war ein Fürst in der Südsee und der größte Verschiffer des Lloyd – so beschloß der Kapitän, ihn zu suchen. Wir fuhren zu den Admiralitätsinseln und klapperten sie ab, eine nach der andern; das nahm uns eine gute Woche. Aber wir fanden ihn nicht, bis wir zu der Insel kamen, auf der er wohnte – da begrüßte uns der Pflanzer, der grade zurückgekommen war. Es wurde ein Fest gefeiert – ein sehr feuchtes Fest.
In dieser Nacht versuchte die ›Wally‹ sich selbständig zu machen. Wir waren alle an Land und tranken in Herrn Vahlens Inselburg auf das Wohl der christlichen Seefahrt, als aus klarstem Sternenhimmel plötzlich ein wüster Sturm aufsetzte. In wenigen Minuten war es stockfinster – und weißgott, es kann blasen in der Südsee! Die Ankerkette riß wie ein Bindfaden, und die ›Wally‹ machte sich sofort auf die Reise. Wir schossen Leuchtraketen ab, konnten sehn, wie sie sich schleunigst entfernte; der Dritte Offizier behauptete, daß sie höhnisch dabei gegrinst habe.
Doch am nächsten Morgen war sie wieder da, Venediger und der Erste Ingenieur, die an Bord geblieben waren, hatten die Hände nicht in den Schoß gelegt und hatten die verrückte Bestie wieder zahm bekommen. Nur der Anker mit der Kette war verloren. Und natürlich die Vahlensche Kopraladung, die eben an Deck gebracht worden war. Aber die war, gottseidank, versichert.
»Wie haben Sie das bloß gemacht, Mann?« fragte ich den Ersten Offizier.
»Wir haben Choräle gesungen!« erwiderte er. »Das ist das einzige, was auf die ›Wally‹ Eindruck macht.«
###
Wir mußten Zeit nachholen und setzten Dampf auf. Alles ging gut – bis zu dem Tage, an dem wir Manila anlaufen sollten. Früh vier Uhr war's, als der Erste in meine Kabine brach.
»Aufstehn!« brüllte er. »Aufstehn!«
»Was gibt's!« rief ich schlaftrunken.
»Kommen Sie!« schäumte er. »Ich will Ihnen was Feines zeigen! Sie können eine Geschichte draus machen und Geld damit verdienen – ich hab die Schererei davon!«
Er zog mich an Deck – da hingen, dicht nebeneinander, sechzehn Chinesen an der Raa.
»Ein netter Christbaum!« fauchte Venediger. »Sechzehn mausetote Kwantungbengels!«
»Ist mein Steward auch dabei?« erkundigte ich mich teilnahmsvoll. »Man kann sie so schwer unterscheiden.«
»Sicher nicht,« entschied der Erste. »Der lauert auf sein Trinkgeld! Sonst hinge er auch da in Reih und Glied.«
»Aber was ist denn geschehn?« fragte ich. »Welche Ursache hatten die Leute zu dem scheußlichen Massenselbstmord?«
Der Erste lachte grimmig auf: »Das begreifen Sie nicht? Der Tod ist doch nichts für die gelben Halunken! Im Augenblick ihres Todes, glauben sie, fährt ihre Seele in den Leib eines in eben dem Augenblick geborenen Kindes. Jetzt sind sie jämmerliche Kulis, die ein Hundeleben haben – im nächsten Moment aber leben sie vielleicht in dem Leib eines reichen Mandarinenkindes. Schlechter werden sie's im nächsten Leben kaum treffen, möglicherweise aber viel besser. Und obendrein haben sie die unerhörte Genugtuung, mich mächtig zu ärgern – das ist doch Grund genug!«
»Sie zu ärgern?« rief ich. »Wieso denn?«
»Mensch, sind Sie schwerfällig!« fuhr der Erste fort. »Jeder einzelne von ihnen heuert doch nur an, um vielleicht in Australien auskneifen und dort viel Geld verdienen zu können. Daran habe ich sie verhindert, einige schon seit Jahren. Die Hiebe und Fußtritte nehmen sie mir nicht weiter übel – aber sie hassen mich, weil ich so verdammt scharf aufpasse. Oh, sie wissen ganz genau Bescheid! Warum haben sie sich nicht vor acht Tagen aufgehängt? Dann hätte kein Hahn danach gekräht; wir hätten sie hübsch ins Meer versenkt. Aber sie wollen nicht ins Meer versenkt werden, wollen in China begraben sein. Sie werden sehn, daß sie all ihr Geld den Kameraden gegeben haben – die sorgen dafür, daß sie, sanft in Honig gebettet, von Manila aus mit einer Dschunke nach Kanton geschifft werden. Und dann wissen die Zitronennigger: Manila ist amerikanisch – da hab ich endlose Scherereien wegen dieser dummen Geschichte! Ich sag Ihnen, nur der Missionar ist schuld an dieser lausigen Schweinerei!«
Cannes, im Mai 19..
– – Und wollen Sie, lieber Baron, nicht vergessen, daß dies alles im zwanzigsten Jahrhundert geschah und in den U. S. A., dem modernsten Lande der Welt!
Nun, denke ich, bin ich endlich fertig mit dieser Frau. Nie wird etwas sein zwischen ihr und mir, das weiß ich seit vielen Jahren nun. Nur: manchmal vergaß ich es, träumte herum, dachte: einmal wird sie dennoch kommen.
Nie wird sie kommen. Sie, Eileen Carter, aus Woonsocket, Rhode-Island, Phil Carters einzige Tochter, die den ekelhaften Barett S. Rogers zum Manne nahm. Sich von ihm scheiden ließ, später Klaus Steckels aus Chikago heiratete mit all seinen Zuckermillionen. Eileen, die nach Steckels' Tode nicht lange Witwe blieb, sie, die heute Lady Brougham heißt, Marchioness von Atwood. Nie wird sie zu mir kommen – und wenn die Hölle zufriert, Eileen wird nicht kommen.
###
Ich spielte Poker gestern nacht und verlor. Warum spielte ich? Seit manchen Jahren habe ich keine Karte angerührt. Warum bin ich überhaupt in Cannes? Cannes ist mir zuwider, wie die ganze Riviera mitsamt ihrem Publikum. Und was das Pokern anbetrifft, so mache ich mir nicht mehr viel draus. Dennoch bin ich in Cannes, dennoch saß ich am Pokertisch gestern nacht.
Das Spiel langweilte mich, ich spielte unaufmerksam und verlor natürlich. Blieb am Tisch nur der Gesellschaft wegen, konnte nicht recht aufbrechen, weil einer fehlte. Dann kam der lange Brockdorff ins Spielzimmer, stellte sich hinter mich.
»Gib deine Karten!« sagte er nach einer Weile. »Du machst doch nur Unsinn heute – die Dame da bringt dir Pech!«
»Welche Dame?« fragte ich, suchte in meinen Karten.
»Da wirst du sie nicht finden!« lachte Brockdorff. »Schau hinüber in den Spiegel – die Dame dort, die dich anstarrt.«
Unser Tisch stand in der Ecke, ich saß mit dem Rücken zum Zimmer; um in den Spiegel zu sehn, mußte ich mich zurückbiegen. Nur ein Tisch im Saal war noch besetzt, da saßen englische Herrschaften beim Bridge. Zwei Herrn und zwei Damen; ein weiteres Paar stand daneben. Während der Herr mit den Spielern plauderte, starrte die Dame ganz offensichtlich zu unserm Tisch herüber.
»Na, kennst du sie?« fragte Brockdorff.
»Ich weiß nicht,« zauderte ich. »Vielleicht –«
Aber die Karte zitterte in meiner Hand. Ich stand auf, rechnete ab, gab meinen Platz an Brockdorff. Während ich mich verabschiedete, ging auch das Paar aus dem Spielsaal, die Dame mit einem letzten langen Blick, der ganz augenscheinlich mir galt.
Ich schritt ihnen nach. Völlig war ich meiner Sache nicht sicher, ob ich gleich drauf gewettet hätte, daß es Eileen war. Die beiden gingen durch die Halle zur Kleiderabgabe; dort erreichte ich sie, konnte sie in nächster Nähe betrachten.
Sie trug ein Stilkleid – mauve mit silber. Rotblond die gelockten Haare und die großen Augen wie Amethysten so blau. Solch irische Augen konnte nur eine haben: Eileen Carter. Ihr Begleiter legte ihr den Chinchillamantel um die Schultern; da wandte sie sich, sah mich voll an.
Ich hob den Arm, ihr die Hand zu geben; meine Lippen formten ihren Namen. Aber ich sprach nichts, und die Rechte fiel wieder zurück. Sie stand vor mir, unbeweglich, hielt meinen Blick, Auge in Auge. Eine halbe Minute wohl, während der Herr Stock und Hut in Empfang nahm und die Kleiderfrau bezahlte. Dann wandte sie sich, nahm seinen Arm, schritt an mir vorbei.
Ich stutzte – hatte ich mich doch geirrt? Ich hörte, wie sie zu ihrem Begleiter sprach: sie wolle doch nicht mehr in den Park gehn; fühle sich müde, wolle in ihr Zimmer. Ihr Englisch hatte ganz ausgesprochen einen amerikanischen, neuengländischen Akzent.
Der Hoteldirektor kam vorbei, begrüßte mich. Ich hielt ihn fest, fragte ihn, wer die Herrschaften seien.
»Die da?« antwortete er. »Earl Brougham ist es, Marquess of Atwood. Seit langen Jahren kommt er her mit seiner Mutter – diesmal hat er auch seine Frau mitgebracht. Kürzlich erst verheiratet. Haben acht Zimmer – Sekretär, Kammerzofen, Chauffeur. Bestes vom Besten!«