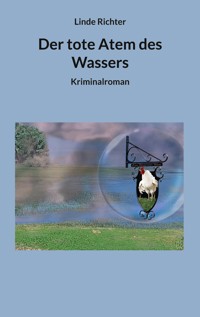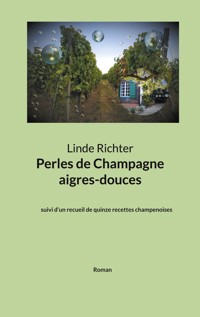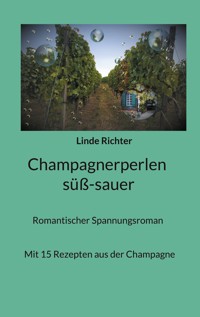Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Linda hat einen aufregenden Job. Sie arbeitet für eine amerikanische Fluggesellschaft und ist viel unterwegs. Offiziell kümmert sie sich um Probleme mit unzufriedenen Passagieren, inoffiziell darum, dass der Ruf ihrer Fluglinie nicht beschädigt wird. Linda ist mit allen Wassern gewaschen und lässt sich unkonventionelle Lösungen einfallen, die meist vergnüglich ausgehen. Privatleben ist für Linda ein Fremdwort bis sie einen charismatischen Politiker trifft. Es beginnt gewaltig zwischen ihnen zu knistern. Doch der Regierungsbeamte ist ein vielbeschäftigter Mann. Und da sind auch noch die Leibwächter. Das bringt fast unlösbare Probleme mit sich. Doch Linda wäre nicht Linda, um nicht Lösungen zu finden. Sie jongliert mit dem Jetzt und dem Morgen und wird mehr und mehr zu einer bestellten Frau. Das gefällt der lebenslustigen Linda gar nicht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 167
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Frankfurter Flughafen gehört zu den interessantesten Arbeitsplätze der Welt. Wer dort arbeiten darf, hat das große Los gezogen. Sagt eine, die es wissen muss:
die Autorin
Handlung und Personen in diesem Roman sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig. Sagt eine, die es wissen muss:
die Autorin
Widmung
Für alle Airliner und solche, die es gerne geworden wären, und für alle anderen auch.
Glossar
Eine kleine Hilfe durch den Sprachdschungel der Airliner ist auf Seite →
Jetzt war es also soweit. Tinnitus. Habe ich schon lange erwartet, und ist auch kein Wunder bei meinem aufreibenden Job. Es dauerte eine Weile, bis mir klar wurde, dass das Klingeln in meinem Ohr von der Wohnungstür kam. Und vom Telefon in meinem Wohnzimmer. Und von meinem iPhone. Alles gleichzeitig auf einmal.
Ich war noch im Bett, hatte einen ausgewachsenen Kater und Kopfweh; nicht gut für schrilles Klingeln im Ohr. Was zuerst? Ich entschied mich für die Sprechanlage: „Wer stört?“ Bület Oppenheim, mein halbtürkischer Kollege, blaffte mich an: „Warum nimmst du nicht ab? Schwing deinen Hintern aus dem Bett. Hier ist der Teufel los.“ Ich drückte auf den Türsummer, schnappte mein Handy und meldete mich.
„Linda, sofort zum Airport, die 1001 hatte eine Notlandung. Bület ist auf dem Weg zu Ihnen und erklärt Ihnen alles.“ Er hatte schon aufgelegt, bevor ich noch Luft holen konnte. Das war wieder einmal typisch für meinen Boss. Infos ohne Erklärungen - wie ich das hasse.
Darf ich mich vorstellen? Ich heiße Linda Lovitt und bin Angestellte der Global World Airways, kurz GWA genannt. Offiziell kümmere ich mich um Problemfälle in Sachen Passagiere, Fracht und Gepäck, inoffiziell darum, dass der Ruf meiner Fluglinie nicht geschädigt wird. Ich fliege rund um den Globus, um kniffelige Angelegenheiten im Sinne meines Arbeitgebers zu lösen. Die Probleme ereignen sich allerorts: am Boden, in der Luft, am Anfang, zwischendurch oder auch am anderen Ende der Welt. Ich war schon überall, nur noch nicht auf dem Mond. Aber das kommt bestimmt auch noch. Kurz gesagt, wenn’s brennt, schickt mich meine Fluggesellschaft in der Weltgeschichte herum, um Kosten zu minimieren und das Image zu polieren.
Manchmal erwischt es mich auch vor Ort, an meinem Standort in Frankfurt am Main. So wie heute.
Das Telefon im Wohnzimmer hörte endlich auf zu klingeln. Dafür stürzte Bület in meine Wohnung und pfiff wie eine alte Dampflok. Zweiter Stock, ohne Aufzug, das erfordert Kondition. Bülets türkische Mama kocht zu gut und viel zu viel. Und Bület liebt seine Mama, da darf nichts auf dem Teller bleiben. Bület steht mit unserem Grooming-Supervisor ständig im Clinch. Wir Airliner werden mehrmals im Jahr begutachtet, untersucht, gewogen und nach Verstößen überprüft. Jedes Gramm mehr auf der Waage bedeutet Abzüge am Kontingent unserer Freiflüge. Aber das sollte im Moment nicht unser Thema sein.
„Die 1001 musste eine Notlandung machen und hat einen Hangar gefetzt. Tote, Verletzte, was weiß ich. Du musst sofort hin.“ Bülent sank auf einen Stuhl, er hatte seine Aufgabe erfüllt.
Schöne Scheiße. Die GW 1001 fliegt rund um die Welt. Die GW 1002 auch, in die Gegenrichtung. NYC, LHR, FRA, IST, BEY, THR, KHI, DEL, BKK, HKG, TYO, HNL, SFO, NYC, hin und wieder zurück. Das ist einmalig auf den Flugrouten dieser Welt, und das gab es in früheren Zeiten auch nur ein einziges Mal, vor ungefähr dreißig Jahren. Das ist lange her. Meine Fluggesellschaft hatte diese Idee vor zwei Jahren wieder aufgegriffen und verdient sich an dem Einfall dumm und dusselig.
Ich wohne in einer hessischen Kleinstadt vor den Toren der Stadt Frankfurt am Main. Nur 35 Busminuten vom Internationalen Flughafen entfernt, was für mich unglaublich praktisch ist. Ich steige vor meiner Haustür in den Bus und am Flughafen vor meinem Büro wieder aus. Aber deshalb bin ich nicht Airliner geworden, wie man uns Angestellte aller Fluglinien nennt, egal ob in der Luft oder auf dem Boden. Ich wollte meine Sprachkenntnisse einsetzen, mich auf internationalem Parkett bewegen, die Welt kennenlernen. Hat auch geklappt. Ich habe vor fünf Jahren, nach einem Sprachstudium in Frankreich, England und Spanien, eine klassische Airliner-Laufbahn am Boden durchlaufen und bin jetzt Trouble-Shooter und löse, wie bereits erwähnt, kniffelige Angelegenheiten für meinen Arbeitgeber. Wir Airliner sind ein munteres Völkchen, mit einer ganz eigenen Sprache und nicht ganz frei von Konkurrenzdenken zwischen Bodenpersonal und fliegendem Personal, wie auch zwischen kleinen und großen Flughäfen.
Während meiner langatmigen Erläuterungen hatte ich mich angezogen, ins Auto gesetzt und die Fahrzeit zum Frankfurter Flughafen mit dem Pkw um gute fünfzehn Minuten verkürzt.
Es war erst kurz nach 07.00 Uhr und noch stockfinstere Nacht. Absperrungen, Feuerwehr, Krankenwagen, das volle Programm erwartete mich. Mit meinem Dienstausweis kam ich überall durch, bis knapp vor die Maschine.
„Drei Verletzte, davon zwei schwer.“ Hagen Werner Wolfram führte die Ermittlungen. „Die Maschine ist einfach abgeschmiert. Der Flugkapitän hatte noch was von Sichtattacken und fremden Himmelskörpern durchgesagt, dann war die Funkverbindung gestört.“
Sichtattacken, fremde Himmelskörper? Drehen die jetzt alle durch? Ich machte mir ein Bild vom Unglücksort. Der Flieger lag schräg auf dem Rollfeld. Die Spitze eines Flügels war lädiert und ein Hangar leicht beschädigt. Noch mal Glück gehabt, war mein erster Gedanke.
„Weiß man schon, wer die Verletzten sind?“ Normalerweise halten die ermittelnden Beamten alle Information zurück, aber Hagen ist ein guter Freund. Ein später Junggeselle und Kripobeamter im gehobenen Dienst. Wir kennen uns aus meiner Ausbildungszeit, wo Hagen den GWA-Frischlingen in Sachen Flugsicherheit Unterricht gab. Als in meiner Heimatstadt plötzlich ein paar undurchsichtige Morde passierten, trafen wir uns wieder und freundeten uns auch außerberuflich an.
„Die beiden Piloten und ein Passagier sind verletzt. Der Rest ist mit blauen Flecken und einem Schrecken davon gekommen. Die Fluglotsen haben gute Arbeit geleistet und die Maschine fast alleine runter geholt.“
Ich schaute ihn ungläubig an. „Was ist mit dem Captain und dem Kopiloten passiert?“ Er zuckte mit den Schultern. „Keine Ahnung, was da passiert ist, aber du kannst dich ja mal umhören, ob sie dir schon mehr sagen können. Ich habe noch keine offiziellen Informationen vom Tower, auch noch nichts von der Flugsicherung.“
Mein Lieblingskollege Joshi hatte sich bereits um die ärztliche Versorgung der Verletzten gekümmert und wusste mehr zu berichten: „Der Kopilot hat ziemlich schwere Augenverletzungen, und der Captain ist irgendwie nicht ansprechbar. Wenn du mich fragst, stehen beide unter schwerem Schock, und der Captain faselt nur wirres Zeug. Ein australischer Fluggast hat einen gebrochenen Arm und Prellungen. Er hatte sich beim Toilettengang verspätet und als er aus der Klotür stürzte, ist er ausgerutscht. Glück im Unglück. Alle drei sind mit dem Sani unterwegs ins nächste Krankenhaus.“
Ich griff nach Joshis Arm. „Wie war dein erster Eindruck? Was meinst du, ist da passiert? Du hast doch mit allen dreien sprechen können, oder?“
Joshi schüttelte den Kopf. „Nicht wirklich. Der Australier war nur am Jammern und Schimpfen. Der Captain machte einen höchst merkwürdigen Eindruck und sein Kopilot hatte ständig die Hände im Gesicht. Er stammelte was von Drohnen und Lasern. Wenn du mich fragst: das klingt alles sehr absonderlich.“
Ich war so schlau wie vorher und ging in Richtung OPS, um die administrative Abwicklung anzugehen.
Dann drehte ich mich nochmal kurz um und winkte dem Kriminalhauptkommissar zu: „Du schickst mir die Unterlegen, ja? Und, Hagen, ich brauche auch das Protokoll des Flugschreibers, sobald es freigegeben ist.“ Der Kriminalhauptkommissar versprach, sich darum zu kümmern. „Und gib mir bitte Bescheid, wenn du was Neues hast.“
Mehr konnte ich momentan nicht tun.
Das kleine, stickige Büro unseres Operation Services liegt in einem Flachbau, nahe der Landebahn, wo mehrere hemdsärmelige Männer nervös herumwuselten. Der Druck war spürbar, die Hektik hoch. Tobias Hauser, unser OPS-Manager, mittendrin. Ich kannte Tobias von ein paar internen Airline-Partys und ja, wir hatten vor ein paar Jahren einen One-Night-Stand. Aus purer Langeweile, während eines öden Empfangs. Nichts Aufregendes damals, und danach hatten wir uns aus den Augen verloren.
Er steuerte auf mich zu. „So eine verdammte Scheiße, haben die Idioten ihren Flugschein im Lotto gewonnen?“
Was für eine Arschgeige. Ich hatte vergessen, dass er ein rücksichtloser Liebhaber und ein rüder Trottel ist. Aber er hatte auch irgendwie Recht. Was hatte die Piloten bewogen, so eine riskante Notlandung auf dem Flughafen hinzulegen? Die Maschine war im ordnungsgemäßen Anflug gewesen und hatte zwei ausgebildete Piloten an Bord. Nur, die waren aus unerklärlichen Gründen beim Landeanflug kaum ansprechbar gewesen und ausgefallen. Und was sollten diese dubiosen Aussagen über Sichtattacken und fremde Himmelskörper?
„Gib mir einfach den Papierkram, und wir treffen uns wieder, wenn wir mehr Hintergrundinformationen haben.“ Ich hatte einfach keine Lust, mich mit diesem schwitzenden Ekelpaket noch länger zu unterhalten.
Der Pistenbus brachte mich zum Tower, wo ich mehr zu erfahren hoffte.
Notlandungen, Airline-Crashs und Ähnliches mehr bedeuten nicht nur Trauer, Leid und Unannehmlichkeiten, sie bedeuten auch eine Unmenge an Recherche und Papierkram. Wir hatten Glück gehabt und wenigstens keine Toten zu beklagen. Mehrere Wochen Bürodienst in meinem Standortbüro waren mir aber sicher.
Ich machte mich seufzend an die Arbeit.
Ich wohne in einer alten Jugendstilvilla unterm Dach, Baujahr 1905. Mit Nebeneingang, ohne Aufzug, aber Zentralheizung und einer Dachterrasse, die eigentlich keine ist. Und einem atemberaubenden Blick in Gärten, Parks und Wald.
Die Wohnung ist sehr großzügig, leicht schräg geschnitten und hoffnungslos altmodisch. Über einhundert Quadratmeter Wohnfläche, mit bodentiefen, weit gebogenen Sprossenfenstern, einem abgelaufenen Parkettfußboden und gluckernde Armaturen.
Die Hauseigentümer, ein älteres Ehepaar, sind ganz liebe Leute und fast nie da. Sie ist Malerin - immer noch, er Antiquitätenhändler - nicht mehr. Die meiste Zeit sind die beiden in ihrem Landhaus auf Ibiza und ich alleine im Haus. Das ist auf der einen Seite ganz angenehm, auf der anderen Seite manchmal auch etwas gruselig. Besonders bei Gewitter. Oder, wenn es in dem alten Gemäuer knistert, knackt und ächzt. Es ist schon erstaunlich, welche Geräusche so ein altes Haus von sich gibt.
Natürlich ist das Haus mit Gemälden und Antiquitäten vollgestopft, aber auch mit einer 1A-Sicherheitsanlage ausgestattet. Wenn ich in meine Wohnung will, muss ich über mein Handy eine geheime Code-Nummer eingeben, dann meine Sicherheitskarte erst in das Eingangstor, dann in die Eingangstür, und danach in meine Wohnungstür einlesen. Die Codierungen wechseln alle sechs Wochen. Aufschreiben darf ich die nicht, Gehirnjogging ist angesagt. Ich habe dafür einen Supertrick gefunden, weil man sich diesen Nummernterror einfach nicht merken kann. Ich merke mir die Zahlenkombination einfach in Form von Bildern: Eins ist mein Daumen, Zwei ein Fahrrad, Drei natürlich ein Dreirad, Vier ein Kleeblatt, Fünf die Olympischen Ringe, Sechs, na ja klar, oder? Und so weiter und so fort.
Jedes Mal, wenn ich das Haus betrete oder verlasse, durchlaufe ich verschiedene Außenkameras, die mit einem Sicherheitsdienst verbunden sind. Und man fragt besser nicht nach, welchen Aufwand ich betreiben muss, um Besuch zu empfangen. Obwohl, mein Umfeld ist nicht gerade üppig mit Freunden besetzt. Meine Freundinnen sind meist gut verheiratet und wohnen weiter weg. Und meine männlichen Freunde haben größtenteils diese Damen geheiratet - da war für mich nicht mehr viel übrig geblieben.
Die umständlichen Sicherheitsvorkehrungen waren mir bekannt, darauf hatte ich mich vor meinem Einzug eingelassen. Trotzdem, wenn ich ein paar Tage außer Haus bin und bei meiner Rückkehr alleine in der Villa, schaue ich erst einmal in sämtlichen Ecken und Zimmern, in sämtlichen Schränken und Einbauschränken, und auch unter sämtlichen Betten und Sofas nach, ob sich da keiner aus Versehen verlaufen hat.
Ich hing am Telefon und telefonierte meine Freunde durch.
„Hey, du bist zuhause? Schön, mal wieder was von dir zu hören. Wie geht‘s denn so? Was macht Rolf?“
Ich glotzte verständnislos in den Telefonhörer.
„Welcher Rolf?“
„Na hör mal, der nette Typ, den du das letzte Mal mitgebracht hast.“ Ich fing an zu rechnen. Ich hatte Gundula und ihren langjährigen Freund Wolfgang in Stuttgart besucht, mit Rolf, einem Apotheker, den ich in meiner alten Apotheke als neuen Besitzer gerade erst kennengelernt hatte. Das war schon eine Weile her und Rolf inzwischen Geschichte. Spätes Mittelalter.
Ach, Rolf ...
Ich hatte eine dicke Erkältung gehabt. Mitten im Sommer. Das sind diese blöden Klimaanlagen, die einen Schritt auf Tritt begleiten. Im Auto, an den Flughäfen, im Büro, in den Hotels. In den Vereinigten Staaten von Amerika kann man diese Dinger nicht mal per Hand runterstellen.
Ich hatte einen Kurztrip nach New York gebucht. Mal kurz ausspannen, was anderes sehen, raus aus dem Alltagstrott. Meine Kollegin Marion wollte mir unbedingt ihre neue Wohnung zeigen, die sie sich vor ein paar Monaten für viel Geld zugelegt hatte und ewig drängelte, sie zu besuchen.
„Es war ein Schnäppchen, am Rand von Manhatten, mit Blick auf einen kleinen Park. Das musst du dir unbedingt ansehen. Komm doch einfach rüber.“
Marion war in New York stationiert, stammte ursprünglich aus Frankfurt, und wir hatten uns auf der Pressekonferenz kennengelernt, die vor zwei Jahren unsere Rund-um-die-Welt-Flieger weltweit vorstellte. Natürlich in unserem GWA-Headquarters in New York. Jede Zwischenstation hatte einen Repräsentanten geschickt, und ich vertrat meinen Heimatflughafen. Wir wurden fotografiert, gefilmt und von der lokalen, wie auch internationalen Presse gründlich ausgefragt. Jede unserer Antworten war vorgegeben und ausgefeilt, nur Marion ritt der Teufel und fiel aus dem Rahmen.
„Warum haben Sie sich bei der GWA beworben?“, fragte ein aufstrebender, rotwangiger Juniorreporter einer bekannten lokalen Zeitung, der sich nicht an den Fragenkatalog halten wollte.
„Ich will einen stinkreichen, alten Millionär kennenlernen, ihn heiraten und ihn überleben.“
Marion war nur ehrlich gewesen, aber die GWA fand ihre Antwort nicht lustig. Sie entging haarscharf einer Kündigung, und dies auch nur dank ihrer langjährigen Mitgliedschaft bei einer großen Gewerkschaft.
Das schmale, rote Backsteingebäude lag in einer Seitenstraße, aber der Großstadtlärm drang bis in den sechsten Stock. Fünf Sicherheitsschlösser mussten an ihrer Wohnungstür geöffnet werden, um in ihr Loft zu gelangen. Man fiel sozusagen sofort in einen großen Wohnbereich. Das Apartment war praktisch ein einziger großer Raum mit einer Klimaanlage, die man nicht regeln konnte, und einer breiten, durchgehenden Fensterfront mit Blick auf einen kleinen Park. Echt schön.
Marion hatte ihr Loft nur sparsam möbliert. Ein großes Bett, auf einem Podest mit einem schweren Brokatbaldachin, stand in der einen Ecke. Ein Kleiderschrank, der auf der Rückseite ein Bücherschrank war, eine ganz pfiffige Idee wie ich fand, trennte den Schlafbereich vom Wohnbereich. Zwei ausladende Sofas, zwei Sessel und ein geschnitzter Tisch aus Indonesien standen mitten im Raum. Fertig.
Fast fertig. Hinter einem bunten Paravent versteckte sich eine Miniküche, die alles hatte, was man braucht, wenn man nicht so oft kochen will. Oder nicht kochen kann. Marion hatte lange in Indonesien gelebt und noch nie einen Kochlöffel in der Hand gehabt. In einem großen Plastikkorb stapelten sich sauber ausgewaschene Pappkörbchen vom Chinesen. Oder vom Thailänder? Ist auch egal.
Nach hinten gab es ein Bad mit einem Fenster, das in die Backalley zeigte, einem engen, dunklen Versorgungsweg, wo sich streunende Hunde und Katzen um den Inhalt umgekippter Mülltonnen stritten. Das Fenster konnte man hochschieben und klemmte sperrig. Ihre Freiluftspeisekammer, wie sie mir erklärte.
„Fleisch und Wurstwaren kannst du dort nicht lagern. Wegen der Katzen. Und wegen der Ratten.“
Ich hatte mal gelesen, dass New York mehr Ratten hat, als Deutschland Einwohner. Tendenz steigend.
Durch das Fenster konnte man vom Erdgeschoss, über eine eiserne Leiter mit einem Zwischentritt an jedem einzelnen Stockwerk, allesamt mit ähnlichen Schiebefenstern versehen, bis in ihre Behausung klettern. Ratten, Katzen, Menschen. Ich schaute sie entgeistert an.
„Fünf Sicherheitsschlösser an der Wohnungstür, und jeder kann von dem düsteren Versorgungsweg ungehindert über die Feuerwehrleiter in deine Wohnung einsteigen, was ist denn das für ein Schwachsinn?“
Marion konnte meine Ängste nicht verstehen. Das sei eben New York; so sei sie nun mal, diese Stadt.
Als ich zurückkam, hatte ich eine dicke Erkältung, die mich in die Arme von Rolf, dem neuen Apotheker meiner alten Apotheke, trieb.
Ach, Rolf ...
„Es tut mir leid, aber dieses spezielle Antibiotikum müssen wir bestellen. Wir können es Ihnen heute Abend nach 19.30 Uhr ausliefern. Geht das in Ordnung?“
Ich hatte ihm von meinem Besuch in New York erzählt und von dem Apartment mit der festgezurrten Klimaanlage. Er schaute mich mit seinen hellgrauen Augen strahlend an, erzählte begeistert von seinem unvergesslichen Jahr als Auslandsstudent in den Vereinigten Staaten und seinen wunderbaren Erlebnissen in New York. Er hatte eine sanfte, dunkle Stimme, der man gerne zuhörte.
Als es um 20.00 Uhr klingelte, stand Rolf, der Apotheker, vor meiner Tür. Er hatte ein Flasche Rum mitgebracht und meinte, dass Tee mit Rum viel besser sei als jedes Antibiotikum. Er kam nach oben. Dort blieb er dann. Für länger.
Ach, Rolf …
Rolf ist das, was man einen guten Freund nennt. Freundlich, zuverlässig und langweilig. Auch im Bett.
Ach, Rolf ...
„Wir sollten heiraten und Kinder kriegen. Mehrere, ich möchte mindesten zwei bis drei. Natürlich musst du aufhören zu arbeiten. Du bleibst zuhause und erziehst unseren Nachwuchs. Und wenn du willst, kannst du später, wenn die Kinder groß sind, vor den Feiertagen, also zu Ostern und Weihnachten, in der Apotheke aushelfen.
Ach, Rolf ...
„Äh, also, ich bin wieder Single.“ Es hatte keinen Sinn, meinen weit verstreuten Freundeskreis mit Einzelheiten aus meinem anstrengenden Job, meinen vielen Reisen, meinen - nett gesagt - sonderlichen Lebensgewohnheiten und ständig wechselnden Bekanntschaften, zu langweilen. Letzteres hatte mit meinem Frust auf die Männer im Allgemeinen, und der Wut auf meinen letzten Verflossenen im Besonderen zu tun. Der war bei weitem nicht so nett wie Rolf, der Apotheker, gewesen.
Wann hatten wir das letzte Mal telefoniert? Ich kam ins Grübeln. So lange war das schon her, so lange hatte ich Gundula nichts mehr von meinem unausgeglichenen Liebesleben erzählt? Na ja, meinen Verschleiß konnte sich in der Regel sowieso keiner merken; ich mir selbst manchmal nicht. Ich war einfach zu viel unterwegs, um feste Freundschaften zu pflegen. Ich bekam ein schlechtes Gewissen und wechselte das Thema.
Er krachte mit einhundertdreißig Kilo Lebendgewicht auf den Glastisch in der eleganten Besucherecke der VIP-Lounge meiner Fluglinie. Doch das alleine wäre noch kein Grund gewesen, dass der Tisch einen fetten Riss, quer durch das getönte Oval, bekam. Aber der Amerikaner hatte was Hartes in der Hose, und bei Weitem nicht das, was man im ersten Moment vielleicht denkt. Außerdem war er sternhagelvoll, abgefüllt mit Bourbon-Whisky aus der Premium-Economy Class.
Ich rief den Flughafen-Doktor, der dem lärmenden Fluggast eine Spritze verpasste und zur Ausnüchterung abtransportieren ließ.
„Das war in diesem Jahr schon der Dritte, der in Ihre Glasplatte gefallen ist. Was sagt denn Ihre Versicherung dazu?“ Dr. Freund grinste mich an und griff nach dem Kaffee, den meine VIP-Lounge-Kollegin ihm entgegenstreckte. „Sie sollten auf den Fliegern nicht so viel Alkohol ausgegeben. Das ist ungesund und erhöht das Versicherungsrisiko.“
Mit Versicherungen kannte ich mich aus. „Klar doch, ich wird’s weiterleiten. Mein Chef hat für Ihre Anregungen immer ein offenes Ohr.“ Ich winkte ihm zu und verschwand in Richtung Abflughalle, zurück in mein Büro. Der hat gut reden, dachte ich, Mein Boss klärt alle Problematiken erst einmal mit Alkohol, Unmengen von Alkohol, und dann durch mich. Das Bodenpersonal hatte die Anweisung, den verärgerten Passagieren Drinks anzubieten, bevor man tiefer in das jeweilige Thema einstieg. Und für den freien Service von Alkoholika in der First- und in der Business-Class, sogar in der Premium-Economy Class, war meine Fluglinie inzwischen berühmt - weltweit berühmt. Mit irgendwas mussten sich die Fluglinien schließlich unterscheiden. Dafür fiel ab und an einer unserer Fluggäste im Flieger vom Sitz oder auch mal in der VIP-Lounge in den Glastisch. Es gab Schlimmeres.
Mein Handy klingelte. Benjamin Herger, mein Boss, höchstpersönlich.
„Linda, Sie müssen die Solux-Angelegenheit doch noch vor Ort regeln. Seine Versicherung will die Sache über ihre Zentrale in den Staaten abwickeln.“
Also doch, meine Befürchtungen waren eingetreten. Ich fragte nach: „Die haben den alten Trick mit seiner amerikanischen Frau benutzt, stimmt‘s? Wann muss ich fliegen?“
Mein direkter Vorgesetzter hatte ein leichtes Bedauern in der Stimme. „Ihr Flug geht morgen um 10.30 Uhr, das Hotel ist gebucht und um 15.00 Uhr Ortszeit haben Sie einen Termin bei der Gegenpartei, um den Kasus Solux aus der Welt zu schaffen.“
Er wusste, dass ich morgen einen Termin beim Friseur und danach eine Einladung zur Hochzeit von Hagen Werner Wolfram hatte. Die freien Tage hatte ich mir schon vor Monaten freigeschaufelt. Aber für Fälle wie Solux habe ich rund um die Uhr Bereitschaftsdienst. Gut bezahlt, immer verfügbar, was übrigens auch meinen Familienstand erklärt: Single, keine Kinder.