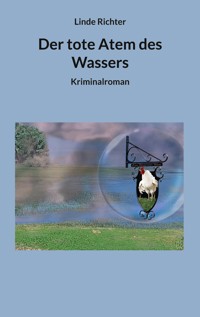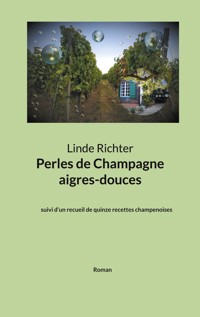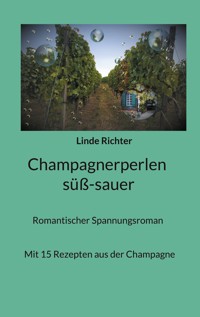Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lilly und Andreas verbringen ihren Urlaub in einem geerbten Wohnwagen auf der Wiese ihrer Freunde, die sich vor zwei Jahren ein marodes Fachwerkhaus in Frankreich gekauft haben. Lilly findet einen Schatz und wird stolze Besitzerin des alten Hauses am Lac-du-Der Chantecoq. Dann bekommt Lilly ein umwerfendes Angebot, und Andreas ist für einen Sommer Strohwitwer. Tina-Lisa begleitet Lilly in die Champagne und wird plötzlich himmelblau und splitterfasernackt von wildfremden Leuten angestarrt. Als Johnny, Frankreichs Rocklegende Nummer Eins, Lillys Freundin mit seiner samtweichen Stimme zu einer fulminanten Hochzeit verhilft, überschlagen sich die Ereignisse.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 191
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Liebe Leserin, Lieber Leser,
Dies ist ein Roman, aber so oder so spielt das Leben. Der See existiert, ebenso die Landschaft, sogar das Eulenhaus ist echt.
Liebe Freunde, Liebe Nachbarn
Ihr habt so starke Charaktere, dass Ihr mich für die eine oder andere Person in diesem Roman inspiriert habt. Dafür seid Euch gedankt.
Trotzdem, alle Personen und Handlungen sind frei erfunden, Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Persönlichkeiten sind rein zufällig.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
1
Der verstorbene Cousin meiner Mutter hatte mich mit dem Wohnwagen beglückt. Die sechzigtausend Euro Barvermögen hatte der örtliche Geflügelzuchtverein als Grundstein für sein neues Vereinsheim bekommen. So ungerecht kann das Leben manchmal sein.
Das cremefarbene „Ding“ stand seit zwei Jahren nutzlos im Hof und versperrte unseren Eingang. Wir quetschten uns täglich daran vorbei, um über die engen Stufen in das Haus zu gelangen. Jeder Einkauf wurde ein Balanceakt zwischen Blech und Stufen, Tüten und Paketen. Unser Auto musste auf der Straße bleiben und bescherte uns ein paarmal im Jahr abgebrochene Außenspiegel und ungemütliches Eiskratzen im Winter.
Dieses Jahr sollte alles anders werden. Miriam und Daniel hatten uns in ihr Ferienhaus nach Frankreich eingeladen, wo sie seit zwei Jahren jede verfügbare Minute nutzten, um es einigermaßen bewohnbar zu machen. Ihre Wiese sollte unser Campingplatz werden, und wir sollten Land und Leute kennenlernen.
Ich warf einen Blick auf Andreas, der sich konzentriert aus dem Frankfurter Kreuz ausfädelte.
»Hast du an die Frankfurter Würstchen gedacht?«
Ich war in meiner Schulzeit eine mehr oder weniger begeisterte Austauschschülerin gewesen, die sich mit Schaudern an die blassen Wurstscheiben in Paris erinnerte. Die sogenannten Frankfurter hatten in der französischen Metropole eine labberige Haut und schmeckten wie ausgekochte Socken.
»Zwei vakuumversiegelte Pakete liegen in der Küchenkiste. Dazu Sahne-Meerrettich, Handkäs vom Bauernmarkt, Kümmel, Graubrot und drei Kästen deutsches Bier.« Andreas kannte seine Bedürfnisse.
Für den Inhalt der Küchenkiste war mein Mann zuständig. Er hatte mir hoch und heilig versprochen, dass er dieses Mal im Urlaub kochen würde. Zusätzlich wollte er sich um die Technik rund ums Auto und dem „Ding“, dem Wohnwagen, kümmern. Ich war fürs Packen verantwortlich und hatte auch versprochen, für die Sauberkeit im Wohnwagen zu sorgen.
Ich hatte wahllos ein paar Badesachen, Sommerkleidung, Toilettenartikel, Bettwäsche und Handtücher in die Transportkisten gepackt. Das musste genügen, alles andere konnte man kaufen.
Andreas saß, wie üblich bei längeren Reisen, am Steuer. Neben mir lag eine ausgedruckte Wegbeschreibung, um in die 400 Kilometer entfernte Champagne zu reisen. Unser Navi war beim Packen runtergefallen und leider kaputt gegangen.
Kurz hinter Mainz kamen die übliche Frage: »Hast du an die Ersatzbrillen und an die Pässe gedacht?«
Ich kramte in meinem vollgestopften Umhänge Beutel: Adressbuch, Medikamente, Handy, Geldbörse, Lippenstift, eine Socke. Eine Socke? Die Ersatzbrillen waren drin und unsere Personalausweise auch. Braucht man in der EU noch Pässe?
Ich zermarterte mir das Hirn, um nach wichtigen Dingen zu forschen, die ich vielleicht vergessen haben könnte. In Gedanken spazierte ich durch den Wohnwagen: da war das Doppelbett auf der einen Seite, Tisch und Eckbank auf der anderen. Dazwischen so etwas wie eine Kombüse und ein Chemie-Klo, sowie massenhaft Stauraum. In meinem Fall ohne Kenntnisse des Inhalts. Ich hatte im vollsten Vertrauen an den Verblichenen nicht ein einziges Mal in die Einbauschränke oder in die Schubladen geschaut, geschweige denn einen Lappen in die Hände genommen. Mir wurde etwas mulmig zumute. Mein Gewissen zwickte mich ordentlich, und ich versuchte mit meinem Geplapper abzulenken.
»Reichen zweimal Bettzeug zum Beziehen für vier Wochen? Ich habe dir die beiden neuen Schlafanzüge vom letzten Weihnachten eingepackt. Brauchen wir Zahnputzgläser?«
Mein Göttergatte schnaufte. Das war kein gutes Zeichen, besser ich hielt jetzt den Mund. Und die Pässe hatte ich auch vergessen.
Rechts und links tauchten spärlich begrünte Weinberge auf, ab und zu ragte ein Kirchturm über die Hügel. Schilder mit vielversprechenden Namen wie Donnersberg, Winnweiler und Otterberg regten meine Fantasie an. Die Pfalz ist dünn besiedelt und die A63 wenig befahren. Als wir die Grenze bei Saarbrücken erreicht hatten, fragte kein Mensch nach unseren Pässen.
Ich konzentrierte mich weiter auf die Ortsschilder und las laut vor.
Andreas schnaufte schon wieder. Schon gut, ich habe vielleicht nicht viel Erfahrung mit französischen Ortsnamen und mache Fehler in der Aussprache, aber ich freute mich über die mit Blumenkästen geschmückten, verträumten Dörfer mit den vielen „y“ am Ende: Many, Buchy, Vigny…
Wir zählten insgesamt zwölf Ortschaften mit dieser für mich eher Englisch klingenden Endung. Der abfallende Putz an den Häusern wurde von frühblühenden Rosensträuchern verdeckt. Statt Gehwege säumten breite Grasflächen die Straßenränder vor den Häusern. An den Brücken schmückten Kästen mit bunten Blumen das Geländer. Die Sonne malte zwischen den Blättern der Bäume flirrende Lichter auf die schmalen, endlos erscheinenden Alleen.
Ich hatte Kaffeedurst. Wir entdeckten eine Bar-Tabac direkt am Straßenrand und hielten unter einem Lindenbaum im Schatten. Vor der Kneipe standen Tische und Stühle aus braunem Plastik unter hässlichen Sonnenschirmen, mit dem Schriftzug Miko. Ein krasser Gegensatz zu der ländlichen Idylle.
Die Besitzerin kam nach draußen und fragte mürrisch nach unseren Wünschen.
« Deux cafés au lait, s’il vous plait, madame. »
Ich staunte nicht schlecht. Seit wann spricht mein Mann Französisch?
Er erklärte es mir: »Ich war Austauschschüler in Frankreich, und meine erste Liebe hieß Chantal. Wir haben uns nach der Schule noch drei Jahre lang geschrieben. Sie in Deutsch, ich in Französisch.«
Wie bitte? Erste Liebe? Chantal? Kitschiger ging’s wohl kaum noch. Mir verschlug es kurz die Sprache. Nun war ich schon einige Jahre verheiratet und musste erfahren, dass es noch immer völlig unbekannte Seiten an dem Mann an meiner Seite gibt.
»Du hast eine Französin zur Geliebten gehabt?«
Ich neige manchmal zu Übertreibungen, wie mir mein Ehemann auch postwendend bestätigte: »Ach Lilly-Schätzchen, nur als Freundin. Sie war zwar meine erste Liebe, aber leider nur eine Brieffreundin.«
Lilly-Schätzchen, das bin ich. Und wenn es dick kommt, dann bin ich Liliane. Das ist mein Taufname und wird in dieser Form nur in absoluten Krisenstimmungen genutzt. Mir fiel ein Stein vom Herzen. Eine Französin als Vergleich wäre mir sichtlich schwergefallen, und ich stellte fest, dass ich noch immer ganz schön eifersüchtig sein konnte.
Die Wirtin schlurfte mit zwei Tassen in den Händen an unseren Tisch, und mein Liebster verwickelte sie in ein Gespräch über das Wetter, den Verkehr und das Leben im Allgemeinen. Soviel bekam ich mit, der Rest versank in einem schnellen Abtausch von mir unbekannten Vokabeln.
»Wir fahren an der nächsten Kreuzung rechts ab. Sie hat uns einen kleinen Umweg durch das blühende Mirabellental empfohlen.«
Andreas fing an, leise vor sich hin zu summen und hatte noch immer das charmante Plauderlächeln in den Augenwinkeln.
Die schmale Straße schlängelte sich zwischen blühenden Bäumen und Wolken weißer Blüten. Kein Auto weit und breit, und die Vögel sangen ihre Freude aus voller Kehle in den sonnigen Himmel. Es war atemberaubend schön.
»Rechts oder links?«
Die Ortsnamen sagten uns beiden nichts. Wir entschieden uns für rechts. Das war ein Fehler. Links die Böschung hoch und rechts die Böschung runter, gab es keine Chance zu wenden. Ein kleiner Rehbock stand plötzlich vor uns und beäugte uns kurz. Dann war er weg.
»Oh Gott, oh Gott! Hast du Ersatzreifen dabei?«
Ich verkrampfte meine Finger. Andreas Blick bewies, dass nur Frauen so blöde Fragen in kritischen Situationen stellen konnten, und ich versank schweigsam im Autositz.
Nach zwanzig Minuten kam endlich ein Schild in Sicht, das unser Ziel, den lac du Der-Chantecoq auswies. Die letzten fünfundvierzig Kilometer fuhren wir auf einer gut ausgebauten Schnellstraße in Richtung Kreisstadt, danach auf einer verträumten Landstraße nochmal gut vierzig Minuten bis in das Dorf unserer Freunde.
Die saßen bereits vorm Haus und warteten auf uns.
»Herzlich Willkommen im Eulenhaus. Hattet ihr eine gute Fahrt? Habt ihr Durst?«
Als der Wohnwagen endlich abgekoppelt und gesichert auf der Wiese stand, atmeten wir erst einmal tief durch. Geschafft! Die Luft war frisch, die Vögel zwitscherten, und die Ruhe fast greifbar. Wir waren müde, aber glücklich und endlich bei unseren Freunden am See. Hoch die Tassen oder viel mehr die Gläser und bienvenue en France. Das Gebräu aus Picon, einem französischen Aperitif-Likör, Bier und einem Spritzer Zitronensaft haute uns aus den Socken. Wir fielen ohne Essen in die Betten. Waschen war morgen.
Die Sonne schien mir ins Gesicht. Andreas saß am Bettrand und hielt mir eine Tasse Kaffee unter die Nase.
»Gut geschlafen, mein Schatz? Das Frühstück ist fertig. Miriam und Daniel warten schon auf uns.«
Ich rekelte mich genüsslich. Das Bett war überraschend bequem gewesen, wenn auch die müffelnde Reisekleidung etwas gestört hatte. Mein Kopf fühlte sich an wie Watte mit Waber. Diese Picon-Bières haben es in sich. Ich trank schnell meinen Kaffee aus und schwang die Beine aus dem Bett. Nach einer Katzenwäsche und hastig übergezogenen frischen Klamotten, kletterte ich aus dem Wohnwagen und streckte mich ausgiebig.
Urlaub ist was Herrliches!
Vor dem Haus unserer Freunde war der Tisch mit einer blau-weißen Tischdecke, blauem Geschirr und einem Krug frisch gepflückter Wiesenblumen gedeckt. Croissants, goldgelbe Butter, Honig vom Imker, hauchzarter Landschinken und ein göttlich cremiger Weichkäse, sowie knackige Baguettes ließen uns ordentlich zugreifen. Hummeln summten, und Schmetterlinge taumelten sonnenhungrig zwischen bunten Frühlingsblumen vor unserer Terrasse.
»Wir könnten heute an den lac du Der-Chantecoq fahren, was haltet ihr davon?«
Den Namen des Sees konnte ich nicht aussprechen, die Übersetzung aber kannte ich bereits aus den unzähligen Berichten unserer Freunde. Der See wurde nach einem der versunkenen Dörfer „Zum krähenden Hahn im Eichenwald“ benannt. 1973 waren mehrere kleine Seen, drei Dörfer und ein paar Bauernhöfe geflutet worden, um die einhundertachtzig Kilometer weit entfernten Pariser bei Hochwasser vorm Ersaufen zu retten. Kurz erklärt, fließt die Marne in die Seine und beide Flüsse haben im Frühjahr sehr viel Wasser im Gepäck. Der flach eingedeichte Stausee reguliert die Marne und die Seine über zwei Kanäle, und die Pariser haben seit einigen Jahren wieder trockene Füße.
Wir waren schon neugierig auf dieses Wasserparadies und nach ein paar Minuten Fahrt im großräumigen Citroen unserer Freunde, breitete sich eine silbrig schimmernde Fläche vor unseren Augen aus. Achtundvierzig Quadratkilometer Wasser soweit das Auge reicht. Segler und Surfer ließen sich von einer kräftigen Brise tragen. Zwei Fischerboote dümpelten am Uferrand. Ein paar Spaziergänger auf dem Deich, ein paar Touris auf dem Weg zum Fremdenverkehrsamt und wir vier. Mehr war nicht.
Die Sonne schien zwar kräftig, aber zum Baden war es noch zu kalt.
»Im Hochsommer ist hier der Teufel los«, erklärte uns Daniel. Miriam fiel ihm ins Wort, »zumindest an den Wochenenden und in den Schulferien. Aber unter der Woche ist hier tote Hose, und das hat uns an der Gegend so gereizt. Kein Massentourismus, gutes Essen und billige Häuser.«
Ich schaute etwas irritiert, von wegen „billige Häuser“. Mag ja sein, dass sie das Häuschen billig erworben hatten, aber wenn ich an die vielen Arbeitsstunden denke, die irrsinnigen Mengen an Baumaterial und die vielen Kisten und Kasten, die die beiden von Deutschland nach Frankreich geschleppt hatten, dann sage ich dazu lieber nichts. Rein gar nichts. Aber gutes Essen, das war definitiv mein Stichwort.
»Gehen wir heute ausnahmsweise mal Essen?«
Ich hatte null Bock auf die Kochkünste meines Mannes und schaute Andreas und meine Freunde erwartungsvoll an. Wir hatten ausgemacht, dass Andreas im Urlaub das Kochen übernehmen würde und ich in der Küche keinen Finger rühren musste.
»Wir gehen in den Dorfkrug. Am See ist es teurer.« Unsere Freunde kannten sich aus.
Der Dorfkrug hieß „Zum Stern“ und sah etwas untergegangen aus. Am Tresen saß ein Mann in grünem Loden mit einem Jagdhund an der Seite. Die beiden sahen auch etwas vergänglich aus. Dahinter werkelte eine mürrisch blickende Frau. Eine weit verbreitete Eigenschaft französischer Wirtinnen, dachte ich mir.
Wir setzten uns vor die Kneipe an einen braunen Plastiktisch mit braunen Plastikstühlen, unter einen hässlichen Sonnenschirm mit dem Schriftzug der Firma Miko. Neben uns unterhielten sich ein paar Touris auf Holländisch.
Unsere Bestellung erwies sich als eine geglückte Zusammenstellung heimischer Produkte, die der Ehemann der Mürrischen mit viel Liebe und noch mehr Kochkunst auf den Tisch gebracht hatte.
Ich stieß Andreas unterm Tisch ans Schienbein. »Da musst du dich aber ordentlich ranhalten, um mithalten zu können.«
Er wischte sich die Himbeersauce aus dem Mundwinkel und nuschelte etwas wie, mit guten Produkten sei das keine Kunst, oder so ähnlich.
Ich erkundigte mich sofort bei Miriam nach der nächsten Tankstelle, den nächsten Einkaufsmöglichkeiten und dem Wochenmarkt. Der Blick zu meinem Angetrauten sagte auch ohne Worte: So mein Lieber, diese Pfründe sind gesichert, ab jetzt bist du dran.
Vor Sonnenuntergang kramte Andreas leise schimpfend im Stauraum unter dem „Ding“ herum.
»Ich weiß genau, dass da ein Grill und ein paar Stühle waren.«
Er kramte weiter und hatte bald Erfolg.
Als die Sonne kitschig und glutrot hinter dem Flüsschen am Horizont unterging, hatte er einen Campingtisch, vier Campingstühle und einen total versifften Holzkohlegrill aufgebaut. Nach meiner Einschätzung war Grillen für den heutigen Abend kein Thema mehr. Also aßen wir Frankfurter Würstchen Made in Germany mit Sahne-Meerrettich und Graubrot. Dazu deutsches Bier.
Als Miriam und Daniel zu uns stießen, gab es noch mehr Bier. Trotzdem klappte es diesmal mit Ausziehen und Waschen vor dem Schlafengehen.
Am nächsten Tag war Markttag. Nicht im Dorf, aber sieben Kilometer weiter in einem überschaubaren Städtchen mit Post, Bank, Friseur und ein paar weiteren Geschäften.
Wir bummelten über den kleinen Platz und nahmen uns viel Zeit zum Gucken. Einfache Bauernstände, Verkaufswagen mit Wurst- und Fleischwaren, ein Käsewagen und ein Fischwagen, dazwischen Tische mit Schuhen und Kurzwaren, ein paar Kleiderständer mit sehr kurzen Kleidern und noch kürzeren Röcken. Ein tiefschwarzer Afrikaner pries seine handgeflochtenen Taschen an, und nebenan versuchte ein Schreiner seine Kleinmöbel aus Eichenholz und Matratzen an den Mann zu bringen.
Andreas kaufte Gemüse, kaufte Obst, kaufte Wurst und kaufte Fleisch. Danach ging er an einen Stand mit mediterranen Delikatessen und danach noch an den Brotwagen. Am Weinstand durfte man probieren. Das Einkaufen nahm kein Ende.
»Du, nächste Woche ist hier wieder Markt. Und der Kühlschrank in dem „Ding“ ist ziemlich klein.«
Er hört nie auf mich, warum also jetzt?
Wir schleppten die Tüten ins Auto und fuhren zur Tankstelle. Der Dieselkraftstoff heißt hier Gazole und ist billiger als in Deutschland. Prima, dann können wir nach dem Mittagessen ein wenig durch die Gegend fahren.
Vor dem Campingwagen legte ich die Füße hoch und verbrachte die Zeit mit einem Buch des Verblichenen.
Andreas schrubbte den Grill und füllte ihn mit herumliegenden Ästen. Ich schaute skeptisch.
»Das machen alle Franzosen so. Jedenfalls die auf dem Land. Ich kenne das noch aus meiner Schulzeit.«
Was mein Liebster so alles weiß. Die Flammen loderten plötzlich stichartig in den Himmel, und ich hörte ihn leise fluchen. Nach einer Weile schmiss er zwei dicke Steaks auf die Glut und drapierte Gurken, Tomaten, Oliven und eingelegte Sardellen auf einen großen Teller. Dazu eine Vinaigrette aus Essig, Öl, Salz und Pfeffer, mit etwas Senf verschlagen. Im Brotkorb lagen die gebrochenen Hälften einer goldbraunen Baguette. Er entkorkte eine Flasche Rotwein und drückte mir einen Schmatz auf die Wange.
»Essen ist fertig.«
Also wirklich, der macht es sich leicht mit dem Kochen, dachte ich mir. Ich schaute kritisch auf meinen Teller, war aber bald mit dem butterzarten, leicht blutigen Steak versöhnt. Die Tomaten schmeckten köstlich, gar nicht wie unsere Holland-Tomaten, und der Salat war frisch und sehr pikant mit den eingelegten Sardellen gewürzt. Ich war mit der Welt zufrieden und nach drei Gläschen Rotwein ordentlich müde.
Andreas trug mich in das cremefarbene „Ding“ und hielt mich auf seine eigene, sehr romantische Art vom Einschlafen ab. Danach fielen wir beide in tiefe Träume.
Ich träumte von Förderbändern, die knirschten und kreischten. Schließlich wachte ich auf.
Die Sonne lachte mir ins Gesicht, und das Wetter war optimal für einen Ausflug. Mein Blick flog in Richtung Ferienhäuschen, von wo die unangenehmen Geräusche kamen. Das satte Jaulen einer Kreissäge ist echt kein Spaß für ausgelaugte Urlaubsbedürftige, aber unsere Freunde wollten heute drei Balken austauschen, wovon uns Daniel am Abend zuvor in epischer Breite vor dem sich leerenden Kasten Bier erzählt hatte. Eigentlich wollten sie nicht, aber sie mussten.
Die beiden hatten kurz vor unserer Ankunft das graue Linoleum im Eingangsbereich herausgerissen, um den darunterliegenden alten Steinboden zu restaurieren. Dunkelrote, handgebrannte Fliesen waren jahrelang von einem hässlichen Plastiklinoleum verdeckt gewesen und sollten endlich wieder das Licht der Welt erblicken. Aber erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Jedenfalls bei einem fast dreihundert Jahre alten Fachwerkhaus. Als Daniel die Fußleisten entfernte, kam ihm ein Teil der Wand entgegen.
Dazu muss man sagen, dass Daniel von Beruf Musiker ist. Ein alter Kumpel meines Mannes, verträumt und künstlerisch hochbegabt, mit vielen fantastischen Ideen für sein Ferienhaus. Da war schon mal die Rede von einer Sauna im ersten Stock und einer großen Landküche im Erdgeschoss gewesen. Alles auf Kosten eines winzig kleinen Bades, null Wohnzimmer, dafür aber eine Veranda vorm Haus, die den halben Garten gekillt hätte. Gott sei Dank blieb es nur bei seinen spinnerten Ideen, und seine Ehefrau holte ihn immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurück.
Daniel kann sich glücklich schätzen, eine handwerklich begabte Frau an seiner Seite zu wissen. Diese Frau stand gerade an der Kreissäge und machte diese schrecklichen Geräusche. Also nix wie weg.
Eine wellige Hügellandschaft und niedrige Eichenwälder beruhigten schnell unser angegriffenes Nervenkostüm.
»Echt schön hier und so viel Grün.«
Ich entspannte mich mehr und mehr. Die schmerzenden Nackenmuskeln von der langen Fahrt und dem ungewohnten Bett kamen langsam wieder zur Ruhe. Auf den Wiesen und Weiden grasten Kühe in allen Farben. Ein handgemaltes Schild führte uns zu einer nahe gelegenen Ziegenkäserei. Der Hof lag einsam im Sonnenschein. Ein grauweißer Hund schwänzelte auf uns zu und legte sich gähnend vor unsere Füße.
»Hallo, ist da wer?«
Nichts rührte sich weit und breit. Ich drückte kurz entschlossen an der Türklinke. Wir fielen direkt in ein Esszimmer.
»Mann, das gibt’s doch nicht!«
Auf dem riesigen Esstisch lagen fleckige Servietten zwischen schmutzigem Geschirr. Gläser mit Weinresten und verstreuten Brotkrümeln wetteiferten mit abgenagten Knochen und traurigen Salatresten. Hier hatten Bauersleute in großer Hast den Mittagstisch verlassen, um schnellstens wieder an die Arbeit zu gehen.
Aber der Aha-Effekt kam vom anderen Ende des Speisesaals. Dort öffnete sich ein Halbrund mit opulenten dunkelroten, tiefblauen und smaragdgrünen Glasfenstern. Wir waren in eine ehemalige Kapelle mit einem Esstisch für zwanzig Personen geraten.
Hastig verließen wir den Raum.
Im Hof stand ein Scheunentor weit offen und bot gähnende Leere. Ein paar Stufen führten in einen Gewölbekeller. Wieder völlig leer. Von Ziegenkäse weit und breit keine Spur.
Wir machten uns in aller Eile vom Hof. Erst Jahre später erfuhren wir, dass in früheren Zeiten Zisterzienser-Mönche ihre Weinfässer auf diesem Hof gelagert hatten. Ora et labora.
»Wir könnten doch was fürs Abendessen einkaufen, oder?« Andreas blinkerte mich an, und das Charmelächeln kroch wieder in seine Augenwinkel.
Das war definitiv keine Frage, und der nächste Ort hatte eine Metzgerei, die auch Obst und Butter, Käse und Mehl sowie Konserven verkaufte. Aber leider kein Brot. Andreas stürzte sich erneut in einen Kaufrausch und orderte hausgemachten Ochsenmaulsalat, Salami mit großen Fettaugen und einige Scheiben geräucherten Landschinken. Der war daumendick. Dazu einen gemischten Karotten- und Selleriesalat, sowie eine üppige Scheibe Pastete, die hierzulande terrine heißt. Eine Flasche Rotwein und eine Ecke Brie, dazu noch zwei saure Gurken, zwei Bananen und zwei Äpfel, wanderten in einen Plastikbeutel. Von Plastikmüllvermeidung hatte man hier offenbar noch nichts gehört.
»Schluss jetzt, Andreas. Wer soll denn das alles essen?«
Mein angetrauter Ehemann schaute mich mit seinem unwiderstehlichen Dackelblick an.
»Ich habe echt Hunger, du nicht?«
Ich schüttelte den Kopf. Wir hatten doch gerade erst zu Mittag gegessen.
Andreas fuhr den nächsten Picknickplatz an und packte seine neu erworbenen Köstlichkeiten aus.
Der Picknickplatz ist das Nationalvergnügen aller Franzosen. Tische mit Bänken, entweder direkt an vielbefahrenen Straßen oder an einem schönen Fleckchen Frankreichs gelegen, sind die Antwort kinderreicher Familien auf die horrenden Preise der Restaurants im Allgemeinen und der französischen Gastronomie im Besonderen. Das typisch französische Ehepaar hat im Schnitt drei Kinder und verbringt infolgedessen aus Kostengründen seine Sonntage, wie auch seinen Urlaub im eigenen Land auf besagten Picknickplätzen.
Wir hatten Glück und saßen unter einem schattigen Baum mit einem weiten Blick ins Tal.
Ich nörgelte: »Wir haben kein Brot, keinen Korkenzieher und auch keine Gläser. Von Messer und Gabeln will ich gar nicht erst reden.«
Mein Mann schaute mich mit einem Blick an, der das Wort Spaßbremse deutlich signalisierte.
Er stieß den Autoschlüssel in den Korken. Es machte flopp, und der Korken rutschte in die Flasche. Autsch!
Andreas kramte in der Seitentasche und fand ein Schweizer Taschenmesser, das bestecktechnisch keine Wünsche offenließ. Selbstverständlich war auch ein Korkenzieher dabei. Die Küchenpapierrolle aus dem Kofferraum ersetzte die Teller. Es fehlte nur noch das Brot. Aber wie das Sprichwort schon sagt: In der Not schmeckt die Wurst auch ohne Brot.
Ich nörgelte weiter: »Ich muss schon sagen, du hast es dir mit der Kocherei bis jetzt ziemlich leicht gemacht.«
Andreas kaute und nuschelte: »Wieso, schmeckt‘s dir nicht?«
Ich wollte keinen Ärger und machte die Augen zu. Ein kleines Nickerchen konnte für die Verdauung nicht schaden, und nach einer Weile schloss ich Frieden mit den Kochkünsten meines Mannes.
Andreas rüttelte mich wach.
»Abflug, mein Schatz. Wir fahren zurück.«
Das Kreischen der Säge hatte aufgehört. Nur noch ein leises Hämmern war zu hören. Wir schlossen das Auto ab und sahen zum Haus.
»Komm lass uns rübergehen und schauen, wie weit die beiden sind.«
Das, was wir sahen, entsprach entschieden nicht deutschen Sicherheitsnormen. Zwei Querbalken waren mit einem Stück Holz abgestützt, das schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hatte, aber offensichtlich das ganze Haus zusammenhielt. Dieses seltsame Konstrukt trug den gesamten Türsturz und einen Teil der linken Wand. Drei alte Ständerbalken lagen zerbröselt am Boden.
»Die Stützen haben wir von einem Dachdecker geliehen bekommen. Vollkommen umsonst, geil was?«, strahlte uns Miriam an.
Ich starrte fassungslos auf die offene Wand.
»Ja und die Löcher überall? Da ist null Lehm in den Gefachen. Da kann ja jeder einsteigen!«
Daniel holte tief Luft. Wir seien hier auf dem Land, sagte er, und hier steige keiner ein, und außerdem würde hier nie geklaut. Und überhaupt, was hätten sie denn machen sollen? Er hatte ja Recht, und ich benahm mich wie eine dumme Stadtpflanze. Ich musste das irgendwie wieder gutmachen.
»Habt ihr Lust zum Abendessen rüberzukommen?«
Die Begeisterung war groß, allerdings nicht bei meinem Mann. Andreas zog alle Register, um mich davon zu überzeugen, dass ich unsere Freunde eingeladen hatte, und damit auch für den Küchendienst zuständig sei. Außerdem habe er keinen Hunger.
Ich blieb hart, und es blieb bei unserer Abmachung. Ich holte das Buch des Verblichenen aus der Schublade und legte die Füße hoch. Andreas begann mit den Vorbereitungen und hatte denkbar schlechte Laune.
Beim Abendessen brachte ich keinen Bissen runter und schaute staunend zu, wie mein Liebster und unsere Gäste kräftig zulangten, um die üppigen Reste aus unserer Küche zu vertilgen.
Es wurde trotzdem noch ein schöner Abend. Wir erzählten von früher, lachten viel, und auch der zweite Bierkasten wurde ohne Schwierigkeiten leer.