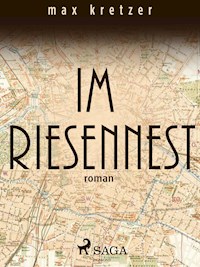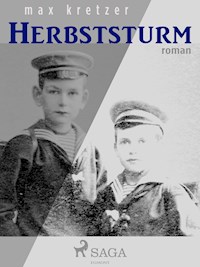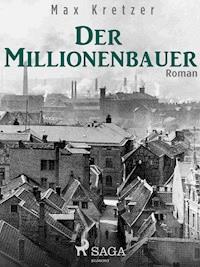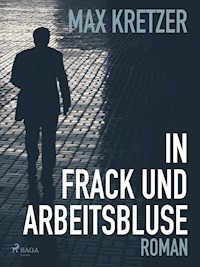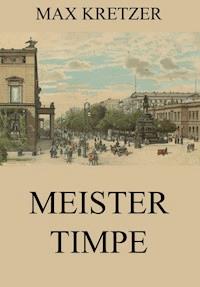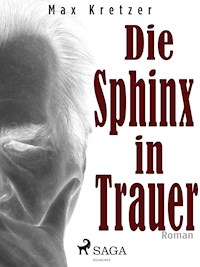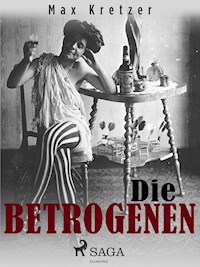
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Sie taugen alle nichts, diese Söhne reicher Väter, die arme Mädchen zu bethören suchen. Baue nie auf eines Mannes Wort, wenn er höher steht wie Du. Lerne sie verachten, hassen, verabscheuen, wenn sie sich Dir mit Hintergedanken nahen. O, Du weißt noch nicht, was es heißt, betrogen zu werden, mögest Du es nie erfahren ..." Maria Seidel weiß, wovon sie redet, als sie der jungen Jenny Hoff diese Ratschläge gibt. Hat sie doch selbst ein uneheliches Kind, das von der "Engelmacherin" Frau Sandkorn betreut wird. Und soeben hat sie – welch ein Schock! – dessen Vater wiedergesehen, den jungen Rothers, Sohn des Fabrikbesitzers, der soeben stolz seine Braut aus den Flitterwochen nach Hause geholt hat: niemand anderen als Marias beste Jugendfreundin Louise Wilmer. Die wiederum begegnet noch am gleichen Tag dem neuen Kassierer der Fabrik – Marias Bruder Robert – und erinnert sich an ihn. Sie beschließt, ihn nach der scheinbar verschollenen Freundin zu befragen. Die Dinge geraten ins Rollen und allmählich öffnet sich ein Abgrund unter ihr ... Jenny Hoff wiederum schlägt die Ratschläge Marias in den Wind, bis sie schließlich in ein anderes "Gewerbe" gedrängt wird – als erster deutscher Autor überhaupt widmet sich Kretzer in "die Betrogenen" auch dem Milieu der Großstadtprostitution. – Kenntnisreich in allen Berliner Schichten und Kiezen und besonders im Milieu der Industrieviertel bewandert und mit scharfer Beobachtungsgabe versehen, lässt Kretzer das Schicksal der Erniedrigten und Betrogenen lebendig werden. Unter anderem aufgrund dieses Romans hat der berühmte Literaturkritiker und Schriftsteller Hermann Bahr Kretzer den "Berliner Zola" genannt. Doch anders als Zola schildert er Leid und Not der Welt nicht mit dem kalten Auge des sezierenden Wissenschaftlers, sondern mit dem engagierten Herzen des Humanisten und Reformers.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 544
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Max Kretzer.
Die Betrogenen
Berliner Sitten-Roman
Vierte Auflage.
Saga
Die Betrogenen
© 1882 Max Kretzer
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711502600
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
Erster Theil.
Vorwort zur dritten Auflage.
„Die Betrogenen“ war der erste „Berliner Roman“, in welchem der Versuch gemacht wurde, Stadt und Menschen realistisch erfasst wiederzugeben. Wie weit das dem Verfasser gelungen ist, hat die Kritik mit seltener Einmüthigkeit festgestellt. Mancher, der dieses Buch zum ersten Male in die Hände bekommt, wird vielleicht erstaunt sein darüber, dass in demselben schon Vieles enthalten ist, was Nachahmer dramatisch und novellistisch verwerthet haben. Der Verfasser freut sich der Anregungen, die er nicht nur in diesem Roman, sondern auch in seinen späteren Werken gegeben hat.
Charlottenburg.
Max Kretzer.
Erstes Kapitel.
In der Fabrik.
„Nun, Oswald —.“
„Mein lieber Junge —?“
„Du starrst ja seit zehn Minuten bereits mit einer Aufmerksamkeit nach der Fabrikuhr hinüber, als sollte Dir das verwitterte Zifferblatt zum neuesten Objekt Deiner ohne allen Zweifel erhabenen Studien dienen — o, und was muss ich sehen, Du rauchst nicht? Verzeihe, wenn ich vergass, aber dieses verzwickte Ornament, diese zopfige Idee ... Du wirst begreiflich finden —.“
Alexander Plagemann, erster Mustermaler der Teppichfabrik von Rother und Sohn, einer der respektabelsten Firmen ihrer Branche, erhob sich bei diesen Worten hinter seinem, gleich einem riesigen Zeichenbrett schräg aufsteigenden Arbeitstisch, stiess das Malbrett von sich, spülte schleunigst den Pinsel aus und schritt eilfertig zu einem kleinen Wandschrank nach der hintersten Ecke des mässig grossen Ateliers. Man hörte das Drehen eines Schlüssels, das Quietschen einer Thür, dann legte Alexander in seinen grünen Plüschschuhen lautlos denselben Weg zurück, die Hand beschwert mit einem Kistchen.
Der Genremaler Oswald Freigang stand noch immer am breiten Fenster in seiner alten Stellung, neben dem Arbeitsplatz seines Freundes. Er hatte den rechten Ellbogen auf die Umrahmung einer Scheibe gestützt und blickte über die vorgestellten Pappstücke, die den unteren Theil des Fensters zur Dämpfung des Lichts verdeckten, hinüber nach dem im Bau begriffenen villenartigen Wohnhaus von Rother und Sohn, das sich, noch nicht vollendet und doch schon prunkend, an der Strasse breit machte, und nach den langgestreckten Fabrikgebäuden jenseits des kiesbedeckten Platzes. Während des Zeitraumes von zehn Minuten hatte sein Auge das Bild vor sich vollständig erfasst: die zellenartig aneinandergeketteten einstöckigen Hallen, bedeckt mit treibhausartigen Dächern aus zolldickem, getrübtem Glase, das jeden Einblick in das hundertfältige Weben und Leben unter ihm unmöglich machte; das vierstöckige Gebäude dahinter; den daranstossenden Garten mit spärlichem Baumwuchs; die dahinter liegende halb schmutzig-braun, halb saftig-grün erscheinende Wiesenfläche, scharf begrenzt von der Silberfarbe der Spree, die sich dort in ihrer ganzen Breite ausdehnte. Ein Dampfer, der sich mit seiner buntbesetzten Menge, zusammengesetzt aus Uniformen, schwarzen Röcken, luftigen Mousselinkleidern, blendendweissen Hüten und farbigen Sonnenschirmen, wie ein schimmerndes Riesenbouquet auf leicht bewegten Wellen ausnahm, zog tiefe, dunkle Furchen, und sein Keuchen und Aechzen drang schwerfällig in gleichmässigem Takte herüber. Auf der andern Seite des Wassers fand das Bild einen theilweise scharfen Abschluss durch tiefdunkelgrüne Baumgruppen, hinter denen eine lange Allee von gleichmässig emporstrebenden Pyramidenpappeln sich langweilig dahinzog. Am Ufer lagen mit herniedergelegten Masten die plumpen Kähne der Flussschiffer, gleichsam spottend der Hand ihres Lenkers, der ohne Wind hier nicht von der Stelle kam. Dazwischen, wie eine Fortsetzung des Ufers bis weit in den Strom hinein, machten sich die zusammengeschlagenen Baumstämme der Flösser breit, wie ein natürliches geradliniges Netz, auf dem ein einsamer Angler mit seiner bildsäulenartigen Ruhe den Eindruck eines Markpfahls machte. Und über dem Ganzen lag brütend die hohe Vormittagssonne eines heissen Junitages und versetzte den Luftraum allmählich in den Zustand eines glühenden Dunstkreises, der mit versengender Schwere auf Natur und Menschen lastete und dieses harmlose Bild mit seinen schweigsamen, verschlossenen Häusern, mit den unbeweglichen Bäumen und Sträuchern, dem halbverdorrten Rasenteppich und dem langweilig erscheinenden Gewässer zu einem Stück vereinsamten Landlebens machte. Nur dort links hindurch, wo das Auge die Glasdächer der beiden am nächsten liegenden steinernen Kästen gleichsam wie durch eine oben offen stehende Schiessscharte entlang streifen konnte, da, wo sich unterhalb zweier zusammenstossenden Baumkronen ein Stück des wolkenlosen Himmels in ungetrübter Bläue scharf abzeichnete, zeigte sich in weiter Ferne ein Theil Berlins mit seinen Schloten und Thürmen. Da dampfte und qualmte es, als stiesse die Riesenstadt ihren Athem aus, erdrückt vom Lärm und der Arbeit des Tages. Brücke spannte sich an Brücke, Haus presste sich an Haus. Thurm ragte neben Thurm und sog mit seinen glänzenden Spitzen und Kuppeln begierig das weisse Licht der Sonne auf, so dass feurige Sterne am hellen Tage schimmerten. Wer dieses Stück des norddeutschen Babel sah und die noch fehlenden kannte, der vernahm im Geiste das Tosen und Rollen der Räder, das Zittern der Häuser, das Surren und Summen der rastlos bewegten Menge mit ihrem Stossen und Drängen: jenes halb grollende, dumpfe Brausen, das wie ein halbunterdrückter, tausendfältiger Schrei nach täglichem Brode klingt.
Oswald Freigang war in seiner stummen Betrachtung nahe daran, sich über den letzteren Punkt philosophischen Betrachtungen hinzugeben, als seines Freundes Unterbrechung der Atelierstille ihn daran erinnerte, dass es allerdings wieder nothwendig sei, einen Blick auf die grosse Fabrikuhr zu werfen. Sie zeigte auf zehn Minuten vor Zwölf. Noch ganze zehn Minuten! Dann begannen sich jene Steinzellen da drüben zu entleeren, und er konnte das Feld seiner realistischen Studien durch den Anblick eines Schwarmes Arbeiterinnen zur Genüge erweitern. Vielleicht fand er unter ihnen irgend ein prächtiges Modell, dessen goldblondes Haar, dessen ebenmässiger Wuchs und plastischer Körper unter geistiger Verwilderung, unter verschossenen Tüchern, geflickten Kleidern und verblichenen Taillen nicht gelitten hatten. Vielleicht auch sah er jenes blonde Kinderantlitz, jenes räthselhafte Weib, das es bemutterte, von denen er gestern Abend in der alten Taverne unten am Wasser so seltsame Dinge gehört hatte, vielleicht —.
Ja, Alexander Plagemann hatte Recht; sein Freund hatte vorhin mit einer Ausdauer nach der Uhr gestarrt, als hätte er nie vorher eine derartige kreisrunde Platte mit schwarzen Ziffern und Zeigern gesehen, und doch wollte er nur die Minuten an ihr zählen!
Oswald Freigang hatte eine Faible für Alles, was die schmutzige Blouse und Jacke der Arbeit trug. Seitdem Menzel die Welt mit seinem „Eisenwalzwerk“ überrascht hatte, war in dem ziemlich unbekannten Dasein Oswalds, das er bis dahin geführt hatte, eine Radikalwandlung vorgegangen. Er vollendete die ungesunde, schablonenhafte Salonscene, die er gerade auf der Staffelei hatte, erst gar nicht, sondern fing an, bei seinen wohlerzogenen Freunden und Gönnern im Geheimrathsviertel dadurch in Verruf zu kommen, dass er das lebhafteste Bestreben zeigte, sich mit Vorliebe in jenen Kneipen und an jenen Orten zu bewegen, wo nach Ansicht seiner bisherigen Verehrer die Luft durch Schnapsdunst und üblen Tabaksgeruch den Aufenthalt eines gebildeten Menschen unmöglich mache. Man sagte, dass er sich in allen Fabriken umhertreibe, dass er in allen Werkstätten derselben zu Hause sei, dass jeder Vorstadtwinkel sammt lebendem Inventar seinem Skizzenbuch einverleibt sei, und dass kein verwittertes Gesicht eines Mannes des vierten Standes, der Anspruch auf Originalität machen durfte, vor ihm sicher sei, des Abends beim Heimkehren von der Arbeit durch Geld und gute Worte auf offener Strasse überrumpelt zu werden, um wie ein Schlachtopfer als Modell nach dem Atelier zu folgen.
Man wird es daher begreiflich finden, dass auch heute Oswald Freigang gesonnen war, bei seinem ersten Besuch Plagemanns an dessen Arbeitsstätte, die Gelegenheit zu benutzen, um seine Studien nach jeder Richtung hin zu erweitern.
Er hatte den guten Jungen seit zwei Jahren nicht gesehen, glaubte ihn noch immer als Schüler irgend eines Meisters in Düsseldorf und musste durch Zufall vor ein paar Tagen doch die alte Erfahrung machen, dass man recht gut während beinahe jenes Zeitraums in ein und demselben Stadtviertel einer Grossstadt leben und wirken kann, ohne von dieser unmittelbaren Nähe eine Ahnung zu haben.
„Nun, lieber Freund, darf ich bitten —? Du wirst schon bessere geraucht haben, aber so ganz schlecht ist die Sorte nicht. Du weisst, gutes Kraut war von jeher meine Leidenschaft, selbst in den schlechtesten Zeiten unseres Düsseldorfer Martyriums, wo die trockenste Ebbe unserer Kasse mich nicht vor dieser Verschwendung bewahren konnte. Aber wer kann für Leichtsinn beim Künstler!“
Alexander Plagemann musste sein Anerbieten wiederholen, ehe er die Genugthuung hatte, seinen im Anstarren der Aussenwelt versunkenen Freund bedient zu sehen. Erst als er diesem selbst ein brennendes Zündhölzchen hingehalten und das Flackern desselben, das Glühen und Dampfen der Cigarre ein paar Augenblicke beobachtet hatte, schien er befriedigt und zur weiteren Unterhaltung aufgelegt.
Die Erinnerung an Düsseldorf brachte eine Reihe wechselnder Fragen und Antworten hervor, wie sie zwischen einstmals intim gewesenen Freunden, die sich lange Zeit nicht gesehen haben und zum ersten Male Gelegenheit finden, sich aussprechen zu können, leicht erklärlich sind.
Plagemann sollte erzählen, wie es ihm während der Zeit ergangen sei, wodurch er sich habe verleiten lassen, den verführerischen Pfad der Kunst mit dem ganz gewöhnlichen einer halb philisterhaften, an mechanische Arbeitseinteilung gewöhnten Brodstellung zu vertauschen.
Brodstellung—in diesem einen Wort lag die ganze Antwort.
Es war die alte Geschichte eines ehemals für die höchsten Ziele seiner Kunst begeistert gewesenen Jünglings, der mit vollen Segeln der Hoffnung in das Meer seiner Ideale hinausgesteuert war, bis sein Lebensschiff eines Tages an der gemeinen Klippe, die man Kampf ums Dasein nennt, hängen blieb und sich schliesslich von der erlittenen Havarie nicht mehr befreien konnte.
„... So lange Du noch in Düsseldorf warst, ging es. Einer war da immer der Trost des Andern, damit ihm der Glaube an die Fleischtöpfe Aegyptens nicht geraubt wurde. Nach Deinem Fortgehen wurde das anders. Es überkam mich öfters eine Muthlosigkeit, die meinem Streben einen argen Damm setzte. Getheiltes Leid, getheilte Widerwärtigkeiten tragen sich leichter zu Zweien, aber so allein ... Ich hatte Pläne, Ideen zu Bildern, aber male doch etwas, wenn Du nicht einmal die Modelle bezahlen kannst. Da starb die Mutter, die kleine Pension verschwand. Das gab den Rest. Du weisst, ich habe eine Schwester ... Es hiess jetzt verdienen. Ich musste versuchen, meine Kunst handwerksmässig zu verwerthen. Wir gingen nach Berlin. Es ist uns schlecht genug in der ersten Zeit gegangen, ich sage Dir — wer nie sein Brod mit Thränen ass ... Elly machte Stickarbeiten für ein Geschäft, ich schmierte abwechselnd Dekorationen und zeichnete auf Stein. Aber es klapperte doch nur, es war kein richtiges Einkommen. Da wurde hier ein Maler verlangt, der tüchtig im Ornament sei. Du weisst, ich hatte darin etwas los. Es hat mich Mühe genug gekostet, mich in die Arbeit hinein zu finden, aber schliesslich ging es doch ... Mit dreissig Thalern monatlich habe ich angefangen, jetzt habe ich siebenzig. Du lieber Himmel, es ist nicht viel, aber gerade genug, um mit Elly sorgenlos leben zu können.... Ich gestehe, ich bin für die Kunst verloren und zum gewöhnlichen Kunsthandwerker geworden, aber was schadet’s auch! Schliesslich erfüllt jeder seine Mission im Leben, der seinen Platz als tüchtiger Arbeiter einnimmt ... Nicht Jeder hat ein gottbegnadetes Talent wie Du, mit dem er alle Schranken über den Haufen wirft. Lass nur (Freigang machte eine abwehrende Bewegung), ich sage nicht zu viel! Ich wusste schon längst von Deinem aufgehenden Ruhm, man sieht ihn ja in allen Schaufenstern der Kunsthandlungen hängen, aber ich wollte Dich absichtlich nicht aufsuchen, weil meine Laufbahn jetzt eine andere ist, als die Deine ...“
„Oh, deshalb ...“
„Und Dir, lieber Junge, wie ist es Dir gegangen? Dein Alter ist natürlich so vernünftig gewesen, seinen Starrsinn zu brechen und sich wieder mit Dir zu versöhnen. Aus Liebe zur Kunst,“ fügte Alex sarkastisch hinzu.
Ueber Freigangs Lippen presste sich ein kurzes Lachen, dessen Bedeutung Plagemann am besten zu würdigen verstand.
„Was Du Dir denkst! Da kennst Du meinen Vater schlecht. Er hat es mir bis heute nicht verziehen, dass sein einziger Stammhalter, als Sohn eines begüterten rheinischen Maschinenfabrikanten, vor die Alternative gestellt, entweder sich zum dereinstigen Nachfolger des Herrn Papa vorzubereiten und die Kasse desselben stets zur Verfügung zu haben, oder seinem Kunstdrange zu folgen und als verlorener Sohn zu gelten, das letztere vorziehen und aus Liebe zu seiner Neigung allem Ueberfluss entsagen konnte. Uebrigens ein Starrsinn des Alten, den man ihm verzeiht, wenn man seine rauhe Seite kennt. Er ist Praktiker durch und durch und hat es nie begreifen können, wie Leute, die es nicht nöthig haben, die Kunst zu ihrem Berufe wählen können. Es ist das eine Folge seines self-made manthums, das er nie ganz verleugnen kann. Aber es ist auch so gegangen, ich habe es ihm bewiesen! Und wenn er mich enterbt — was kümmert’s mich? Ich habe Glück genug gehabt, ich kann von Pinsel und Palette leben. Jetzt wird er sich rächen und meine Schwester an einen Mann verheirathen, der in seine Fusstapfen tritt und das Soll und Haben seines Hauptbuches besser wahrzunehmen im Stande ist, als ich. Die gute Schwester! Sie hat mich auch fernerhin noch redlich mit ihrem Nadelgeld unterstützt — Du weisst, wir nannten es „Pinselgeld“ in Düsseldorf. Was soll ich Dir weiter erzählen! Ich war ein Jahr in Paris, habe am Tage bei Meissonnier studirt und Abends Modekupfer für wenige Centimes das Hundert colorirt, und Alles aus Liebe zur Kunst. Jetzt hause ich in einem ehemaligen Photographenkasten in Deinem Viertel und befinde mich mitten in meinem Element. Mein Nachbar ist ein Heiligenmaler Namens Hannes Schlichting, ein westphälischer Hüne mit dem Gemüthe eines Kindes, ein Schwärmer edler Art, ein Naturmensch, der die Dinge mit andern Augen betrachtet wie wir, und deshalb auch nie zu etwas kommt, aber ein Prachtkerl, Du wirst ihn kennen lernen.“
Alexander Plagemann nickte und zog seine Uhr. Dabei sagte er:
„Es ist gleich Zwölf. Noch wenige Minuten und Herr Fritz Vetter wird uns das Vergnügen seiner Aufwartung schenken, um pflichtschuldig die gesammelten Neuigkeiten des Vormittags über uns ergehen zu lassen.“
Da Freigang eine fragende Miene machte, fuhr Plagemann gleich fort
„Du kennst Fritz Vetter nicht? Ich habe noch nicht von ihm gesprochen? O, den musst Du kennen lernen! Ich sage Dir, mindestens derselbe Prachtmensch wie Dein Heiligenmaler, wenn auch in etwas verkleinertem Massstabe. Die reine Gliederpuppe an Beweglichkeit. Augenblicklich sitzt er noch unten hinterm Pult und giebt sich als wohlbestallter Comptorist der Firma Rother und Sohn die redlichste Mühe, für seine dreissig Thaler monatlich seine Hose auf dem ewigen Drehschemel, auch Marterbock genannt, so viel als möglich zu schonen. Er hat nur einen Fehler, der gute Junge: er leidet an Erfindungen. Kein Tag vergeht, ohne dass er nicht irgend eine Verbesserung an einer unserer Maschinen erfunden haben will, die ihm nach einer besondern Steigung in der Achtung des alten Chef die endliche lukrative Aussicht gäbe, seinen längst geplanten Heimstand zu gründen, was augenblicklich auch noch an der unerbittlichen Thatsache scheitert, dass Freund Fritz gewöhnlich immer nur bis zum Zehnten eines jeden Monats im Besitze von Baarmitteln ist, bis zum Fünfzehnten an der schrecklichen Geldkrankheit, die man Dalles nennt, laborirt, und von diesem Tage an aus dem sogenannten Vorschuss nicht herauskommt. Der gute Junge, er ist wie zum Ehemanne geschaffen. — Du darfst nämlich, lieber Freund, getrost Fritz Vetter als meinen Schwager in spe betrachten,“ schloss Plagemann lächelnden Mundes seinen kurzen Bericht.
„Ah, dann gratulire ich Dir herzlich.“
Plagemann ergriff die dargereichte Hand und schüttelte sie derb.
Im selben Augenblick begann die Fabrikuhr in hellen Tönen zu schlagen. Nach dem letzten Schlag zischte aus einer Röhre des Maschinenhauses ein heller Dampf, der in einem langgedehnten gellenden Pfiff endete. Aus nächster Nähe drang ein ähnlicher herüber, dem in gewissen Entfernungen verschiedene andere folgten, bis aus der Umgebung ein halbes Dutzend Pfeifen zu gleicher Zeit die Mittagsstunde der Fabriken kündeten. Das bisherige Zittern des Hauses hörte auf — die Maschinen standen still.
Oswald Freigang trat wieder ans Fenster, Erwartung auf seinen Zügen.
Plagemann stand an seiner Seite und sagte:
„Ich werde Dir die Aussicht bequemer machen — die Sonne ist weg von dieser Seite, wir können die Fenster öffnen.“
Er nahm eilfertig die Pappstücke vom Fensterbrett und öffnete die beiden Flügel.
Der Hof belebte sich jetzt, und in den Gebäuden entstand jene Bewegung, die immer bei Beginn der Mittagsstunde in einer grossen Fabrik entsteht, wenn das Surren und Summen der Treibriemen, das hundertfältige Geräusch lebhafter Arbeit nicht mehr vernommen wird. Schwere Thüren wurden geöffnet und zugeschlagen, Stimmen wurden laut, dann hörte man klappernde und schlurfende Tritte die steinernen Treppen herunterkommen, langsam und eilig, erst vereinzelt, dann in ununterbrochener Reihenfolge hintereinander. Durch das Gitterthor von der Strasse eilten noch immer unter der Hitze keuchende Frauen und Kinder herbei, die ihren weitab wohnenden Männern und Vätern das karge Essen zutrugen. Junge russige Gesellen aus dem Maschinenhause steuerten dem Thore zu, um die nächste Speisewirthschaft des Dorfes oder schnellen Schrittes die nahe Vorstadtwohnung aufzusuchen. Ihnen folgten ein paar andere Arbeiter aus der Färberei, und jetzt schritt auch ein kleiner aber knorriger Mann, angethan mit ausgebleichter blauer Jacke, auf dem Kopfe eine Mütze mit Riesenschirm, das charakteristisch geschnittene Gesicht umrahmt von einer weissen Bartfraise, vorüber. Er warf einen Blick zu dem Atelier empor, erblickte die beiden jungen Männer, rückte etwas nachlässig an seiner Mütze und liess ein kräftiges „Mahlzeit!“ vernehmen.
„Das war Papa Titius, unser ältester Webermeister,“ sagte Plagemann, „ein kreuzbraver Schlesier von echtem Schrot und Korn, ausserdem, zu Dir nebenbei gesagt, Vater einer ganz allerliebsten Tochter. Goldblondes Haar, blaue Augen, regelmässiges Profil, weiche Züge, kleinen Mund, Schwanenhals, herrliche Büste, schlanke Gestalt —.“
Freigang unterbrach ihn lachend:
„Du schwärmst ja ganz gefährlich, lieber Alex. Wie in den besten Zeiten unserer Düsseldorfer Liebesabenteuer.“
„Oh, was Du denkst —.“
Alexander Plagemann hielt es für nothwendig, eine halbe Körperwendung zu machen, um eine leise auftauchende Röthe der Verlegenheit in seinem Gesicht zu verbergen. Aber Freigang hatte in diesem Moment keinen Blick für ihn. Seine Augen hatten bereits ein anderes Bild erfasst, das ihn frappirte, seinen Künstlersinn zu lauten Aeusserungen reizte:
„Potz Blitz, das ist ein Kopf, der ist was werth, den muss ich haben. Sieh doch, die brillanteste Studie zu einem Othello, selbst die schwarze Färbung fehlt nicht.“
Oswald Freigang gerieth in eine lebhaftere Bewegung, als es vordem der Fall war. Er neigte sich halb zum Fenster hinaus, um die Person seiner künstlerischen Gefühlsausbrüche besser mit den Augen verfolgen zu können.
Plagemann war sofort an seiner Seite.
„Ah, Den meinst Du! Das glaube ich wohl. Du bist nicht der Erste, dem der famose Kerl gefällt. Ein echter Römerkopf, wie gemeisselt und geschaffen für die Bühne. Und doch nur ein gewöhnlicher Arbeiter unserer Fabrik. Sein Name ist Schott. Er ist Maschinenschlosser und arbeitet unten neben einem Dutzend Kollegen. Wir haben hier unsere eigene Reparaturwerkstatt, in der immer zu thun ist. Auch kleinere Maschinen von leichter Konstruktion machen wir uns selbst ... Ein geschickter und fleissiger Mensch, aber ein jähzorniger, leicht reizbarer Bursche, mit dem nicht zu spassen ist. Eine sonderbare Natur, unter Umständen ungezügelt und roh, aber im Grund treu und aufopfernd wie ein seltener Freund. Besondere Kennzeichen: Sozialdemokrat vom reinsten Wasser. Wenn Du sonst noch etwas wünschest, lieber Freund —.“
Plagemann schloss mit einer humoristischen Anwandlung; und die beiden Freunde lachten zu gleicher Zeit.
Bei dem kleinen Anbau vorüber, der durch die Ateliers und Comptoirräume gebildet wurde, schritt nach dem hinten gelegenen Kohlenplatz zu eine kräftig gebaute, mittelgrosse Gestalt im schmutzigen Arbeiteranzug ohne Kopfbedeckung, im Munde eine kurze, abgebrochene Thonpfeife. Der etwas kleine Kopf vereinigte sich wie im Guss mit dem schlanken Hals und dieser mit den breiten Schultern. Dunkles, kurzgeschnittenes, krauses Haar schnitt scharf an der hohen Stirn ab und kräuselte sich nur hinten wie Teufelskrallen bis weit in den Nacken hinab. Wie sich die Brust unter der Blouse wölbte, wie Nacken und Arme sich in ihren scharfen Konturen zeigten — das gab ein Bild strotzend von jugendlicher Kraft und zäher Gesundheit. Das Gesicht war noch geschwärzt vom Schweiss und Russ der Arbeit, und in ihm sprühte das Feuer zweier dunkler Augen. Etwas Wildes, Eigenartiges, zusammengesetzt aus roher Kraft und natürlicher, halb unbewusster Intelligenz gab dem Antlitz einen Reiz, der das Interesse an ihm herausforderte.
Paul Schott war mitten auf dem Hof angelangt, als helles, überlautes Gewirr weiblicher Stimmen die nahen Arbeiterinnen verkündete. Ein Schwarm Mädchen zeigte sich im Halbdunkel des Flurs und drängte sich die Steinstufen hinab, theils kichernd und lachend, theils stumm und starr mit regungslosen Mienen: Mädchen über die erste Blüthe ihrer Jahre hinaus, mit eckigen Formen und jenen halbverlebten, wachsbleichen Gesichtern, die den Stempel ewiger Sehnsucht nach den Tanzböden gewöhnlicher Kneipen tragen — mit jenem Ausdruck halbversteckter Gemeinheit, wie ihn der stete Umgang mit gleichgearteten Männern zeitigt, denen jedes Wort eine geheime Anspielung ist. Zweierlei hatten diese Mädchen, sobald sie bereits längere Zeit nach der Fabrik gingen, gemein, das wie die Charakteristik ihrer Lebensart erschien: das gleich einer Dirne in die Stirn gekämmte, kurz abgeschnittene Haar und Stiefeletten mit hohen Hacken. War das Kleid vom gemeinsten Stoff, oft eine Stätte des Schmutzes, war das Umschlagetuch der armseligsten Art, machte die ganze Erscheinung den Eindruck äusserlicher Vernachlässigung — Stiefeletten mit Hacken oder Stelzschuhe mit Schnallen durften nicht fehlen. Sie und das Stirnhaar waren das Aushängeschild der moralischen Entwürdigung ihrer Besitzerinnen, das stumm aber schlagend auf den geheimen Weg des Lasters wies. Und unter diesen Frauensleuten, die ihre einstigen blühenden Wangen beim Lampenlicht der Kneipentänze eingebüsst hatten, tauchten jüngere, vollere Gestalten auf: Mädchen mit noch halb kindlichen Gesichtern, an deren weiblichem Hauch die Fabrikatmosphäre noch spurlos vorübergegangen war. Ihr Haar war glatt geordnet, als zeigte es noch die Pflege einer besorgten, sittsamen Hand; die Füsse steckten in derben Lederschuhen, die noch vortrefflich genug waren, nach dem Besuch der Gemeindeschule den Weg zur Fabrik zu machen. Sie lachten noch hell und melodisch, nicht heiser und frech, wie die andern; sie ehrten noch ihr Geschlecht in ihren Bewegungen und verletzten das Auge nicht, wie jene; sie träumten noch von dem Glück ehrbarer Arbeiterfrauen und dachten noch nicht an das Ideal der Sonnabendsbälle in schlechter Gesellschaft — an das einzige Ideal der andern. Für sie war der winkende Lohntag die rosige Fernsicht eines Familienfestes im Kreise der Eltern und Geschwister, der Ausgangspunkt fröhlicher, froher Arbeit, und nicht der Anfang widerwärtiger Streitigkeiten mit gemeinen Wirthsleuten und Schlafstellenvermietherinnen, denen jene andern im zerrissenen Familienbande preisgegeben waren. Ihr Sinn verpönte noch jede versteckte Gemeinheit eines männlichen Kollegen — jene andern nahmen sie in Kauf als selbstverständlich.
Und doch, wie lange wird es dauern, im Dampf und Qualm der Säle, Aug’ in Aug’ mit Männern — —.
Die meisten der Mädchen wohnten zu entfernt, um zu Tisch gehen zu können. Sie verbrachten die Mittagsstunde in der Fabrik, und ihre Hauptnahrung bildete der Kaffee. Einer bunten Schleife wegen, eines falschen Zopfes, irgend eines Flitterkrames halber, womit der kommende Sonntag sie geschmückt sehen sollte, entbehrten sie die warme Speise, kauten sie ihre Stullen, schlürften sie das zweifelhafte Gebräu.
So sah man sie auch heute mit ihren braunen Töpfen, die Arme halb entblösst, die schmutzige Schürze um den Leib, den Budiken der Dorfwirthe zueilen, um ihr dampfendes Morgengetränk einzuholen.
Wie sie in einzelnen Gruppen vorüberkamen, hatte Freigang Musse genug, sie zu betrachten.
Da nahte jetzt auch inmitten zweier langaufgeschossener Arbeiterinnen ein junges Mädchen, mehr Kind als Jungfrau, das ovale, leuchtende Antlitz umrahmt von natürlichen hellblonden Locken — ein Gesicht mit allen Eigenheiten einer Schönheit aus dem Volke, vom vollen, so klassischedel abgerundeten Kinn, vom kleinen kirschroth gefärbten Mund bis zur schmalen, zierlich gestalteten Nase, den klaren, unter vornehm geschwungenen Brauen strahlenden Augen und den durch ihre Kleinheit herausfordernden, von Blut durchglühten Ohren: eines jener Antlitze, die zu den Menschen wie ein verkörpertes Lied sprechen, dem ein Dichtergott ein Stück von seiner Seele eingehaucht. Es sprach so deutlich vom vollendeten Kunstwerk der Natur, vom höchsten Liebreiz eines schönen Menschenkindes ...
O, sie war wirklich schön, so rührend schön, die kleine sechzehnjährige Jenny Hoff. Sie war zwar nur die Tochter eines Kohlenschippers der städtischen Gasanstalt, des Lebens Schicksalswürfel hatte sie frühzeitig dazu verdammt, an der grossen „Trommel“ einer Teppichfabrik Tag für Tag bunt gefärbte Fäden mechanisch nach den vorgeschriebenen Ziffern der gemalten Muster nebeneinander zu spannen; sie trug zwar ein billiges Kattunkleid, eine grobe Schürze und noch gröbere Schuhe, aber das änderte daran nichts: sie war wirklich schön; das konnte ihr doch nicht die schlanke Gestalt, die zarte kecke Büste, die feine nette Taille nehmen — nicht einmal die kleinen Hände, die reinen Kinderhände, um die sie, trotz der augenblicklich rauhen und nicht ganz weissen Haut, so manche Dame besserer Stände beneidet hätte. Und wenn sie auch wie die Andern zu Mittag dünnen Kaffee trank und dünne Butterstullen ass, so blieb sie doch ein hübsches Kind — eine herrliche Knospe in der Blüthezeit des Lebens.
„Was meinst Du, Plagemann, wenn das Mädchen in seidenen Kleidern im Salon erschiene — wenn auch nur in Mousselin — das ist ja das reine Madonnengesicht.“
Oswald Freigang liess den „Othellokopf“ bereits wieder unbeachtet. Sein stets beobachtendes Auge hatte eine andere Wahl getroffen.
„Ah, die —“ Alexander Plagemann hatte wieder Auskunft zu ertheilen.
„Die kleine Blonde ... Nicht wahr, wie bei einer Heiligen, so süss ist das Gesicht. Sie ist noch nicht lange hier und scheint noch unverdorben ... Das liegt daran, sie wird bemuttert, seitdem sie nur noch ihren Vater hat. Sie wohnt auf einem Flur mit der Marie Seidel. Ein ganz rätselhaftes Weib, diese Seidel. Ich muss Dir von ihr erzählen. Seit einem Vierteljahr ist sie bereits hier. Gleich nachdem Edmund Rother seine Hochzeitsreise nach Italien angetreten hatte, trat sie hier ein ... Sie spricht fertig englisch und französisch und muss eine ausgezeichnete Erziehung genossen haben. Jetzt steht sie hier bei uns in Lohn als Teppichstopferin. Da hinten, oben im zweiten Stockwerk, wo die matten Scheiben sind, da verrichten dreissig Mädchen, oder meinetwegen auch „Damen“, wenn Du willst, diese Beschäftigung. Wenn die Teppiche fertig sind, finden sich immer noch kleine Fehler, die ausgebessert werden müssen, oder „nachgegangen“, wie wir zu sagen pflegen ... Niemand wird aus diesem Weibe klug, weil sie unnahbar ist, trotz Höflichkeit und manchmal rosiger Laune. Das macht das „Etwas“, das sie besitzt. Halb Stolz, halb Herablassung. Dabei eine Schönheit, aber eisig kalt, sage ich Dir, trotz ihrem Lachen. Sie soll ein Kindchen haben, das sie bei fremden Leuten in Pflege gegeben hat — so sagt man wenigstens. Es wird wohl die alte Geschichte sein, die ewig neu bleibt: Eheversprechen, Verführung, Gemeinheit eines Mannes — und dann Entsagung und Resignation auf Kosten der bösen Zungen und aus Liebe zu einem Kinde —“
Der redselige Alexander Plagemann war mit einem melancholischen Anflug im besten Flusse, die Neugierde seines Freundes auf die Spitze zu treiben, als eben unten ein paar Kollegen aus den Nebenateliers vorübergingen, mit denen Alex ein paar Worte zu wechseln hatte. Dann schoss plötzlich aus dem Flur heraus, die Steinstufen hinunter ein kleiner Mann, bewehrt mit einer goldenen Brille und bewaffnet mit einer langen Feder, die wie ein Spiess dräuend zwischen Ohr und glattgeschorenem Haupthaar lag; den Kopf bedeckt mit einer ballonartigen Comptoirmütze, deren nebelgraue Farbe zum leichten Anzug aus dito Stoff insofern harmonirte, als sie wie eine körperliche Verlängerung der ganzen Figur erschien. Er turnte mit seinen dünnen Beinen wie ein Windspiel die vorgebaute Treppe hinab und nahm drei Stufen auf einmal. Dabei flatterten die unendlich langen Zipfel seiner herabhängenden Kravatte mit seinen Rockschössen um die Wette und machten im Verein mit den Bewegungen der Arme und Beine den ganzen Menschen zu lebenden Windmühlenflügeln, die das Weite suchten.
Jetzt wollte er auch den Kiesplatz mit langen Sätzen nehmen, als er seine tintengeschwärzte Waffe hinterm Ohr verlor; als er sich darnach bückte, fiel ihm auch die etwas übergrosse Mütze vom kegelartigen Haupte. Während er den ersten Schaden gut machte, sich in athemloser Eile wieder bedeckte, verlor der aussergewöhnlich dicke, anscheinend patentirte Federhalter abermals sein Gleichgewicht. Dadurch entstand eine Drolerie, die erst das halbunterdrückte Lachen der vorübergehenden Mädchen herausforderte und dann auch von oben den lauten Ausbruch einer ungezügelten Heiterkeit herabschallen liess.
Alexander Plagemann sah sich alsdann veranlasst, laut hinunter zu rufen:
„Aber Fritz, bei allen Heiligen, was ist denn los? Du läufst ja gerade, als läge da drüben das Patentamt, aus dem der endliche Segen winke.“
Fritz Vetter drehte sich schleunigst um, und Freigang hatte das Vergnügen, in ein bartloses, schmales Antlitz zu blicken, das neben einer Portion geistiger Eigenschaften den unverkennbaren Stempel grosser Gutmüthigkeit trug.
„O, lass heute Deine Spöttereien! Das ist eine nette Geschichte —.“
Der junge Comptoirist und Erfinder erblickte einen fremden Herrn da oben und unterbrach sich, indem er pflichtschuldigst noch einmal das kurzgeschnittene Haar zeigte. Dann fuhr er athemlos fort:
„Eine wirklich nette Geschichte. Kein Mensch ist ausser mir im Comptoir. Brendel, der neue Volontair — Du weisst ja, der Neffe vom Alten — scheint wieder den „moralischen“ zu haben, denn er ist heute gar nicht gekommen, Knauer (so hiess ein anderer Comptoirist) hat sich bereits zu Tisch begeben, Rösicke (das war der Direktor der Fabrik) ist nach dem Comptoir in der Stadt, und jetzt kommt plötzlich eine Depesche von dort, dass Rother junior seit gestern zurück ist von seiner Hochzeitsreise und an der Seite seiner jungen Frau im Verein mit dem Alten uns hier in der Mittagsstunde seine Aufwartung zu machen gedenkt, wahrscheinlich um den Bau der Villa in Augenschein zu nehmen und der jungen Frau Chef einen Einblick in die Fabrik zu gestatten. Und das kommt über Hals und Kopf und ich bin allein. Sie müssen jeden Augenblick kommen ... Wahrhaftig, da unten rollt schon ein Wagen. Das sind sie, ich kenne die Schimmel. O, es ist entsetzlich, ich verliere noch meinen Kopf und komme bei der jungen Frau ganz um mein Renommee ... Ich bitte Dich, hilf Alarm schlagen, damit Alles am rechten Platz ist. Ich gehe nach der Weberei, thu’ Du das Uebrige. Es wäre unverantwortlich, wenn wir uns in den Augen der jungen Frau blamirten.“
Fritz Vetter war ganz ausser Rand und Band und machte Miene, seine Hetzjagd von Neuem aufzunehmen, als er sich noch einmal umdrehte und laut nach der Portierstube hinüberrief:
„Neumann!“
Es erfolgte eine Antwort.
„Oeffnen Sie gefälligst das Gitterthor, die Chefs kommen angefahren!“
Dann trabte er von dannen.
Plagemann sah nach der Chaussee hinüber, dann sagte er:
„Teufel, da kommen sie wirklich. Der gute Junge hat Recht gehabt ... Bitte, bleibe ruhig hier, aber entschuldige mich auf ein paar Augenblicke —“
Er war bereits verschwunden, als Freigang etwas von „einer Ueberraschung nach der andern“ laut werden liess.
Dann suchte der junge Künstler eine Stellung halb verdeckt vom Fensterflügel, die ihm ungesehen die freie Aussicht gestattete.
Ein paar Minuten vergingen, als Plagemann wieder eintrat und ein paar im Wege stehende Stühle und Sessel bei Seite rückte.
Dann sah man auch wieder Herrn Fritz Vetter herbei gestürmt kommen, in einer Verfassung, die allerdings schon von einer gewissen „Kopflosigkeit“ sprach, denn beinahe hätte er den Maschinenschlosser Paul Schott, der langsam daher geschlendert kam, als interessirte ihn im Augenblick nichts weniger als der respektable Besuch aus der Stadt, über den Haufen gerannt.
Diese anscheinend rücksichtslose Ruhe, im Verein mit den etwas schmerzhaften Folgen des Zusammenstosses, mussten die Entrüstung in der Brust des dienstbeflissenen Comptoiristen ausnahmsweise anfachen.
„Aber, Herr Schott, Sie promeniren hier wie ein Pascha auf und ab und haben soeben gehört, was für ein Ereigniss uns jede Minute bringen wird. Es wäre besser, wenn Sie Ihre Kollegen, die hier sind, benachrichtigten.“
„Es ist jetzt Mittagsstunde, da kann ich machen, was ich will,“ gab der Arbeiter kurz, fast rauh zur Antwort und qualmte und promenirte ruhig weiter.
Fritz Vetter war ob einer solchen nach seiner Ansicht einzig dastehenden Gleichgültigkeit, die um so wirksamer war, je unerwarteter sie kam, derartig starr und sprachlos, dass er es im Vorgefühl der nahenden feierlichen Momente überhaupt unter seiner Würde hielt, noch ein einziges Wort gegen eine derartige „Ausserachtlassung des guten Tones“ zu verschwenden.
Er warf über die geschliffenen Brillengläser hinweg nur noch dem jungen Arbeiter einen Blick nach, in dem sich die ganze Fülle seines wohlmeinenden Vorwurfs aussprach, murmelte ein paar verzeihliche Grobheiten vor sich hin und nahm mit einem kühnen Saltomortale die Plattform der Treppe, um das Arbeitszimmer des jungen Chefs einer flüchtigen Uebersicht zu unterziehen und dann schleunigst seine etwas nachlässige Toilette in Ordnung zu bringen.
Den Hof belebten noch immer Arbeiterinnen, die sich beeilten, ihren alten Platz aufzusuchen, oder sich gegenseitig ein paar Augenblicke aufhielten, um über den Besuch zu schwatzen, auch wohl erwartungsvoll ihre Blicke nach der Strasse zu richten.
Dadurch bildeten sich Gruppen. Man kicherte, machte allerhand Bemerkungen über Herr und Frau Rother junior, sprach von dem Aussehen einer Braut nach der Hochzeitsreise und vergass dabei ganz das Kaffeeholen.
Eins der Mädchen von jener Art mit Stirnhaar und Stiefeletten wandte sich plötzlich den Fabrikgebäuden zu und sagte mit ihrer rauhen Stimme:
„Nu seh doch blos, Tine, da kommt sie wieder mit Schleier und Handschuhe, diese hochnäsige Marjelle, was die sich inbildet! Ob sie mehr is wie wir! Dabei hat se schon wat Kleenes. Det weess Jeder, wie —.“
Das Frauenzimmer machte eine freche Bemerkung, die das Lachen einiger ihrer Genossinnen herausforderte.
Die Teppichstopferinnen hatten ebenfalls Mittagsschicht gemacht. Man sah einen Theil von ihnen daher kommen, allen voran Maria Seidel, eine schlanke, hohe Gestalt in einfacher, dunkler Robe. Jetzt musste sie bei Paul Schott vorüber. Ein sengender Blick des Arbeiters traf sie, wie jeden Tag um diese Zeit, so auch heute. Paul Schott blieb stehen, kreuzte die Arme übereinander und sah ihr nach, seltsam, merkwürdig, als wollte er ihr Bild in seinen Augen fixiren.
Maria Seidel plauderte harmlos mit einer ihrer Kolleginnen, als Jenny Hoff leichtfüssig ihr entgegensprang.
„O, Fräulein, wir haben uns heute noch gar nicht gesehen. Schön guten Tag! Wissen Sie schon, sie kommen. Ach, ich bin so neugierig, wie sie aussehen mögen — das junge Paar. Bitte, bleiben Sie noch einen Augenblick hier. Kommen Sie, wir treten bei Seite.“
Fräulein Seidel lächelte und strich der Kleinen eine muthwillige Locke von der Stirn.
„Hast Du gestern Abend noch gelesen?“
„In dem Buch? O, es ist so schön! Sie sind immer so gut — aber Vater hat mir das Licht vor der Nase ausgeblasen.“
Sie lachte laut auf und zeigte dabei zwei Reihen kleiner weisser Zähne.
Vorn am Gitterthor ertönte jetzt Peitschengeknall, Staubwolken wirbelten auf, und in einer kühnen Kurve bog die prächtig geschirrte Equipage des Hauses Rother ein und rollte vor die Steintreppe, auf der Fritz Vetter bereits harrte. Der Portier sprang eilfertig hinzu, um den Wagenschlag zu öffnen.
Des alten Chefs behäbige Gestalt in schwarzem Rock und weisser Weste stieg zuerst aus; ihm folgte sein Sohn Edmund in grauem Sommeranzug, das bärtige Haupt bedeckt mit einem hellen Strohhut.
„Louise, bitte, stütze Dich —.“
Rother junior reichte der jungen Frau seinen Arm.
Ein leichtes Lächeln des Dankes war die Antwort. Dann knisterte und rauschte die perlgraue Robe, unter Spitzen und Kanten schob sich ein kleiner Fuss hervor, und Louise Rother stand neben ihrem Gatten.
Rother senior hatte sich mit seinem buntseidenen Taschentuch den Schweiss von der kahlen Stirn gewischt. Jetzt lächelte er väterlich, streckte seiner Schwiegertochter die etwas grosse, fleischige Hand entgegen und sagte in seiner breiten, gutmüthigen, aber stets nach der Zeit gemessenen Sprechweise:
„Sei willkommen, Kind, auf unserer Stätte des Fleisses.“
Dasselbe Lächeln von vorhin, dann rauschte sie am Arme des Schwiegerpapas bei Fritz Vetters unglücklichen, von stotternden, unverständlichen Begrüssungen begleiteten Verbeugungen vorbei in den Flur hinein.
Edmund Rother drehte sich noch einmal um, sagte dem Kutscher ein paar Worte, reichte dann mit freundlichem Lächeln seinem Comptoiristen die Hand und folgte in das Haus.
Drüben am Platze stand todtenbleich Maria Seidel und rang in fürchterlicher, seelischer Aufregung nach Kraft, um nicht zusammenzusinken. Etwas wie ein wahnsinniger Schrei nach Luft, nach Hilfe, sollte sich über ihre Lippen pressen, aber ihre Kehle war zugeschnürt vom eben empfangenen Eindruck des Gesehenen.
Jenny Hoff fühlte dann auf ihrer Schulter einen Druck, so dass sie schmerzhaft ein gedehntes „Oh“ hören liess. Sie starrte ihre Nachbarin an.
„Um Gotteswillen — Fräulein, was fehlt Ihnen? Sie fallen!“
Die Kleine schrie hell auf und zeigte eine halbweinerliche, ängstliche Miene.
Die versammelten Mädchen blickten sich um und traten näher. Da stand auch schon Schott an ihrer Seite und hatte sie umfasst. Sie aber fiel nicht, sondern riss sich los, wie gepeinigt von der Berührung des Arbeiters. Und sie hatte auch wieder ihre Sprache gefunden.
„Was wollen Sie? Gehen Sie — es ist schon gut ... Diese schreckliche Hitze. Komm, Jenny, begleite mich ein Stück.“
Sie zwang sich aufrecht wie früher zu erscheinen, und es ging.
Sie sah oben am Fenster Freigang nicht, der sie mit den Augen verfolgte, sie sah die Equipage nicht, an der sie vorbei musste, sie sah auch dort die grossen Fenster mit den braunen schweren Gardinen nicht, an denen sie vorüberging.
Am Portierhause machte sie Halt.
Sie heuchelte Gleichmuth und frug:
„Herr Neumann, war das der junge Chef mit seiner Frau?“
Der kleine Mann gab eine bejahende, freundliche Antwort und empfing einen Dank dafür.
Dann waren sie Beide auf der Chaussee. Hinter einer Pappel küsste sie Jenny auf die Stirn. „Geh’ jetzt, mein Kind, und denke daran, was ich Dir gesagt habe: lass Dich nie mit den Andern ein. Mir ist so unwohl, ich werde Nachmittag zu Hause bleiben.“
Jenny Hoff ging mit betrübtem Gesicht zurück, und Maria Seidel schritt der Stadt zu — langsam, schwankend, wie im Taumel ... So ging sie durch die belebten Strassen, so erklomm sie die vier Stiegen des Hinterhauses zur Wohnung der „Engelmacherin“ Frau Sandkorn, so sank sie an der Wiege ihres Kindes nieder ...
Zweites Kapitel.
Vormittags in der Stadt.
Palast an Palast gereiht, in denen hinter riesigen Schaufenstern der Luxus zum Verkauf sich breit macht, als gäbe es nichts Nothwendigeres neben ihm auf Erden. Vom Parterre bis zum vierten Stockwerk blitzende Spiegelscheiben, glitzernde Firmen und weithin leuchtende vergoldete Wappen, umgeben von Hoflieferantentiteln aller Nationen, vom Kaiser aller Reussen bis zum Herrscher jenes Ländchens, das mit blossem Auge nicht mehr auf der Landkarte zu entdecken ist, dafür aber durch die Grösse seiner Landeszeichen den Zinkgiessern Gelegenheit giebt, die besten Geschäfte zu machen.
Durch die offenstehenden Thüren der Läden erblickt das Auge hinter den langen Ladentischen eine Reihe Mamsells, emsig beschäftigt, die Kartons zu ordnen, Blicke in die grossen Spiegel zu werfen und sich allerlei Neuigkeiten und Dinge zuzuraunen, vom Vergnügen des letzten Abends, von den Geschenken der Liebhaber, von ihrer Aufopferung, ihrer „Knickrigkeit“, ihrer Treue, ihrer Gemeinheit . . Geschniegelte und pomadisirte Commis mit ausgeschnittenem Stehkragen und rother Cravatte, mit Offiziersscheitel und weitabstehenden Ohren, engen Beinkleidern und zu gross gerathenen Füssen lungern in allen Ecken umher und benutzten die Vormittagsstunden, um sich nach halb durchschwelgter Nacht auszugähnen, fortwährend das Haar zu bürsten, dann zusammenfahrend nach dem Staubwedel zu greifen, sobald von dem Zimmer des Chefs her sich ein Räuspern vernehmen lässt — wie Katzen, die sich buckeln und putzen und bei jedem Fusstritt zusammenschrecken. Noch herrscht Stille in den Geschäften, noch fehlt die Bewegung des Tages, denn noch fehlen auch die vornehmen Kunden, die Equipagen halten noch nicht auf dem glatten Asphalt — der distinguirte „Westen“ Berlins hält noch seinen Morgen.
Und doch wogt draussen schon buntes, wechselvolles Treiben, doch pulsirt das Leben der Riesenstadt im hellen Sonnenschein mit schrillem Geräusch und dumpfem Rollen. Die Pferdebahn klingelt, die Omnibusse rumpeln, Wagen reiht sich an Wagen. Wie lang nebeneinander gezogene bunte Ketten, deren Glieder sich fortwährend loslösen, erscheinen die Passanten auf den Trottoirs. Das bleibt stehen, beäugelt die Schaufenster, aber kauft nichts; sieht sich um, drängt sich dann weiter, eilig, langsam, rastlos phlegmatisch, ernst, heiter — sich gegenseitig bekannt in dem Gefühle der Zusammengehörigkeit als Bürger einer grossen Stadt, und doch fremd jedem Einzelnen. So wogt und rauscht es auf und ab, ein lebendes Meer, glänzend, blendend, täuschend, verlockend wie dieses, auf ebener Erde voll Klippen und Untiefen, gähnend, verheerend ...
Das ist die Leipzigerstrasse, jene prachtvolle, feurig rauschende Ader Berlins, die von dem Grün der Villengärten doppelter Millionäre im Thiergarten nach dem steinernen Herzen der Residenz führt.
Es war elf Uhr am andern Tage, jene Zeit, in der die Chefs grosser Häuser nach Erledigung der wichtigsten Geschäftssachen sich behaglich in ihren Fauteuil zurücklehnen und die Zeitungen zur Hand nehmen.
Auch Rother senior sass in seinem Arbeitszimmer und rauchte behaglich seine Cigarre. Er las nicht, er schrieb nicht, er machte nur den Eindruck eines zufriedenen, glücklichen Geschäftsmannes, der es so weit gebracht hat, um statt Zahlen einmal Gedanken zu spinnen, dabei aber doch immer Zeit findet, seine Augen im Kreise umherschweifen zu lassen: durch die halbgeöffnete Glasthür nach den zwei Reihen Pulten da vorn, hinter denen gebückte Gestalten rechneten und schrieben, Folianten auf- und zuklappten; nach dem Verschlag rechts, auf dessen grosser, mattgeschliffener Scheibe mit Goldbuchstaben das vielversprechende Wort „Kasse“ stand; nach der Wendeltreppe links, die hinunter nach dem Parterregeschoss führte mit seinem bunten Musterlager von Teppichen aller Art und seinem Verkaufsgewölbe. Dann auch zog seine Hand die schwere Gardine am Fenster etwas zurück, und sein Blick glitt über den Hof hinüber nach jenem eleganten Theil des Seitenflügels, den er Rother junior nebst Frau abgetreten hatte, bis der Prachtbau draussen an der Spree vollendet und bewohnbar sein würde.
Sein einziger Sohn, sein Erbe — bei dem Gedanken an ihn thaute das Herz des Alten auf, er fühlte sich weniger Geschäftsmann, weniger Zahlenmensch, nur noch Vater, glücklicher, von schweren Sorgen befreiter Vater, der endlich seinen leichtlebigen Sohn, den dereinstigen alleinigen Träger einer Weltfirma, in ruhige Bahnen eingekehrt sieht, der das Bewusstsein hat, ihn durch ein Weib an das solide, arbeitsame Leben eines strebenden Ehemannes gekettet zu sehen.
O, wie viel Mühe hatte es ihn gekostet, wie viel Projekte hatte er gemacht, wie viele hatte ihm dieser Sohn zerstört! Und doch endlich, endlich —.
Was hatte er schliesslich darnach gefragt, dass diese Frau kein Vermögen mitbrachte, nicht einen Heller; dass er die Schulden ihres Vaters, eines ebenso berühmten wie verschwenderischen Universitätsprofessors bezahlen musste, nichts, nichts hatte er darnach gefragt! Er zerriss die lange Liste seiner goldenen Projekte und begrub seine gehegten Hoffnungen in seiner Brust, mit einem schmerzlichen Seufzer zwar, aber er that es doch, einer langersehnten Schwiegertochter wegen. Und dieses endlich erreichte Ziel hatte ihn mit seinen praktischen Anschauungen vom Leben versöhnlicher gestimmt, hatte ihn schliesslich selber mit dem Gedanken befreundet, dass ein Weib auch Kapital mit in die Ehe bringe, wenn es Geist und Liebreiz besitzt, wie Louise Wilmer sie besass, jetzt die Gattin seines Sohnes.
O, es war im Uebrigen doch Alles so nach Wunsch gegangen. Sie liebten sich Beide, der Anschein sprach dafür, sie waren gesellschaftlich gleich, sie waren ein glückliches Paar, das geschäftliche Renommée des Namens Rother war gerettet, die Basis der Zukunft fester denn je.
Alles das waren Thatsachen in seinen Augen, die ihm die Länge der Hochzeitsreise zum eigenen Wunsch gemacht hatten, die den aufquellenden Zorn im Keime erstickten, wenn er immer und immer wieder nach der bekannt gewordenen Verbindung in die Tasche greifen musste, um den zarten Anspielungen seitens ehemaliger Geliebten seines Sohnes klingend entgegen zu kommen, dadurch den dem öffentlichen Anstand gefährlichen Lästerzungen den Mund zu stopfen, sie verstummen zu machen.
Er war alt und grau, er stand allein. Jetzt sollte ihm der so oft herb empfundene Verlust der entschlafenen Gattin ersetzt werden im Familienglück des jungen Paares. Wie hatte er den Bau da draussen geleitet, wie war er bestrebt, ihn zum Tuskulum der Beiden gestalten zu lassen, mit allem Komfort des Wohllebens, mit aller Behaglichkeit soliden Bürgersinnes. O, wenn er den ersten Enkel auf seinen Knieen schaukeln wird, wenn er ihn zum ersten Mal „Grosspapa“ wird lallen hören, wenn er des Abends in sommerlicher Frische, des Winters in behaglicher Wärme den neuen und doch so alten Reiz seligen Familienlebens wird mitempfinden können, dann wird er wahrhaft glücklich sein, dann wird er friedlich, sorglos seine Tage beschliessen können.
Sie war so sonnig diese Perspektive, sie lag so klar vor seinem geistigen Auge, dass Rother senior, wie seit Jahren nicht, der zeitverschwendenden Beschäftigung unterlag, den Dampf seiner Cigarre in Ringeln aus dem Munde zu stossen. Und jeder gelungene Ring schien ihm ein vollendetes Glied in der Kette seiner Betrachtungen, das sich fest den vorangegangenen anschmiegte. Er hörte den dumpfen Lärm nicht, der von der Strasse bis nach dem stillen Hinterzimmer herüberdrang, er vergass den gewohnheitsmässigen Blick nach dem Comptoir, er träumte nur mit offenen Augen. Er schmunzelte vor sich hin, zog dann wieder die Gardine zurück und blinzelte hinüber nach dem Seitenflügel, als müsste er dort hinter den rothen Vorhängen jeden Augenblick ein rosiges Gesichtchen sehen, das ihm die Bestätigung seiner Gedanken gäbe.
Das Klopfen, das jetzt an der Glasthür ertönte, musste wiederholt werden, ehe es Gehör fand.
Dann trat ein betresster Comptoirdiener ein und überreichte einen Brief, den ein Herr abgegeben habe, der vorn warte.
Rother senior riss das Kouvert auf und überflog die Zeilen, dann wusste er genug, um die eben durchlebten Illusionen durch die Wirklichkeit des Geschäfts verdrängen zu lassen.
Er sagte ein paar Worte, dann klopfte es wieder und herein trat Robert Seidel, bisheriger erster Korrespondent von Leon Guillard, Teppichfabrik in Brüssel, empfohlen durch diesen an Rother und Sohn in Berlin.
Der alte Rother erhob sich von seinem Sitz, stützte nach seiner Gewohnheit die beiden Hände auf den Schreibtisch, sah über diesen hinweg zu dem Eingetretenen und erwiderte dessen höfliche Verbeugung durch ein Neigen des Kopfes. Dann griff er über die weisse Weste nach dem goldenen Pincenez und musterte durch dieses ein paar Sekunden lang scharf seinen Besuch, der seinen Blick voll erwiderte. Die Augen Rothers glitten über die mittelgrosse Gestalt, vom männlich-schönen Kopf über den modischen, aber nachlässig getragenen Sommeranzug bis auf die hellen Glacéhandschuhe und eleganten Stiefel.
Der Eindruck musste ein sympathischer sein, denn das Gesicht des alten Fabrikanten verlor sofort einen Theil seiner kaufmännischen Strenge.
Mit einer Handbewegung wies er auf einen Stuhl.
„Nehmen Sie Platz, Herr Seidel.“
Etwas schwerfällig wurde diesem Ersuchen Folge geleistet, wie von einem Müden, der endlich die ersehnte Ruhe findet.
Dann schritt Rother der Thür zu, schloss sie und kehrte zu seinem Fauteuil zurück.
Er hauchte auf sein Augenglas, polirte es mit seinem rothseidenen Taschentuch und frug dabei:
„Sie waren zwei Jahre im Ausland?“
„Sehr wohl, um mich in der Sprachenkenntniss zu vervollkommnen. Ein Jahr bei William Sniders in London als Kassirer, das letzte in Brüssel bei Guillard als Korrespondent.“
„Sie sind wie alt, Herr Seidel?“
„Achtundzwanzig Jahre.“
„Ein geborener Berliner —?“
„Ja wohl.“
„Sie haben hier Familie —?“
„Nein Niemand. Ich steh’ allein, ganz allein.“
Der Ton, in dem dies gesagt wurde, musste anders gewesen sein wie der der vorangegangenen Antworten, denn der alte Chef blickte plötzlich sonderbar auf, man wusste nicht, war er von Mitleid gepackt, oder betroffen von der Härte, die in dem Klang der Stimme lag.
Er machte eine Pause und benutzte dieselbe, um sein Glas vor die Augen zu bringen. Dann frug er wieder:
„Wollen Sie mir noch die Frage gestatten, was Ihr Vater war, Herr Seidel —?“
„Lehrer der neueren Sprachen, zuletzt Privatdozent an der hiesigen Universität.“
„Ah, sooo —.“
Als Rother senior diese langgedehnten Laute überraschend schnell ausstiess, befand er sich in der Lage eines Mannes, dem plötzlich eingeflösster Respekt vor Jemandem zwingt, diesem durch irgend etwas, sei es auch nur durch die Veränderung einer Miene, unbewusst Kenntniss von diesem Respekt zu ertheilen.
„So, so —.“
Der Mann vor ihm hatte durch dieses Eingeständniss seines guten Herkommens in einer halben Minute in seinen Augen ein anderes Aussehen bekommen. Dieses eine Wort „Universität“ pflegte ihm stets zu imponiren, seitdem er dabei immer an seine Schwiegertochter denken musste.
Es trat abermals eine Pause ein. Rother las noch einmal das Empfehlungsschreiben, dann begann er wieder:
„Haben Sie ein Zeugniss von Sniders in London?“
Robert Seidel zog ein grosses ledernes Portefeuille aus seiner Brusttasche und entnahm demselben ein zusammengefaltetes Papier. Er erhob sich dann und machte einen Schritt.
„Bitte —.“
Rother senior las langsam und bedachtsam. Als er fertig war und das Papier wieder zusammenlegte, nickte er, und eine halblaute Meinungsäusserung wie „vortrefflich“, die mehr für ihn selbst bestimmt war, kam über seine Lippen.
Dann schien er einen Augenblick zu überlegen, denn er trommelte mit den Fingern der rechten Hand auf die Platte des Tisches und blickte vor sich hin.
Als er sich jetzt erhob, schien er mit seinem Entschluss fertig zu sein.
„Es freut mich, Herr Seidel, durch Ihre auf unser Inserat erfolgte Offerte Ihre Bekanntschaft gemacht zu haben, um so mehr, da der Zufall gerade eine Vakanz in unserem Geschäft eintreten liess, als Sie bereits mit einem Empfehlungsschreiben an mich unterwegs waren. Ich engagire Sie hiermit als Kassirer und theilweise für das Ressort der auswärtigen Korrespondenz mit einem Salair von vorläufig achthundert Thalern, und wünsche nur noch, dass Sie sich dieses Vertrauenspostens würdig zeigen mögen.“
Robert Seidel sprach seinen herzlichen Dank aus und ergriff die ihm dargereichte Hand.
Während man noch ein paar Worte über den Tag des Antritts wechselte, hörte man vom Hofe herauf das Scharren der Pferde. Es war angespannt worden. Die Zeit war herangerückt, wo Rother senior den üblichen Besuch in der Fabrik zu machen pflegte, um sich gleichzeitig am Fortschritt des Villenbaues zu erfreuen.
Er warf einen Blick hinunter und fasste dabei nach der Westentasche, wo die Uhr steckte, als die Thür, die nach den Wohnräumen führte, knarrte und Frau Rother junior mit einem durch den Anblick eines Dritten abgebrochenen: „Lieber Papa —.“ in voller Morgentoilette hereinrauschte.
„Du, mein Kind —?“
Der alte Rother drehte sich glücklich lächelnd um und drückte seiner Schwiegertochter, die auf ihn zugeeilt war, einen Kuss auf die weisse Stirn.
Dann wandte er sich zu seinem neuen Kassirer und sagte verbindlichst in rosiger Laune:
„Auf Wiedersehen, Herr Seidel — sprechen Sie gefälligst morgen um diese Zeit wieder einmal vor.“
Frau Rothers junior und Robert Seidels Blicke begegneten sich jetzt, flüchtig und doch lange genug, um zu wissen, wer Jedes von ihnen war. Aber Keiner von Beiden wollte es im ersten Augenblick glauben. Der junge Mann starrte die Frau dort vor sich an, unhöflich, brüsk und doch erwartungsvoll, irgend ein Wort, das ihm gelte, zu vernehmen, aber es kam nicht über ihre Lippen, denn sie war in derselben Verfassung wie er. Er hatte also nichts zu erwarten. Er fühlte, wie ihm das Blut nach dem Herzen ging, plötzlich mit einem einzigen Stoss, dann ergriff er seinen Hut.
„Ich empfehle mich Ihnen —.“
Er wusste nicht, ob er sich dabei verbeugt hatte — wahrscheinlich, er nahm es an. Er wusste auch nicht, wie er die Treppe herunter kam. Aber er wusste, dass er dann im hohen, breiten, reich stuckatirten Hausflur stand und einem Mann begegnete, der gerade den zweiten Thorflügel öffnete und den er für den Portier hielt. Er hatte für diesen ein paar Fragen bereit, auf die er Antwort fand.
Als in den Strassen der Lärm der Weltstadt ihn wieder umbrauste, ihn den Heimathlosen in der Heimath, war es für ihn keine Täuschung mehr: Frau Rother junior, die Gattin seines neuen Chefs, war Louise Wilmer, seine erste Liebe, die Jugend- und Schulfreundin seiner armen verlorenen Schwester ...
Oben hatte Rother senior seiner Schwiegertochter den Arm gegeben, und mit der jungen Frau nach dem Wohnzimmer zurückkehrend, wo das Frühstück aufgedeckt war, zeigte er eine köstliche Laune, und hatte zu fragen, zu lachen, zu plaudern, dass er dabei ganz übersah, wie er nur allein spreche. Aber er war rein närrisch geworden in der letzten Zeit. Wenn ihn nur sein Personal einmal so in seinem Sich-gehen-lassen beobachtet hätte, es wäre um den alten Respekt geschehen gewesen. Dieser glückliche Schwiegervater, was hatte er Alles zu fragen ... „Hast Du gut geschlafen, liebes Kind ... Du findest Dich doch behaglich? Wenn Dir im Haushalt etwas fehlt, nicht recht ist, bitte, verschweige nichts ... Edmund hat mir gesagt, die Kammerzofe scheine Dir nicht zu gefallen, Du möchtest sie aber nicht gleich wieder fortschicken. Ich bitte Dich, sei nicht zu gutmüthig. Am Ende noch darunter leiden, Du mein Kind, das fehlte noch! Nein, Du sollst eine andere Zofe haben, diese Woche noch ... Ihr wohnt ein wenig beengt, nicht wahr? Gedulde Dich nur noch ein, zwei Monate, dann habt ihr euer Haus für euch. Wie wirst Du Dich wohl fühlen, Kindchen ... Aber Edmund könnte jetzt auch kommen. Der gute Junge! Er müht sich selbst ab, unten beim neuen Arrangement des Musterlagers.“ (Er nannte seinen Sohn jetzt sogar einen „guten Jungen“.)
Alles das brachte der alte Herr in verschiedenen Pausen hintereinander hervor, während er, den einen Zipfel der Serviette oben am Hals hinter den Kragen gesteckt, sich redlich mühte, seinem Appetit auf ein junges Huhn (seiner Lieblingsspeise) gerecht zu werden.
Während er sich dann mit der Serviette den Mund abwischte, um einen Schluck Rothwein zu sich zu nehmen, hatte er Gelegenheit, eine Wahrnehmung zu machen.
„Aber Du isst ja gar nicht, Kind. Und was sehe ich, Du siehst blass aus, scheinst so unruhig — bist Du krank? Vielleicht ein plötzliches Unwohlsein — nimm ein wenig Sodawasser, das wird helfen.“
Das fehlte noch, dass seiner lieben Schwiegertochter nicht sofort Alles zur Verfügung stände.
Rother senior sprang auf, um nach der Klingel zu schreiten, aber Frau Rother junior legte ihre feine weisse Hand auf seinen Arm.
„Bitte, Papa, bemühe Dich nicht, es ist nichts von Bedeutung. Aber wenn Du mir einen Schluck von dem leichten Wein einschenken wolltest, würde ich Dir sehr verbunden sein. Das wird dieselben Dienste thun.“
„Wenn Du meinst, Kind — sonst aber —.“
„Auf mein Wort, Papa.“
Rother senior war überzeugt, setzte sich wieder und bediente seine Schwiegertochter. Dann trat eine minutenlange Pause ein, während welcher er ängstlich durch rasche Seitenblicke das Gesicht der jungen Frau beobachtete. Wirklich, sie bekam wieder Farbe und griff ebenfalls zu Messer und Gabel.
„Ich war nur so erschrocken, Papa, beim Anblick des jungen Mannes vorhin. Denke Dir nur, das war eigentlich ein alter Bekannter von mir. Sein Vater war Privatdocent und befreundet mit meinem Papa. Wir wohnten zehn Jahre lang zusammen in einem Hause und auf einem Flur. Er hatte eine Schwester, mit der ich die Schule besuchte und die meine intimste Freundin war. Wir sind zusammen aufgewachsen. Dann starb sein Vater und wir kamen ganz auseinander. Es soll ihnen nachher sehr schlecht gegangen sein. Der Sohn wurde Kaufmann. Die Tochter gab erst Unterricht in Sprachen, dann trat sie in irgend ein Geschäft ein, ich glaube gar, sie musste arbeiten. Die gute, arme Maria!“
Die schöne Frau Rother seufzte und nippte aufs Neue am Weine.
Dann sagte sie wieder:
„Was er nur denken wird, der junge Herr Seidel! Ich glaube, er hat mich auch erkannt und wird mich für stolz halten. Wie kamst Du zu ihm? Mich interessirt das Schicksal dieser Familie lebhaft. Sie bestand aus lauter guten Menschen. Die Kinder namentlich waren vortrefflich erzogen. Ich entsinne mich noch mancher angenehmen Gesellschaftsstunde mit ihnen.“
Frau Rother sprach das so gelassen — sie schien sich ihrer Jugendliebe nicht mehr erinnern zu können.
Rother hatte mit wachsendem Interesse seiner Schwiegertochter zugehört. Erstaunt war er eigentlich nicht. Das war ein Zusammentreffen von Verhältnissen, Schicksalsschlägen, wie es tagtäglich in einer Weltstadt vorkommen kann.
Aber seine liebe Schwiegertochter interessirte sich lebhaft für diese Familie, das war genug für ihn, um ihr jedenfalls im Voraus einen Wunsch zu erfüllen. Er bemerkte, dass er Seidel als Kassirer engagirt habe ... „Seine Schwester muss auch todt sein, er sagte, er stände allein ... Du warst mit der Familie befreundet? Das ändert die Sache vollständig. Er hat auf mich sofort den Eindruck eines Mannes von gesellschaftlicher Bildung gemacht. Wir könnten ihm vielleicht den Anschluss an unsere Familie gestatten, wenn Du wünschest —.“
Rother senior war seiner Schwiegertochter gegenüber zu allen Konzessionen bereit, die ihr Familienleben behaglicher und angenehmer hätten machen können. Denn dieses Familienleben war ein Band, das auch seinen Sohn umschlang.
„O, Papa, ich würde mich freuen! Ich könnte mein heutiges Benehmen durch einige wohlmeinende Worte gut machen.“
„Also es bleibt dabei.“
Der alte Herr legte seine Serviette zusammen und reichte seiner Schwiegertochter im Aufstehen die Hand.
Dann hörte man Stimmen aus dem Vorzimmer, und Rother junior trat mit einem grossen, starken Herrn ein, der in Reisekleidung steckte, und dessen rothes, gesundes Gesicht durch einen kurzen, grauen Backenbart nicht gerade verschönert wurde.
Rother senior war erst ganz überrascht, dann stürmte er mit ausgestreckten Händen dem Besuch entgegen.
„Was sehe ich, mein lieber Freigang — diese Uberrumpelung! Nicht einmal Ihre Ankunft vorher zu avisiren!“
„Es ging nicht, ich bin auf der Durchreise und will morgen wieder fort.“
„Papperlapapp — reden Sie nicht! Sie sind ein paar Tage unser Gast. Sie kommen überhaupt wie gerufen. Wir gebrauchen Maschinen und müssen darüber sprechen.“
Es erfolgte jetzt erst eine Vorstellung der jungen Frau, die der Fabrikant Freigang benutzte, mit seiner Bassstimme dem jungen Paar nochmals persönlich seine Glückwünsche auszusprechen.
Dann war Rother senior wieder besorgt um seinen Gast.
„Sie werden uns das Vergnügen schenken, Sie bei uns frühstücken zu sehen. Louise, liebes Kind, Du bist wohl so gut —.“
Der alte Freigang unterbrach ihn sofort:
„Bitte, keine Bemühungen, meine Herrschaften. Ich komme soeben von Dressel —.“
„O, das ist schade! Dann kommen Sie aber gleich mit nach der Fabrik. Wir können im Wagen plaudern. Wollen Sie?“
Freigang senior war damit einverstanden.
„Adieu, meine Lieben. Louise, liebes Kind, Herr Freigang speist selbstverständlich bei uns.“
Er gab seiner Schwiegertochter den üblichen Kuss auf die Stirn, dann ging man.
Als die beiden Alten im Wagen dahin rollten, sagte Freigang:
„Offen gestanden, lieber Freund, ich bin eigentlich nach Berlin gekommen, um meinen Sohn zu suchen —.“
„Immer noch das alte Verhältniss?“
Im Lärm der Strasse nickte Freigang nur.
„Ihr seid Beide aus zu trockenem Holz geschnitzt. Wenn’s zusammen gerieben wird, giebt’s Feuer,“ meinte Rother nur kurz. Dann kam er hintereinander auf seine Maschinen, seinen Bau und seine Schwiegertochter zu sprechen.
Drittes Kapitel.
Die „alte Geschichte“.
„Fräulein Seidel, ich glaube gar, Sie weinen.“ Jenny Hoff war wie immer wild und geräuschvoll in die kleine Kammer gestürmt und blickte jetzt zaghaft die am Fenster Sitzende an.
O, wenn die Kleine das gewusst hätte! Sie wäre drüben in der dumpfen, schmutzigen Stube ihres Vaters geblieben und hätte ihre Lehrerin nicht gestört. Sie fand Thränen so hässlich und konnte es nicht begreifen, wie man zu weinen vermochte, wenn man so eine weisse Haut hatte, wie Maria Seidel sie besass.
Jenny hatte recht gesehen, Maria hatte wirklich geweint. Warum, weshalb? Die blonde Hoff hätte nicht zu fragen brauchen. Sie hätte keine Antwort bekommen. In diesem kleinen, einfenstrigen, armselig möblirten Zimmer mit der Aussicht nach dem tiefgähnenden, von Arbeiterkasernen eingeengten Hof war Alles Schweigen: das geheimnissvolle Dunkel, das wie ein unendlich langer, unsichtbarer Schatten immer stärker und schneller zum Fenster hereinzog und Farben und Linien verschlang; die ganze Atmosphäre, zusammengesetzt aus den emporsteigenden Dünsten der Riesenstadt und der schwülen Abendluft des Sommertages, die sich in der Kammer lagerte; die schwarz erscheinenden wenigen Möbel, die geflickte, farblose, traurig dreinschauende Gardine und das Weib am Fenster, die Bewohnerin dieser möblirten Schlafstelle am meisten. In dem hereinbrechenden Dunkel schien sich die niedrige Decke immer mehr zu neigen, herabzulassen, als wollte sie sich schliesslich, wie ein Alp auf die Menschenbrust, auf all dies Schweigen setzen und es ganz und gar erdrücken, noch todter, öder machen ...
Maria Seidel hatte nicht gehört. Wenn man in versunkenen Welten sich befindet, sind die Sinne für das Geräusch der gemeinen, wirklichen nicht empfänglich.
Was ging es auch Andere an, ob sie geweint hatte, selbst diese niedliche Tochter des Kohlenschippers, die sie vor dem Verderben bewahren wollte!
„O, wenn diese Kleine nur gewusst hätte, dass es auch Thränen geben kann, die Hass und Rache weinen — jener trockene, brennende Durst nach Vergeltung, der nach jahrelangem, wahnsinnig-schmerzhaftem Schmachten endlich die erste belebende Nahrung in erstickten, heissen Thränen findet. Wie da das Herz jubelt, wo die Augen weinen!
„Fräulein Seidel —.“
Die kleine Arbeiterin vermochte dieses Schweigen, dieses ganze Ausserachtlassen ihrer stets vorlauten Person nicht mehr zu ertragen. Sie fühlte hin und wieder, als ein echtes Berliner Vorstadtmädchen, das Bedürfniss, sich in geschwätzigen Plaudereien zu ergehen, und fand nichts peinlicher, unverständlicher, als eine Stille im Zimmer, wenn sie nicht allein war.
„Ich habe Ihnen doch nichts gethan.“
Jenny Hoff liess sich auf die Diele zu den Füssen ihrer Nachbarin nieder und fasste nach deren Händen.
Maria Seidel blickte jetzt auf.
„Du, Kleine —?“
War es die Rührung, die nach den letzten noch in ihren Ohren nachklingenden Worten Jennys sie überkam, die sie sich zu dem Arbeiterkind herniederbeugen hiess, um einen heissen, langen Kuss auf ihre Stirn zu drücken?
„Du solltest mir etwas gethan haben, harmlosestes aller Geschöpfe?“
Sie lachte. Sie wusste selbst nicht worüber — seitdem seit gestern bei ihr die Stimmungen wie Sonnenschein und Schatten wechselten.