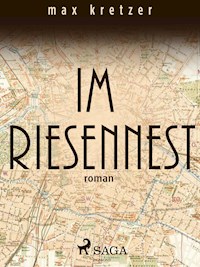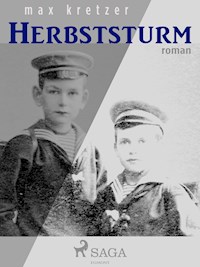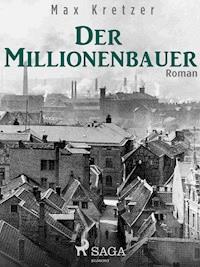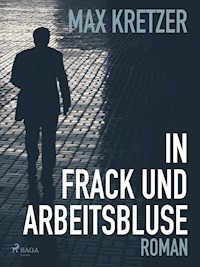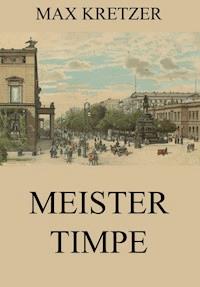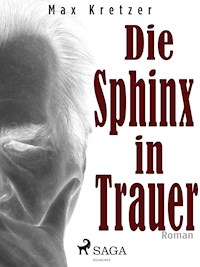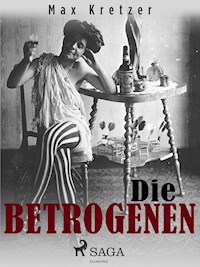Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lindhardt og Ringhof Forlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
„Vor der Maschinenhalle, einem gleich den anderen Gebäuden roten Backsteinhause, an dem die Arbeiter sämtlicher Werkstätten vorbeigehen mußten, hatten sie sich zu einem dichten Haufen gestaut und blickten neugierig zu einem großen, schwarz auf rot gedruckten Plakat empor, das an der einen eckigen Säule am Eingange des Gebäudes angeklebt war. Kaum hatte einer der Vordersten die Bekanntmachung gelesen, so war die Lücke auch schon durch einen Zweiten ausgefüllt, und während er sich durch nachdrängende Menge Bahn zu brechen suchte, hielten ihn ein paar Dutzend Arme fest, um ihn zur Mitteilung des Gelesen zu bewegen. Dann klang es in allen Tonarten wie: ›Du, was gibt’s denn?‹ – ›Was wollen sie wieder?‹ – ›Was ist denn los?‹ Und dann kam gewöhnlich dieselbe Antwort: ›’s ist wegen unserer Forderungen. Wer es wagen sollte, für den Streik zu agitieren, soll auf der Stelle entlassen werden.‹" In dieser frühen Erzählung wendet sich Max Kretzer als einer der ersten deutschen Autoren den Problemen des Industrieproletariats zu und tritt mit großer, deutlich sozialdemokratisch geprägter Verve für die Rechte der ausgebeuteten Fabrikarbeiter ein. Max Kretzer (1854–1941) war ein deutscher Schriftsteller. Kretzer wurde am 7. Juni 1854 in Posen als der zweite Sohn eines Hotelpächters geboren und besuchte bis zu seinem 13. Lebensjahr die dortige Realschule. Doch nachdem der Vater beim Versuch, sich als Gastwirt selbstständig zu machen, sein ganzes Vermögen verloren hatte, musste Kretzer die Realschule abbrechen. 1867 zog die Familie nach Berlin, wo Kretzer in einer Lampenfabrik sowie als Porzellan- und Schildermaler arbeitete. 1878 trat er der SPD bei. Nach einem Arbeitsunfall 1879 begann er mit der intensiven Lektüre von Autoren wie Zola, Dickens und Freytag, die ihn stark beeinflussten. Seit dem Erscheinen seines ersten Romans "Die beiden Genossen" 1880 lebte Kretzer als freier Schriftsteller in Berlin. Max Kretzer gilt als einer der frühesten Vertreter des deutschen Naturalismus; er ist der erste naturalistische Romancier deutscher Sprache und sein Einfluss auf den jungen Gerhart Hauptmann ist unverkennbar. Kretzer führte als einer der ersten deutschen Autoren Themen wie Fabrikarbeit, Verelendung des Kleinbürgers als Folge der Industrialisierung und den Kampf der Arbeiterbewegung in die deutsche Literatur ein; die bedeutenderen Romane der 1880er und 1890er Jahre erschlossen Schritt für Schritt zahlreiche bislang weitgehend ignorierte Bereiche der modernen gesellschaftlichen Wirklichkeit für die Prosaliteratur: das Milieu der Großstadtprostitution (Die Betrogenen, 1882), die Lebensverhältnisse des Industrieproletariats (Die Verkommenen, 1883; Das Gesicht Christi, 1896), die Salons der Berliner "besseren Gesellschaft" (Drei Weiber, 1886). Sein bekanntester Roman, "Meister Timpe" (1888) ist dem verzweifelten Kampf des Kleinhandwerks gegen die kapitalistische Konkurrenz seitens der Fabriken gewidmet. Während Kretzer anfangs der deutschen Sozialdemokratie nahestand, sind seine Werke nach der Jahrhundertwende zunehmend vom Gedanken eines "christlichen Sozialismus" geprägt und tragen in späteren Jahren immer mehr den Charakter reiner Unterhaltungsliteratur und Kolportage. Er starb am 15. Juli 1941 in Berlin-Charlottenburg.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 176
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Max Kretzer
Im Sturmwind des Sozialismus
von
Saga
Im Sturmwind des Sozialismus
© 1884 Max Kretzer
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711502631
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
Max Kretzer
Max Kretzer darf mit vollem Recht der eigentliche Begründer des „Berliner Romans“ genannt werden. Er ist am 7. Juni 1854 zu Posen geboren, allwo sein Vater Besitzer eines grossen Etablissements war, in dem Wallner sein Sommertheater aufgeschlagen hatte. Nach dem Vermögensverlust der Eltern und der Übersiedlung nach Berlin musste der künftige Dichter tüchtig zum Lebensunterhalt beitragen helfen; er wurde Maler und Zeichner. Auf dem Krankenbett, im tiefsten Jammer, schrieb Kretzer seine erste Humoreske; ihr folgten Berliner Novellen und Sittenbilder (2 Bde.), der soziale Roman „Die beiden Genossen“, bis ihn der Berliner Sittenroman „Die Betrogenen“ mit einem Schlage berühmt machte. Es folgten diesem Roman „Die Verkommenen“, „Drei Weiber“, „Meister Timpe“ u. a. Eine der bedeutendsten Kretzerschen Schöpfungen ist „Das Gesicht Christi“, ebenso der Roman „Die Bergpredigt“, nicht minder der Roman „Der Holzhändler“, der durch die „Woche“ geführt wurde. Auch auf der Bühne blieb dem Dichter der Erfolg treu; sein „Millionenbauer“, sein „Sohn der Frau“ sind Zugstücke aller Bühnen; ersteres wurde in Berlin über 200mal gegeben. Ausser diesen Werken seien noch die Romane genannt „Die gute Tochter“, „Ein verschlossener Mensch“, „Warum?“, „Irrlichter und Gespenster“, „Verbundene Augen“, „Die Madonna vom Grunewald“, „Die Buchhalterin“, „Die Sphinx in Trauer“, „Treibende Kräfte“, „Familiensklaven“, „Der Mann ohne Gewissen“, „Was ist Ruhm?“, „Söhne ihrer Väter“, die Novellen „Frau von Mitleid“, „Die Blinde“, „Maler Ulrich“, „Furcht vor dem Heim“, „Magd und Knecht“, „Das Armband“, „Herbststurm“, und die Skizzenbücher „Im Riesennest“, „Ein Unberühmter“ und „Grossstadtmenschen“. Neuerdings hat sich Kretzer wieder der Bühne zugewandt und ein Märchenstück „Der wandernde Taler“ geschaffen, das ernste kritische Geister als ein bedeutsames Werk voll tiefer Mystik erklärt haben; ebenso ein Schauspiel „Leo Lasso“.
Im Sturmwind des Sozialismus
Erstes Kapitel
Die dumpfe Dampfpfeife der Maschinenbauanstalt von Sonderthum und Sohn hatte soeben zwölf gepfiffen. Der Portier, ein Mann in den besten Jahren, mit der Tressenmütze auf dem Kopfe und der Militärdienstmedaille auf der Brust, trat aus dem Wärterhäuschen und öffnete das grosse Fahrgitter, das nach der Strasse führte, um dem in der nächsten Minute zu erwartenden Strom von einigen tausend Arbeitern neben der kleineren Passage auch die grössere frei zu machen. Er war es sonst gewöhnt, gleich nach dem Klirren der Riegel die ersten russigen Gestalten anlangen zu sehen, erst vereinzelt, wie im Gänsemarsch hintereinander, dann unregelmässig durcheinander, immer dichter und dichter, bis, einer dunklen Lawine gleich, ein festgeballter Haufen sich auf die Strasse wälzte und erst dort in langen Ketten sich auflöste. Diesmal jedoch wartete er vergeblich.
Leise pfiff er vor sich hin und wandte seinen Blick über den grossen Platz den Fabrikgebäuden zu, von wo aus dumpfes Stimmgewirr zu ihm herübertönte.
„Aha — die lesen erst den Anschlag,“ sprach er vor sich hin. „Wenn das nicht wieder böses Blut gibt, dann will ich Matz heissen.“ Er tat ein paar Züge aus seiner Pfeife und ging dann langsam seiner Wartebude zu.
Drüben, an der andern Seite des Platzes, hatte eine aufregende Szene ihren Anfang genommen. Vor der Maschinenhalle, einem gleich den anderen Gebäuden roten Backsteinhause, an dem die Arbeiter sämtlicher Werkstätten vorbeigehen mussten, hatten sie sich zu einem dichten Haufen gestaut und blickten neugierig zu einem grossen, schwarz auf rot gedruckten Plakat empor, das an der einen eckigen Säule am Eingange des Gebäudes angeklebt war. Nur die Zunächststehenden konnten es bequem lesen, und so entstand ein Drängen und Schieben, hervorgerufen durch den Wunsch, so schnell als möglich die Neugierde zu befriedigen, denn die Mittagspause war gerade lang genug, um in schnellem Schritte dem eigenen Heim oder der Speisewirtschaft zuzueilen, in aller Hast das Essen herunterzustürzen und ohne weiteren Aufenthalt aufs neue ins Geschirr zurückzukehren.
Kaum hatte einer der Vordersten die Bekanntmachung gelesen, so war die Lücke auch schon durch einen Zweiten ausgefüllt, und während er sich durch nachdrängende Menge Bahn zu brechen suchte, hielten ihn ein paar Dutzend Arme fest, um ihn zur Mitteilung des Gelesenen zu bewegen. Dann klang es in allen Tonarten wie: „Du, was gibt’s denn?“ — „Was wollen sie wieder?“ — „Was ist denn los?“ Und dann kam gewöhnlich dieselbe Antwort: „’s ist wegen unserer Forderungen. Wer es wagen sollte, für den Streik zu agitieren, soll auf der Stelle entlassen werden.“
Und nun folgte der Ausbruch eines tiefen Grolls, der sich in halblauten Verwünschungen bemerkbar machte und als ein Zeichen des Klassenhasses zu betrachten war. Jene leidenschaftlichen Bewegungen der Gesichtsmuskeln zeigten sich, die dem Unterdrückten eigen sind, wenn er die Faust in der Tasche ballt und bei jedem Schritt das Klirren der Kette hört, die die Freiheit der Bewegung nimmt.
Nach solchen Äusserungen, die wie eine Parole von Mund zu Munde gingen, kam es wohl auch vor, dass der Hohn bei einzelnen wie eine Rakete hervorplatzte und seine beissenden Funken nach jenen Seiten sandte, wo sie frischen Zündstoff fanden und aufs neue hell aufloderten.
Da war ein altes kleines Männchen mit tiefdurchfurchtem Gesicht und spärlichem grauen Stoppelbart, seines Zeichens ein Stellmacher. Man konnte es diesem Antlitz ansehen, dass der Sturm des Lebens darüber gebraust war und unerbittlich jede Hoffnung im Keime erstickt hatte. Achtzehn lange Jahre hatte er hintereinander unermüdlich und treu in einer Wagenfabrik gearbeitet und seine besten Kräfte geopfert, bis eines Tages der Fabrikherr der Meinung war, der Alte könne ihm für denselben Lohn nicht mehr so viel verrichten wie in früheren Jahren. Und so zahlte man ihm am nächsten Sonnabend sein Geld mit dem Bemerken aus, er brauche nicht mehr wiederzukommen. Jetzt war er hier gegen einen niedrigen Verdienst für kleine Reparaturen angestellt.
„Lasst sie doch nur drohen, so viel sie wollen,“ begann er hasserfüllt. „Der Tag ist vor der Tür, wo sie kirre werden. Die sollen lange suchen, ehe sie andere Arbeiter bekommen — gerade jetzt während der Gründerzeit, wo alle Hände voll zu tun haben. Haha! Das soll mich freuen, wenn sie die Karre nicht mehr aus dem Dreck bekommen.“
Hinter ihm stand ein halbwüchsiger junger Bursche mit geschwärztem Gesicht, der dem Sprecher zunickte. „Das sollt ich meinen,“ begann er. „Ob sie kirre werden! Sonst müssen sie das Strafgeld an die Agenten berappen, wenn die Maschinen für die Brasilier nicht zur rechten Zeit fertig werden.“
Der Alte blickte auf und sah sich nach dem Burschen um. Im nächsten Moment hatte er ihn am Arme gefasst und zog ihn mit sich fort. „Komm, Anton, ich hab dir etwas zu sagen.“ — In einiger Entfernung, seitwärts von dem Gedränge blieb er mit dem Burschen stehen und fragte hastig: „Was ist’s mit dem Strafgeld? Ich bin daraus nicht klug geworden. Rede.“
„Das ist doch einfach, Schmidt,“ begann der Gefragte. „Sie wissen doch, der Laufjunge vorn im Kontor ist mein Cousin!“
Schmidt nickte ungeduldig. „Weiter, weiter!“
„Der hat mir neulich erzählt, die Sonderthums hätten mit den Agenten, welche die Lieferung der Maschinen für die Brasilier auszuführen haben, einen Kontrakt abgeschlossen, wonach die Sonderthums hunderttausend Taler Strafe bezahlen müssen, wenn die Maschinen nicht bis zum ersten Oktober fix und fertig sind.“
„Weisst du das genau?“
„Ganz genau. Mein Cousin sagt, er hätte neulich zwischen dem jungen Sonderthum und dem ersten Buchhalter, dem alten Ehrentraut, das ganze Gespräch belauscht. Alle Tage sprechen sie davon.“
Der Bursche entfernte sich und Schmidt blickte sinnend vor sich hin. Dann murmelte er: „So also hängt die Geschichte zusammen.“ Er lachte still in sich hinein. „Jetzt haben wir eine Waffe in Händen, die wir hübsch benutzen wollen. Wartet nur, ihr Geldprotzen! Ich will schon agitieren, dass euch Hören und Sehen vergehen soll.“
In diesem Augenblick kam ein neuer Strom Neugieriger hinzu. Es waren die Schmiede der ganz nach hinten liegenden Werkstätten, die gewöhnlich zuletzt die Fabrik verliessen. Allen voran ging ein junger, herkulisch gebauter, blondlockiger Mann. Sein scharfgeschnittenes Gesicht zeugte von Intelligenz, und seine blauen Augen blickten frei und offen in die Welt hinein. Das war der Schlosser Karl Wegener, Vorsitzender des sozialdemokratischen Vereins der Schmiede und Schlosser, bei dessen Mitgliedern er seiner Beredsamkeit wegen in hohem Ansehen stand. Schmidt zog ihn beiseite und erzählte, was er soeben von dem Burschen vernommen hatte. Wegener hörte ihm aufmerksam zu.
Die knapp gemessene Mittagszeit trieb zur Eile, und so hatte der Portier endlich die Genugtuung, die laut schwatzenden Scharen an sich vorüberziehen zu sehen.
Die Zurückgebliebenen gingen nach dem grossen Esssaal der Fabrik, wo die Frauen mit dem zugetragenen Mittagsessen ihrer harrten. Nur Wegener und Schmidt standen noch an derselben Stelle und unterhielten sich halblaut.
„Das müssen wir ausnutzen, gar keine Frage,“ begann Wegener. „Am besten wär’s, wenn wir das sofort drucken liessen, damit’s bei der Versammlung alle wissen. Nur mit dem Verteilen in den Werkstätten steht’s schlimm. Es sind da noch so manche, die nicht mit unserer Sache sind —“
„Das überlass nur mir — ich werde es schon betreiben, dass allen das Wasser im Munde zusammenläuft. ... Du besorgst also das mit den Zetteln?“
Wegener nickte. „Noch heute abend werde ich in unserer Assoziation ein paar Zeilen setzen lassen.“
„Das wirst du nicht tun, Karl!“
Hinter ihnen tauchte ein schwächlich gebauter, junger Arbeiter auf. Er hatte, von den beiden unbemerkt, das ganze Gespräch mit angehört und stand jetzt unerwartet vor ihnen. Das lange, nach hinten schlicht gekämmte Haar, die Brille, die er trug, das durchgeistigte Gesicht hätten ihn als einen Studenten kennzeichnen können, wenn nicht die hellblau gestreifte, bis über die Knie herabfallende Bluse und die rauhen, in den Flächen geschwärzten Hände in ihm den Handwerker verraten hätten.
Die schlanke, schmale Gestalt nahm sich fast wie die eines Zwerges neben Wegener aus, aus dessen Gesicht der Unmut sofort wich.
„Ach, du bist’s, Reinhard. Mit dir kann ich darüber nicht streiten. So gute Freunde wir auch sonst sind, in sozialen Angelegenheiten liegt ein Abgrund zwischen unseren Ansichten.“
Er wandte sich zur Seite und flüsterte Schmidt zu, dass sie über ihren Plan am Nachmittag noch sprechen wollten. Dann ging dieser dem Tore zu.
„Ja, du hast recht, Karl, es liegt ein Abgrund zwischen deiner Meinung und meiner Meinung. Weiss Gott, ich gäbe viel darum, wenn ich wenigstens dich nicht zu jener verblendeten Menge zu zählen brauchte, die einem Phantom nachjagt, das unerreichbar ist. Aber lassen wir das jetzt. Komm, Anna wird mit dem Essen warten.“
Sie gingen an der Maschinenhalle vorbei dem prachtvollen Wohnhause der Besitzer zu. Eine Weile schritten sie stumm nebeneinander, bis Wegener das Schweigen brach.
„Du sagst verblendete Menge. Das ist wieder eins jener Schlagwörter, mit denen man uns in den Augen unwissender Menschen herabzusetzen sucht. Ganz vernünftig finde ich diese Menge. Sie will endlich auch etwas vom Leben haben.“
Reinhard Wald brauste auf: „Die Art und Weise, wie du den Kontraktabschluss über die Lieferung der Maschinen zum Vorteile des bevorstehenden Streiks ausbeuten willst, ist eine Handlungsweise, die geradezu niedrig und hinterlistig ist.“
Die Stirn des jungen Riesen verfinsterte sich auf einen Augenblick, dann kehrte seine gute Laune zurück.
„Lieber Reinhard, das ist doch nur ein Mittel zum Zweck, um unsere Forderungen durchzusetzen.“
„Gewiss, so ein richtiges Mittel, wie es Erbschleicher oder Jesuiten zu gebrauchen pflegen. Immer mit offenem Visier kämpfen, Karl, das musst du dir zur Parole machen.“
„Ich seh schon, Reinhard, wir werben nie dieselbe Meinung haben.“
Sie waren am Hause angelangt, bogen dann links ab und gingen eine Mauer entlang, die einen grossen, prächtig gepflegten Garten einschloss, der dicht an das Wohnhaus anstiess. Ganz am Ende dieser Mauer öffnete Reinhard eine Pforte, und beide betraten den Garten, her eher den Eindruck eines Parks machte. Sie durchschritten ihn und waren an ihr Ziel gelangt. Hier stand ein kleines weissgetünchtes, fast ganz unter wildem Wein verborgenes einstöckiges Haus, das zu der Besitzung der Sonderthums gehörte.
Reinhards Vater hatte das Amt eines Gärtners zu verwalten und wohnte hier mit seinem Sohne und seiner achtzehnjährigen Tochter, der hübschen Anna, die es Karl Wegener angetan hatte, der hier regelmässig sein Mittagbrot einnahm, da ihm der Weg nach Hause zu weit war.
Der alte Wald nannte Anna nur seinen Augapfel, und Karl Wegener hätte es auch gerne getan, aber er traute es sich nicht. Hundertmal hatte er es sich schon vorgenommen, und ebenso oft kam er wieder davon ab. Er war ihr so recht von Herzen gut und hätte so gern gewusst, ob sie es ihm auch sei, aber dieser junge Herkules war in Liebesangelegenheiten ungeheuer blöde.
Er stand in zahlreichen Versammlungen im Wortgefecht, wenn die Leidenschaft der Meinungen die Köpfe erhitzt hatte, und er war nie verlegen um Worte, wenn er angegriffen wurde, aber diesem schelmisch blickenden Krauskopf gegenüber blieben ihm die Worte in der Kehle stecken.
Der alte Wald stand seit zwanzig Jahren im Dienste des Kommerzienrats Sonderthum. Damals, als er eintrat, bestand die Fabrik noch aus einem einzigen Gebäude, befand sie sich erst in ganz bescheidenen Anfängen. Von dem Palast, der sich jetzt dort vorn kühn zum Himmel türmte, war noch nichts zu sehen, aber Energie und Fleiss, auch wohl eine gute Portion Glück hatten dem damaligen unbekannten Friedrich Sonderthum zur Seite gestanden und dieses grossartige Werk geschaffen, das jetzt mit der ganzen Welt in Verbindung stand und zu einer Fundgrube des Reichtums geworden war. Vor ein paar Jahren hatte der alte Chef seinen Sohn Georg als Kompagnon ins Geschäft aufgenommen, und seitdem überliess er diesem fast die ganze Leitung, ohne jedoch seine Autorität ganz aufzugeben.
Wald war erst Hausdiener beim Alten gewesen, da er aber die Gärtnerei erlernt hatte, wurde ihm eines Tages die Aufsicht der Anlage übertragen, die er zum Schmuck des Besitztums umzuwandeln verstand. So meinte wenigstens immer Fanny, die Tochter des Kommerzienrats, ein siebzehnjähriges Ding, das nicht im mindesten stolz auf seinen Reichtum war. Dafür zeugte die Freundschaft, die sie zu Anna, ihrer Jugendgespielin, offen zur Schau trug, und von der auch viel auf Reinhard überging, den sie stets als viel zu gebildet für einen Arbeiter erklärte.
Ihr Bruder Georg dagegen hatte diese Jugenderinnerungen längst vergessen. Und so fand er diesen Verkehr höchst unpassend, was aber Fanny sehr wenig berührte. Sie lasse sich vom Bruder nicht Befehle erteilen, das war die jedesmalige Antwort. Eine gewisse Abneigung gegen ihn hatte sich ihrer bemächtigt, als sie eines Abends im Park ungesehen Zeugin war, wie ihr Bruder in heftiger Leidenschaft ihre Freundin Anna umfasst und sie in verletzender Weise belästigt hatte. Erst als das junge Mädchen drohte, laut um Hilfe zu schreien, liess er es los und verschwand in den dunklen Gängen.
Georg Sonderthum war ein arger Lebemann, der es verstand, das Geld unter die Leute zu bringen und dennoch in den Augen seines Vaters der biedere fleissige Sohn zu bleiben, dem das Geschäft über alles geht. Der Kommerzienrat war in dieser Beziehung blind und baute fest auf die Umsicht seines Kompagnons, dem er die Zügel in Händen liess.
Der alte Wald hatte noch einen Sohn, den Ältesten, der Kaufmann geworden war und nun im Kontor als Kassierer eine einträgliche Stelle innehatte.
Wie in jeder Familie immer ein Kind als Liebling verhätschelt wird, dem man auf Kosten der andern mehr zuwendet, so war auch Paul Wald dieser Liebling, aus dem irgend etwas Grosses werden sollte. So wurde er denn in eine hohe Schule geschickt und dann zum Kaufmann bestimmt, während Reinhard frühzeitig Mechaniker wurde, von früh bis spät tätig sein musste, und doch noch Zeit fand, um in einsamen Nachtstunden seine Lernbegier zu befriedigen und sich ein Wissen anzueignen, vor dem man alle Achtung haben musste.
Es war damals eine tolle Zeit, die Periode der Gründerjahre. Die Jagd nach dem Gelde brauste über das Land und riss alles in wahnsinnigem Verlangen nach dem Besitz des Mammons mit sich fort. Es war ein Rausch, wie er alle Jahrhunderte einmal vorkommt, dann aber alles trunken macht und mit sich fortschleift in den Strudel der Schwelgereien, bis dann nach Jahren die Exnüchterung eintritt, das glänzende Kartenhaus über Nacht zusammenstürzt und das Elend die letzten Trümmer zusammensucht.
Der Genuss war an der Tagesordnung und die Maitressenwirtschaft trieb ihre schönsten Blüten. Alles wollte geniessen. Der Adel wurde zum Aushängeschild für Krämer, und die Krämer wurden dadurch zu Rittern geschlagen; Titelfürsten zeigten den Dummen aus dem Volke ihre purpurgefütterten Kronen, und „das Volk, der grosse Lümmel“, war so ehrlich und vertraute dem — Fürstenwort. Von allen Seiten strömten die Sparpfennige der Armen herbei, die den Witwen und Waisen ein Notgroschen werden sollten. Millionen wurden aus diesen Sparpfennigen zusammengescharrt und sie zerrannen auf Nimmerwiedersehen unter den Fingern dieser Direktoren, dieser Verwaltungsräte, dieser gekrönten Protektoren, dieser Konsortien von Schwindel, Betrug und Habgier, die den Armen und Elenden unter der Maske der Ehrlichkeit das letzte Hemd auszogen und das Frohlocken verbargen, mit dem sie es zu Geld machten.
Die Diebe aus Not steckte man einfach ins Gefängnis, die Betrüger aus Prinzip fuhren auf Gummirädern durch die Strassen und blickten verächtlich auf den „Pöbel“, der diese Gummiräder mit seinem Schweisse bezahlt hatte. Und dieser Wurm der moralischen und materiellen Zerstörung, der wie die Pest das Land überzog, begann denn auch, nachdem er die sogenannte gute Gesellschaft angefressen hatte, sich in das Mark der unteren Klassen festzusetzen und es langsam, aber sicher auszusaugen. Das Proletariat, diese vielköpfige Hydra der Gesellschaft, erhob sein drohendes Haupt und zeigte der Welt hohnlächelnd die Brosamen, mit denen man es abspeisen wollte. Das Versammlungsrecht war die Keule, mit der es die Schläge austeilte, um seine Macht zu zeigen.
Die Streiks wurden organisiert und jener gewaltige Druck ausgeführt, der den Klassenhass in seiner ganzen erschrecklichen Grösse zeigte. Die Sozialdemokratie spann ihre Netze aus, und die „hungernden Streikler“ waren die verlassenen Herden, die zuerst hineinliefen. Das war der „dumpfe Massenschritt hungernder Arbeiter“, den man als Köder auswarf.
Die jungen Leute in den Bankhäusern und Fabriketablissements, die als Kontoristen angestellt waren, hatten ihren guten Tag, und in den Aktiengesellschaften den besten, man brauchte recht viel Personal, und wenn es auch überflüssige Elemente gab — die Aktionäre bezahlten alles.
„Leben und leben lassen! Wie der Herr so der Diener!“ So rief man sich gegenseitig zu und warf das Geld mit vollen Händen um sich.
Was Wunder also, dass Paul Wald ebenfalls sich dem Leichtsinn in die Arme warf und den tollen Reigen des lustigen Lebens begann. Er zog weg von seinen Eltern, denn er wollte sein eigener Herr sein und niemand Rechenschaft ablegen über sein Gehen und Kommen. Als seine Mutter noch lebte, waren seine Besuche häufiger, seit deren Tode aber, der vor einigen Monaten eingetreten war, kam er immer seltener und seltener. Und nun erst wurde der alte Wald gewahr, was er an seinem Reinhard besass, den er oft vernachlässigt hatte. —
Als dieser und Karl das kleine Häuschen erreicht hatten, kam Anna ihnen schon mit einigen wohlgemeinten Scheltworten über das heutige lange Ausbleiben entgegengesprungen.
„Sie haben wohl ganz vergessen, Herr Wegener, dass ich Ihnen gestern versprach, heute Ihr Leibgericht zu kochen?“ Sie drohte ihm und lachte dabei so schelmisch, dass dem jungen Riesen ganz warm ums Herz wurde und er sie am liebsten gleich an seine Brust gezogen hätte.
Der alte Wald kam um das Haus herum, und man setzte sich stillschweigend zu Tisch.
Er sah heute merkwürdig finster aus, so dass es allen auffiel. Nach der Suppe räusperte er sich und unterbrach das Schweigen. „Nun Kinder, habt ihr den Anschlag gelesen?“
Karl Wegener bejahte und Reinhard nickte.
„Nun — was meint ihr, ist das in der Ordnung so?“
„Nein, Herr Wald, das ist ein Terrorismus, mit dem die Sonderthums doch nichts ausrichten werden.“
„So, hm, hm.“ Des Alten Gesicht verfinsterte sich noch mehr. „Terrorismus? Was verstehen Sie unter Terrorismus?“
„Wenn man uns mit Gewalt Rechte nehmen will.“
„Nennen Sie das Recht, diese Aufhetzereien zum Streik? Diese masslosen Lohnforderungen?“ stiess der Alte heftig hervor.
„Aber Vater —.“
„Sei ruhig, Mädel! Du verstehst davon nichts“
„Aber ich, Vater, ich verstehe etwas davon,“ warf Reinhard ein. „Wir können darüber ja in aller Ruhe sprechen.“
Wald sah seinen Sohn an. „Ja, dass du etwas davon verstehst, das glaub’ ich. Du sitzest ja die ganzen Nächte über deinen Büchern, da musst du es wohl. Aber ich dachte bisher immer, du wärest ein Gegner dieser, die mit Gewalt alles durchsetzen wollen.“
„Gewiss, Vater, ich verdamme den Streik, weil er die Kluft zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer nur noch mehr erweitert, wenn ich auch die Lohnforderungen bei der jetzigen Geschäftslage gerechtfertigt finde. Aber der Arbeiter von heute, Vater, ist kein Sklave mehr, trotzdem ihn so manche dafür ansehen möchten. Man darf ihm sein Brot nicht entziehen wollen, weil er seine Meinung anderen mitteilen will. Karl hat recht, wenn er dieses Vorgehen der Sonderthums Terrorismus nennt.“
Wegener warf seinem Freunde einen dankbaren Blick zu, und Anna drückte ihrem Bruder verstohlen unter dem Tisch die Hand.
Wald schwieg sich aus, während Reinhard wieder begann: „Vater, du weisst doch schon lange, dass Karl Sozialdemokrat ist. Du hast ihm das noch nie zum Vorwurf gemacht, weshalb denn gerade heute deine schlechte Stimmung? Aber ich ahne schon den Zusammenhang. Georg von drüben hat dich aufgesucht und dir zu verstehen gegeben, dass man es ungern sieht, Wegener so oft in deinem Hause zu wissen. Ist es nicht so, Vater?“
„Ja, Reinhard. Georg hat mit Vater darüber im Garten gesprochen, ich weiss es,“ fiel Anna ein.