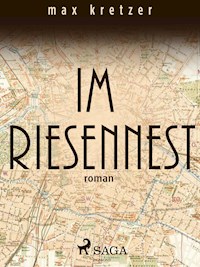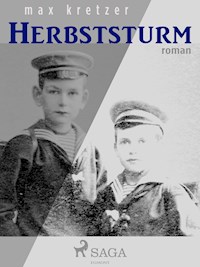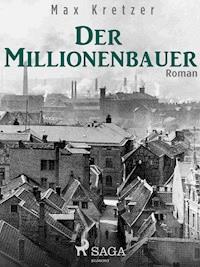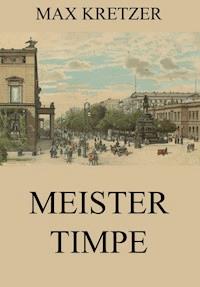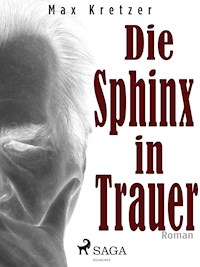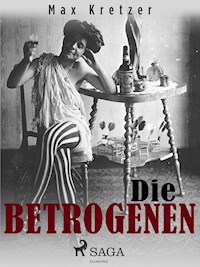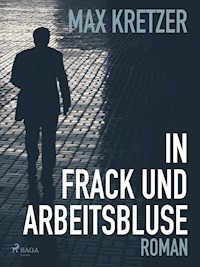
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Friedrich Tempel war das schwarze Schaf seiner Familie. Statt eines anständigen bürgerlichen Berufs heuerte er auf verschiedenen Überseeschiffen an, schlug sich als Kellner durch und fing dann mit einer kleinen Gastwirtschaft in Schmargendorf an. Am Ende seines Lebens ist der ewige Junggeselle richtig reich. Um seiner Familie, die ihn bis zum Schluss geschnitten hat, einen Denkzettel zu verpassen, vererbt er sein ganzes Vermögen seinem Neffen Waldemar. Der sympathische junge Mann war mit seinen Freunden häufiger Gast im Lokal, ohne auf ein Erbe zu spekulieren. Allerdings ist an die Erbschaft eine einjährige Arbeitszeit in einer Berliner Fabrik gebunden – als einfacher Arbeiter wohlgemerkt. Amüsiert fängt Waldemar, der echte Arbeit gar nicht kennt, bei Fabrikdirektor Geiger an. Der ahnt allerdings nichts von dem bürgerlichen Hintergrund seines neuen Angestellten. Aber die ersten Monate werden viel härter als gedacht. Als teilweise auch noch Waldemars Doppelleben als Arbeiter tagsüber und nächtlicher Bohemien Verwirrung stiftet, steht er auf einmal einer Ex-Verlobten, einer Möchtegern-Verlobten und seiner heimlichen Liebe gegenüber. Ein turbulenter Roman – (nicht nur aus der Welt) einer Fabrik.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 443
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Max Kretzer
In Frack und Arbeitsbluse
(Waldemar Tempel)
Roman
Drittes und viertes Tausend
Saga
In Frack und Arbeitsbluse
© 1920 Max Kretzer
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711474693
1. Ebook-Auflage, 2017
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
I.
Ende Oktober erlebte Fabrikbesitzer Geiger etwas Überraschendes, wie es ihm ähnlich noch nicht begegnet war. Vormittags gegen elf Uhr sass er in seinem Privatkontor und hatte sich gerade nach allerhand Morgengeschäften etwas Luft gemacht, als ihm ein Unbekannter gemeldet wurde, der ihn auf einige Minuten zu sprechen wünsche. Auf der kleinen mit Goldschnitt versehenen Karte stand weiter nichts als der Name Waldemar Tempel. Der rundliche, bewegliche, stets über unliebsame Störungen klagende Herr Ferdinand Geiger, den seine Freunde kurzweg mit Nante bezeichneten, wollte schon heftig werden, weil man den Besuch nach seinem Begehr zu fragen vergessen hatte, als er noch rechtzeitig einen Blick durch das kleine Lugfenster ins grosse Kontor warf und dort einen dunkel gekleideten Herrn stehen sah, der den Eindruck eines neuen Kunden auf ihn machte. Und so sagte er kurz und geschäftsmässig: „Ich lasse bitten.“
Ein etwas mitgenommen aussehender junger Mann sass dann vor ihm, dessen tadelloses Benehmen aber sofort auf gute Erziehung schliessen liess. Er hatte sehr schönes, glänzendes Haar, und in dem angenehmen Gesicht mit der kühnen Nase und dem modisch gestutzten Schnurrbart sprachen ein paar kluge und klare Augen ihre reizvolle Sprache.
Und es entspann sich folgendes Gespräch:
„Womit kann ich Ihnen dienen?“
Mit Arbeit, mit irgend welcher Arbeit in Ihrer Fabrik.“
Geiger, der ihn jetzt erst sprechen hörte, glaubte einen Ausländer vor sich zu haben, der sich nicht richtig auszudrücken verstehe. Daher sagte er entgegenkommend: „Sie können bei mir alles bekommen, was Sie wünschen.“ Und schon langte er nach Mustertafeln und einem Preisverzeichnis, als er über seinen Irrtum aufgeklärt wurde und zwar in einer Form, die ihm jeden Gedanken an „Ausländerei“ nahm. Sofort wurde sein Ton ein anderer, schwand das stolze Bild da vor ihm.
„Ach, Sie wollen Beschäftigung bei mir haben? Det is jut, sehr jut.“
anchmal fiel er um, besonders in Fällen, die seine Urwüchsigkeit als Berliner herausforderten, und so tat er sich keinen Zwang mehr an. „Ja, lieber Herr, hör’n Se mal .... Danach hätten Sie auch im Kontor fragen können — bei meinem Pokuristen. Es ist gar keine Vakanz vorhanden. Bedaure, bedaure. Was sind Sie denn. Buchhalter?“
Er sagte es wie zur Verabschiedung, nachdem er sich ärgerlich erhoben hatte. Aber der andere bewog ihn durch seine andauernd höfliche Haltung weiter zum Anhören. Er sei weder Buchhalter noch etwas anderes, habe auch keine Sehnsucht nach Schreibertätigkeit, die er als Gebildeter schliesslich auch wo anders bekommen könne. Sein Wunsch gehe nur nach harter Handarbeit, denn erstens verlange das die Wiederherstellung seiner Nerven, und zweitens seine ganze Zukunft, die er sich nur durch eine gänzlich veränderte Lebensweise erobern könne. Im übrigen müsse er arbeiten, denn er stehe vis-a-vis de rien.
Er sprach es mit müder, verhaltener Stimme, aber doch in der überlegenen Art des Mannes aus guter Gesellschaft, der voraussetzt, dass seinesgleichen ihn nach dieser Darlegung verstehen werde.
Nante Geiger, nahe daran, ihn nun für einen Narren zu halten, blähte die gesunden Apfelwangen unter einem zurückgedämmten Lachen und liess die hellen, beweglichen Augen über den ganzen, noch so frisch gefirnissten Menschen gleiten, vom sorgsam, fast kokett gescheitelten Haar bis zu dem modernen, blitzblanken Schuhwerk, über dessen schmaler Gelenkumspannung ein Streifen des bronzefarbenen Modestrumpfes unter der Bügelfalte der Hose gerade noch hervorlugte.
Und sofort griff Waldemar Tempel diesen Blick verständnisvoll auf: „Ich bitte, sich nicht an die Lackstiefel zu stossen, damit wollte ich mich nur gut bei Ihnen einführen,“ sagte er verbindlich mit leichter Selbstverspottung. „Die werde ich natürlich ablegen müssen, wenn ich zu Ihnen ins Geschirr gehe.“
„Ja, haben Sie denn was gelernt?“ fragte ihn dann Geiger gemütlich, nachdem er sich von der Verblüffung einigermassen erholt hatte.
„Bisher nur Geld auszugeben, und dazu gehört wohl kein besonderes Talent. Ich bitte, darin keine Frivolität zu erblicken. Es hätte für mich gar keinen Zweck zu heucheln, nachdem ich hier mit der Absicht aufgetaucht bin, in Ihnen meinen Lebensretter zu sehen.“
„Lebensretter is jut,“ warf Geiger trocken ein, da er plötzlich geneigt war, hinter dieser sonderbaren Einführung eine kleine Komödie zu erblicken, bei der man es lediglich auf seine Tasche abgesehen habe. Als Förderer der Wohltätigkeit hatte er genug verschämte Arme kennen gelernt, die auf die kühnsten Schliche gekommen waren. Er sah nach der Wanduhr und wollte schon dem seltsamen Anliegen mit offener Abweisung begegnen, als er durch den Hinweis auf eine vorzügliche Empfehlung davon zurückgehalten wurde.
In diesem Augenblick musste er das Gespräch unterbrechen, denn durch die Tür vom Flur her trat seine Tochter in elegantem Strassenkostüm herein, das hübsche Gesicht noch rot vom scharfen Herbstwinde draussen.
„Ich störe wohl, Papa?“
„Nein, nein, Helmine. Aber wie kommst du denn hierher?“
„Ich war auf dem Görlitzer Bahnhof, das weisst du doch: Tante Ottilie ist abgereist.“
„Ach richtig.“
„Ich wollte dir nur sagen —“
Waldemar Tempel schnellte in die Höhe und machte seine artige Verbeugung, wobei er fast die Hacken zusammen nahm, und zum Dank kam ein freundliches Nicken, begleitet von einem rasch musternden Blick.
Vater und Tochter traten ans Fenster und sprachen dort halblaut weiter, so dass der Wartende jedes Wort hören konnte.
„Wer ist das?“
„Ach, nichts von Bedeutung,“ erwiderte Geiger, und seine Miene schnitt jede weitere Bemerkung darüber ab. Für ihn stand da nur ein stellenloser Mensch, der für seine verwöhnte Tochter lediglich „Sache“ war.
Nichts von Bedeutung! Waldemar Tempel wiederholte diese Worte in Gedanken und lächelte still vor sich hin, so wie jemand lächelt, der eigentlich etwas darauf erwidern möchte, durch Umstände aber daran verhindert wird. Dann aber erschien ihm dieses Urteil sehr treffend, angepasst seiner Lage, denn um in Bedeutungslosigkeit zu versinken, war er hierher gekommen.
Er kehrte sich der Wand zu und betrachtete ein Bild, um sich die Zeit zu verkürzen. Dabei spitzte er aber unwillkürlich die Ohren, denn hinter seinem Rücken fielen ein paar Namen, die in ihm die wonnige Erinnerung an das fröhliche Leben jener sonnigen Welt erweckten, in der man sich niemals langweilt, die er aber nun, einem hässlichen Zwange folgend, auf bestimmte Zeit verlassen sollte.
„Aber hör’ mal, Papa, du darfst nicht vergessen, dass wir am zwanzigsten zu Frau von Lettendorf geladen sind, zum ersten Male,“ plauderte Helmine weiter. „Ich freue mich riesig darauf. Es soll da geradezu reizend sein.“
„Ja, ja,“ warf Geiger unruhig ein.
„Und dann denk’ daran, dass wir am zweiten November unseren ersten Abend haben. Und dann kommen Hertels, der Abend im Zoo, das Wagnerkonzert, na, und so weiter.“
„Jajaja,“ kam es nun ächzend über des Vaters Lippen, da ihm diese Sache schon zu lange dauerte.
Ganz besonders der Name Lettendorf klang Tempel so vertraulich, als spräche ihn eine gute Bekannte aus, und als müsste er sich plötzlich in die Unterhaltung mischen mit den Worten: „Wie geht es denn eigentlich der Teuren? Wollen Sie nicht die Güte haben, mich ihr bestens zu empfehlen?“
Zum Glück ging Helmine, so dass er seine Haltung bewahren konnte.
„Also grüss’ Mama, ich komme heute etwas später.“
„Danke, Papa.“
Zum zweiten Mal machte Tempel seine tadellose Verbeugung, und abermals erhielt er den Kopfnicker, der diesmal allerdings etwas kühl ausfiel. Aber mit Vergnügen sog er den kalten Veilchenduft ein, den sie nun beim Gehen wieder aufgescheucht hatte.
Geiger nahm das Empfehlungsschreiben aus Tempels Händen entgegen, überflog es noch im Stehen und bat dann, wieder Platz zu nehmen. Und auch er setzte sich aufs neue, nunmehr bedeutend höflicher geworden, denn da schrieb ihm ein höchst ehrenwerter Mann, der Justizrat Dietzel, Königlicher Notar am Kammergericht, bekannt auch als Stadtverordneter, dessen persönlicher Begegnung hin und wieder er sich entsann, dass Herr Waldemar Tempel, Sohn des verstorbenen Architekten Reinhard Tempel und seiner Gemahlin Mathilde, geborene von Schmesow, nach einem „bedauerlichen Nichtstuerleben“ den zwar etwas sonderbar klingenden, aber erklärlichen und gewiss anzuerkennenden Wunsch hege, auf einige Zeit sein Heil in einer Fabrik zu suchen, um, entgegen seinen bisherigen Gewohnheiten, durch irgend welche ihm zusagende, aber durchaus harte Arbeit andere Anschauungen vom Leben und von der Welt zu bekommen. An diesem Entschluss sei nicht mehr zu rütteln, und so werde Herr Ferdinand Geiger freundlichst gebeten, dem „begabten und geistig hervorragenden“ jungen Mann, der auch sonst viel Liebenswürdigkeit besitze, bereitwillig sein Entgegenkommen zu zeigen.
„Ist das nun wirklich Ihr Ernst?“ fragte Geiger, nachdem er den Brief noch einmal gelesen hatte.
„Ich würde mich schämen vor Ihnen, wenn es anders wäre,“ erwiderte Tempel einfach.
„Es liegen doch nicht etwa besondere Dinge vor, die Sie zwingen (er räusperte sich), auf solche Art die Flucht zu ergreifen?“
Tempel glaubte ihn zu verstehen. „Ich habe weder im Gefängnis noch im Zuchthause gesessen,“ sagte er mit leichter Heiterkeit. „Natürlich bin ich auch noch nicht mit Ehrverlust ausgezeichnet.“
Geiger lachte verlegen. „Nee, nee, das mein’ ich nicht, den Eindruck machen Sie nich,“ redete er sich aus, denn etwas Ähnliches hatte er sich gedacht. „Da hätte mir der Geheimrat wohl schon so’n kleinen Wink gegeben. Der wäre schliesslich dafür verantwortlich. So ganz neu wäre die Sache übrigens nicht.“
Und er sprach davon, dass ihm der Verein zur Besserung entlassener Strafgefangener schon zweimal Leute zugeschickt habe, die sich ganz gut bewährt hätten. Natürlich habe von den Werkstattkollegen niemand etwas von deren Vergangenheit gewusst.
Tempel sass mit brennendem Gesicht da, so wie ein Mensch, der eine heimliche Folter unverdient ertragen muss. Und um sich Luft zu machen, fügte er ernst hinzu: „Gestraft bin ich allerdings, aber nur durch meinen Lebenswandel, der mich so weit gebracht hat. Aber Sie werden mir wohl zugeben: bestraft hätten eigentlich diejenigen werden müssen, die mich erstens falsch erzogen haben, und zweitens mir frühzeitig zu viel Geld in die Hände gegeben haben.“
„Das ist richtig,“ warf Geiger lebhaft ein. „Manchmal verdienen die Eltern noch im Grabe eins drauf. Entschuldigen Sie nur —: ich hatte nicht die Ehre, Ihren Herren Vater zu kennen, aber wenn Sie es selbst sagen ....“
„Pardon, es war mein seliger Grosspapa, dessen Liebling ich war.“
„Na, dann verdient der Grosspapa eins drauf. Vielleicht hat das Petrus schon besorgt ... Übrigens sagen Sie mal —: der Name Tempel ... Tempel ... Tempel. Da dämmert mir etwas. Mir ist’s so, als hätt’ ich da mal irgend was in der Zeitung gelesen: ’ne dolle Jeschichte von einem jungen Mann, der ’ne Korsofahrt mit zehn Droschken die Linden entlang machte. Am hellen, lichten Tage. In jeder sass’n Dienstmann. Nachher hat er allen ein Essen gegeben — in’n Zelten. Zaren Sie das vielleicht?“
Waldemar Tempel nickte zustimmend. „Ich bekenne mich schuldig dieser Freveltat, die eine von meinen kleineren Sünden war.“
Nante Geiger lachte wieder. „Mein Gedächtnis! Na, besser, als wenn’s welche aus den Amorsälen gewesen wären.“
„Das sagte ich mir auch. Sie mögen daraus ersehen, Herr Geiger, dass ich schon immer etwas für das Volk übrig hatte. Um so leichter wird mir jetzt der Übergang auf das andere Geleis werden.“
„Sie hatten wohl damals so’n kleenen Tick wej, wie?“
„Ich schwamm in einem ganzen Meere von Ticks, bis ich eben auf dem Trockenen sass.“
„Und dann kam der Katzenjammer.“
„Und auch die Reue.“
„Ja, die kommt immer, wenn’s zu spät ist,“ sagte Gei ger und sann einen Augenblick nach.
Es ging ihm noch etwas im Kopf herum, das seine Bedenken wach hielt. Vor längerer Zeit war ihm nämlich ein Buch in die Hände gekommen, das den Titel, „Drei Monate Fabrikarbeiter“ führte, und worin irgend ein Schriftsteller, der sich als Arbeiter verdingt hatte, seine Erfahrungen zum besten gab. Wer konnte wissen, ob dieser junge Herr nicht eine ähnliche Absicht hatte und die vorgebrachten Dinge nur heuchelte. Der Schwindel in der Welt war gross. Es gab zwar bei ihm nichts zu „enthüllen“, immerhin aber hatte jede Fabrik ihre kleinen Geheimnisse, die man nicht gern an die grosse Glocke gebracht sah. Es war doch auffallend, wenn ein bisher verwöhnter Mensch, der sicher andere nützliche Dinge hätte treiben können, gerade Arbeiter werden wollte, ausgerechnet in seiner Fabrik. Und er machte kein Hehl aus dieser Ansicht und meinte, dass er sich die Sache noch sehr überlegen müsse.
Tempel dachte einige Augenblicke nach, ob er Geiger sogleich mit der ganzen Wahrheit kommen solle, die fernab von dessen Vermutungen lag. Dann aber hielt er es für besser, darüber zu schweigen, was ihm um so leichter wurde, da dem zukünftigen Brotgeber weder Nachteil noch Unannehmlichkeiten daraus erwachsen würden. Um ihm aber das letzte Misstrauen zu nehmen, versicherte er aufs neue mit bewegten Worten, dass es ihm nur darum zu tun sei, durch harte Selbstprüfung zu einem arbeitssamen Menschen zu werden.
Solle er Stadtreisender werden? Oder Versicherungsagent? Nein. Dadurch würde er sich dem Gespötte seiner Freunde aussetzen und Gefahr laufen, ins alte Bummelleben zu kommen, wenn auch auf andere Art. Oder solle er vielleicht nach Amerika gehen, um dort zu verkommen? Nein, nein! Er hänge mit grosser Liebe an seiner Mutter, die über diese Trennung höchst unglücklich werden würde und vor Gram sterben könnte. Er sei dafür, im Lande zu bleiben und sich ehrlich zu ernähren. Hier draussen in der Fabrik würde ihn niemand von seiner alten Gesellschaft zu sehen bekommen, und so könne er sich mit Duldung und Behagen in die neuen Verhältnisse fügen. Sei es überhaupt eine Schande, harte Arbeit zu treiben? Das müsse Herr Geiger, von dem es ihm bekannt sei, dass er sich aus kleinen Verhältnissen, durch eigene Kraft, zu Reichtum und Ansehen emporgerungen habe, doch wohl am meisten anerkennen.
Damit hatte Tempel die schwache Seite Nantes berührt, wodurch er gewöhnlich zu haben war, denn Geiger gehörte zu den offenen Naturen, die ihre Vergangenheit nicht zu verleugnen pflegen, vielmehr sich ihrer beizeiten mit einem gewissen Stolz zu erinnern wissen.
„Was Sie da sagen, lieber Freund, hat ja vieles für sich,“ warf er schmunzelnd ein, ersichtlich bestrebt, über das empfangene Lob nunmehr mit Anstand zu quittieren. Wenn Geiger schon „lieber Freund“ sagte, so war sicher anzunehmen, dass sein Widerstand bereits halb bezwungen war.
„Haben Sie nicht sonst noch Referenzen?“ fragte er dann, schon fertig mit seinem Entschluss.
„O, eine ganze Menge,“ erwiderte Tempel, „aber Sie werden es erklärlich finden, wenn ich unter solchen Umständen keinen Gebrauch davon machen möchte. Man zeigt sein Skelett nicht gern den alten Freunden .... Wie wäre es denn, wenn Sie sich hier in meiner Gegenwart telephonisch mit dem Herrn Justizrat in Verbindung setzen würden? Dann müsste Ihnen doch jedes Misstrauen schwinden. Ich bitte sogar darum.“
Geiger hatte schon daran gedacht, sich aber geniert, es auszusprechen, um seinem Zweifel nicht auch noch die beleidigende Form zu geben. Nun jedoch liess er sich sofort an seinem Schreibtisch nieder, setzte den losen Apparat des Fernsprechers an Mund und Ohr und redete darauf los. Er hatte das Glück, den Justizrat vorzufinden, und so gab er seiner Stimme einen anderen Tonfall, wobei er unwillkürlich eine kleine Verbeugung machte, als hätte er den alten Herrn persönlich vor sich.
Tempel fand das so komisch, dass er sich sein Lachen verbiss. Dann vernahm er nur, was Nante mit ausgesuchter Höflichkeit, so in seinem saloppen Berlinisch hineinrief; aber aus seiner Miene, besonders aus der Art und Weise, wie er die hellen Augen aufriss, beim Zuhören unaufhörlich nickte, dann wieder den Kopf wiegte, lächelte und einen Indianerruf ausstiess, glaubte Tempel auf die Antwort schliessen zu können. Und fast war es ihm, als hörte er die etwas krächzenden Laute seines Gönners, der ihm als einer der Testamentsvollstrecker seines Onkels den Weg zu diesen Gemütsmenschen hier gewiesen hatte. Hoffentlich hatte der Alte keine Dummheit gemacht und zuviel gesagt, dann wäre es mit dem Maskenspiel hier vorbei.
„Jut, jut, Herr Rat, soll bestens besorgt werden,“ tutete Geiger zum Schluss noch hinein. „Danke, danke. Gleichfalls, gleichfalls.“
Dann stapfte Herr Nante Geiger vorerst auf seinen kurzen Beinen im Zimmer umher, wobei er seinen soliden Bauchansatz, umspannt von einer buntgetüpfelten Modeweste, etwas wackelnd nach Seemannsart, wiederholt der geöffneten Kontortür zutragen musste, weil von dort her allerlei kleine Anfragen kamen, natürlich stets nach einem respektvollen Klopfen. Alsdann zündete er sich eine grosse, dicke Zigarre an, zog sich seine schottisch-karrierte Hausmütze über die Sardellenlichtung auf dem Schädel, und steckte dann das runde Apfelgesicht durch das kleine Fensterchen ins Kontor hinein.
„Herr Neumann, ich geh’ mal nach der Fabrik. In ’ner halben Stunde bin ich wieder hier. Fräulein Mücke kann später zu Tisch gehen.“
Er meinte damit die „Klapperschlange“, die das Stenogramm nach seinem Diktat aufzunehmen hatte.
Dann bat er Tempel, ihm zu folgen.
Zu seinem Mitgefühl kam auch die Klugheit, denn dieser schon etwas lädierte junge Mann hatte durch sein einnehmendes Wesen einen derartig günstigen Eindruck auf ihn gemacht, dass er sich der Einbildung hingab, er werde aus ihm etwas formen können, das auch ihm von grossem Nutzen sein würde: einen sogenannten Edelarbeiter, den man der Welt als Muster zeigen könne. Über ein solches Experiment hatte Nante Geiger schon oftmals nachgedacht, und hier winkte ihm die Erfüllung. Zwar kam ihm der ganze Fall noch immer etwas märchenhaft vor, aber auch in einem Märchen konnte eine gesunde Wahrheit enthalten sein.
„Haben Sie denn wirklich gar nichts gelernt?“ fragte er ihn dann noch zum Überfluss, als sie schon den Flur hinter sich hatten, und nun, an zwei mächtigen Rollwagen vorbei, über den ersten Fabrikhof schritten, dem rotgemauerten Hauptgebäude zu, dessen hundert mattgestrichene Fensterscheiben wie ebensoviele blinde Augen ins Leere starrten. Man verspürte die Arbeit schon, ohne dass man sie sah, denn das innere Erbeben des ganzen Hauses sandte seine verhaltenen Grolllaute dumpf durch die Mauer.
„Ich kann etwas zeichnen,“ erwiderte Tempel, „auch habe ich als Junge aus Brotteig allerhand hübsche Figucen geformt.“
Geiger lachte. „So’n Nussknacker haben wir wohl alle mal gemacht. Das wird Ihnen wohl nicht viel dienen; höchstens, dass Sie Geschicklichkeit in die Finger kriegen. Wenn Sie aber zeichnen können — das ist schon was. Da können Sie bald avancieren. Ich sagte immer: Wer zeichnen kann, der sieht mehr.“
Der grosse Torweg, der ihnen wie ein dunkles Maul entgegenklaffte, nahm sie auf. Dann umgab sie das lärmende Geräusch eines Fabriksaales, in dem alles in Tätigkeit ist.
Tempel, der vorsichtig hinter seinem Führer schritt, liess dieses Arbeitsorchester wie eine wilde, schlecht gestimmte Musik auf sich wirken, die sich unheimlich in die Ohren bohrt. Von der langen Reihe der Drehbänke an der Fensterflucht schrillten entgleiste Klarinettentöne auf, die ihm durch Mark und Bein gingen. Und hinein mischte sich das Surren und Summen der Treibriemen und ein leises, unaufhörliches Fauchen, das von einem unsichtbaren Ungeheuer auszugehen schien. Tempel sah eigentlich nichts Bestimmtes; er sah nur rasende Bewegungen an der Decke, schwarze, dahinschnellende Streifen und eine Garnitur blauer Blusen, auf der hell die Mittagssonne lag. Nur hin und wieder erhob sich ein Kopf, wandte sich ihnen ein neugieriges Gesicht zu, um sich aber gleich wieder über die Arbeit zu beugen.
„Nun, wie wird Ihnen? Haben Sie immer noch Lust?“ fragte ihn Geiger, als sie den ersten Saal hinter sich hatten und nun über den Flur über die andere Seite gingen.
„Ich danke, es geht,“ erwiderte Tempel verbindlich. „Ich bekomme jetzt erst recht Lust.“
„Na, und die Nerven —?“
„Die werden sich an die Symphonie gewöhnen müssen. Ein Geräusch hebt das andere auf.“
Und um dieses Thema nicht weiter auszuspinnen (denn in Wirklichkeit waren seine Nerven durchaus nicht abgestumpft), erging ec sich in Bewunderung über den grossartigen Betrieb, was Geiger so angenehm berührte, dass er ihm unaufgefordert Aufklärung über die verschiedensten Dinge gab, wobei er nicht vergass, wiederholt einzuwerfen: „Das ist noch gar nichts.“
„Sie wissen doch, dass ich Beleuchtungsartikel fabriziere,“ sagte er dann, als sie wieder ins Parterre hinunterstiegen. Und er fügte hinzu, dass er heute nicht mehr die Zeit habe, dem Neuling den ganzen Betrieb zu zeigen, der sich noch im zweiten Hof weiter fortsetze, und von dem man bis jetzt nur einen kleinen Teil gesehen habe. Alles das werde ja Tempel nach und nach noch zu Gesicht bekommen, wenn es ihm ernst mit dem Aushalten sei.
Sie durchschritten mehrere kleinere Werkstätten und kamen dann in einen Raum, in dem Rohmaterialien aufgestapelt waren und an einem kleinen Pult der Verwalter sass, ein Mann mit einem Lockenkopf, der in seinem ganzen Aussehen, auch in seiner Kleidung, ein Mittelding zwischen Kontorist und Werkführer war.
„Peters, hören Sie mal,“ begann Geiger mit gespitztem Munde, „dieser Herr hier wird vom Montag ab als Lohnarbeiter eingestellt, verstehen Sie? Es liegt ihm daran, irgend eine ihm zusagende Beschäftigung zu erhalten, um sich mit der Branche vertraut zu machen.“ Das fiel ihm so ein, um eine Erklärung dafür zu finden. „Hier unten wird sich das am besten machen, sprechen Sie einmal mit Knox, ich kann ihn nicht finden.“
Und er stellte Tempel dem anderen kurz vor und behandelte dann die Sache rein geschäftsmässig.
Peters, der dahinter einen guten Bekannten seines Chefs witterte, schüttelte sich die Mähne aus der Stirn und machte seine Verbeugung vor Tempel. Dann gab er ihm rasch die nötigen Anweisungen für sein Erscheinen am Montag.
„Lassen Sie sich wieder mal die Haare schneiden, Peters,“ sagte Geiger noch, was er jedesmal tat.
Als er dann mit Tempel wieder hinausging, schlug es gerade zwölf, und die Arbeiter strömten aus allen Türen ins Freie.
Im Torweg, auf einem Handwagen, stand ein Bursche und sprach etwas Putziges zu einer Horde gleichaltriger Jungen, worüber die ganze Bande lachte.
„Das ist unser Faxenmacher,“ sagte Geiger so im Vorübergehen, ohne der kleinen Szene weiter Bedeutung beizulegen.
Auf dem Hofe empfahl er sich durchaus höflich.
Tempel bedankte sich für das freundliche Entgegenkommen und zog tief den Hut.
Dann liess er sich von dem schwarzen Menschenstrom hinaustragen auf die Strasse, so mit dem traurigen Bewusstsein eines Menschen, der bald auf lange Zeit hinaus in diesem Strome untergehen wird.
II.
Um Waldemar Tempels sonderbaren Lebensschritt zu begreifen, muss man die eigentlichen Gründe dazu kennen, die seine kleinen Abweichungen von der Wahrheit Geiger gegenüber erklärlich und verzeihlich machten.
Im Spätsommer dieses Jahres starb der alte Einsiedler Friedrich Ludwig Karl Tempel in Schmargendorf, ein Mann, über den man sich zuraunte, dass er trotz seiner Gebrechlichkeit immer noch rege gewesen sei, sein schon grosses Vermögen nach Möglichkeit zu vermehren.
Aus angesehener Bürgerfamilie stammend, hatte er in seiner Jugend Schiffbruch gelitten, sich bald hier, bald dort herumgetrieben, war Steward auf verschiedenen Überseedampfern gewesen und hatte dann, von Heimweh getrieben, diesen Beruf als Kellner in Berlin fortgesetzt, wodurch er mit seinen Angehörigen zerfiel und schliesslich von seinem Vater enterbt wurde. Das hatte ihn zwar gegen die ganzen Tempels verbissen gemacht, ihm aber die Zähigkeit nicht genommen — im Gegenteil ihn erst recht dazu getrieben, zu zeigen, was er könne. Mit seinen Ersparnissen kaufte er eine kleine Gastwirtschaft im stillen Schmargendorf, noch zur Zeit, als ein Ausflug nach dort einer Landpartie gleichkam. Er besass billig erworbenes, ausgedehntes Land, das er nun, als die Berliner sich in Scharen draussen ansiedelten, mit hohem Gewinn an den Mann zu bringen verstand. Schliesslich hatte er so viel verkauft, dass er sich zur Ruhe setzen und die Gastwirtschaft einem anderen überlassen konnte.
Nun, da er sich „Rentier“ nannte, zeigten die nächsten Verwandten, ganz besonders sein „lieber Bruder“ der Architekt, die Neigung, ihn wieder in Gnaden, mit offenen Armen, aufzunehmen. Jetzt wollte er aber nicht, denn natürlich witterte er nur Erbschleicherei dahinter. Und so verkapselte er sich diesen Hoffenden gegenüber immer mehr in seine Unnahbarkeit.
Das hinderte ihn aber nicht daran, besonders zur Zeit, als er noch Gastwirt war, die entfernteren Verwandten, die „Seitenlinie“, wie er sie nannte, mit viel Freundlichkeit zu empfangen, wobei er seine Scherze und Witze bereit hatte. Dann drückte er jedem die Hand, liess ihn im besten Glauben, der allein Bevorzugte zu sein, strich aber mit Vergnügen die Zeche ein.
Eine kurze, unglückliche Ehe, die er als gereifter Mann mit einem jungen Ding aus Berlin eingegangen war, hatte ihn später menschenscheu gemacht. Man erzählte sich, dass er nur acht Tage verheiratet gewesen sei, und dann schon Gelegenheit gehabt habe, auf Scheidung zu klagen. So hatte er also keinen direkten Leibeserben, und es war erklärlich, dass ihm, je älter er wurde, der Gedanke an seine Hinterlassenschaft Kopfschmerzen verursachte.
Mehrfach hatte er sein Testament umgestossen. Zuerst war Schmargendorf mit dem grössten Teile seines Vermögens bedacht worden, denn er hing mit Liebe an der Scholle. Ein grosses Krankenhaus sollte gebaut werden. Dann aber bekam er Streit mit dem Gemeindevorstand, dem obendrein noch eine böse Auseinandersetzung mit dem Landrat folgte. Und so schwur er sich hoch und teuer, seinen lieben Ortsnächsten keinen Pfennig anzutun. Die sollten froh sein, ihn in ihrer Mitte gehabt zu haben, schon wegen der grossen Portionen, die er ihnen als Gastwirt verabreicht hatte.
Seinen einzigen Bruder, noch bei dessen Lebzeiten als Haupterben einzusetzen, wie es ihm, einer besseren Regung folgend, einmal einfiel? Nein. Der hätte längst selbst ein hübsches Vermögen haben können, wenn er sich nicht in unglückliche Bauspekulationen eingelassen haben würde, die ihn grössenwahnsinnig machten. Ausserdem hatte er sich immer für etwas Besseres gehalten und am meisten gegen ihn beim Vater gehetzt. Der Lohn war zwar nicht ausgeblieben, indem der Alte das hübsche Vermögen seinem einzigen Enkel Waldemar vermacht hatte, der es dann nach seiner Grossjährigkeit hübsch unter die Leute zu bringen verstand.
Es hätte auch der Fall eintreten können, dass die ganze bewegliche und unbewegliche Habe als Niessbrauch in die Hände der Frau Architekt übergegangen wäre, — na, und die hatte er, Friedrich Ludwig Karl Tempel, erst recht im Magen, obgleich sie ihm persönlich niemals etwas Schlimmes zugefügt hatte. Aber sie stammte aus adeliger Familie, wenn auch aus einer verarmten, und so war es wohl anzunehmen, dass sie sich erst recht als etwas Besseres vorkam, und den „Kellner“ am wenigsten vergessen konnte.
Somit blieb nur noch einer der Allernächsten, und das war „Musjö Waldemar“, das liebe, verzärtelte Muttersöhnchen, dem man schon seit der frühesten Kindheit alles nachgesehen und das man immer als Wunderkind ausposaunt hatte. Hatte sich was mit dem Wunderkind! Wunder erweckte er zwar, aber immer in anderem Sinne: bei den Leuten, die die Hände über den Tunichtgut zusammenschlugen und die Frage aufwarfen: „Was wird das einmal werden?“ Na, und es wurde ja auch so allmählich etwas aus ihm: ein Talent mit Ärmeln“, wie der Berliner zu sagen pflegt. Poussierstengel und Kneipier. Schon mit sechzehn Jahren, als er kaum flügge geworden war, immer „mang die Mächens“. Dann, als er anfing, Student zu werden, eine rote Mütze auf und ein buntes Band über die Weste. Und nun immer mehr bei den Schänkmamsells als auf der Universität. Mit dem Jus ging es aber nicht lange, denn das war ihm selbst gegen den Strich. So kam denn der „Kunststudent“ heran, der damit endete, ein wenig in den Ateliers des Vaters herumzuschnüffeln, um wenigstens Zeugnis vom Geborensein abzulegen. Und baute mit und nannte sich Architekt.
Und doch hatte Friedrich Ludwig Karl in seinem Herzen gerade für diesen etwas übrig, wenigstens mehr, als für alle übrigen. Das hing mit dem gutartigen Wesen des Jungen zusammen, in dem nichts von dem Dummstolz seines Vaters enthalten war. Viel Natur, so wie er. Fast fand er etwas Verwandtes darin, soweit er an seine eigene Jugendunstätigkeit dachte. Nur dass er, der Onkel, frühzeitig durch die Schule des Lebens gegangen war und sich dadurch wiedergefunden hatte aus Trotz gegen die eigene Sippe. Dem Neffen stand das vielleicht noch bevor, wenn erst das liebe Mamachen das Zeitliche gesegnet haben und er mit ganz leeren Taschen dastehen würde.
Auch war Waldemar der Einzige, der manchmal zu „Onkel Karl“ hinauspilgerte, schon damals, als er noch das schöngelegene Lokal mit dem schattigen Garten hatte. Als junges Bürschchen zog er da hinaus und schleifte einen Haufen gleichalteriger Freunde mit, die dann alles auf den Kopf stellten. Dann kam Leben in die Bude, so dass Onkel Karl sich selbst wieder jung fühlte, mitlachte, dann einen heimlichen Seufzer tat und bei sich dachte: Wenn’s meiner wär’, ich wollte schon etwas aus ihm machen. Er pumpte ihm sogar hin und wieder einen Taler, immer mit dem Refrain: „Wiedersehn macht Freude.“ Als dann Waldemar jedesmal den Taler wiederbrachte, nahm er ihn zwar an, schenkte ihn ihm aber wieder. Denn in dem Worthalten des Jungen erblickte er einen hübschen Zug. Es steckte also doch so etwas wie ein guter Kern in ihm. Die Eltern hatten ihn bloss anfaulen lassen. Es freute ihn dann auch, dass der Neffe, älter geworden, immer noch hinaus nach Schmargendorf kam und ihm seinen Krankenbesuch machte, stets mit derselben Redensart: „Du, Onkel Karle, ich komme nicht von wegen Riecherei, ob du bald abschiebst. Vermachen tust du mir ja doch nichts.“
Und der Griesgram erwiderte so mit verärgerter Miene: „Ich euch Bande was vermachen? Nich ’ne alte Serviette, die doch früher mein Handwerkszeug war.“ Denn in die Freude über den Besuch mischte sich doch das Misstrauen, dass Waldemar nur gekommen sein könnte, um auf den Busch zu schlagen.
„Nein, nein, diesem leichtlebigen Burschen konnte er auch nicht das schwer erworbene Geld in den Schoss schütten, so angenehme Eigenschaften er auch hatte, ganz besonders die, die „Seitenlinie“, worunter sich einige Musterexemplare befanden, als „Ausschussware“ zu bezeichnen.
Die schönen dreihunderttausend Mark auf der Bank, das schöne Haus in Berlin und die schöne Villa in Schmargendorf! Friedrich Ludwig Karl Tempel, der im Stillen eine offene Hand hatte, kam darüber nicht ins Reine mit sich. Zwei Gewalten kämpften andauernd in ihm: der Schmerz der Trennung vom Besitz und der Gedanke an die Einzig-Würdigen. Der grosse Zug für allgemeine Wohltätigkeit fehlte ihm ganz besonders seit dem Krach mit seiner Gemeinde. Staatliche und städtische Einrichtungen waren seiner Meinung nach überhaupt nur da, um die Steuerzahler zu ärgern. Dann schon in den sauren Apfel beissen und dem besten aus der Sippe den Tanz an seinem Grabe gönnen. Dieser Hader mit sich selbst raubte ihm die letzte Lebensruhe, so dass er gelb vor Ärger wurde.
Da, als er vernommen hatte, dass die runden Taler seines seligen Vaters bei dem Musjö Waldemar immer spärlicher rollten und er annehmen durfte, dass das liebe Mamachen darunter zu leiden beginne, und als ihm dann sein Magenleiden auch den letzten Appetit raubte, er immer mehr zusammenklappte und in visionären Stunden den Mann mit der Hippe in der Ferne schrittweise aber sicher herankommen sah, — da raffte er sich zu einem letzten Entschluss auf, wie ihn zusammenbrechende Kraftmenschen oftmals zeigen. Er liess seinen Rechtsberater, den Justizrat Dietzel, zu sich bitten, liess von ihm seinen letzten, unumstösslichen Willen aufsetzen, ernannte ihn und seinen Freund Hagedorn, auch so einen verflixten groben Kerl in Schmargendorf, zu Testamentsvollstreckern, und legte sich an diesem Tage zum ersten Male ruhig schlafen. Aber bevor er zu träumen begann, lachte er sich seinen Galgenhumor aus, laut und herzhaft, und sein Selbstgespräch dabei war: „Die sollen die Platze kriegen.“
Vier Wochen darauf war er tot.
Und vierzehn Tage später fand an Gerichtsstelle die Testamentseröffnung statt, feierlich und trocken im Beisein aller vom Justizrat Benachrichtigten, darunter auch die „Seitenlinie“.
Und es hiess:
„Ich, Friedrich Ludwig Karl Tempel usw. usw. ernenne hiermit meinen Neffen, den ewigen Studenten, Viktor Hugo Waldemar Tempel, Sohn des usw. usw. zum Universalerben meines gesamten beweglichen und unbeweglichen Vermögens, das in folgendem besteht usw. usw., mit Ausnahme der unter e) verzeichneten Legate usw., unter der Bedingung, dass er sich seinen Lebensunterhalt während mindestens eines Jahres als Lohnarbeiter in einer von den Testamentsvollstxeckern gut geheissenen Berliner Fabrik erwirbt, um auf diese Art zu der Erkenntnis zu kommen, dass der Wert des Daseins nicht im Nichtstun und unerspriesslichen Geldausgeben besteht, und um sich dadurch meiner hiermit erwiesenen Grossmut würdig zu erzeigen.
Für den Fall, dass mein Neffe sich ausser Stande erklärt, sich dieser Bestimmung zu unterwerfen, oder die ihm auferlegte Verpflichtung weder teilweise noch ganz zu erfüllen, und zwar aus ihm allein zur Last fallenden Gründen, soll ein Drittel meines Gesamtvermögens dem Musikus Robert Emanuel Philipp Kladisch usw., Sohn der Witwe Amalie Kladisch, geborene Tempel usw., zufallen, in Anerkennung eines mir freiwillig dargebrachten Geburtstagsständchens, dem Einzigen unter meinen Verwandten, der mich nicht angepumpt hat; die übrigen zwei Drittel jedoch zu gleichen Teilen den unter e) verzeichneten Personen. Auf alle Fälle, auch ohne Erfüllung der ihm auferlegten Verpflichtung, jedoch nur nach der unter b) vorgesehenen Erklärung seinerseits, fällt meinem Neffen ein Legat von fünftausend Mark zu, das auf das Dreifache erhöht werden soll für den Fall, dass er durch eingetretene, von einem Arzte zu bescheinigende Krankheit bei Ausübung seines Berufes verhindert sein sollte, die ihm auferlegte Bedingung bis zu Ende zu erfüllen, jedoch nur, nachdem der Nachweis für eine mindestens halbjährige, ununterbrochene Tätigkeit, bei guter Führung, in der Fabrik erbracht ist.
Stirbt mein Neffe im Laufe seiner neuen Tätigkeit, nach welcher Frist es auch sei, so fällt das unter a) angeführte bewegliche und unbewegliche Gesamtvermögen inkl. aufgelaufenen Zinsen den unter e) angeführten Personen, wozu in diesem Falle die Mutter meines Neffen, die Frau Mathilde, verwitwete Architekt Tempel, geborene von usw., zu rechnen ist, zu gleichen Teilen zu, mit Ausnahme der Frau Dorothea Alwine Musdal, Gattin des Seifenhändlers Theodor Emil Georg Musdal. Die ausgezahlten Legate werden in Anrechnung gebracht.“
Es folgten dann noch eingehende Bestimmungen für die Testamentsvollstrecker über Realisierung der toten Werte, über Kapitalsanlage und über die Ausführung der harten Verfügung, damit nicht etwa durch irgend welche Umgehungen der vorgesehene Universalerbe auf leichte Art in den Besitz des Vermögens kommen könne.
Ein origineller Querkopf hatte seine letztwilligen Bestimmungen getroffen, und ein tüchtiger Jurist hatte ihm dabei geholfen. Gut und Böse lagen nebeneinander; aber das Gute überwog doch. Kraft und Wille eines einzelnen wurden herausgefordert, zugleich aber auch der Neid der anderen erweckt, und für alle war das liebe Geld der Köter, um den sie sich balgen konnten, gleich einer Meute goldhungeriger Menschen, die, in ihren Instinkten einmal losgelassen, beutelustig, mit wilder Gier auf den Spuren des Glückes dahinstürmt.
Und diese Meute fand sich gleich am Tage der Testamentseröffnung zusammen.
Als jetzt Waldemar Tempel Geigers Fabrik in der Reichenbergerstrasse hinter sich hatte und nun der Hochbahn zustrebte, noch immer mit dem niederdrückenden Gefühle eines Menschen, der plötzlich vor einer erstaunten Menge reiten soll, ohne es zu können, tauchte ihm der denkwürdige Tag wieder auf, eigentlich als in seiner Erinnerung schon lange zurückliegend, obwohl erst ein paar Wochen seitdem vergangen waren. Aber etwas Unbegreifliches, Aussergewöhnliches wirkt so schwer auf den Menschen, dass er wie unter einer Last von Monaten dahingeht.
Und er sah sich, seine schwarzgekleidete, feinzügige Mutter am Arm, stolz und abseits durch den kalten und grauen Gerichtskorridor dahinschreiten, vorüber an den lieben Verwandten, von denen er kaum zwei dem Ansehen nach kannte. Acht Menschen standen und sassen da herum, alle lange vor der Zeit erschienen, den Ernst von Leichenbittern im Gesicht, der sich so rasch in Freude nach dem Trinkgeld verwandeln kann. Da man aber noch nicht wusste, ob der andere bevorzugt worden war, so wog man einstweilen die Worte und liess seine ganzen Empfindungen in ein kurzes Lob über den Entschlafenen ausströmen.
Man war gerufen, und das war doch schon etwas.
Eine kleine Trauergemeinde, jeden Augenblick bereit, einer Andacht beizuwohnen, schien sich da zusammengefunden zu haben. Es fehlten nur die Kränze, um das beginnende Leichenbegängnis zu wittern.
Natürlich kannten sie Mutter und Sohn, und kaum hatte einer das Eis durchbrochen, so ging das Gezeter los. Die natürlich würden die Haupterben sein, denn das waren ja „die Nächsten und die Feinen“.
Seifenhändler Musdal, der seinen Kriegervereinszylinder älteren Jahrganges mit Würde auf seinem inzwischen breiter gewordenen Schädel trug, musste es am besten wissen, denn er hatte die Tochter einer Cousine des Toten zur Frau und bildete sich daher ein, über diese Dinge besser unterrichtet zu sein. Er war überhaupt der Mann, der alles schon vorher kommen sah. Er sprach auch viel davon, wie gut er sich mit dem „lieben Onkel“ gestanden und was dieser ihm alles anvertraut habe! Natürlich existierte dies alles nur in seiner Phantasie, aber es machte sich so schön, wenn die anderen die Mäuler aufsperrten.
Waldemar Tempel sah die Mienen und machte sich sein Bild daraus. Der grüne Neid blickte ihm nach, und fast wiegte er sich schon in der Hoffnung, der alte Einsiedler da draussen könnte den Hass gegen den Bruder Architekten in letzter Stunde aufgegeben haben.
„Ich glaub’s nicht, mein Sohn,“ sagte die Mutter seufzend. „Machen wir uns nur auf Enttäuschungen gefasst.“
Musikus Kladisch, der nie mit seiner Frau ausging, hatte sie allein von allen übrigen höflich begrüsst, besonders die „Frau Baumeister“, und sogar gewagt, sie anzusprechen, wonach man ihm auch die Freude einer kurzen Unterhaltung gönnte. Er hatte zwar gleich den anderen niemals Beziehungen zu diesen Verwandten gehabt, roch aber schon die Bevorzugung des Neffen, und so konnte es nichts schaden, wenn er sich beliebt machte.
Alsdann stelzte er wieder auf seinen langen Beinen einsam den Korridor auf und ab, so wie ein hungeriger Wolf, der die Fütterungsstunde nicht erwarten kann. In seinem verkannten Künstlertum dünkte er sich mehr, als die übrige „Bagage“, und so liess er sie ebenfalls links liegen, innerlich erfreut darüber, ihnen gezeigt zu haben, wie er mit den Haupterben stehe.
In dem langen, ausgedienten Lodenmantel, den er um die dürren Glieder geschlagen hatte, den Sommerorchesterzylinder mit Trauerflor auf, einen dickgequollenen Regenschirm in der Hand, nahm er sich sonderbar genug aus, fast wie eine menschliche Fledermaus, die bei jedem Luftzug die Flügel auseinander schlägt.
Dann, im Saal, kam die grosse Verblüffung und die noch grössere Enttäuschung. Für alle Teile. Es gab Gesichter, als hätte man sich bei einer fremden Leiche zusammengefunden.
Schliesslich schlug alles in einen gewissen Humor um, Seifenhändler Musdal lachte, so dass ihm der Bauch wackelte. Ganz respektwidrig lachte er, — er lachte sogar Tränen, wobei seine ohnehin schon kleinen Augen verschwanden.
Und die rundliche Frau Musdal lachte mit, so dass ihr üppiger, hochgewölbter Busen Sprünge bis zum Halse machte.
Und auch des Agenten Tempels Spitzmausgesicht ging in die Breite, wodurch seine Drahtpuppe von Frau angesteckt wurde.
Und auch Musikus Kladisch lachte, nachdem er sich mit offenem Rachen von der mangelhaften Fütterung überzeugt hatte.
Und sie lachten alle, alle, ausgenommen Frau Tempel und ihr Sohn, die, zwar bleich aber doch rasch gefasst, stolz davongingen, so wie sie gekommen waren, begleitet von dem Justizrat Dietzel, dem besonders daran zu liegen schien, mit dem Neffen des Erblassers rasch ein paar wichtige Worte zu sprechen, bevor er wieder in den Gerichtssaal zurückkehrte.
Es war auch zum Lachen, was der witzige und saugrobe Schmargendorfer, „der alte Schinder“, wie ihn Seifenhändler Musdal jetzt ganz offen nannte, dem „Universalerben“ aufgebrummt hatte. Natürlich nur aus Hohn, um ihn öffentlich lächerlich zu machen, weil er dies Söhnlein kannte. Das wax ihnen eine ausgemachte Sache. Denn dass diese Bestimmung niemals durchgeführt werden könne, war selbstverständlich, obschon Agent Tempel meinte, er habe deutlich gehört, wie der „Beglückte“ zum Justizrat gesagt habe, er hoffe im Sinne des Onkels handeln zu können. Aber das war wohl nur so eine Verlegenheitsphrase, ein Stammeln aus Scham über den erteilten Rüffel. Der Verschwender und arbeiten! Obendrein in einer Fabrik. Das sei dasselbe, als wolle man das Brandenburger Tor in die Lindenpassage schieben, oder aus der Siegessäule einen Pfeifenanstecker machen.
So meinte Herr Seifenhändler Musdal.
„Nee, nee, so wat jibts ja jar nich. Een Armeekorps uff’n Brummtriesel ruffkriegen, — det wär ’ne Kleenigkeit dajejen ... Habt ihr ibrijens jehört: der ew’je Studente. So war’t richtig. Der soll man bei det Fach bleiben.“
So sprach Herr Seifenhändler Musdal weiter.
Und als er eine Lachsalve dafür empfangen hatte, so dass der Korridor davon erdröhnte, schritt er der Verwandtschaft voran, würdevoll und erhobenen Hauptes, so wie jemand, dessen Meinung nicht zu erschüttern ist. Und beim Anblick des Justizrates zog er zwar tief, aber doch mit einem Lächeln die Trauertonne, als wollte er sagen: Wir sehen uns bald zur Abrechnung.
Und als er schon ein paar Schritte weiter war, schallte seine quakende Stimme noch zurück: „Nu is de Hauptsache: Abschrift von’s Testament für jeden.“
Frau Tempel und Sohn mussten dann noch ein paar Augenblicke verweilen, weil der Justizrat ihnen den zweiten Testamentsvollstrecker, Herr Hagedorn, vorstellte, einen bartlosen, sehnigen Mann, der sich die Leute immer erst anguckte, bevor er mit ihnen sprach.
Schon drinnen im Saal, als er, den unzertrennlichen Regenschirm in der Hand, am Fenster stand, hatte er alle Erben mit feindseligen Blicken betrachtet, so mit Gendarmenaugen, als wollte er sagen: „Hier steht einer, der passt auf, verlasst euch darauf.“ Und ganz besonders schien er Waldemar Tempel damit zu treffen. Dann rieb er sich jedesmal die mächtige Nase, was eine Angewohnheit von ihm war, und schnupperte in der Luft herum. Auch wenn er dem Justizrat sein fades Lächeln unter den dünnen Lippen zeigte, kam diese stille Feindschaft zum Ausdruck, denn er hatte ihn einmal als Prozessgegner gehabt, was er noch nicht vergessen hatte. Und weil er überdies ein Feind aller Advokaten war, so lautet sein fortwährender Gedanke: Wir beide werden bald zusammenkommen.
Nun nickte er wieder, als Waldemar zu ihm sprach, der ihn natürlich kannte. Und schliesslich quirlte er ein paar Worte hervor: „Is’ n bisken happig die Bestimmung, was? Na, der Lohn is auch danach. War ’n Schlaukopp, der olle Onkel Karl. Die Gemeinde draussen macht drei Kreuze.“
Er hätte gern noch mehr gesagt, um seine Autorität als Testamentsvollstrecker hier gleich festzustellen, aber Frau Rührmund, die langjährige Wirtschafterin des Verblichenen, eine breithüftige, schon angejahrte Person mit gutmütigem Gesicht, einen mächtigen Trauerhut auf, von dem die Federn wie schwarze Fahnen herabhingen, trat auf sie zu und beglückwünschte durchaus ernst den jungen Tempel. Sie war mit einer anständigen Summe bedacht worden, hatte die ganzen Möbel bekommen und war damit zufrieden.
Der Neid lag ihr überhaupt fern. Das sei doch nicht so schlimm, einmal derbe zu arbeiten, meinte sie. Der alte Onkel habe es jedenfalls nur gut gemeint. Sie würde sich zehn Jahre lang ans Waschfass stellen, von früh bis spät, wenn es sich um so viel Asche handelte; oder gar in die Unterwelt gehen. Und sie fügte hinzu, dass der alte Herr Tempel sie in letzter Zeit öfters zu Rate gezogen habe, und dass sie immer bereit gewesen sei, ihn zu Gunsten seiner Verwandten umzustimmen. Ganz besonders habe sie dabei an den jungen Herrn gedacht. Und sie nannte dessen Mutter „Gnädige Frau“ und bat, man möchte doch herauskommen nach Schmargendorf und sich zum Andenken aussuchen, was man wolle. Es sei das auch der Wunsch des Verstorbenen gewesen. Der Tod mache doch alles wieder gut, nicht wahr?
Frau Tempel war sehr gerührt davon und bat sie, bei Gelegenheit zum Kaffee bei ihr zu erscheinen. Das offene Wesen dieser einfachen Frau gefiel ihr umso mehr, da sie zuerst etwas anderes hinter ihrer Miene gewittert hatte.
Rentier Anton Hagedorn hatte der Gruppe sofort den Rücken gekehrt, denn erstens behagte ihm diese rasche Intimität nicht, zweitens hatte er für die Rührmund nie viel übrig gehabt, und drittens ärgerte er sich, dass ihre Gedanken über die Testamentsklausel sich mit den seinigen deckten. Er wäre auf seinen Stockbeinen bis nach Paris gelaufen und würde dazu Gras gefressen haben, wenn man es verlangt hätte, er, Gottlieb Anton Hagedorn, früher Ackerwirtschaftler in Schmargendorf, jetzt Villenbesitzer ebenda, Grosskonteninhaber der Deutschen Bank, Schwiegervater eines Oberleutnants und eines Amtsrichters. Aber bei der Aussicht auf dreimalhunderttausend Mark, ein grosses Mietshaus in Berlin und eine Zwölfzimmer-Villa da draussen, — da riss man sich schliesslich noch ein Bein aus.
Dieser alte Tempel war doch ein richtiger Esel gewesen, dass er nicht zum zweiten Male geheiratet hatte. Denn dann wäre der ganze Zimt doch wenigstens in der Familie geblieben und brauchte nun nicht von Drohnen geschluckt zu werden.
Und sein Gendarmenauge ging noch einmal auf den Eventual-Universalerben zurück, denn die Parole hiess: „Aufpassen, immer aufpassen.“ Er wollte schon dafür sorgen, dass keine Durchstechereien getrieben wurden; denn das erforderte schon die Rache der leer ausgegangenen Schmargendorfer.
Als Mutter und Sohn dann auf der Strasse waren, sahen sie die ganze Seitenlinie friedlich und wie beratend zusammenstehen.
Auch Musikus Kladisch hatte seinen Künstlerstolz aufgegeben und stand nun wie ein Wegweiser mitten in der Gruppe, und zwar in wörtlichster Bedeutung, denn die Hand mit dem aufgeblasenen Schirm wies geradeaus nach einer Kneipe gegenüber.
„Anfechten, jleich anfechten,“ quakte Seifenhändler Musdal hervor, ohne zu ahnen, dass die Nachkommenden diese Worte hören könnten.
Bureauvorsteher Fiebig aber, der erst in letzter Minute erschienen war, ein intelligent aussehender Mann mit Kneifer und aufgewichstem rotem Schnurrbart, warf überlegen ein: „Jibt’s ja jar nich, bei solchen klaren Bestimmungen. Aber einen Schoppen trink’ ich mit.“
„So? Wenn er verrückt war?“ beschwerte sich gleichsam Musdal bei der ganzen Gemeinde. „Und det war er doch. Komplett.“
Aber Herr Fiebig im Bewusstsein seiner Rechtserfahrung, zuckte nur mit den Achseln, spannte seinen Regenschirm auf und eilte über die Pfütze hinweg dem Lokal zu. Denn er hatte Durst.
Und die übrigen folgten ihm wie hüpfende Riesentrauervögel.
„Die werden uns etwas zu schaffen machen,“ sagte Frau Tempel zu ihrem Sohne.
„Lass’ sie doch“, erwiderte Waldemar heiter.
Sein Plan war bereits gefasst.
III.
Und nun wunderte sich Waldemar Tempel, wie leicht ihm der erste Schritt geworden war. Aber je mehr er sich wieder dem heiteren Westen näherte, je stärker kam ihm das stille Grauen vor dem Joch da draussen. Nicht die Arbeit schreckte ihn, denn etwas Ernstes hätte er nun doch treiben müssen, aber das Ausgeben der persönlichen Selbstbestimmung, das verfluchte Muss, das Einschirren in die früh geöffnete Tretmühle, denn er war gewöhnt daran, lange zu schlafen und sich die Zeit nach Wunsch einzuteilen.
Dieser Meinung war auch seine Mutter, als sie sich bei Tisch gegenübersassen in dem noch immer eleganten Heim in der Geisbergstrasse, in einem der Häuser, das noch der selige Architekt erbaut hatte. Während der letzten zehn Jahre hatten sie in diesem sogenannten bayerischen Viertel die Rolle von Trockenbewohnern gespielt, das heisst: sie hatten sich in jedem vollendetem Neubau des Alten stets zuerst festgesetzt, damit Gardinen an die Fenster kämen, und zwar so lange, bis das Haus in anderen Besitz übergegangen war und ein Einzug in die neueste, noch feuchte Schöpfung des genialen Häusererzeugers winkte.
„Verzichte auf alles und nimm die fünftausend Mark, dann wird’s auch gehen,“ sagte sie mit ihrer ewig klagenden Stimme, und begann sofort, ihre Pläne daran zu knüpfen. Man werde sich zum ersten Januar, da man doch ziehen müsse, eine Wohnung in der Nähe des Zoologischen Gartens nehmen und ein Pensionat für Ausländer aufmachen, das bei guter Haushaltung sicher florieren werde. Dann würde sich auch wohl etwas für ihn finden, und wenn nicht anders, könne er ja einen Teil des Legats zu irgend einer Kaution benutzen.
Waldemar wurde ungemütlich.
„Das sprichst du wieder so hin, liebe Mama — in deiner Sorge um mich. Pensionate gibts hier wie Sand am Meer, und die meisten führen ein trauriges Dasein. Das weisst du doch von Frau Windmüller. Die paar Kröten würden draufgehen, und dann sässest du erst recht da. Na, und ich? Soll ich deinen Ausländern vielleicht die Stiefel putzen, um mich im Hause beliebt zu machen? Vielleicht Mister Mix pickles, der morgens um sieben schon nach „die w—uarme-Mundwuasser“ schreit, das Frühstück hineintragen? Oder gar Juffrouw van Houten aus Amsterdam, die um acht Uhr bereits das Klavier zerpaukt, „das Kakau“ vor die Tür stellen? Denn schliesslich werde ich dich doch nicht den Unausstehlichkeiten dieser anspruchsvollen Gesellschaft aussetzen lassen. Nee, liebstes Mamachen, — dann schon lieber die Zähne zusammen beissen und da draussen untertauchen .... Schwielen an die Hände kriegen und Messingstaub schlucken und was sonst noch .... Es ist ja auch schon abgemacht.“
Er hatte ihr alles gleich vor dem Essen berichtet, und nun, bei der Suppe, fügte er hinzu, dass er auch wahrscheinlich „auf bessere Schlafstelle“ werde ziehen müssen, denn Justizrat Dietzel, der ihm ja sonst sehr wohlwolle, wahrscheinlich infolge eines noch mündlich abgegebenen Wunsches des verstorbenen Onkels, habe ihn noch gestern ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass Testamentsvollstrecker Hagedorn, der alte Sandfresser, so genannt, weil er in Schmargendorf den Leuten das unfruchtbarste Land angeschmiert habe, schon geäussert habe, er werde über alles eingehend Protokoll führen. Der habe den ganzen Tag nichts zu tun, stecke seine grosse Nase in alle überflüssigen Dinge und fahre jetzt schon jeden Tag dreimal von Schmargendorf nach Berlin, wo er regelmässig gut frühstückte, alles auf Kosten seiner Bestallung.
Frau Mathilde Tempel gehörte zu den wundersamen Müttern, deren ganzes Leben im Glück ihrer Kinder aufgeht, so sehr sie selbst auch darunter zu leiden haben mögen, und so wenig die Welt das zu verstehen vermag. Schon in dem ewigen Auf und Nieder ihrer Ehe daran gewöhnt gewesen, ihrem schrullenhaften, an chronischem Spekulationsfieber leidenden Manne gegenüber in Ergebung die Nachsichtige zu spielen, hatte sich diese Schwäche auch allmählich auf ihren einzigen Sohn übertragen; und so war es erklärlich, dass sie in ihm seit dem Tode ihres Mannes den alleinigen Herrscher erblickte. Jetzt jedoch regte sich in ihr der Widerspruch, denn Ungeheuerliches drohte ihrem Liebling.
„Bis jetzt habe ich die Sache als grausamen Scherz betrachtet, nun aber müssen wir mal ernst darüber reden. Ein total verwöhnter Mensch wie du, ich bitte dich! Nach der ersten Woche lägest du da. Arbeiten ist gewiss keine Schande, aber jeder hübsch an seinem Platze. Lass’ die anderen alles schlucken, nur vergiss dich nicht.“
Es stand fest bei ihr: eher hätte sie sich im geheimen zu ähnlichen Dingen erniedrigt, bevor sie den Sohn darunter leiden gesehen haben würde.
Aber Waldemar taute auf. Wie? Dieser Verwandtensippe den Triumph gönnen, das ganze Vermögen einzustecken, während sie beide, als die Nächsten, mit einem Butterbrot abgespeist werden würden? Nie und nimmer! Jetzt erst recht nicht, da er gehört habe, dass die Gesellschaft schon im Trüben zu fischen beginne.
In Waldemar Tempel regte sich der Trotz, so wie er damals vor Jahrzehnten Friedrich Ludwig Karl aufgerüttelt hatte, als man den „Kellner“ nicht vergessen konnte. Und hier war es der „ewige Student“, der nun herausgefordert wurde, — ihm aufgebrummt leider von dem, der selbst unter ähnlichem Hohn gelitten hatte. Aber das war die Wesenseinheit von Onkel und Neffen, die nun auch dem Jungen den Weg zur Erkenntnis wies. Und der alte Schmargendorfer hatte sehr richtig gewittert, wenn er ihn schon ehrgeizig die Beute nach Hause tragen sah. Denn der kannte die Menschen, die von dem Geld nicht lassen konnten, weil er sich selbst kannte; sie sträubten sich zuerst, es unter Kränkungen anzunehmen, und dann kamen sie von selbst und baten darum und scheuten dabei die schlimmsten Entwürdigungen nicht.
„Und Lüssi Reimer, was wird die dazu sagen?“ meldete sich Frau Tempel wieder. „Die werden alle auf den Rücken fallen, wenn sie das hören.“
„Vor Freude, das glaub’ ich wohl,“ lachte Waldemar hervor. „Denn nun ist doch Aussicht, dass ich sie heiraten kann.“
„Ja, wenn sie so lange wartet.“
„Ach, sie wird schon. Bis jetzt hat der Alte angenommen, ich sässe immer noch in der Wolle und würde losbauen wie Papa. Aber wovon? Macht alles, weil sie dich immer noch für die Besitzerin des Hauses halten. Nun aber winken die Moneten.“
Frau Tempel seufzte. Ihr Besitztum stand nur noch im alten Adressbuch, was ihr bis jetzt nur Scherereien gemacht hatte. Das Haus hier, das letzte des seligen Erbauers, war so überschuldet gewesen, dass man schliesslich froh war, es mit der Vergünstigung loszuwerden, noch eine Zeitlang mietefrei wohnen zu können.
„Was wirst du nun tun? Willst du ihr alles sagen?“
„Aber selbstverständlich. Bei der Aussicht ...“
„Sie wird dich für verrückt halten.“
„Oder für sehr vernünftig.“
„Und der Alte ist so penibel.“
Erfahren müssen sie es ja doch,“ sagte Waldemar und ging wieder fort, denn er wollte zu ihr.
Frau Tempel begleitete ihren Sohn bis auf den Korridor, und was sie ihm zum Abschied noch nachrief, war die Herzensbitte: er möge sich doch alles noch einmal überlegen, bevor es zu Auseinandersetzungen käme.
Das alles ging Waldemar im Kopfe herum, denn sonst hätte er wohl gemerkt, wie das Spitzmausgesicht von neulich, das vor dem Hause gewartet zu haben schien, ihn nicht aus den Augen liess.
Langsam schlenderte er die Strasse entlang, der Richtung nach der Kaiserallee zu. Es war ein klarer, heller Nachmittag und schon bedenklich kühl, so dass man die Vorwehen des nahenden Winters empfand. Der Himmel prangte noch blau, und in der durchsichtigen Luft zeichnete sich der Strassenzug in scharfen Linien ab.
Alle diese Häuser hier mit ihren übermodernen Stilarten hatten etwas von einer rasch entstandenen, eigensinnigen Stadt, die man an den alten Berliner Westen herangeschoben habe, um eine Verbindung herzustellen.
Waldemar war gerade in die Bamberger Strasse eingebogen und fand wie immer hier die Häuser mit ihrem überall gleichmässigen Erkervorbau, der steif vom Parterre bis zum Dache führte, höchst langweilig, als er in dieser stillen Betrachtung durch eine unerwartete Anrede gestört wurde.
Eine tiefe Verbeugung, der Anblick eines schon halb kahlen Schädels, der sich eigentlich nur wie eine abgeschrägte Fortsetzung der Nase ausnahm, und es unterlag keinem Zweifel mehr, dass dies das Spitzmausgesicht war, das nun mit einem kühnen Entschluss die Attacke machte.
Natürlich trug der Allerweltsagent, wie gewöhnlich, eine einstmals hellbraun gewesene, nun aber durch den jahrelangen Gebrauch fettig-schwarz gewordene Aktenmappe unter dem Arm, denn ohne Mappe ging er niemals aus. Das gehörte zu seinem Handwerk, zu seinem Lebensbedürfnis, zu seiner Repräsentation.
„Mein Name ist Gustav Tempel, Agentur und Kommission,“ begann er unterwürfig, so in der Art von Leuten, die sich immer zwischen Tür und Schwelle vorstellen. „Herr Baumeister kennen mich wohl nicht mehr? Ich hatte schon einmal den Vorzug Ihrer persönlichen Bekanntschaft — vor etwa einem Jahr.“
Das pflegte er immer zu sagen, obgleich es niemals wahr war; aber dadurch machte er die Leute irre und gewann den Anknüpfungspunkt. „Wir sind entfernte Verwandte ...“
„Wohl sehr entfernt,“ unterbrach ihn Tempel und schritt ruhig weiter, um ihn auf diese Art abzuschütteln.