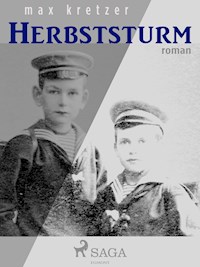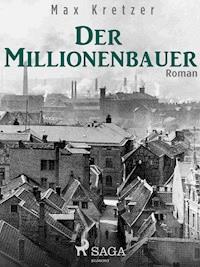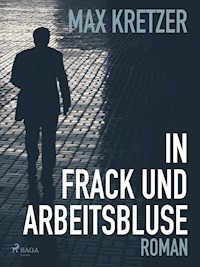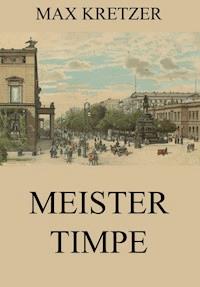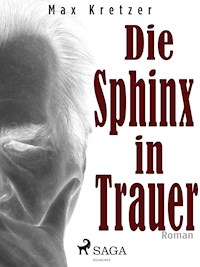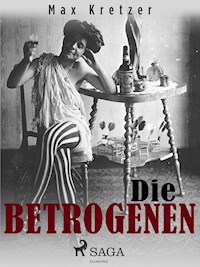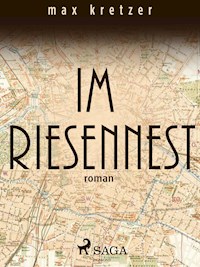
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das titelgebende "Riesennest" ist Kretzers Heimatstadt Berlin, in der er sein gesamtes Leben verbracht hat und die den in diesem Band versammelten neun Erzählungen – "Die beiden Kleinen", "Ein Humorist", "Der kleine Dög", "Sie liebt die Kinder", "Eine Rose", "Mein Flickschneider", "Erlösung", "Ein "Schritt vom Tode" und "Die Geschichte eines schwarzen Anzugs" – einen einigenden Rahmen verleiht. Anschaulich und mit viel psychologischem Gespür beschreibt Kretzer die Stadt und das Leben und die Nöte ihrer Bewohner in den Gründerjahren des späten 19. Jahrhunderts und richtet seinen wachen, stets kritischen und naturalistisch geschulten Blick gerade auch auf jene Milieus und Existenzen, von denen die Autoren vor ihm den ihren Blick zumeist abgewandt haben.Max Kretzer (1854–1941) war ein deutscher Schriftsteller. Kretzer wurde am 7. Juni 1854 in Posen als der zweite Sohn eines Hotelpächters geboren und besuchte bis zu seinem 13. Lebensjahr die dortige Realschule. Doch nachdem der Vater beim Versuch, sich als Gastwirt selbstständig zu machen, sein ganzes Vermögen verloren hatte, musste Kretzer die Realschule abbrechen. 1867 zog die Familie nach Berlin, wo Kretzer in einer Lampenfabrik sowie als Porzellan- und Schildermaler arbeitete. 1878 trat er der SPD bei. Nach einem Arbeitsunfall 1879 begann er mit der intensiven Lektüre von Autoren wie Zola, Dickens und Freytag, die ihn stark beeinflussten. Seit dem Erscheinen seines ersten Romans "Die beiden Genossen" 1880 lebte Kretzer als freier Schriftsteller in Berlin. Max Kretzer gilt als einer der frühesten Vertreter des deutschen Naturalismus; er ist der erste naturalistische Romancier deutscher Sprache und sein Einfluss auf den jungen Gerhart Hauptmann ist unverkennbar. Kretzer führte als einer der ersten deutschen Autoren Themen wie Fabrikarbeit, Verelendung des Kleinbürgers als Folge der Industrialisierung und den Kampf der Arbeiterbewegung in die deutsche Literatur ein; die bedeutenderen Romane der 1880er und 1890er Jahre erschlossen Schritt für Schritt zahlreiche bislang weitgehend ignorierte Bereiche der modernen gesellschaftlichen Wirklichkeit für die Prosaliteratur: das Milieu der Großstadtprostitution (Die Betrogenen, 1882), die Lebensverhältnisse des Industrieproletariats (Die Verkommenen, 1883; Das Gesicht Christi, 1896), die Salons der Berliner "besseren Gesellschaft" (Drei Weiber, 1886). Sein bekanntester Roman, "Meister Timpe" (1888) ist dem verzweifelten Kampf des Kleinhandwerks gegen die kapitalistische Konkurrenz seitens der Fabriken gewidmet. Während Kretzer anfangs der deutschen Sozialdemokratie nahestand, sind seine Werke nach der Jahrhundertwende zunehmend vom Gedanken eines "christlichen Sozialismus" geprägt und tragen in späteren Jahren immer mehr den Charakter reiner Unterhaltungsliteratur und Kolportage. Er starb am 15. Juli 1941 in Berlin-Charlottenburg.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 150
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Max Kretzer
Im Riesennest
Berliner Geschichten
Saga
Im Riesennest
German
© 1886 Max Kretzer
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711502655
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
I.
Die beiden Kleinen.
Es liegt in der menschlichen Seele eine versteckte Falte, in der der Same der Zwietracht verborgen schlummert. Die leiseste Befruchtung genügt, um ihn emporschiessen und üppig wuchern zu lassen. Wer da ganz ergründen könnte, aus welchen Kleinigkeiten des Lebens oft der bitterste Hass seinen Ausgang findet, der würde dann wissen, dass der Hass weiter nichts als verletzte Eigenliebe ist, die über die edelsten Regungen in unserer Brust triumphiert. Ferdinand Leineweber mied seinen Bruder Johannes Leineweber der bunten Toilette seiner Frau wegen. Das war so gekommen: Die Leinewebers hatten in Gesellschaft ihnen befreundeter Vorstadtfamilien eine Landpartie per Kremser nach dem reizend gelegenen Grünau unternommen. Die Damen waren gerade bei der sechsten Tasse Kaffee angelangt, als es Frau Susanne, der Gattin des Hutmachers Herrn Johannes Leineweber, einfiel, den neben ihr sitzenden Bürgerinnen höchst liebenswürdige Bemerkungen ins Ohr zu tuscheln: Du lieber Himmel, ihre Frau Schwägerin hätte es ja dazu! Wenn man erster Buchhalter der berühmten Firma Müller, Schulze und Kompanie sei und ein festes Einkommen von jährlich fünfzehnhundert Talern habe, dann könne man sich in dieser Beziehung bei einem einzigen Kinde schon etwas leisten, aber — — —. Dieses „Aber“ war insofern vielbedeutend genug, als sich daran ausserordentlich lebhafte Betrachtungen knüpften, die alle in dem Endsatze wurzelten: „Ich bleibe nun einmal dabei, meine Lieben, wem’s nicht sitzt und kleidet, der kann sich über und über mit Sammet und Seide behängen, er wird doch stets ‚nach nichts‘ aussehen.“
O, und diese Hüte der lieben Frau Schwägerin! Madame Susanne verstand sich ganz besonders darauf, nicht nur als Gattin eines viel in Anspruch genommenen Hutfabrikanten, der in der belebten Oranienstrasse ein offenes Geschäft betrieb, sondern auch als Putzmacherin von Fach, die sich rühmen durfte, die honorabelsten Damen der südöstlichen Luisenstadt zu ihren Kundinnen zu zählen.
„Nicht wahr, meine Lieben, wenn man schon einmal Hüte für zwanzig Mark trägt, dann sollte man doch auch das bunte Gemüse in der Garnitur nicht dulden. Ja, ja, aber ich bleibe dabei, wo’s nicht drin liegt, da kommt der Geschmack nie.“
O, tadelt die Kleidung eines Weibes, sagt, dass sie hässlich sei, und sie wird euch das nie vergeben können. Madame Juliens Ohr wurde unangenehm von diesen Bemerkungen berührt, und der Riss zwischen den beiden Schwägerinnen war fertig.
Die beiden Leineweber wohnten in einem Hause in zwei verschiedenen Etagen. Erst fand es der Buchhalter eines Mannes unwürdig, eine Weiberklatscherei ernst zu nehmen und sich in seinem bisherigen friedlichen Verkehr mit Herrn Johannes Leineweber stören zu lassen; schliesslich aber bildete er sich selbst ein, seine Frau sei wirklich beleidigt worden, und dies erfordere die nötige Sühne.
Wenn man sich jetzt zufälligerweise auf der Treppe begegnete, blickte man zur Seite und ging vorüber, als wäre man sich vollständig fremd und hätte keine Ahnung, wer eins oder das andere sei. Und diese zur Schau getragenen äusserlichen Anzeichen eines anscheinend tödlichen Hasses versuchte man beiderseits, auf die Dauer durch allerhand kleine schadenfrohe Neckereien, durch welche der eine Teil sich den Ärger des anderen versprach, ganz besonders zu würzen. Herr Ferdinand Leineweber gebrauchte plötzlich alle vier Wochen einen neuen Hut. Beim Einkauf desselben passte er die Gelegenheit ab, bis der behäbige Herr Johannes Leineweber in der geöffneten Ladentür stand und wie ein zufriedener Kleinbürger, behaglich seine Zigarre rauchend, das bunte Leben auf der endlosen Strasse beobachtete. Dann schritt der etwas hagere Herr Ferdinand gravitätisch über den Damm und verschwand im Laden eines Konkurrenten seines Bruders, um nach zehn Minuten, das Haupt bedeckt mit einem neuen Chapeau, in der Rechten den sauber kartonnierten alten haltend, wieder zurückzukehren. Das rechte Auge machte dann Anstrengung, nach der ersten Etage, das linke, nach einer gewissen Glastür zu schielen, die soeben klirrend ins Schloss gefallen war, nicht bevor noch ein überaus höhnisches Lachen sein Ohr berührt hätte. Herr Ferdinand wusste nicht umsonst, dass besagter Konkurrent seines Bruders in den Augen des letzteren zu den unausstehlichsten Menschen der ganzen Gegend gehörte. Trafen sich die beiden Brüder am Schluss des Quartals zufälligerweise beim Hauswirt im Parterregeschoss, um die Wohnungsmiete zu entrichten, so kehrte der zuletzt gekommene sofort um und verschwand mit den Worten: „Ich komme wieder, Herr Lehmann, ich habe nicht nötig, gewisser Leute wegen zu warten“; und erfuhr der eine, dass in der Wohnung des anderen von seiten des ausnahmsweise aufmerksamen Wirtes irgendeine Veränderung oder Verbesserung vorgenommen wurde, so hatte Herr Lehmann sich auch sofort des Besuches des anderen zu erfreuen, der ihm ungefähr folgendes sagte: „Die Tapete meines Wohnzimmers ist wirklich schon überaus schadhaft. Sie wissen, ich wollte schon längst ziehen. Ich habe es nicht nötig zu sehen, wie man gewissen Leuten immer mehr entgegenkommt als mir.“
Diese indirekten Plänkeleien wurden in gleichem Masse von den beiden Frauen vollführt; suchte jetzt die Frau des Hutmachers ihre ganze Würde darin zu finden, besonders an den Markttagen, gefolgt von ihrem Mädchen, so einfach wie nur möglich gekleidet zu erscheinen, so fand die Frau Buchhalter ein besonderes Vergnügen darin, in ihrer schwersten Robe bei ihren Einkäufen die Marktweiber zu beglücken.
Eines Tages las Herr Ferdinand Leineweber in der „Vossischen Zeitung“ folgendes sehr auffallend gedrucktes Inserat: „Ich suche für meine Hutfabrik einen tüchtigen, soliden Buchhalter. Gehalt per anno fünfzehnhundert Taler. Allmonatlich einen neuen Hut, Fasson nach Belieben, gratis. Nur ledige Leute, oder wenn verheiratet, nur solche, die nicht unter dem Pantoffel stehen, werden berücksichtigt. Gefällige Adressen postlagernd Postamt Oranienstrasse.“
Es war im Juni und ganz besonders heiss an diesem Tage. Der erste Buchhalter der Firma Müller, Schulze und Kompanie war vor wenigen Minuten erst schweisstriefend aus dem Kontor angelangt und hatte es sich einstweilen auf dem Sofa bequem gemacht, während seine liebe Frau, Madame Julie, damit beschäftigt war, das Mittagessen aufzutragen. Herr Ferdinand brauchte das Inserat nicht erst zum zweiten und dritten Male zu lesen, um zu wissen, dass es nur auf ihn gemünzt sei und von seinem liebenswürdigen Bruder unten im Laden ausginge. Der Buchhalter brach zuvörderst in ein schallendes Gelächter aus, so dass Frau Julie vor Schreck den Suppenlöffel klirrend auf einen Teller fallen liess. Aber ihr Mann lachte unbändig weiter. Dieser Filzkrämer da unten, dessen ganze Geschäftsbücher in einer einzigen Schmierkladde bestanden, masste sich an, einen Buchhalter gebrauchen zu können. Was der für eine Ahnung von einem wirklichen Kaufmann hatte!
Dass man sich auch gerade an einem Tage, wo man sein Leibgericht vor Augen hatte, den Appetit verderben musste! Das kam aber davon, wenn die gegenseitige Übereinstimmung der Familiengewohnheiten sich bis auf das Lesen derselben Zeitung erstreckte. Madame Julie befand sich wieder in der Küche.
Der Herr Buchhalter wurde dann wütend. „Julie!“ rief er laut mit ersichtlichem Zorne durch die geöffneten Türen, „ich habe dir doch bereits am vergangenen Ersten gesagt, dass das Abonnement der „Vossischen Zeitung“ uns zu teuer wird, und habe dich gebeten, die Zeitung des Morgens abzubestellen, du vergisst auch alles.“
„Soo — meinst du?“ kam die Angeredete erwidernd zurückgerauscht; „ich soll wohl nun dafür können, dass dein ‚so liebenswürdiger, ausgezeichneter, aufrichtiger‘ Bruder so gering von dir denkt, dass er sich öffentlich über dich lustig macht. Man liest doch auch seine Zeitung,“ fügte sie etwas selbstbewusst hinzu und schloss dann: „Die drei Hüte, die dort hängen, hättest du überhaupt auch sparen können. Es wird eine Ewigkeit vergehen, ehe du sie ganz aufträgst.“
Herr Ferdinand schwieg natürlich. Weshalb hatte die „Vossische Zeitung“ auch so viele Verlobungs- und Verehelichungsanzeigen, die jede Frau zum eifrigen Studium des Inseratenteils drängten.
Zwei Tage später hatte Herr Ferdinand sich weidlich gerächt, denn als nun unten, eine Treppe tiefer, Herr Johannes Leineweber die Spalten der „Vossischen Zeitung“ überflog, las er folgenden Herzenserguss, der wie der hämische Gruss eines engen Verwandten klang: „Für Hutmacher, die in beschränkten Verhältnissen leben! Alte und dicke Filze werden von einem erfahrenen Buchhalter einer der ersten Firmen (die letzten vier Worte waren gesperrt gedruckt) nach Noten gegerbt. Auf Wunsch auch gratis. Dickwämse vorgezogen. Offerten Postamt Oranienstrasse.“ Es war wohl nur ein leidiger Zufall, dass Herr Johannes Leineweber an diesem Tage genau die Zeit abpasste, wo sein Bruder an seiner Ladentür vorübergehen musste; wie ein Schild hielt er das „Berliner Tageblatt“ vor das halbgesenkte Haupt, so dass jedermann den Titel des Journals beim Vorübergehen lesen musste. Herr Ferdinand Leineweber aber schien seine Pappenheimer zu kennen. „Ha, ha, ha,“ lachte er ganz laut, „wer gestern noch die ‚Vossische Zeitung‘ gelesen hat, liest sie heut auch noch. Man ist doch nicht aus Dummsdorf.“ Dann hatte der Buchhalter die Genugtuung zu hören, wie sein Bruder wütend die Ladentür ins Schloss warf. Beim Weiterschreiten murmelte Herr Ferdinand vergnügt vor sich hin: „Na — die Filzgerberei wird er aber wohl verstanden haben. Ha, ha, ha!“
Wo die Eltern im Hader liegen, da haben die Kinder am meisten zu leiden. Klein Fritzchen und Lottchen wussten davon zu erzählen. Frau Julie bemerkte eines Tages vom Küchenfenster aus, wie ihre Schwägerin unten auf dem Hof sich so weit verstieg, ihrem Kleinen das Haar aus der Stirn zu streichen und dem rosigen Buben schliesslich einen Kuss zu geben. Die Gattin des Buchhalters war empört. „Lene!“ rief sie ganz laut zu ihrem Mädchen herunter, „komm sofort mit dem Jungen herauf, hörst du?“ Oben gab es dann eine Flut von Vorwürfen. „Wenn du noch einmal erlaubst, dass diese Person da unten mein Kind küsst, dann bist du sofort aus dem Dienst entlassen, hast du verstanden?“ Lene war eine echte Berlinerin, die, wenn sie sich keines Unrechts bewusst war, nicht ohne weiteres Vorwürfe hinnahm. „Jotte doch, Madamken, nun soll ich wohl noch dafor können, wenn die Herrschaften sich meilenweit aus dem Wege gehen. Ihr Mann hat gestern erst im Hausflur das kleine Lottchen geküsst, und da dachte ich, es würde wohl nichts schaden, wenn Ihre Frau Schwägerin auch mal wieder unser Fritzchen küsst. Das war doch früher so. Die armen Würmer die, — nun sollen die noch for die Sünden ihrer Eltern aufkommen.“
Die Frau Buchhalter unterbrach sie sofort: „Mein Mann hat das getan?“ Frau Julie schien das Unerhörte nicht begreifen zu können, als ihr Lene den Kelch noch voller machte: „Gewiss, Madamken, sogar auf den Arm hat er Lottchen genommen und sie ‚seine kleine liebe Prinzessin‘ genannt. Sie wird jetzt auch wirklich zu reizend, die kleine Jöre.“ Frau Julie hätte weinen mögen vor Zorn, wenn sie nur im Augenblick die üblichen Tränen gefunden hätte.
So trug der Baum der Zwietracht also allgemach die giftigsten Früchte: Die Eltern versuchten die beiden Kleinen sich gegenseitig zu entfremden und die frommen Kindergemüter im zartesten Alter zu trüben. Wenn nun die Dienstmädchen der beiden Leineweber des Nachmittags wie gewöhnlich, jedes das Kindchen seiner Herrschaft auf dem Arme, den nahegelegenen Mariannenplatz aufsuchten, wo inmitten schöner Parkanlagen unter grünenden Bäumen und Sträuchern während Stunden hindurch Hunderte von kleinen Weltbürgern unter der Aufsicht ihrer Mütter und Wärterinnen sich gar ergötzlich belustigten und mit strahlenden Gesichtern so fröhlich dreinschauten, als sendete der blaue Himmelsdom hoch oben nur ihretwegen die Sonnenstrahlen hernieder, — dann war es Fritzchen und Lottchen nicht mehr vergönnt, wie sonst, Händchen an Händchen des Weges zu schreiten, drollige Dinge zu plappern, so dass die Leute zuweilen stehen blieben und den beiden Liliputanern mit einem Lächeln nachblickten, als wollten sie laut ausrufen: Seht doch nur diese kleinen Rangen, wie reizend sie gekleidet gehen, was für wunderschöne Gesichtchen sie haben, wie altklug sie tun, als wären sie Braut und Bräutigam, das ist ja köstlich. O, die Eltern sind zu beneiden, die sie besitzen.
O gewiss, die Leute hatten recht. Wer könnte auch grosse blaue Kinderaugen sehen, wer könnte das in seiner unklaren Aussprache ebenso komisch wie rührend wirkende Geplapper kleiner, noch halb hilfloser Seelen hören, ginge ihm das Herz dabei nicht auf? Nun war das anders wie sonst. Da sass auf der einen Bank Herrn Johannes Leinewebers Küchenfee und getrennt von ihr auf einer anderen Herrn Ferdinand Leinewebers Lene, jede sorgsam bemüht, die Kinder voneinander fernzuhalten. Das war nun einmal der Befehl ihrer Herrschaften, und den suchte man zu befolgen. Und während ringsherum das laute Jubeln der Kinderscharen ertönte, endloses Schreien, helles Jubilieren die Luft erfüllte, diese ganze kleine, rosige Welt im Genuss der Freiheit schwelgte, suchten über die Köpfe hinweg stumm zwei Augenpaare sich, als wollte eins dem anderen zurufen: Was habe ich dir getan, dass ich hier nicht herunter darf, um mit dir zusammen, wie die anderen Kinder dort drüben, im Sande Kuchen zu backen und ein Schloss zu bauen? Und was diese stummen Blicke nicht noch alles weiter erzählten!
Vier Wochen hindurch hatten die beiden Kleinen ihr unverschuldetes Schicksal zu ertragen, als eines Nachmittags die gute Fee für sie auftauchte, die nun einmal im Leben der Kinder eine grosse Rolle spielt. Es war wieder auf dem Spielplatz. Die beiden dienenden Geister der beiden Brüder sassen sich in dem breiten, schattenbedeckten Wege gegenüber, jedes krampfhaft bemüht, der beiden Leinewebersprösslinge geheime Sehnsucht durch möglichstes Kneifen in die Arme und nicht gerade zarte Äusserungen zu besänftigen; dabei ergingen sie sich in einer höchst bedeutsamen Küchenphilosophie, die darin gipfelte, ob es für ihre eigene Ruhe nicht schliesslich vorteilhafter wäre, einmal von den Befehlen der Herrschaft abzugehen und den „unnützen Rangen“ den Willen zu lassen. „Es ist gar nicht mehr zum Aushalten mit diesem Bengel!“ sagte Herrn Ferdinand Leinewebers Lene mit entschieden zorniger Miene; und ihr Gegenüber fiel sogleich ein: „Ist das möglich? Nun sehn Sie mal, die will zu dem Jungen rüber. Is nich, Lotte! Sei ruhig und schrei nicht, sonst gibt’s einen Klaps.“ Die armen Kleinen fingen nun laut an zu weinen und erzürnten dadurch ihre sorgsamen Hüterinnen noch mehr. Plötzlich schrieen sie ganz laut durch ihr Weinen hindurch: „Gomama, Gomama!“ wandten ihre grossen Augen nach der Mitte des Weges und machten nun ganz unbändige Anstalten, vom Schoss der würdigen Dienstboten zu gelangen. Nun zeigte sich auch den Blicken der beiden Wärterinnen die würdige Frau Henriette Leineweber, Witwe des weiland pflichtgetreuen Bankbeamten Leineweber, die Mutter des hageren Buchhalters und des korpulenten Hutmachers. Frau Henriette war am Morgen erst nach zweimonatlicher Abwesenheit von Berlin vom Besuche einer Schwester zurückgekehrt, und ihr erster Gang sollte ihren Söhnen gelten. O, und was musste sie nun erleben! Nach einer Minute bereits sass sie auf der Bank zwischen den beiden Dienstboten, in jedem Arme eins der beiden Kinder. Über diese gottvergessene Zeit, die nur Hass und Zwietracht sät und unschuldige Wesen darunter leiden lässt! Madame Henriette genierte sich vor den Dienstboten ihrer Kinder nicht; sie würde den beiden grossen Jungen, die sich wie die kleinen Kinder benähmen, ganz gehörig die Köpfe zurechtsetzen, dass ihnen Hören und Sehen verginge. Während sie bei den Erzählungen der beiden Küchenfeen ihrer Entrüstung immer erneuerten Ausdruck gab, strich sie den beiden Kleinen sorgsam das Haar aus der Stirn und überschüttete sie mit Liebkosungen aller Art. „Ja, du mein Herzblättchen, mein süsses Zuckerpüppchen, das soll jetzt anders werden; ich werde euch jetzt nicht mehr aus den Augen lassen, ihr werdet jetzt immer zu mir kommen und eure Spielstube bei mir aufschlagen.“ Die Kleinen lebten auf; es begann ein Geplapper, ein gar drollig anzuschauendes Bewegen, Rumoren und Gemisch ergötzlicher Gesprächsweise, das auf den Kinderfreund rührend wirkte. Nun strahlten die Augen wieder in lichter Bläue wie der Himmel dort oben, nun röteten sich die Wangen, zeigten sich die Grübchen im pausbackigen Gesicht von Fritzchen und beim herzigen Lachen die kleinen Zähne Lottchens.
Am Abend desselben Tages gab es in jeder Wohnung der beiden Brüder eine grosse Beratung. „Wir uns wieder vertragen?“ meinte Frau Julie und schien dabei sogar den Respekt vor ihrer Schwiegermama verloren zu haben. „Das hätte mir gerade gefehlt! Diese Person gönnt mir nicht einmal meine sauer erworbenen Kleider. — Nimmermehr! Ich sage dir, Ferdinand, es bleibt dabei: Ich lass mich von dir scheiden, wenn du zuerst nachgibst.“ Und als nun Frau Henriette, ganz und gar nur beflissen, dem unsinnigen Zanke ein Ende zu machen, zum dritten Male bereits den Weg eine Treppe tiefer machte, um hier ihr Heil von neuem zu versuchen, musste sie wiederum zu der Überzeugung kommen, dass sie abermals aus dem Regen in die Traufe käme. „Ich, ich soll zuerst nachgeben?“ sagte Frau Susanne mit ganz merkwürdiger Bestimmtheit; „nein, meine liebe Frau Schwiegermutter, ich habe nur die Wahrheit gesagt. Die Brücke zwischen uns beiden ist abgebrochen. Mein Mann hat es ja nicht gerade nötig, darauf zu warten, bis gewisse Leute kommen und sich bei uns Hüte kaufen, aber es ärgert einen doch, wenn man sieht, wie man gerade aus Bosheit zu einem Konkurrenten geht, der bereits dreimal Bankerott gemacht hat.“
O, diese Schwiegertöchter! Weshalb hatte Frau Henriette auch solche Söhne, die sich solche Frauen nehmen mussten?! Die alte Dame stieg also wieder zum zweiten Stockwerk hinauf, um im geheimen ihre Angriffe direkt beim Herrn Buchhalter, den sie immer für höchst vernünftig gehalten hatte, zu beginnen. Nach fünf Minuten war sie dann wieder unten und zog den Herrn Hutfabrikanten beiseite. Der hatte merkwürdig dasselbe Achselzucken gelernt wie Herr Ferdinand. „Liebe Mama, — meine Frau! — Ich kann dazu nichts machen.“
Frau Henriette war untröstlich. „Ihr wollt Männer sein?“ sagte sie schliesslich mit der grössten Entrüstung und gebrauchte dann einen Vergleich mit einem gewissen Küchenobjekt, das im nassen Zustand dazu dient, die Tische zu reinigen. Zu allerletzt führte sie das schwerste Geschütz in den Kampf: „Aber die beiden Kleinen, bedenkt doch die beiden Kleinen; sie werden die Sünden ihrer Väter vergelten.“ „Ach so, die Kinderchen! Hm, hm —.“ Der Herr Buchhalter kratzte sich hinterm Ohr, und dem Herrn Hutmacher ging dieser Gedanke im Kopfe herum. Die Grossmutter hatte allerdings recht, darin musste eine Wandlung geschaffen werden.